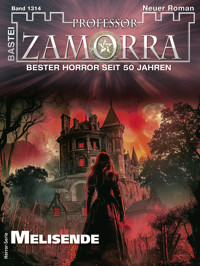6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Castor Pollux Sammelband
- Sprache: Deutsch
Vier spannende Romane um CASTOR POLLUX, den Bezwinger der Finsteren.
Im zweiten Sammelband lesen Sie:
Die schwarze Galeere
Ein Tor in die Finsternis
Brennen muss Rom
Tod der weißen Hexe
In dieser historischen Grusel-Serie kann man die Spannung spüren, wenn römische Aristokraten mit mysteriösen Flüchen behaftet werden und sich finstere Kulte in den Katakomben der Stadt versammeln. Vampire, Totenfresser und andere grauenhafte Wesen versetzen die römische Welt in Angst und Schrecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Castor Pollux Sammelband 2
Cover
Titel
Inhalt
Gespenster-Krimi 106
Die schwarze Galeere
Special
Gespenster-Krimi 101
Ein Tor in die Finsternis
Special
Gespenster-Krimi 115
Brennen muss Rom
Special
Gespenster-Krimi 126
Tod der weißen Hexe
Guide
Start Reading
Contents
Die schwarze Galeere
von Michael Schauer
Wie aus dem Nichts stand sie plötzlich vor ihm.
Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel auf ihn herab, das Meer umspielte seine Knöchel und das Rauschen der Brandung klang wie eine schöne Melodie in seinen Ohren.
Doch all das war jetzt vergessen, denn sie zog ihn in ihren Bann. Sie war nackt und von vollkommener Schönheit. Lange blonde Locken fielen ihr über die schmalen Schultern und verdeckten ihre Brüste. Ihre Augen strahlten so blau wie das Meer selbst, und ein feines Lächeln umspielte ihre vollen Lippen. Verlangen ergriff ihn. Dann dachte er an seine Liebste, die zu Hause auf ihn wartete, und er drängte es zurück. Sie bedeutete ihm so viel mehr als alles andere auf der Welt.
Die Haut der Fremden war seltsam, fiel ihm auf. Bleich wie die einer Toten. Sie öffnete den Mund und entblößte ebenmäßige weiße Zähne. »Möchtest du mein Gefährte sein?«, fragte sie.
Er starrte sie an. Er wollte Nein sagen, doch er konnte es nicht ...
Sardinien, 64 n. Chr.
Bonza runzelte missmutig die Stirn. Der kleine Mann am Tisch neben der Tür trank zu viel. Mal wieder. Er lag bereits mehr auf seinem Hocker, als dass er saß. Die Ellenbogen hatte er auf dem Tisch abgestützt, mit der rechten Hand umklammerte er seinen Holzbecher, als fürchtete er, jemand könne ihm den Wein entreißen.
Der Blick aus seinen dunklen Augen war trübe, das Gesicht faltig und unrasiert, die breite Nase leicht gerötet. Mit der linken Hand rieb er sich über den kahlen Schädel, wobei er um ein Haar das Gleichgewicht verloren hätte und vom Hocker gefallen wäre.
Petronella kehrte mit dem leeren Tablett hinter den Tresen zurück und fuhr sich mit den Fingern durch ihre schwarzen Locken.
»Die zwei Römer wollen noch einen Krug Wein«, informierte sie ihn.
Mechanisch griff er in das Fach unter dem Tresen und holte einen sauberen Krug hervor. »Caros hat mehr als genug«, sagte er tonlos.
»Da geht es ihm wie mir«, zischte sie.
Bonza verdrehte die Augen, wandte sich aber sicherheitshalber ab, damit sie es nicht sehen konnte. »Was soll denn das schon wieder bedeuten?«, fragte er in einem so gelassenen Tonfall wie möglich.
»Das weißt du sehr genau«, gab sie zurück.
Ihre Stimme hatte diesen gefährlichen, vibrierenden Unterton angenommen, den er nur zu gut kannte. Das bedeutete, dass sie in einer Stimmung war, in der sie dem berüchtigten griechischen Feuer glich. Wenn es einmal loderte, konnte es nicht mehr gelöscht werden. Deshalb war es das Beste, wenn es gar nicht erst entflammte.
»Es ist doch alles in Ordnung«, erwiderte er, ging in die Knie und zapfte aus dem Fass unter dem Tresen den Wein ab.
Leise plätschernd strömte der Rebensaft in den Krug. Die Qualität war mäßig, wie er sehr wohl wusste, aber in dieser Ecke von Sardinien schienen die Menschen sowieso keinen besonderen Wert auf einen guten Tropfen zu legen. Dementsprechend gaben sie auch kein Geld dafür aus, es lohnte sich also nicht, in etwas Besseres zu investieren. Seine römischen Gäste lobten den Wein zudem in höchsten Tönen, vor allem, wenn sie vorher in Germanien stationiert gewesen waren. Daraus schloss er, dass das Zeug, das sie dort ausschenkten, von erlesener Scheußlichkeit sein musste.
Routiniert stellte er den Krug auf das Tablett. Petronella griff danach und kehrte ohne ein weiteres Wort zu dem von den beiden Römern besetzten Tisch zurück. Erleichtert atmete er auf. Obwohl er auch nach zwanzig Jahren Ehe noch immer in sie verliebt war, fand er ihre Streitlust zunehmend bedrückend. Schon in Rom war es manchmal schlimm gewesen, aber seit sie im vergangenen Sommer nach Sardinien gegangen waren, fürchtete er sie regelrecht.
Ihm war bewusst, dass er selbst schuld daran war. Petronella hatte nie hierher gewollt, und all ihre Befürchtungen und Ängste schienen sich erfüllt zu haben.
Die Schenke, die sie in Rom besessen hatten, hatte ordentlich was abgeworfen, doch Bonza war in der riesigen Stadt nie richtig heimisch geworden. Die vielen Menschen, der Gestank und das fortwährende Gedränge in den Straßen und Gassen machten ihn nervös. Es war dort so ganz anders gewesen als in der friedlichen Idylle des Dorfs, in dem er geboren war.
Als er die Nachricht erhalten hatte, dass sein Onkel Molipeter verstorben war und ihm als einzigen lebenden Verwandten seine Taverne vererbt hatte, hatte er die Gelegenheit beim Schopf gepackt, sein eigenes Wirtshaus verkauft und war mit Petronella – ungeachtet ihrer Proteste – zurück in seine Heimat gezogen.
Der glückliche Fisch befand sich an einer Verbindungsstraße zwischen den beiden Dörfern Kalabrus und Fordongianus. Letzteres war im Schatten des gleichnamigen römischen Legionslagers entstanden, und in den Straßen brummte es vor Geschäftigkeit. Wobei das nicht mit den Zuständen in Rom vergleichbar war.
Von Anfang an waren die Geschäfte mehr schlecht als recht gelaufen. Wie sie gleich bei ihrer Ankunft festgestellt hatten, schien sich Molipeter zuletzt nicht mehr besonders um das Haus gekümmert zu haben, die Einrichtung wirkte veraltet und heruntergekommen. Jedoch scheute Bonza die Investition, die nötig gewesen wäre, um den Laden wieder auf Vordermann zu bringen.
Zum anderen hatte er bald herausgefunden, dass es im nahen Fordongianus bereits mehrere Tavernen gab, die natürlich eine starke Konkurrenz darstellten. Die meisten seiner wenigen Gäste waren römische Soldaten, die einen Narren an seinem Wein – oder an dem besonders günstigen Preis – gefressen hatten und deshalb den zwanzigminütigen Fußmarsch zu ihm nicht scheuten.
Doch das waren nur ein paar Handvoll. Einheimische ließen sich noch seltener sehen, und aus dem weiter entfernten Kalabrus kam gar keiner, wenn man von Caros absah. Und der lebte, soweit er da informiert war, nicht im Dorf selbst, sondern in einer Hütte oder Höhle in der Nähe.
Petronella war vom ersten Tag an in ihrem neuen Heim unglücklich gewesen, und mit den Monaten waren die Spannungen zwischen ihnen gewachsen. Sie fühle sich wie eine verdorrende Pflanze, hatte sie ihm ein ums andere Mal vorgeworfen. Sie hasse Sardinien, sie hasse die Menschen hier und ganz besonders hasse sie die Taverne.
Insgeheim hatte Bonza bereits beschlossen, dass sie nach Rom zurückkehren würden, wenn sich an der Situation bis zum Ende des Winters nichts geändert hatte. Auf Dauer konnte er es nicht ertragen, sie leiden zu sehen. Und wenn es sich nicht einmal finanziell lohnte ...
Petronella hatte den Krug bei den Römern abgeliefert und kehrte zum Tresen zurück. Dabei musste sie an Caros' Tisch vorbei. Mit seinem durch unzählige alkoholgeschwängerte Abende erfahrenen Blick sah Bonza das Unheil kommen, doch es ging so schnell, dass er es nicht verhindern konnte. Caros griff nach ihrem Gewand. Seine Finger gruben sich in den groben Stoff und zerrten daran. Ruckartig kam sie zum Stehen. Das leere Tablett entglitt ihrer Hand und landete scheppernd auf dem unebenen Dielenboden. Wütend fuhr sie herum und riss sich dabei los.
»Was fällt dir ein, du widerliche Missgeburt?«, kreischte sie.
»Ich will noch Wein!«, brüllte er. »Du beachtest mich überhaupt nicht.«
Sie bückte sich und hob das Tablett auf. Ihr Gesicht war so rot angelaufen wie die Sonne, wenn sie abends im Meer zu versinken schien. »Du hast genug, du versoffenes Schwein!«, fuhr sie Caros an und holte mit der freien Hand aus.
Er zuckte zurück, aber wenn sie vorgehabt hatte, ihn zu schlagen, hatte sie es sich im letzten Moment anders überlegt. Sie warf ihm einen düsteren Blick zu und verschwand mit schnellen Schritten hinter dem Vorhang neben dem Tresen, der die Treppe zu ihren privaten Räumen vom Schankraum abtrennte.
Bonza seufzte leise. Es würde eine unerfreuliche Nacht werden.
Caros hatte seine Überraschung überwunden. »Ich will Wein!«, heulte er.
»Du hast genug«, donnerte Bonza. »Raus mit dir, und lass dich so bald nicht wieder blicken.«
Er spürte, wie der Zorn in ihm immer stärker zu lodern begann. Nach diesem Vorfall würde es ihn viel Mühe kosten, Petronella zu beruhigen und sie zu überreden, morgen wieder die Arbeit aufzunehmen. In der Ecke neben ihm stand ein Knüppel, für alle Fälle. Wenn der alte Säufer nicht gleich das Weite suchte, würde er ihn zu spüren bekommen.
Caros' Gesicht hatte einen trotzigen Ausdruck angenommen. »Wenn du wüsstest«, rief er mit bebender Stimme. »Ich bin nämlich reich. Reicher als du.«
»Was du nicht sagst.«
»Du glaubst mir nicht, was?«, geiferte er. Speichel sprühte aus seinem Mund, seine Augen rollten wild in ihren Höhlen. »Solltest du aber. Ich hüte einen Schatz. Einen gewaltig großen Schatz. Und wenn du nicht aufpasst, dann kaufe ich mir damit deine verdammte Taverne und jage dich von der Insel.«
Womit du Petronella einen Gefallen tun würdest , dachte Bonza.
»Und ich hüte einen Knüppel«, entgegnete er ungerührt. »Den lasse ich auf deinem Rücken tanzen, wenn du nicht augenblicklich verschwindest.«
Caros' Augen verengten sich zu Schlitzen, und einen Herzschlag lang glaubte Bonza, dass er es darauf ankommen lassen würde. Dann rutschte er von seinem Hocker, wobei er beinahe ausgerutscht und lang hingeschlagen wäre. Schwankend blieb er stehen und warf ihm einen letzten wütenden Blick zu, bevor er sich umdrehte, die Tür aufriss und in die kühle Abendluft hinaustorkelte.
Bonza sahs zu den beiden Römern, die die Auseinandersetzung schweigend verfolgt hatten. Ihre Blicke waren auf die Tür gerichtet, die in diesem Moment ins Schloss fiel.
†
»Wir haben genug für heute«, verkündete Volat und sah dabei in seine Richtung.
Menus hockte mit seinem jüngeren Bruder Lobus im Heck des Boots und war damit beschäftigt, die silbrig glänzenden Fische aus dem Netz zu befreien und in die Holzkisten zu werfen. Er strich sich eine Strähne seines dichten schwarzen Haars aus dem Gesicht und fing den Blick seines Vaters auf.
Trotz seiner fünfzig Jahre war Volat noch immer von kräftiger, sehniger Statur. Seine Haut war von der jahrzehntelangen Arbeit auf dem Meer braun gebrannt, sein schütteres Haar schlohweiß.
Er nickte ihm zu. »Die Netze waren heute wieder ganz schön voll.«
»Da hast du recht, mein Sohn. Die Götter haben es gut mit uns gemeint, als sie unsere Familie an diesen Ort verschlagen haben. Beeilt euch, ihr beiden. Sobald ihr alle Fische in die Kisten gepackt habt, brechen wir auf.«
Sie fuhren mit ihrer Arbeit fort, wobei es Menus nicht besonders eilig hatte, denn er genoss jede Minute, die er auf dem Meer verbringen konnte. Er liebte den salzigen Geruch, den immerwährenden Wind und die friedvolle Einsamkeit, die hier draußen herrschte. Und er war stolz darauf, in nicht allzu ferner Zeit in die Fußstapfen seines Vaters treten zu dürfen.
Bei seinem Bruder schien das anders zu sein. Wenn sie morgens hinausfuhren, vermeinte er seit einigen Wochen stets einen leichten Widerwillen bei ihm zu bemerken. Und nicht nur ihm war aufgefallen, dass sich Lobus plötzlich brennend für die Arbeit des Schmieds interessierte. Was auch an dessen hübscher Tochter liegen konnte, die zwar erst dreizehn war, doch schon jetzt jedem Burschen im Dorf den Kopf verdrehte.
Er kniff die Augen zusammen und spähte in Richtung Küste. Aus dieser Entfernung war Kalabrus kaum mehr als ein Schatten, hinter dem sich die Wälder und Berge Sardiniens erhoben. Seine Gedanken schweiften zu Elene. Sie war fünfzehn und damit ein Jahr jünger als er, und ihre Schönheit strahlte heller als die Sonne.
Er sah sie vor sich, ihr ebenmäßiges Gesicht mit der Stupsnase, das von glatten schwarzen Haaren umrahmt war. In ihren dunklen Augen konnte er regelrecht versinken. Sie hatten sich erst ein Mal geküsst, ihre Eltern ahnten noch nichts von ihrer Liebe. Es war seltsam, in Elenes Gegenwart fühlte er sich gleichzeitig geborgen und unsicher, denn er wusste nicht recht, wie er mit ihr umgehen sollte und wollte auf keinen Fall etwas falsch machen. Frauen schienen Wesen voller Mysterien zu sein. Er nahm sich vor, heute Abend seinem Vater von ihr zu erzählen und ihn um Rat zu bitten.
»Bist du eingeschlafen, Menus?« Volats kräftige Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Rasch griff er nach dem nächsten Fisch.
»Du hast bestimmt an Elene gedacht«, flüsterte Lobus und kicherte leise.
Obwohl es ihm schier den Atem verschlug, hielt er nicht inne und zog weiter Fisch um Fisch aus dem Netz. Woher wusste sein kleiner Bruder von ihr? Er musste ihm gefolgt sein, als er sich aus dem Haus geschlichen hatte, um sich heimlich mit Elene zu treffen.
»Ein Wort, und ich ...«, begann er, als ein riesiger Schatten auf ihn fiel.
Menus hob den Kopf. Sein Mund öffnete sich wie von selbst, doch er brachte kein Wort heraus. Als wäre seine Zunge plötzlich gelähmt.
Das Schiff, das wie aus dem Nichts erschienen war, trieb so nah neben ihnen, dass er es mit ausgestrecktem Arm fast hätte berühren können. Von ihren gelegentlichen Ausflügen zum Hafen von Karali kannte er sich mit Schiffen aus und wusste sofort, dass es sich um eine Galeere handelte.
Sie war vielleicht fünfzig Schritt lang. Die Bordwand ragte etwa zehn Fuß aus dem Meer empor. Das an den Rändern ausgefranste dunkle Segel hing trotz des Winds schlaff am Mast herunter. Soweit er das von hier unten erkennen konnte, schien niemand an Deck zu sein. Am seltsamsten war, dass man das Schiff vom Heck bis zum Bug vollkommen schwarz gestrichen hatte. So etwas hatte er noch nie gesehen.
»Vater?«
Volat antwortete nicht. Er stand am Bug und starrte die schwarze Bordwand hinauf. Seine Haut war blass geworden. Jetzt drehte er den Kopf, und als sich ihre Blicke trafen, zuckte Menus erschrocken zusammen. Sein Vater sah aus, als wäre er einem Gespenst begegnet. In seinen Augen flackerte nackte Furcht.
»Wir müssen zurück!«, rief er mit zitternder Stimme. »Schnell, das Segel!«
Menus sprang auf und erreichte mit einem Satz den Mast, der im Vergleich zu jenem der Galeere lächerlich klein wirkte. Gerade als er das Segel setzen wollte, erscholl ein dumpfes Röhren.
Lobus stieß einen schrillen Schrei aus, und sein Vater stöhnte entsetzt auf. Menus wirbelte herum. Beinahe hätte er ebenfalls aufgeschrien. Ein Dutzend Männer stand an der Reling und starrte auf sie herunter. Aber das waren keine gewöhnlichen Männer. Ihre Kleidung war zerlumpt und hing größtenteils in Fetzen an ihnen herab. Ein Geruch nach Algen und Verwesung lag plötzlich in der Luft. Ihre Haut war bleich. Bei einigen schienen die Nasen und Ohren weggefressen worden zu sein, an manchen Stellen waren die blanken Knochen zu sehen.
Am schlimmsten waren ihre Augen. Sie waren vollkommen weiß und glühten hell wie Sterne.
Eines der Wesen hob den rechten Arm. In seiner Hand, die mehr einer Klaue glich, hielt es eine Axt. Die Klinge starrte vor Rost, als hätte sie jahrelang im Wasser gelegen. Alles ging vollkommen lautlos vor sich. In einer schnellen Bewegung holte der Unheimliche aus und warf die Axt.
Menus hörte ein schmatzendes Geräusch neben sich. Sein Kopf flog herum. Die Schneide hatte sich in Lobus' Stirn gebohrt. Mund und Augen seines Bruders waren weit aufgerissen. Ohne einen Laut kippte er nach hinten und stürzte mit einem Klatschen ins Meer.
Menus war wie gelähmt. Er sah seinen Vater auf sich zustürzen. Von der Seite kam ein Schatten angeflogen. Eine Lanze bohrte sich in Volats Hüfte und riss ihn von den Füßen. Blut spritzte aus der Wunde. Als er den Kopf hob, war sein Gesicht schmerzverzerrt.
»Flieh«, keuchte er. »Ins Meer. Versuch an Land zu schwimmen.«
»Vater, ich ...«
»Du sollst fliehen, du Narr. Rasch!«
Ein zweiter Speer bohrte sich neben ihm in die Planken und blieb zitternd darin stecken. Menus warf sich herum und sprang in die Fluten. Um diese Jahreszeit war das Wasser kalt. Ein eiserner Reif schien sich um seine Brust zu legen und ihm die Luft abzuschnüren. Sofort schwamm er tiefer. Wenn er zu dicht an der Oberfläche blieb, würden sie ihn mit einem besser gezielten Speerwurf auch unter Wasser erwischen. Erst als seine Lungen förmlich nach Luft schrien, tauchte er wieder auf.
Erleichtert stellte er fest, dass die Galeere abgedreht hatte. Doch dann änderte sie den Kurs, beschrieb einen scharfen Halbkreis und steuerte auf ihr Boot zu. Mit einem lauten Krachen bohrte sich der Bug in die Bordwand. Holzteile wurden durch die Luft geschleudert, als die Galeere über die Reste dessen hinwegwalzte, was noch vor wenigen Minuten der ganze Stolz seines Vaters gewesen war. Danach drehte sie erneut ab und nahm Kurs aufs offene Meer. Während sie sich entfernte, wurde sie durchscheinend, als löse sie sich langsam in Luft auf.
Dann war sie verschwunden.
Menus hatte ihr nachgestarrt. Jetzt merkte er, dass er vor Kälte und Entsetzen zitterte. Die Trauer um seinen Vater und seinen Bruder schnürte ihm die Kehle zu, doch er drängte sie zurück. Er musste nach Hause. Er musste seinen Leuten erzählen, was passiert war.
Eine Träne löste sich aus seinem linken Auge, rann über seine Wange und vermischte sich mit dem Salzwasser auf seiner Haut. Er begann zu schwimmen.
†
Castor Pollux und sein Freund Kimon saßen stumm an ihrem Tisch und hingen ihren Gedanken nach. Sie hatten einen Platz in der hintersten Ecke der Taverne ergattert, die sich Zum rauen Gesellen nannte. Wenn er sich umsah, schien ihm der Name mehr als passend. Außer ihnen waren etwa zwei Dutzend Männer anwesend, allesamt muskulöse und wild aussehende Kerle. Augenscheinlich hatten sie etwas zu feiern, denn sie orderten Krug um Krug des blassroten, wässrigen Weins, der hier ausgeschenkt wurde. Castor tippte auf freigelassene Sklaven oder Gladiatoren.
Die beiden Huren des Hauses, ein blondes und ein schwarzhaariges Mädchen, von denen keine älter als achtzehn war, hatten buchstäblich alle Hände voll zu tun. Kaum kehrte eine von ihnen aus ihrer Kammer in der oberen Etage zurück, sprang schon der nächste Bursche auf und forderte lautstark ihre Dienste ein, woraufhin sie mit ihm im Schlepptau die Treppe wieder hinaufstieg. Inzwischen wirkten beide Frauen etwas müde.
Es war bestimmt eine Viertelstunde vergangen, ohne dass Castor und Kimon auch nur ein Wort miteinander gewechselt hatten. Eine bedrückende Schweigsamkeit hatte sich während ihrer Rückreise aus Germanien über sie gelegt. Zu tief saßen die Eindrücke dessen, was sie dort erlebt hatten. In dem Wald, in dem germanische Aufständische vor über fünfzig Jahren drei römische Legionen niedergemetzelt hatten, hatte der Dämon Noros ein Tor zwischen den Welten geöffnet. Zwar hatten sie ihn vernichten und das Tor schließen können, doch zuvor hatte es sie in das Reich der Finsteren verschlagen. Was er dort gesehen und erlebt hatte, quälte Castor seitdem in seinen Träumen, und er war sicher, dass es Kimon ebenso ging.
Und noch mehr war passiert. Merle, eine junge Frau, die Kimon bei ihrem Kampf gegen die Nebelreiter in Britannien kennengelernt hatte und die dort unter den Einfluss der Hexe Nara geraten war, war überraschend in Germanien aufgetaucht und hatte ihnen geholfen, das Tor zu zerstören.
Zuvor hatte sie Kimon enthüllt, dass sie eine weiße Hexe war, was ihr selbst nicht bewusst gewesen war, bevor Nara von ihr Besitz ergriffen hatte. Zu gerne hätte sich Castor mit ihr unterhalten, doch sie war in der Welt der Finsteren verschollen.
Für Kimon war das ein besonders schwerer Schlag gewesen, denn er hatte sich bereits in Britannien in Merle verliebt. Zwar war er inzwischen mit Zoe zusammen, einer jungen Griechin, die sie in Rom vor Medusas Sohn gerettet hatten. Doch als er Merle erneut begegnet war, waren seine Gefühle für sie wieder entflammt. Castor fragte sich, wie sein Freund diesen neuerlichen Verlust verkraften würde. Vermutlich wusste er es selbst noch nicht.
Er musste an Florentina denken, und ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. Er konnte es kaum erwarten, sie in seine Arme zu schließen. Rom war nur noch eine Tagesreise entfernt.
Ihm fiel auf, dass es in der Taverne still geworden war. Eine seltsame Spannung schien plötzlich in der Luft zu liegen. Er bemerkte einen jungen Burschen in einer schlichten Tunika, der einen etwas nervösen Eindruck machte. Ein kahlköpfiger Hüne mit einem dichten Vollbart hatte sich vor ihm aufgebaut und funkelte ihn wütend an. Der Kerl war wenigstens einen Kopf größer und beinahe doppelt so breit. Sein linkes Ohrläppchen fehlte und Narben an seinem Oberarm kündeten davon, dass er so manchen Kampf ausgefochten hatte.
»Wegen dir habe ich meinen Wein verschüttet«, knurrte er den Burschen mit einem starken, Castor unbekannten Akzent an.
»Es tut mir leid, Herr«, entschuldigte er sich. »Es war nicht meine Absicht, dich anzurempeln.«
Die anderen Männer brachen in dröhnendes Gelächter aus. Der junge Mann hielt dem finsteren Blick des Kahlkopfs trotzig stand. Entweder hatte er den Mut eines Löwen oder er war ein Narr, überlegte Castor.
»Du hattest also nicht die Absicht, mich anzurempeln, he? Aber vielleicht habe ich die Absicht, dir die Kehle durchzuschneiden.« Der Hüne griff unter seinen Mantel, zog einen Dolch hervor und richtete die Spitze auf die Nase seines Gegenübers.
»Das würde ich an deiner Stelle nicht tun«, sagte er.
Castor war das leichte Zittern in seiner Stimme nicht verborgen geblieben. Seine unerschrockene Fassade begann also zu bröckeln. Auch der Kahlkopf schien es bemerkt zu haben, denn ein breites Grinsen war auf seinem Gesicht erschienen.
»Und warum sollte ich das nicht tun?«
»Weil ich ein Auxiliar bin.«
Das Grinsen wurde zu einem wölfischen Lächeln. »So, so. Einer von den Hilfstruppen also. Wo ist denn deine Rüstung, Kleiner?«
»Ich bin auf Urlaub.«
»Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Soldaten töte ich am liebsten. Ganz egal, ob es sich um Auxiliare oder einen richtigen Legionär handelt.«
Wie auf ein stummes Kommando erhoben sich Castor und Kimon gleichzeitig.
»Lass ihn in Ruhe«, rief Castor.
Der Kopf des Mannes flog herum. Sein Lächeln verschwand und machte einem verärgerten Ausdruck Platz. »Haltet euch da raus. Das geht euch nichts an«, blaffte er.
»Wenn du einen römischen Soldaten abschlachten willst, der dir nichts getan hat, dann geht uns das etwas an«, erwiderte Castor und legte demonstrativ die Hand auf das Heft seines Gladius, der in einer hölzernen Scheide an seiner Seite baumelte.
»Er hat meinen Wein verschüttet.«
»Er bezahlt dir einen neuen.«
»Das werde ich mit Vergnügen tun«, bekräftigte der Bursche.
Dann ging alles ganz schnell. Der Kahlkopf versetzte dem Auxiliar einen so kräftigen Stoß gegen die Brust, dass er das Gleichgewicht verlor und auf dem Hosenboden landete. Blitzartig warf er sich herum und stürzte sich auf Castor, während einer seiner Kumpane, ein hagerer Kerl mit langen, strähnigen Haaren, Kimon packte und ihn zur Seite zerrte.
Castor blieb keine Zeit, sein Schwert zu ziehen. Mit einem schnellen Schritt nach rechts wich er der Attacke aus. Der Dolch zischte dicht vor seiner Nase vorbei. Seine Hand schoss vor, umklammerte das Handgelenk seines Gegners und bog es zurück. Der Kahlkopf heulte wütend auf und holte mit der freien Faust aus. Castor duckte sich, sprang vor und grub seine Schulter in den Bauch des Hünen. Dafür musste er jedoch die Hand mit dem Dolch loslassen.
Jetzt musste es schnell gehen. Er umklammerte die Hüften des völlig überraschten Mannes und richtete sich auf, sodass dieser plötzlich in der Luft hing. Mit einem angestrengten Ächzen schleuderte er ihn zu Boden. Hart landete sein Gegner auf dem Rücken. Wild fuchtelte er mit dem Dolch umher und versuchte seine Beine zu erwischen. Castor trat ihm mit einem gezielten Tritt die Waffe aus der Hand, zog seinen Gladius und richtete die Spitze auf seine Kehle. Aus dem Augenwinkel lugte er zu Kimon hinüber. Sein Freund hatte seinen Gegner bereits niedergerungen. Der Hagere lag auf den Knien und japste nach Luft.
Aus großen Augen starrte der Kahlkopf Castor ungläubig an.
»Keiner rührt sich«, rief er und warf einen warnenden Blick in die Runde. »Sonst ist euer Freund hier tot.«
Die übrigen Kerle bewegten sich nicht von der Stelle. Bei einigen glaubte Castor ein amüsiertes Schmunzeln zu bemerken, als seien sie durchaus damit einverstanden, dass ihrem Kameraden eine Lektion erteilt worden war. Es war so still, dass man eine Pfeilspitze auf dem Boden hätte landen hören können.
»Also«, wandte er sich an den Kahlkopf. »Ich sage dir jetzt, wie es weitergeht. Ich, mein Freund und der Soldat verlassen diese Taverne und suchen uns etwas anderes. Der Wein hier schmeckt sowieso nach Eselspisse.«
»Scheißkerl«, rief der Wirt, ein dicker Gallier mit einem riesigen Schnauzbart, hinter seinem Tresen hervor. Einige der Männer lachten. Castor ignorierte ihn.
»Du bleibst da unten liegen, bis wir zur Tür raus sind. Hast du mich verstanden?«, fragte er.
Der Kahlkopf nickte.
»Und du wirst uns auch nicht verfolgen. Sonst wird es schlecht für dich enden.«
Wieder ein Nicken.
Mit der freien Hand nestelte Castor ein Geldstück aus dem Beutel an seinem Gürtel und warf ihn dem Besiegten zu, der es mit einer Hand geschickt auffing. »Das ist für einen neuen Becher Wein.«
Er trat zurück und nickte Kimon zu. Mit gezogenen Schwertern und sich gegenseitig Deckung gebend arbeiteten sie sich langsam zur Tür vor. Im Vorbeigehen packte Castor den Soldaten am Halsausschnitt seiner Tunika und zog ihn mit sich. Keiner der Männer machte Anstalten, sie aufzuhalten. Kurz darauf marschierten sie nebeneinanderher durch die Straßen des Hafenstädtchens, wobei Kimon und Castor in regelmäßigen Abständen Blicke über die Schulter warfen.
»Wie heißt du?«, fragte Castor den Mann, als er sicher war, dass sie nicht verfolgt wurden.
»Lucius. Lucius Kimbus.«
»Bist du auf dem Weg nach Rom?«
»Nein, ich komme gerade von dort. Ich muss nach Germanien.«
»Nach Germanien?«, schaltete sich Kimon ein. »Ganz allein?«
»Ich bin auf der Suche nach zwei Männern, mit denen ich dringend sprechen muss. Und die befinden sich gerade in Germanien. Jedenfalls wurde mir das in Rom so mitgeteilt. Ich bin zwar nicht scharf drauf, mit den Barbaren dort Bekanntschaft zu schließen, aber die Sache ist wichtig. Das Überleben meines Heimatdorfs hängt vielleicht davon ab.«
Castor spürte plötzlich ein Prickeln auf seiner Kopfhaut. »Wie heißen denn die beiden Männer?«
»Ihre Namen lauten Castor Pollux und Kimon.«
Sie blieben stehen, was Lucius erst bemerkte, als er ihnen schon drei Schritte voraus war. Stirnrunzelnd ging er zu ihnen zurück. »Was ist los?«
»Du brauchst nicht nach Germanien zu fahren«, antwortete Castor.
»Wie meinst du das?«
»Du hast die beiden Männer gefunden. Ich bin Castor, und das ist Kimon«, stellte er sie vor. »Wir sind auf der Rückreise.«
»Aber ...« Lucius sah von einem zum anderen und wirkte dabei ebenso aufgeregt wie erleichtert. »Aber das ist ja wunderbar. Was für ein Glück, dass ich in dieser Taverne eingekehrt bin. Die Götter müssen mit mir sein.«
»Da vorne ist ein Gasthaus. Lass uns da hineinsetzen, dann kann er uns erklären, warum er so dringend mit uns reden will«, schlug Kimon vor.
Die Gäste in dieser Schänke machten einen weitaus friedlicheren Eindruck. Stimmengewirr erfüllte die Luft, dennoch war es leise genug, dass sie sich unterhalten konnten, ohne sich anschreien zu müssen. Und auch der Wein war entschieden besser, wie Castor nach dem ersten Schluck anerkennend feststellte.
»Also raus mit der Sprache«, forderte er Lucius auf. »Was willst du von uns?«
»Ich komme aus Sardinien und bin dort auch stationiert. Im Lager Fordongianus, das ist ganz in der Nähe von Kalabrus, dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Vor einigen Tagen wurde vor der Küste von Kalabrus ein Fischerboot von einer schwarzen Galeere überfallen und versenkt. Ein Junge konnte sich retten und an Land schwimmen. Sein Vater und sein Bruder sind dabei umgekommen.«
»Eine schwarze Galeere?«, hakte Kimon nach.
Lucius nickte. »Der Junge hat erzählt, dass Männer an Bord gewesen seien, die sehr seltsam ausgesehen hätten. Wie Leichen, die schon lange im Meer gelegen haben. So hat er sie jedenfalls beschrieben.«
Castor und Kimon wechselten einen raschen Blick.
»Seit dem Vorfall taucht die schwarze Galeere immer wieder auf. Sobald die Fischer aufs Meer hinauswollen, ist sie da. Plötzlich, wie aus dem Nichts. Natürlich kehren sie dann sofort um, jeder weiß ja, was passiert ist. Meine Leute leben von dem, was das Meer ihnen schenkt. Ihre Vorräte werden langsam knapp und sie haben nichts mehr zu verkaufen. Früher oder später werden sie hungern oder das Dorf verlassen müssen. Ich habe mit unserem Kommandanten darüber gesprochen, aber er glaubt nicht an die Existenz der Galeere und weigert sich einzugreifen. Ein Kamerad aus meiner Einheit, der vor Kurzem aus Rom zurückgekehrt ist, hat mir von euch erzählt. Ihr sollt an den Saturnalien gegen lebende steinerne Statuen gekämpft haben.«
Womit er recht hatte. Dardos, der Sohn der Gorgone Medusa und seine Gefährtin Eunika hatten sich eine kleine Armee geschaffen, indem sie Menschen in Statuen verwandelt hatten, die dann zu einem schaurigen Leben erwacht waren. Auch Senator Urbanus, Florentinas Vater und Castors Verbindungsmann in den Kaiserpalast, war unter den Opfern gewesen. Zum Glück hatten sie ihn und die meisten anderen retten können.
»Mein Kamerad hat auch gesagt, dass du, Castor, schon häufiger mit übernatürlichen Gegnern zu tun gehabt haben sollst«, fuhr Lucius fort. »Vielleicht kannst du meinem Volk helfen, die schwarze Galeere zu vertreiben. Oder noch besser zu vernichten.«
Castor warf Kimon einen Blick zu. Der Gedanke, so kurz vor dem Ziel den Kurs ihrer Reise zu ändern und noch länger von Florentina getrennt zu sein, ließ ihm das Herz schwer werden. Nur hatte er keine Wahl. Die Aufgabe, die ihm das Schicksal auferlegt hatte, hatte Vorrang. Und nach dem, was ihnen Lucius erzählt hatte, war es sehr wahrscheinlich, dass hier die Finsteren die Hände im Spiel hatten.
»In Ordnung«, willigte er ein, griff nach seinem Becher und leerte den restlichen Wein in einem Zug.
Lucius strahlte ihn an. Dann trübte sich sein Blick. »Ich habe aus Rom eine Botschaft mitgebracht«, sagte er. »Sie ist für Kimon.«
Kimon hob eine Braue. »Für mich? Dann los, worauf wartest du?«
»Es geht um eine Frau namens Zoe. Sie ist sehr krank. Man hält es für möglich, dass sie nicht überleben wird.«
Das Gesicht des Griechen wurde starr. »Ich verstehe«, sagte er leise.
Am nächsten Morgen brachen sie auf. Während Castor Lucius nach Sardinien begleiten würde, würde Kimon nach Rom zurückkehren. So hatten sie es gestern Abend vereinbart.
»Und du bist sicher, dass du allein zurechtkommst?«, fragte Kimon mit besorgter Miene.
»Natürlich«, antwortete Castor und hoffte, dass ihn die Zukunft nicht Lügen strafen würde.
»Soll ich den Pfeil wirklich mitnehmen?«
Sie hatten den weißen Pfeil in Germanien in der Nähe des Weltentors gefunden. Er verfügte über Kräfte, die denen seines vom Kriegsgott Mars geschmiedeten Schwerts ähnlich waren. Kimon hatte bislang keine wirksame Waffe gegen die Finsteren besessen. Deshalb fand Castor es nur recht und billig, dass sein Freund den Pfeil an sich nahm.
»Ja«, bestätigte er. »Der Pfeil gehört dir.«
Sie fassten sich an den Unterarmen und verabschiedeten sich. Kimon schwang sich auf sein Pferd und ritt los. Castor sah ihm nach, bis er hinter der nächsten Häuserecke verschwunden war.
†
Die Sonne war bereits untergegangen, als es an Pollomas' Hütte klopfte. Seine Frau Tertia öffnete die Tür und ließ die Besucher hinein. Erwartungsgemäß handelte es sich um Sculpa und Dormon.
Nach ihm waren sie die beiden ältesten Männer im Dorf, wobei man das nur Sculpa ansah, der nur noch wenige Haare auf dem Schädel, dafür aber Falten wie Gräben im Gesicht hatte. Dormon mochte um die sechzig sein, so genau wusste Pollomas das nicht, doch er wirkte wenigstens fünfzehn Jahre jünger als Sculpa, der die sechzig bereits überschritten hatte. Sein Haarschopf war grau und voll, und in seinen grünen Augen funkelte ungebrochene Lebensfreude. Nachdem seine Frau vor zwei Jahren verstorben war, hatte er nach einer angemessenen Trauerzeit damit begonnen, regelmäßig das kleine Bordell in Fordongianus aufzusuchen.
»Ich grüße dich, Pollomas«, sagte er und lächelte ihn an.
Ohne eine Einladung abzuwarten, nahm er wie gewohnt zu seiner Rechten an dem großen Holztisch Platz. Sculpa nickte nur stumm, stieß sein übliches heiseres Husten aus und ließ sich auf der anderen Seite nieder. Tertia servierte wortlos einen Krug Wein und drei Becher, bevor sie sich zurückzog. Pollomas schenkte ihnen ein. Den Wein hatte erst gestern einem fahrenden Händler abgekauft, und er schmeckte ausgezeichnet. Stumm prosteten sie sich zu.
Dormon schnalzte mit der Zunge. »Ein guter Tropfen, Pollomas. Ich bin aufrichtig beeindruckt.«
»Wirklich nicht übel«, stimmte Sculpa mit der ihm üblichen Zurückhaltung zu und hustete. »Aber wir sind nicht hier, um deinen Wein zu verkosten, nicht wahr?«
»Scharfsinnig wie immer, mein Freund.«
»Dafür braucht es kaum einen besonderen Scharfsinn«, wandte Dormon ein.
Sculpa schnaufte empört. Pollomas hob beschwichtigend die Hände. Manchmal kamen ihm die beiden wie ein altes Ehepaar vor. Ständig beharkten sie sich, doch in Wahrheit waren sie sich in tiefer Freundschaft verbunden. Und das, obwohl sie nicht nur äußerlich, sondern auch in ihrem Wesen grundverschieden waren. Während Dormon stets freundlich und interessiert wirkte – vor allem Frauen gegenüber –, machte Sculpa auf jeden, der ihm erstmals begegnete, einen verschlossenen und griesgrämigen Eindruck. Er war ein Mensch, den man näher kennenlernen musste, um sich ein Urteil über ihn erlauben zu können.
»Lasst uns nicht streiten, meine Freunde«, sagte Pollomas. »Der Tag, vor dem uns unsere Väter und Vorväter gewarnt haben, ist nicht mehr fern. Die schwarze Galeere ist ihre Vorbotin, und sie wird kommen. Ich hatte gehofft, dass dieser Kelch an uns vorüberziehen und sich diese ganze Geschichte als eine fantasievolle Legende entpuppen würde. Dem ist offenkundig leider nicht so.«
Dormon kratzte sich am Kopf. »Wenn ich durchs Dorf spaziere, kann ich die Angst beinahe mit Händen greifen. Die Leute fürchten sich.«
»Und wenn die Fischer nicht bald wieder hinauskönnen, werden wir alle hungern«, fügte Sculpa hinzu.
»Was ist mit dem jungen Lucius?«, wollte Dormon wissen. »Ist er wieder zurückgekehrt?«
Pollomas schüttelte den Kopf. »Nein. Und selbst wenn, ich glaube nicht daran, dass es jemanden gibt, der ihr die Stirn bieten könnte. Wenn ihr mich fragt, hat er sich einen Floh ins Ohr setzen lassen.«
»Die Leichtgläubigkeit ist der Jugend Verderben«, merkte Sculpa an. »Vor allem, wenn diese Jugend sich als Soldat des Feindes verdingt.«
»Ganz recht«, erwiderte Pollomas, ohne auf den zweiten Teil der Bemerkung einzugehen. »Mit dieser Bedrohung müssen wir allein fertig werden. Sie will ihren Schatz holen. Dann soll sie ihn bekommen.«
Dormon nahm noch einen Schluck Wein. »Es war eine gute Idee, ihn in der Höhle zu verstecken. Wenn er den Banditen in die Hände gefallen wäre, wären wir jetzt verloren.«
»Oder die Römer hätten ihn sich unter den Nagel gerissen«, ergänzte Sculpa, und seine Miene verfinsterte sich. »Sie hätten ihn ihrem verfluchten Kaiser zum Geschenk gemacht.«
»Du solltest deinen Gram ihnen gegenüber allmählich begraben«, gab Dormon zu bedenken. »Sie sind nun einmal hier, und daran können weder du noch ich etwas ändern.«
Sculpa hustete und funkelte ihn an. »Solange du nur deine Huren hast, Dormon. Ich sage dir etwas. Wäre ich nicht so alt, würde ich zu den Waffen greifen und eigenhändig einen Aufstand gegen sie anführen.«
»Mag sein, aber darum geht es jetzt nicht«, wechselte Pollomas schnell das Thema. »Ich schlage vor, dass wir morgen früh den Schatz ins Dorf bringen. Es kann nicht mehr lange dauern, bis sie ihn einfordern wird. Nach meinen Berechnungen müsste es in drei Tagen so weit sein.«
»Wir sollten Rapus, Tosus und Belunus mitnehmen«, schlug Dormon vor. »Sie sind unsere stärksten und mutigsten Männer. In jüngster Zeit sollen sich wieder Räuber in der Gegend herumtreiben.«
»Ein wahres Wort. So soll es geschehen«, stimmte Pollomas zu und schenkte ihnen Wein nach.
Am frühen Vormittag des nächsten Tages brachen sie auf. Sie gingen zu Fuß und hatten einen Esel dabei, auf dem sie den Schatz transportieren würden. Der Frühling war noch einige Wochen entfernt, doch der Tag war mild. Nur wenige Wolken zogen am Firmament entlang und ein sanfter Wind streichelte ihre ernsten Gesichter.
Ihre Begleiter, alle drei groß und kräftig, gingen voraus. Sie waren mit Schwertern und Dolchen bewaffnet. Auch die Alten trugen Dolche in ihren Gürteln. Pollomas war sich darüber im Klaren, dass er, Dormon und Sculpa bei einem Überfall nicht von großem Nutzen sein würden, denn sie waren keine Kämpfer und waren es nie gewesen. Dennoch war er entschlossen, sein Leben dafür einzusetzen, dass der Schatz heil nach Kalabrus gelangte.
»Auf ein Wort«, sagte Sculpa neben ihm und sprach dabei so leise, dass es die jungen Männer vor ihnen nicht hören konnten. »Was machen wir eigentlich mit Caros?«
»Nun, seine Aufgabe ist damit erfüllt. Er kann ins Dorf zurückkehren.«
»Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Caros ist ein ebenso verrückter Teufel, wie sein Vater und sein Großvater es gewesen sind. Ich glaube, niemand hätte etwas dagegen einzuwenden, wenn er Kalabrus fernbleiben würde. Er scheint sich da draußen doch recht wohlzufühlen.«
»Weil er eine Aufgabe hatte«, gab Pollomas zu bedenken. »Dass er damit betraut worden ist, den Schatz zu bewachen, hat ihn zu etwas Besonderem gemacht, und das ist viel mehr, als er vom Leben zu erwarten hatte. Das weiß er ganz genau, denn er mag ein wenig verrückt sein, jedoch ist er nicht dumm. Wenn das Gold erst weg ist, ist ihm niemand mehr zu Dankbarkeit verpflichtet und sein Leben in der Einsamkeit hätte seinen Sinn verloren. Ich finde, wir schulden ihm etwas. Wir finden schon eine neue Aufgabe für ihn.«
»Dein Wort in der Götter Ohren.«
Kurz darauf erreichten sie einen dichten Wald, durch den ein schmaler Pfad führte. Äste und kleine Zweige schienen wie gierige Klauen nach ihnen zu greifen, verhakten sich in ihren Gewändern und Mänteln. Pollomas atmete auf, als der Pfad nach einem beinahe halbstündigen mühsamen Marsch endlich breiter wurde. Misstrauisch sah er sich immer wieder um, doch zwischen den Bäumen und Büschen war niemand zu sehen.
Eine weitere halbe Stunde später erreichten sie einen mehr als haushohen, mit Moos und Gras bewachsenen Felsen. Hinter einer kaum mannsgroßen Spalte verbarg sich eine geräumige Höhle, von der ein schmaler Stollen abging, der wiederum in einer kleineren Höhle unter der Erde endete. Er selbst hatte sie entdeckt, als er noch ein junger Bursche gewesen war. Ein halbes Jahr später war das Dorf von Banditen überfallen worden, die jedoch zurückgeschlagen werden konnten. Pollomas' Vater, dem er von seiner Entdeckung erzählt hatte, hatte daraufhin darauf gedrängt, den Schatz dort zu verstecken, und so hatten es die Ältesten schließlich beschlossen.
Pollomas hatte ein mulmiges Gefühl dabei gehabt, den Schatz unbewacht zu lassen, auch wenn es ein gutes Versteck war. Der Zugang war von dichtem Buschwerk verdeckt und nicht leicht zu finden. Aber er hatte es schließlich auch geschafft. Also hatten sie Protonox, Caros Vater, zum Wächter bestimmt.
Sie hatten ihn nicht lange überreden müssen. Die Aussicht auf ein Leben ohne Arbeit bei guter Verpflegung hatte in seinen Augen den Nachteil des ständigen Alleinseins wettgemacht. Nachdem er gestorben war, hatte sein Sohn die Aufgabe übernommen. Er lebte in der oberen Höhle, während der Schatz unter ihm verborgen lag.
Rapus hatte bereits mit seinen schwieligen Händen das Buschwerk zur Seite gedrückt und steckte gerade seinen Kopf in die Öffnung. »Caros!«, rief er. »Komm raus, wir sind's.«
Als sie keine Antwort erhielten, schlüpfte Dormon, der Schlankste von ihnen, ins Innere. Nicht lange danach hörten sie einen erstickten Schrei, dann drängte er mit kreidebleichem Gesicht zurück ins Freie. Bei seinem Anblick hatte Pollomas plötzlich das Gefühl, als läge ihm ein riesiger Stein im Magen. Eine düstere Vorahnung ergriff ihn wie eine eiskalte Hand.
»Was ist los?«, fragte er.
»Caros ... er ...«, stotterte Dormon.
»Nun rede schon«, mischte sich Sculpa ein. »Was ist mit ihm?«
»Er liegt in der Höhle. Tot. Jemand hat ihm den Schädel eingeschlagen.«
Ein Schwindelgefühl erfasste Pollomas, und er musste sich an einem Baum abstützen, um nicht zusammenzubrechen.
»Und der Schatz?«, fragte er und fürchtete sich vor der Antwort.
Dormon schüttelte in einer hilflosen Geste den Kopf. »Er ist verschwunden.«
†
Marius Bilibus runzelte die Stirn. Mit diesem Zenturio stimmte doch etwas nicht. Aus zusammengekniffenen Augen musterte er den Mann, der auf der anderen Seite des Schreibtischs vor ihm saß.
Prantus Quatramus' Gesicht wies eine ungesunde Farbe auf. Blass und dabei irgendwie grünlich. Ob er etwas Verdorbenes gegessen hatte? Sein Optio Talbo Martinus, der neben ihm hockte, war dagegen wie stets braun gebrannt. Und wie üblich präsentierte er dieses dümmliche Grinsen, bei dem sich Marius manchmal fragte, ob es ein Ausdruck fortwährenden Spotts war oder ob er einfach nicht anders konnte.
»Unter uns«, richtete der Kommandant des Legionslagers Fordongianus das Wort an Prantus. »Geht's dir nicht gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Nein, eher so, als wärst du selbst ein Geist.«
Prantus winkte mit seiner mächtigen linken Hand ab. Der Kerl war ein Baum von einem Mann und überragte selbst ihn, der nicht gerade kleingewachsen war, um beinahe einen halben Kopf. Im Vergleich zu ihm war sein Optio eine Bohnenstange, die sich in seinem Schatten glatt hätte verstecken können. »Alles bestens, Herr. Ich bin nur ein wenig müde.«
»Müde. So, so«, erwiderte Marius und sah ihn durchdringend an.
Wovon er wohl müde war? Sicher nicht von der aufopfernden Erfüllung seiner Pflichten. Zudem herrschte in dieser Gegend schon seit einigen Monaten wohltuende Ruhe. Die Aufständischen, die immer wieder wie aus dem Nichts auftauchten und ihnen das Leben schwermachten, schienen eine längere Pause eingelegt zu haben.
Es waren nie so viele, dass sie ihnen ernsthafte Schwierigkeiten bereiten konnten. Ein paar Scharmützel wurden geschlagen, dann herrschte für eine gewisse Zeit Ruhe, bis alles wieder von vorn losging. Rom war anscheinend zu dem Schluss gekommen, damit leben zu können.
Jedenfalls dachte man dort gar nicht daran, ihnen Verstärkung zu schicken, damit sie endlich hart durchgreifen konnten. Den Kaiser, so machte es den Eindruck, scherten die Unruhestifter kaum mehr als ein Pickel an seinem vornehmen Hintern.
Ob Prantus die Gelegenheit genutzt hatte, um etwas zu ausgiebig dem Wein und den Huren zuzusprechen? Was das betraf, hatte er sich einen zweifelhaften Ruf unter den Legionären erarbeitet, sehr zu Marius' Missfallen, denn er hasste Undiszipliniertheiten.
Wenn die einfachen Soldaten ihren Sold mit Wein, Weibern und Würfeln durchbrachten, war ihm das egal, solange sie nicht in Streit gerieten und sich gegenseitig an die Kehle gingen. Von seinen Offizieren hingegen erwartete er eine etwas andere Lebensführung. Nun gut, das Problem würde sich bald erledigt haben. Zumindest für eine gewisse Zeit.
»Ich habe euch rufen lassen, weil ich eine Aufgabe für euch habe«, begann er.
Prantus und Talbo wechselten einen schnellen Blick. »Eine Aufgabe, Herr?«, fragte der Zenturio ungläubig, als wäre das das Letzte, was er erwartet – und erhofft – hatte.
Bei den Göttern, wer hatte den Mann eigentlich zum Zenturio befördert?, dachte Marius. In seinen Augen musste ein Soldat, gleich welchen Rangs, in jeder Sekunde dafür brennen, für Rom Dienst zu tun.
»Eine Aufgabe, ganz recht, Zenturio Prantus«, antwortete er, wobei er das Wort Zenturio besonders betonte. »So etwas kommt in der Legion hin und wieder vor.«
»Natürlich, Herr.«
»Du und deine Zenturie setzt euch in zwei Tagen in Richtung Rom in Bewegung. In Callopenia, etwa zwanzig Meilen östlich unserer geliebten Hauptstadt, treibt eine Bande von Banditen ihr Unwesen. Zufälligerweise besitzt dort ein Mann namens Jerus Cottenius ein Landgut, und wenn ich die Sache richtig durchschaue, pflegt dieser Bursche hervorragende Beziehungen in den kaiserlichen Palast. Und da man in Rom der Ansicht zu sein scheint, dass wir hier auf Sardinien sowieso nur mit dem Finger im Arsch herumsitzen, habe ich den Befehl erhalten, eine Einheit zu entsenden. Ihr werdet die Räuber aufspüren und mit ihnen kurzen Prozess machen, damit unser Freund Cottenius wieder beruhigt schlafen kann.«
»Ich verstehe, Herr«, sagte Prantus.
Marius entging nicht, dass der Zenturio und der Optio verschwörerische Blicke wechselten. Als hätten sie vergessen, dass sie sich in seinem Büro befanden. Er räusperte sich, was ihm augenblicklich wieder ihre ungeteilte Aufmerksamkeit einbrachte.
»Bevor ihr aufbrecht, werdet ihr mit den Männern exerzieren und sie auf Vordermann bringen. Ich hatte zuletzt den Eindruck, dass sie etwas schlaff geworden sind. Wir wollen ja nicht, dass dieser Cottenius einen schlechten Eindruck von uns bekommt.«
»Natürlich nicht, Herr. Und wir sollen erst in zwei Tagen aufbrechen?«, fragte Prantus.
Sieh an, der Bursche konnte es offenbar kaum erwarten, die Banditen abzuschlachten. Sonst schien er damit zufrieden zu sein, im Lager herumzulungern und seine Untergebenen zu schikanieren. Vielleicht hatte er ihn doch falsch eingeschätzt.
»Ja, denn du wirst diese Zeit brauchen, um deine Leute aufzumöbeln. Die Räuber laufen dir schon nicht weg. Ach, bevor ich es vergesse, ich möchte, dass ihr jemanden aus der Auxiliartruppe mitnehmt. Einen Burschen namens Lucius Kimbus. Meiner Meinung nach braucht er dringend eine Luftveränderung.«
Der Kerl war ein Einheimischer, der sich freiwillig zur Hilfstruppe gemeldet hatte. Vor Kurzem hatte er ihn mit einer völlig verrückten Geschichte behelligt und war dabei so penetrant gewesen, dass er ihn schließlich aus seinem Büro hatte werfen lassen. Er hatte etwas von einer schwarzen Galeere gefaselt, die vor der Küste seines Heimatdorfs auf dem Meer kreuzte und gegen die man etwas unternehmen müsse.
Was für ein Blödsinn. Außerdem, was gingen ihn die Probleme der Leute hier an? Es wurde Zeit, dass dieser Lucius ein wenig Kampferfahrung sammelte. Das würde ihn auf andere Gedanken bringen. Innerlich grinste er, denn er liebte solche Strafaktionen.
»Und da ist noch etwas«, fuhr er fort. »Cottenius scheint ein äußerst großzügiger Mann zu sein. Wenn ihr eure Aufgabe erledigt habt, erwartet euch als Belohnung eine Woche Urlaub in Rom. Prantus, wenn ich richtig informiert bin, besitzt du ein Haus in der Stadt?«
Der Zenturio nickte. »Meine Eltern haben es mir vererbt. Zwei Sklaven halten es in meiner Abwesenheit in Schuss.«
»Dann wird es dich sicher freuen, für eine Weile in deine eigenen vier Wände zurückzukehren. Cottenius hat außerdem jedem deiner Männer einen halben Monatssold versprochen. Das ist genug, um sich ein paar Tage in der großen Stadt zu amüsieren. Aber ich warne dich. Ich möchte keine Geschichten darüber hören, dass unsere Legionäre in Schlägereien verwickelt wurden oder irgendeine verlauste Taverne auseinandergenommen haben. Du bist mir dafür verantwortlich, verstehst du?«
»Natürlich, Herr. Ich und Optio Talbo werden darauf achten.«
»Gut. Das war alles. Wegtreten.«
Wieder wechselten die beiden einen merkwürdigen Blick, dann erhoben sie sich, salutierten und verließen sein Büro. Marius sah ihnen nach, bis sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte. Einen leisen Seufzer ausstoßend stand er auf, trat zu einem kleinen Tisch und goss sich aus einem Bronzekrug etwas Wein ein. Nachdenklich nahm er einen Schluck und genoss den Geschmack des Rebensafts auf seiner Zunge.
Er hatte den Zenturio ausgewählt, weil er auf ihn am ehesten verzichten konnte. Wer wusste schon, wann die Aufständischen wieder zuschlagen würden? Seine fähigsten Offiziere brauchte er an Ort und Stelle, und wenn dieser Cottenius mit Kaiser Nero persönlich befreundet war. Mit ein paar Banditen aufzuräumen war eine Aufgabe, die selbst Prantus bewältigen konnte.
Er stellte den Becher ab, streckte sich und spürte, dass seine Muskeln verspannt waren. Vielleicht sollte er mal wieder Levia aus dem Bordell von Fordongianus zu sich kommen lassen. Ja, er würde seinen Adjutanten nach ihr schicken lassen, damit sie ihm heute Abend ein wenig Gesellschaft leistete. Der Gedanke daran ließ ihn Prantus und Talbo schnell vergessen.
†
Wie immer war Castor froh, als er wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Er hasste Schiffsfahrten, dabei wurde ihm zu Kimons Vergnügen jedes Mal übel. Doch diesmal war sein Freund nicht bei ihm, und als sich er und Lucius auf die Pferde schwangen, wurde ihm bewusst, dass er ihn schmerzlich vermisste. Von seiner ersten Begegnung mit den Finsteren abgesehen, hatten sie bislang alle Kämpfe gemeinsam bestritten. Diesmal würde er auf sich allein gestellt sein.
Sie ließen den Hafen hinter sich und ritten an der Küste entlang. Als sie Kalabrus erreichten, dämmerte bereits der Abend. Vom Meer her wehte ein starker, kühler Wind über das Land und zerrte an seinen Haaren. Unwillkürlich hielt er Ausschau nach einer schwarzen Galeere, doch weit und breit war nichts zu sehen.
Vom zur Meerseite gelegenen Dorfrand bis zum Strand waren es nur etwas mehr als hundert Schritte. Castor bemerkte einige Fischerboote, die man an Land gezogen hatte. Neben einem der Boote saß ein alter Mann im Sand und starrte aufs Meer hinaus.
»Ich muss noch heute Abend zurück ins Lager«, eröffnete ihm Lucius, während sie zwischen den niedrig gebauten Häusern hindurchritten. »Ich bin bereits einen halben Tag überfällig.«
Castor hob eine Braue. »Du hast einiges riskiert, um mich zu finden. Wenn wir uns in Dornobia nicht begegnet wären, wärst du mit mehr als einem halben Tag Verspätung zurückgekehrt. Das hätte dir eine Menge Ärger eingebracht.«
»Ich weiß. Aber das war es mir wert. Immerhin geht es um meine Heimat.«
»Gibt es hier eine Herberge, in der ich unterkommen kann?«
»Nein, aber das ist auch nicht nötig. Du kannst bei mir wohnen. Das heißt, bei meinem Vater Gropus und meiner Schwester Andria. Unser Haus ist relativ groß und bietet genug Platz.«
Castor konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Du hast also eine Schwester. Ist sie hübsch?«
»Sehr sogar«, antwortete er, und der Stolz in seinen Worten war nicht zu überhören.
»Ich bin gespannt«, erwiderte Castor.
Er hatte nicht vor, Florentina untreu zu werden. Aber gegen die Gesellschaft eines schönen Mädchens hatte er noch nie etwas einzuwenden gehabt.
Zwei ältere Frauen überquerten vor ihnen die schmale Straße und warfen ihnen misstrauische Blicke zu. Castor nickte ihnen grüßend zu, doch sie verschwanden ebenso wortlos wie eilig in einem der Häuser.
Kurz darauf hatten sie Lucius' Zuhause erreicht. Er sprang vom Pferd und stürmte, ohne sich mit Anklopfen aufzuhalten, hinein. Während Castor aus dem Sattel stieg, hörte er von drinnen einen hellen Freudenschrei. Er band den Gaul an einem Pfosten fest und trat ein.
Als er die junge Frau erblickte, die Lucius im Arm hielt, klappte ihm die Kinnlade herunter. Der Auxiliar hatte nicht zu viel versprochen. Andria war großgewachsen und reichte ihrem Bruder bis zum Scheitel. Sie mochte etwa achtzehn Jahre alt sein und trug ein schlichtes Gewand, das ihre Formen betonte. Lange, schwarze Locken fielen ihr über die schmalen Schultern. Ihr Gesicht war feingeschnitten, Augen, Nase und Mund bildeten eine so perfekte Symmetrie, wie Castor es noch bei keiner anderen Frau gesehen hatte. Am auffälligsten waren ihre Augen. Sie waren blauer als das Meer selbst und strahlten wie die Sterne.
»Ist das der Mann, von dem du gesprochen hast?«, fragte sie ihren Bruder mit einer tiefen Stimme, die im Widerspruch zu ihrer anmutigen Erscheinung stand.
Lucius nickte eifrig. »Castor, darf ich vorstellen, das ist meine Schwester Andria.«
Huldvoll neigte er den Kopf. »Es freut mich, dich kennenzulernen.«
Sie schenkte ihm ein Lächeln, das seine Knie weich werden ließ.
»Wer ist da?«, dröhnte eine raue Stimme aus dem hinteren Teil des Hauses, und gleich darauf betrat ein gedrungener Mann das Zimmer.
Wenn das ihr Vater ist , dachte Castor, ist es ein Geschenk der Götter, dass seine Tochter nichts von seinem Aussehen geerbt hat. Seine Augen lagen tief in ihren Höhlen, und seine hohe Stirn schien sein Gesicht auf beinahe groteske Weise in die Länge zu ziehen. Seine Nase war gewaltig, die Lippen waren wulstig und aufgesprungen.
»Da ist ja mein feiner Herr Sohn, der Soldat«, ätzte er mit einem Blick auf Lucius. »Wen hast du da mitgebracht?«
»Das ist Castor Pollux aus Rom, Vater.«
»Ich grüße dich, Gropus«, sagte Castor, aber dieser beachtete ihn gar nicht.
»Was will er hier?«, fuhr er stattdessen seinen Sohn an.
»Uns dabei helfen, die schwarze Galeere zu vertreiben.«
Als Antwort zog der Alte geräuschvoll die Nase hoch.
»Ich muss sofort ins Lager zurück. Ich habe ihm angeboten, hierzubleiben.«
»Hier? Bei uns? Ein Römer? Das wäre ja noch schöner.«
»Ich bitte dich, Vater, sei nicht unhöflich«, schaltete sich Andria ein. »Er ist unser Gast, und Gäste gilt es gut zu behandeln. Das sind deine Worte.«
»Aber nicht, wenn es sich um einen Römer handelt«, grummelte er, doch sein Widerstand erlahmte bereits sichtlich. Offenbar war er Wachs in den Händen seiner Tochter.
»Ich bin stubenrein, mach dir keine Sorgen«, konnte sich Castor eine spitze Bemerkung nicht verkneifen.
Gropus warf ihm einen finsteren Blick zu und zog erneut die Nase hoch, sagte aber nichts mehr.
»Andria, bringst du Castor zu Pollomas?«, bat Lucius.
»Natürlich, Bruder. Das mache ich mit Freuden. Wie schade, dass du nicht länger bleiben kannst.«
Die Art, wie sie Castor dabei ansah, ließ seine Kehle trocken werden. »Wer ist dieser Pollomas?«, wollte er wissen.
»Unser Dorfältester«, antwortete Lucius. »Du musst dich mit ihm unterhalten. Auf Wiedersehen, Castor. Ich danke dir nochmals, dass du gekommen bist. Sobald es mir möglich ist, kehre ich zurück.«
Er drückte seine Schwester an sich, nickte seinem Vater zu und verließ das Haus. Castor konnte das Wiehern seines Pferds und gleich darauf Hufgetrappel hören.
Gropus zog ein letztes Mal die Nase hoch, grummelte etwas vor sich hin und zog sich in den Teil seiner Behausung zurück, aus dem er gekommen war. Andria trat auf Castor zu und fasste seinen Arm. Die Berührung ihrer Finger verursachte ein wohliges Kribbeln auf seiner Haut.
»Gehen wir?«, fragte sie.
†
Elene lehnte den Kopf an Menus' Schulter und lauschte dem Rauschen des Meeres. Sie liebte es, am Strand zu sein, die salzige Luft zu riechen und den Sand unter ihren Füßen zu spüren. Am schönsten war es, wenn Menus bei ihr war. Allzu lange jedoch würden sie nicht mehr bleiben können. Die Sonne begann bereits am Horizont zu versinken. Spätestens wenn sie untergegangen war, würde sich ihr Vater fragen, wo sie steckte. Er war streng und duldete es nicht, wenn seine Tochter bei Einbruch der Dunkelheit nicht zu Hause war.
Menus hatte keinen Vater mehr.
Bei diesem Gedanken griff sie nach seiner Hand. Ihre Finger verschränkten sich ineinander. Trotz seiner jungen Jahre waren Menus' Hände von der harten Arbeit eines Fischers bereits schwielig. Gerne hätte sie ihm etwas Tröstendes gesagt, nur wollten ihr nicht die richtigen Worte einfallen, also schwieg sie lieber. Stumm beobachteten sie die Wellen, die sich unaufhörlich am flachen Strand brachen.
»Wenn ich daran denke, dass sie jetzt da draußen auf dem Meeresboden liegen ...«, hauchte Menus, und der Druck seiner Hand wurde fester.
»Ich weiß, was du meinst. Niemand hat es verdient, so zu sterben.«
»Weißt du, worüber ich nachgedacht habe?«
»Sag es mir.«
»Ich würde gerne Vaters altes Schwert nehmen, aufs Meer hinausfahren und diesen Kreaturen die Köpfe abschlagen.«
Sie ließ seine Hand los, setzte sich auf, packte ihn an den Schultern und sah ihm in die Augen. »Sag nie wieder so etwas, hörst du?« Ihr heftiger Ausbruch überraschte ihn sichtlich. Sein Mund öffnete sich, doch sie ließ ihn nicht zu Wort kommen. »Du hättest keine Chance gegen sie. Wie viele waren es, sagtest du? Ein Dutzend, oder? Nicht einmal der tapferste aller Krieger könnte etwas gegen eine solche Übermacht ausrichten.«
Daraufhin schwieg er, und sie fürchtete schon, er könne aufspringen und davonlaufen, weil sie ihn in seinem Stolz verletzt hatte. Doch dann wurden seine Augen feucht, und seine Lippen begannen zu zittern. Sie zog ihn an sich, woraufhin er seine Arme um sie legte, den Kopf an ihrer Brust barg und zu weinen begann. Zärtlich strich sie ihm übers Haar und ließ ihn gewähren. Es war das erste Mal, das sie einen Mann weinen sah, und sie fühlte sich geehrt, dass er seine Gefühle ohne Scham mit ihr teilte.
Als er sich wieder beruhigt hatte, löste er sich von ihr. Traurig schüttelte er den Kopf. »Es tut mir leid, Elene.«
»Es gibt nichts, was dir leidtun müsste, Menus. Wenn man traurig ist, weint man. Nicht nur, wenn man eine Frau ist, weißt du?«
Bei diesen Worten musste er lächeln. Fasziniert betrachtete sie die Grübchen, die sich dabei in seinen Mundwinkeln bildeten. Menus war der hübscheste Bursche im Dorf, trotzdem hatte er nur Augen für sie, was sie mit Stolz erfüllte. Plötzlich verspürte sie das Verlangen, ihn zu küssen. Die Erinnerung an das erste und bislang einzige Mal war süß wie Honig.
»Weißt du, ich komme mir so hilflos vor«, sagte er. »Wenn es Römer gewesen wären, dann wüsste ich, was ich zu tun hätte.«
Sie nahm wieder seine Hand. »Rache bringt sie dir nicht zurück. Niemand hat etwas davon, wenn du auch noch dein Leben verlierst.«
Er senkte den Kopf. »Ich weiß nicht, ob mein Leben noch eine Bedeutung hat. Meine Mutter ist vor Trauer gebrochen. Sie verbringt den ganzen Tag in ihrer Kammer und spricht kein Wort. Ich glaube, sie gibt mir die Schuld. Weil ich es nicht verhindert habe. Oder weil ich überlebt habe.«
»Für mich hat es eine Bedeutung«, sagte sie so eindringlich, dass er zu ihr aufsah.
Ihre Blicke versanken ineinander, und sie glaubte, sich in seinen großen, dunklen Augen zu verlieren. Wie auf ein geheimes Signal hin näherten sich ihre Gesichter. Es war, als würden sie auf magische Weise voneinander angezogen. Dann berührten sich ihre Lippen, und ein wohliges, warmes Gefühl machte sich in ihrer Magengrube breit.
Seine Zunge drängte gegen ihre Zähne. Bereitwillig ließ sie ihn ein. Der kühle Abendwind streichelte ihre Haut, doch sie nahm ihn nicht wahr. Seine Hand legte sich auf ihre linke Brust. Behutsam erkundeten seine Finger ihren Busen, strichen über den Nippel, der sich unter dem Stoff aufrichtete.
Sie hatte noch nie mit einem Mann geschlafen, doch in diesem Moment wusste sie, dass Menus ihr die Jungfräulichkeit nehmen sollte. Ein Feuer begann in ihrem bereits erhitzten Körper zu lodern und breitete sich rasch aus. Sie löste sich von ihm und streifte sich in einer schnellen Bewegung ihr Gewand über den Kopf. Menus' blieb der Mund offen stehen, was sie zum Kichern brachte.
»Möchtest du etwa nicht?«, neckte sie ihn.
»Oh doch«, erwiderte er und begann hektisch an seiner Tunika zu zerren, wobei sie ihm amüsiert zusah.
Plötzlich war etwas anders. Sie waren nicht mehr allein.
Ihr Kopf flog herum. Es war, als hätte jemand einen Eimer eiskaltes Wasser über ihr ausgekippt. Ein schriller Schrei drang aus ihrem Mund.
Wie aus dem Boden gewachsen, standen zwei grauenvolle Kreaturen vor ihnen. Sie trugen zerlumpte, zerrissene Kleidung. Ihre Haut war fahl, das Fleisch an einigen Stellen angefressen, und ein widerlicher Gestank ging von ihnen aus. Eine war mit einer Axt bewaffnet, die andere hielt ein Schwert in ihrer klauenartigen Hand. Aus toten weißen Augen starrten sie sie ausdruckslos an.
Menus fasste sich als erster. »Lauf!«, schrie er und sprang auf die Füße.
In einer blitzschnellen Bewegung stieß ihm das Wesen das Schwert in die Brust. Der Stoß war so heftig, dass die blutige Spitze an seinem Rücken wieder heraustrat.
Elene wollte schreien, doch ihre Kehle war wie zugeschnürt. Ein grässliches Schmatzen entstand, als der Unheimliche mit einem Ruck das Schwert aus Menus' Körper zog. Er drehte den Kopf und sah sie an. Sein Mund öffnete und schloss sich, als wolle er etwas sagen, dann sackte er auf die Knie, kippte zur Seite und blieb liegen. Blut quoll aus der Wunde an seinem Rücken und färbte den Sand rot.
Elene hatte das Gefühl, als wäre jegliche Kraft aus ihr herausgesaugt worden. Verzweifelt versuchte sie, auf dem Rücken liegend vor den Monstern davonzukriechen. Sie wusste, dass sie auf die Beine kommen und wegrennen musste, aber sie schaffte es einfach nicht. Die beiden Gestalten beobachteten sie aufmerksam. Wie Raubtiere, die sicher waren, dass ihnen ihr Opfer nicht entrinnen konnte.
Hinter ihnen nahm Elene eine Bewegung wahr. Vor der untergehenden Sonne stieg eine Gestalt aus dem Meer und kam auf sie zu. Eine Frau, groß und schlank. Sie war vollkommen nackt. Lange, lockige blonde Haare fielen über ihre Schultern. Von der Hüfte abwärts war ihre blasse Haut mit silbrig glänzenden Schuppen bedeckt, ähnlich denen eines Fischs.
Als sie heran war, ging sie vor ihr in die Knie. Elene begann zu frösteln. Eine unheimliche Kälte ging von ihr aus. Ihre Augen leuchteten in einem tiefen Blau. Sie war sehr schön, doch etwas Grausames, Unbarmherziges lag in ihrem Blick. In Elenes Kehle bildete sich ein Kloß. Sie schielte zu Menus' Leiche hinüber. Würde sie an seiner Seite sterben?
Die Fremde öffnete den Mund. »Wie ist dein Name?« Ihre Stimme klang freundlich und sanft.
Sie schluckte. »Elene.«
»Es tut mir leid wegen deines Freundes, Elene. Bei dem, was ich mit dir vorhabe, hätte er jedoch nur gestört.«
Ein würgendes Gefühl stieg in ihr auf. Sie warf sich herum und erbrach sich mehrmals in den Sand.
»Was ... was hast du mit mir vor?«, fragte sie, als ihr Magen endlich leer zu sein schien. Ein saurer Geschmack lag auf ihrer Zunge.
»Ich habe für die Menschen in Kalabrus eine Botschaft. Und du wirst sie überbringen.«
Hoffnung keimte in ihr auf. Wenn sie eine Botschaft überbringen sollte, bedeutete das, dass man sie am Leben lassen würde.
»Was für eine Botschaft?«
Die Fremde beugte sich zu ihr herab. Aus nächster Nähe verströmte sie eine solche Kälte, dass sich auf Elenes nacktem Oberkörper eine Gänsehaut bildete. »Küss mich«, hauchte sie, packte ihren Hinterkopf und zog sie zu sich heran.