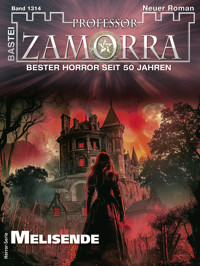6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Castor Pollux Sammelband
- Sprache: Deutsch
Vier spannende Romane um CASTOR POLLUX, den Bezwinger der Finsteren.
Im ersten Sammelband lesen Sie:
Der Vampir von Rom
Angriff der Nebelreiter
Stirb in der Arena, Castor Pollux!
Medusas Sohn
In dieser historischen Grusel-Serie kann man die Spannung spüren, wenn römische Aristokraten mit mysteriösen Flüchen behaftet werden und sich finstere Kulte in den Katakomben der Stadt versammeln. Vampire, Totenfresser und andere grauenhafte Wesen versetzen die römische Welt in Angst und Schrecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2021/2022 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covermotiv: © Mario Heyer (MtP Art) unter Verwendung von KI Software
ISBN: 978-3-7517-7569-4
https://www.bastei.de
https://www.sinclair.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Castor Pollux Sammelband 1
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Gespenster-Krimi 77
Der Vampir von Rom
Special
Gespenster-Krimi 84
Angriff der Nebelreiter
Gespenster-Krimi 88
Stirb in der Arena, Castor Pollux!
Special
Gespenster-Krimi 94
Medusas Sohn
Special
Guide
Start Reading
Contents
Der Vampir von Rom
von Michael Schauer
Römisches Reich, 63 n. Chr.
Zwischen den Dimensionen ist ein Riss entstanden. Nachdem sie vor über zwanzig Jahren von einem tapferen Krieger mit Namen Aurel zurückgedrängt wurden, versuchen die Kreaturen der Hölle erneut, Rom und die ganze Welt ins Unheil zu stürzen. Man nennt sie Die Finsteren. Ihr Name wird geflüstert, wenige Eingeweihte nur wissen von ihrer Existenz. Sollten sie die Oberhand gewinnen, wären die Tage der Menschheit gezählt, denn ihr einziges Streben ist das nach Schrecken und Chaos, Gewalt und Blut, Tod und Vernichtung. Aurel hat seinen Kampf gegen sie mit dem Leben bezahlt. Ausgezehrt und erschöpft von unzähligen Schlachten starb er an einem geheimen Ort. Allein sein Sohn könnte verhindern, dass die Finsteren diesmal den Sieg davontragen.
Sein Name lautet Castor Pollux ...
Hier unten herrschten Dunkelheit und Tod. Doch dieser Tod war lebendig, kratzte mit langen Krallen über kahle Steinwände, kroch unentwegt und gleichsam ohne Ziel durch das Verlies, in das seit Jahren kein Licht mehr gefallen war. Die Luft war kühl, stickig und verbraucht und roch faulig. Die Wesen scherte es nicht, diese Dinge hatten für sie keine Bedeutung. Sie kannten nur den Hunger.
Über hundert waren es an der Zahl. Klagendes Stöhnen entrang sich ihren ausgetrockneten Kehlen. Rot glühende Augen starrten durch die Finsternis. Die Wesen waren ausgemergelt, ihre Knochen bohrten sich durch die lederartige, kalkweiße Haut. Ihre Gesichter glichen Skelettfratzen, ihre Haare, spröde und verfilzt, fielen ihnen bis über die mageren Schultern. Manche trugen noch ihre Tuniken, schmutzig und zerfetzt, andere waren völlig nackt. Sie alle einte das Bewusstsein, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis sie endgültig ausgezehrt waren und in einen tiefen, ewig dauernden Schlaf fallen würden.
An der Oberfläche gab es Nahrung. So nah und doch unerreichbar. Sie konnten die Stimmen hören, aus weiter Ferne drangen sie zu ihnen hinunter. Wütendes Gezanke, zärtliche Liebesschwüre, leidenschaftliche Seufzer, Lachen und Weinen. Zu Tausenden wandelten die Menschen über die Erde. Durch die Adern jedes Einzelnen strömte der köstliche Nektar, den sie so sehr begehrten, den sie brauchten, um zu existieren.
Blut.
Einige der Wesen lagen apathisch auf dem Boden oder lehnten an der Wand. Andere konnten nicht aufhören, über die feuchte Erde zu kriechen wie Regenwürmer. Manchmal erfasste sie der Mut der Verzweiflung, und dann robbten sie in Richtung des Schachts, doch ein ums andere Mal verließen sie ihre spärlichen Kräfte, lange bevor sie auch nur in die Nähe gekommen waren.
Sie kannten den Weg nach oben. Dort hatte es jemanden gegeben, den sie fürchteten, der die Macht hatte, sie zu vernichten. Also hatten sie gewartet. Als seine Präsenz endlich verschwunden war, waren sie bereits zu erschöpft und ausgezehrt gewesen. In diesem Zustand wäre es ihnen niemals gelungen, ihre Beute niederzuringen. Eine Beute, die im Gegensatz zu ihnen höchst agil war. Ein Stich mit der Lanze, ein Hieb mit dem Schwert konnte ihnen zwar nichts anhaben. Doch auch sie waren nicht davor gefeit, in Stücke gerissen zu werden. Und sie fürchteten das Feuer.
Also warteten sie schicksalsergeben auf ihr Ende.
Warum hatte der Meister sie hergebracht, um sie dann zu vergessen? Sie wussten es nicht. Da waren nur noch Erinnerungsfetzen, wie Lichter in einer dunklen Nacht. Hin und wieder flammten sie auf, um sogleich zu verlöschen. Der Meister hatte ihr Blut getrunken und sie in seinesgleichen verwandelt, und dann sie hatten auf seinen Befehl hin das Blut von anderen getrunken. Auf diese Weise hatten sie sich vermehrt, waren zu einer kleinen Armee angewachsen.
Dann hatte es die Kämpfe gegeben. Viele von ihnen waren vernichtet worden.
Wo war er? Warum rettete er sie nicht? Wieso ließ er sie leiden?
Ein Luftzug in der Finsternis.
Über hundert Köpfe hoben sich. Jene, die sich in einer Art Dämmerschlaf befanden, wurden wach, öffneten ihre glühenden Augen. Unruhe breitete sich unter ihnen aus, das leidende Stöhnen wich aufgeregtem Gemurmel. Sie waren nun wie Ratten, die einen Leckerbissen rochen.
Das Geräusch von Schritten. Sie spürten die Gegenwart des Wesens, das sich ihnen näherte. Eine Gegenwart, die ihnen vertraut war. Es fühlte sich warm und wohlig an.
Jetzt lagen sie auf den Knien, starrten erwartungsvoll in die Dunkelheit. Ihre Augen waren anders als die eines Menschen, sie benötigten kein Licht, um sehen zu können.
Da war er. Hochgewachsen, sehnig. Der Kopf kahl und glatt wie polierter Marmor, die Ohren spitz, die Gesichtszüge scharf geschnitten. Seine Augen glühten wie ein Stück Metall, das ein Schmied gerade aus dem Feuer gezogen hatte. Er trug eine schwarze Tunika, das typische Gewand eines Römers, und einen langen roten Mantel. Obwohl auch in ihm kein Leben war, strotzte er vor Kraft und war voller Tatendrang. Was für ein Unterschied zu ihnen. Doch sie fühlten keinen Zorn, keine Verbitterung. Kein Laut des Vorwurfs würde ihnen über die blassen Lippen kommen. Denn die Jahre der Qualen waren mit einem Schlag vergessen, hinweggefegt von der Freude über seine Rückkehr.
Rodan, ihr Meister, war wieder bei ihnen.
»Ihr habt lange auf mich gewartet.« Seine Stimme, kalt wie Eis, schneidend wie eine scharfe Klinge, so vertraut. »Ich sage euch, euer Warten hat sich gelohnt.«
Aufgeregt wisperten sie miteinander, wiegten ihre Oberkörper hin und her. Mit einem Zischen brachte er sie zum Schweigen.
»Die Stunde der Rückkehr ist da. Wir wurden geschlagen, doch meine Welt ist bereit für einen neuen Kampf. Bald schon werden wir über die Menschen herfallen, und diesmal wird niemand sie retten. Nicht ihre Götter, und nicht der Krieger, der sie einst beschützte. Sie haben große Macht, doch wir sind die Stärkeren. Zum zweiten Mal hat sich der Riss aufgetan, und diesmal ergreifen wir unsere Chance.«
Sie hörten seine Worte, wenngleich nur wenige unter ihnen den Sinn zu durchdringen vermochten. Sie hatten, noch als Menschen, nie höhere Ziele gekannt als das eigene Überleben. Sie würden alles tun, was der Meister von ihnen verlangte. Dies war ihr Daseinszweck.
Sie spürten, wie sich zwischen ihnen und ihm ein unsichtbares Band manifestierte. Ein Band, das es schon einmal gegeben hatte, das aber zerrissen worden war. Jetzt erneuerte er es. Sie existierten weiterhin getrennt, waren aber eins.
»Ihr seid schwach«, fuhr Rodan fort. »Ihr müsst zu Kräften kommen, bevor ihr zur Oberfläche aufbrechen könnt. Ich werde euch Nahrung beschaffen. Bald schon wird frisches Blut durch die Adern von jedem einzelnen von euch strömen.«
Als seine Worte verklungen waren, war die Aufregung unter ihnen beinahe mit Händen zu greifen. Sie spürten den Hunger, der in ihren Eingeweihten wühlte wie die scharfen Zähne eines Wolfs. Plötzlich war da noch etwas anderes. Ein besonderer Geruch, den sie seit vermeintlichen Ewigkeiten nicht mehr wahrgenommen hatten, stieg ihnen in die knochigen Nasen.
Der Duft nach Leben.
Wie aufs Stichwort regte sich etwas in den Armen des Meisters. Jetzt erst bemerkten sie, dass er ein Bündel trug. Zartes Fleisch, jung, lebendig. Eine Frau. Sie war ohnmächtig gewesen, gerade erlangte sie wieder das Bewusstsein. Ein leises Stöhnen drang über ihre Lippen. Sie öffnete die Augen, doch sie konnte nichts sehen. Furcht ergriff sie. Sie spürten ihre Angst, welch ein wohltuendes Gefühl. Die Frau begann sich in den Armen des Meisters zu winden. Eisern hielt er sie fest.
Lippenpaare zogen sich zurück, enthüllten lange, nadelspitze Fangzähne.
»Sie wird nicht für alle reichen«, rief er ihnen zu. »Aber seid unverzagt. Schon bald werde ich zurückkehren und euch ein neues Opfer bringen. So lange, bis sich jeder von euch gelabt hat.«
»Wo bin ich?« Ihre Stimme, ängstlich und brüchig. »Wer bist du? Lass mich los.«
Rodans düsteres Lachen erfüllte die Dunkelheit. »Nein, mein Kind. Erkenne dein Schicksal.«
Jetzt sah sie die glühenden Punkte. Dutzende Augenpaare, die auf sie gerichtet waren. Sie begann zu schreien.
In den Ohren der Wesen waren ihre Schreie wie Musik.
Der Meister ließ sie einfach fallen. Schwer schlug sie auf der feuchten Erde auf. Sie wollte davonkriechen. Sie waren schneller, viel schneller. Die nahe Beute verlieh ihnen neue Kräfte. Wie wilde Tiere stürzten sie sich auf sie, rissen ihr das Gewand vom Körper, schlugen ihre Zähne in jedes Körperteil, das ihnen am nächsten war. Es dauerte nur Augenblicke, da sprudelte ihr Blut aus einem Dutzend Wunden, strömte warm in ihre Kehlen. Für jene, die das Glück hatten, etwas von ihr abzubekommen, war es ein unbeschreibliches Gefühl, und sie wünschten sich, es würde niemals enden.
Bald verebbten ihre Schreie. Nur die saugenden Geräusche der Kreaturen waren noch zu hören.
†
Zufrieden schlenderte Rodan durch die abendlichen Straßen der Metropole Rom. Überall drängten sich die Menschen. Wenn er sich ihnen näherte, machten sie ihm eilig Platz. Wie einen Schild schob er seine düstere Ausstrahlung vor sich her und teilte damit die Menge. Der Abend roch nach gegrilltem Fleisch und nach Unrat, nach Wein und nach menschlichen Ausscheidungen, ein stetes Stimmengewirr lag in der Luft. Rom war eine faszinierende Stadt, Millionen Menschen lebten hier auf engstem Raum zusammen, und während er zwischen ihnen hindurch schritt, nahm er einen Teil ihrer unendlich scheinenden Energie in sich auf.
Wenn er sich konzentrierte, konnte er seine Diener unter der Erde spüren. Einige Glückliche waren satt und zufrieden, nachdem sie sich an dem Blut des jungen Mädchens gelabt hatten. Die anderen beneideten sie darum und sehnten seine Rückkehr herbei – und ein neues Opfer.
Ein Lächeln umspielte seine dünnen Lippen. Sie brauchten noch ein wenig Geduld. Zunächst musste er sich selbst stärken. Damit er bei Kräften blieb, war es notwendig, dass er mindestens einmal täglich trank. Seine Macht war zwar groß, doch sie schwand umso schneller, wenn er ihr nicht regelmäßig frischen Lebenssaft zuführte.
Mit Befriedigung stellte er fest, dass es allmählich dunkel wurde, hier und dort wurden bereits Fackeln und Öllampen entzündet. Der Tag war nicht seine bevorzugte Zeit, die Strahlen der Sonne schwächten ihn und ließen ihn matt und träge werden. Deshalb blieb er tagsüber am liebsten in der abgeschirmten Kühle seiner Unterkunft. Er hatte eine Unterkunft im Erdgeschoss eines mehrstöckigen Hauses am Rande der Subura, dem Elendsviertel der Stadt, gefunden. Ein schmutziges Loch, das kaum mit seiner gepflegten Erscheinung in Verbindung zu bringen war. Ihm genügte es, und auf weltlichen Luxus legte er sowieso keinen Wert. Der Vermieter verlangte nicht viel Geld und stellte keine Fragen.
Seine geschärften Sinne suchten nach der Frau, doch er konnte sie nicht finden. Sie war nicht in der Nähe. Enttäuschung zeichnete sich auf seiner Miene ab. Vor einigen Tagen hatte er ihren Geist gespürt. Zufällig nur, jedoch hatte er sofort gewusst, dass sie die Richtige war. Sie hatte Zugang zu dem Mann, der über all diese Menschen gebot. Er musste sie finden und ihr seinen tödlichen Kuss des Lebens spenden, unbedingt. Mit ihr würde alles einfacher sein. Wenn er über den Herrscher herrschte, konnte ihn nichts mehr aufhalten.
Außerdem war ihre Seele verdorben. Sie würde eine gute Dienerin abgeben.
Heute Abend schien sie nicht auf den Straßen unterwegs zu sein.
In seinen Eingeweiden breitete sich ein nagendes Gefühl aus. Der Hunger begann mit spitzen Klauen nach ihm zu greifen.
Er überquerte das Forum Romanum, den zentralen Platz im Herzen der Stadt, und bog in eine belebte Seitenstraße ein. Zwei junge Männer rannten ihm entgegen, verfolgt von den wütenden Schreien einer älteren Frau. Der erste konnte ihm ausweichen, der zweite bemerkte ihn zu spät und rannte in ihn hinein.
»Pass auf, wo du hingehst«, blaffte er und starrte ihn herausfordernd an.
Rodan erwiderte seinen Blick. Einen Lidschlag lang glühten seine Augen auf. Im Schritt des Burschen bildete sich ein feuchter, gelblicher Fleck. Er wurde rot vor Scham, ein ängstlicher Ausdruck legte sich über seine groben Gesichtszüge, und dann rannte er weiter, wobei er mit einer Hand notdürftig die Stelle bedeckte, an der er sich eingenässt hatte.
Rodan seufzte zufrieden. Diese Menschen waren manchmal wie dumme Kinder.
Auf beiden Seiten der Straße standen Frauen vor den Häusern, lehnten an den Türrahmen oder schlenderten herum. Manche waren blutjung und frisch, andere älter und dahingewelkt wie Blumen in der Wüste. Viele trugen Kleider aus durchsichtigen Stoffen, die mehr enthüllten als sie verbargen, andere hatten noch weniger am Leib.
Er blieb vor einer jungen Frau stehen und musterte sie. Keinesfalls war sie älter als sechszehn Jahre. Schwarzes, gelocktes Haar fiel auf ihre nackten Schultern. Ihre Lider waren mit Ruß geschwärzt, was ihre dunklen Augen betonte. Sie trug lediglich ein dünnes Tuch, das sie um ihre Hüften geschlungen hatte. Seine Blicke wanderten über ihren wohlgeformten Körper und verharrten an ihrer Halsschlagader. Begehren stieg in ihm auf.
Sie bemerkte sein Interesse, löste sich von ihrem Platz und kam auf ihn zu, wobei sie lasziv die Hüften schwang.
»Na, mein Großer«, begrüßte sie ihn. »Für nur drei As kannst du mit mir einen Ausflug zu den Göttern machen.«
Die wären sicher nicht erfreut, mich zu sehen , dachte Rodan und nickte. »Einverstanden.«
»Dann komm mit, Großer. Ich heiße Justina, ein Name, den du dir merken solltest.«
Sie drehte ihm den Rücken zu, und er folgte ihr. Sie betraten ein schmuckloses Ziegelhaus, das sich über fünf Stockwerke in den Abendhimmel erhob. Die Luft roch muffig und abgestanden, die Wände waren mit obszönen Zeichnungen übersät. Über eine schmale Treppe stiegen sie in den zweiten Stock hinauf. Die Eingänge zu den Zimmern hatten keine Türen, sondern waren mit schweren Tüchern verhängt.
Justina betrat das letzte Zimmer am Ende des Gangs, zog den Vorhang zurück und ließ ihn eintreten. Er musste den Kopf einziehen, um nicht gegen den Querbalken zu stoßen. Das Zimmer war winzig und so kahl und schmucklos wie der Rest des Gebäudes. An der Wand befand sich eine steinerne Liegestatt, auf der eine mit einem dunklen Laken notdürftig abgedeckte, fleckige Matratze den einzigen Komfort darstellte. Durch eine kleine, mit einem dünnen Stück Stoff abgehängte Öffnung in der Wand wehte frische Abendluft herein. Eine Öllampe auf einem Sockel neben dem Steinbett sorgte für schummrige Beleuchtung.
Sie drehte sich zu ihm um und legte eine Hand auf seine Brust. Wenn sie durch die Tunika hindurch die unnatürliche Kühle seiner Haut bemerkte, so ließ sie es sich nicht anmerken. »Erst das Geld, mein Großer.«
Er griff in seine Tasche und holte die Münzen hervor. Sie nahm sie entgegen und ließ sie rasch zwischen den Falten ihres Hüftgewands verschwinden.
»Wie hast du's denn am liebsten?«, gurrte sie, wobei sich die Hand auf seiner Brust allmählich in tiefere Regionen vortastete.
»Blutig«, antwortete er und öffnete den Mund.
Für einen Augenblick genoss er den Schrecken in ihren Augen, als sie seine Hauer bemerkte, dann packte er sie mit einer Hand im Nacken und zog sie zu sich heran. Ihre Halsschlagader pochte, eine einzige Einladung für ihn. Sie begann zu zappeln. Seiner Kraft hatte sie nichts entgegenzusetzen. Er machte den Mund noch weiter auf und beugte sich zu ihr hinab, bereit für den Biss. Seine Zähne berührten das dünne Fleisch ihrer Kehle.
Ein glühender Schmerz in seiner Hüfte.
Er zuckte zurück, stieß sie gleichzeitig von sich, sodass sie über das Bett stolperte und zu Boden fiel. Der Dolch, mit dem sie zugestoßen hatte, entglitt ihrer Hand, die Klinge glänzte nass von seinem kostbaren Blut. Schon spürte er, wie seine Tunika sich damit vollsog.
Rodan ging auf die Knie und versuchte den Schmerz auszublenden. Eine solche Verletzung konnte ihn nicht umbringen. Doch jeder Tropfen, der aus seinem Körper strömte, kostete ihn Kraft, und es würde einen Moment dauern, bis sich die Wunde wieder verschloss.
»Leonidas!«, kreischte das Mädchen. »Leonidas!«
Schnelle Schritte auf dem Gang. Der Vorhang wurde zurückgerissen. Ein Mann stürmte in das Zimmer. Groß, beinahe so groß wie er, breit wie ein Schrank und muskulös. Seine olivfarbene Haut und der gepflegte Vollbart verrieten ihn als einen Griechen. In seiner rechten Hand hielt er eine kurze, mit Nägeln bestückte Keule.
»Was ist los?«, bellte er.
»Der Kerl ist verrückt, er hat versucht, mich zu beißen«, schrie Justina und zeigte mit dem Finger auf ihn.
Leonidas war offensichtlich kein Mann, der die Dinge auszudiskutieren pflegte. Ohne zu zögern schwang dieser die Keule und wollte sie auf Rodans Schädel niedersausen lassen. Im letzten Moment warf er sich zur Seite. Funken sprühten, als die Nägel auf blanken Stein schlugen.
Aus den Augenwinkeln bemerkte er, dass Justina sich hinter Leonidas' Rücken aus dem Zimmer zwängte.
Ein tierisches Fauchen drang aus seiner Kehle. Verunsicherung blitzte in den Augen seines Gegners auf. Schon ließ er den nächsten Angriff folgen.
Beinahe spielerisch machte Rodan einen Schritt nach links. Der Hieb ging ins Leere. Leonidas wollte zurückweichen, aber diesmal war er schneller. Mit einer einzigen raschen Bewegung packte er das Handgelenk des Griechen und riss es herum. Die Schmerzensschreie des Mannes mischten sich in das trockene Knacken, mit dem der Knochen brach.
Rodan trat ihm die Beine weg. Schwer landete er auf dem Rücken. Er stürzte sich auf seinen Gegner, packte mit beiden Händen den kantigen Schädel. Ein kräftiger Ruck, und Leonidas' Schreie erstarben abrupt. Seine blicklosen Augen starrten zur Decke.
Für einen Moment überlegte er, ob er ihm das Blut aussaugen sollte, dann verwarf er den Gedanken. Das Blut von Männern schmeckte ihm schal und abgestanden, er hasste es und trank es nur im äußersten Notfall.
Er spürte, wie sich die Wunde an seiner Hüfte zu schließen begann, seine Tunika war inzwischen rot gefärbt von seinem Blut. Damit würde er auf den Straßen Aufsehen erregen, er brauchte rasch eine neue.
Wo war die Hure?
Hastig verließ er das Zimmer, stürmte die Treppe hinunter und ins Freie. Mit schnellen Blicken sah er sich um, aber er konnte sie nirgends entdecken. Zwei Passanten beäugten ihn misstrauisch, und er zog den Mantel enger um seinen Körper, um die blutige Tunika so gut wie möglich zu verdecken.
Das war nicht gut gelaufen. Gar nicht gut.
†
Konzentriert fixierte Castor Pollux seinen Gegner durch das engmaschige, einem stählernen Netz gleichenden Visier seines Helms. Der riesige Retarius sprang leichtfüßig vor ihm hin und her. Mit der linken Hand hielt er das Netz, täuschte immer wieder einen Wurf an, um ihn in Bewegung zu halten und zu ermüden. Seine Rechte umschloss den Schaft des Dreizacks, einer Lanze, an deren Ende eine stählerne Gabel mit drei scharfen Zinken angebracht war. Bis auf einen Lendenschurz und einen Armschutz war er unbekleidet und damit deutlich schneller und beweglicher als Castor, der die typische Ausrüstung eines Murmillo mit sich herumschleppte. Den mächtigen Helm mit dem eisernen Kamm, den schweren Schild der Legionäre, das typische Kurzschwert, Gladius genannt, eine Metallschiene am linken Bein und einen schweren Panzer aus Leder und Metall, der seinen rechten Arm umhüllte. Die Rüstung schützte ihn, machte ihn aber langsamer.
Heiß brannte die Mittagssonne auf die Arena herab. Ein Schweißtropfen löste sich von seiner Stirn und rann ihm ins Auge. Er blinzelte ihn weg. Durch den eisernen Helm drangen das Johlen und Schreien der Zuschauer aus den vollbesetzten Rängen des Circus Maximus nur gedämpft an seine Ohren. Er achtete sowieso nicht darauf, seine volle Konzentration galt dem Gegner.
Er kannte den Retarius, sie lebten im selben Ludus, der Gladiatorenschule. Sein Name war Demos, ein großer, schlanker Mann mit mächtigen Muskeln. Das schwarze Haar trug er kurz geschnitten, die Gesichtszüge wirkten grob und brutal. Ein Blick aus seinen himmelblauen Augen pflegte die Frauen zum Schmelzen zu bringen, obwohl keine Spur von Wärme in ihnen lag. Demos war ein verurteilter Schwerverbrecher, dem die Wahl zwischen Hinrichtung oder Arena gelassen worden war. Mehr wusste er nicht von ihm, denn Demos, meistens mürrisch und immer wortkarg, gab so gut wie nichts über sich preis.
Sie mochten sich nicht, und das verlieh diesem Kampf eine persönliche Note. Außerhalb von Trainingskämpfen hatten sie sich noch nie gegenübergestanden.
Sein wievielter Kampf war das eigentlich? Der zehnte? Nach dem fünften hatte er aufgehört, mitzuzählen.
Demos machte einen schnellen Schritt auf ihn zu und schwang gleichzeitig das Netz. Castor riss den Schild hoch. Mit einem dumpfen Laut prallte das schwere Netz dagegen. Demos hatte nicht losgelassen und zog es sofort wieder zurück. Der Kampf dauerte nun schon einige Minuten, und er schien kein bisschen außer Atem zu kommen. Behände tänzelte er durch den heißen Sand. Schon wurden erste Unmutsäußerungen im Publikum laut. Die Menschen waren gekommen, um sie kämpfen zu sehen.
Castor durchschaute Demos' Strategie. Sein Gegner wollte ihn müde machen, indem er ihn zu Abwehrreaktionen zwang. Jedes Mal, wenn er den Schild heben musste, kostete ihn das Kraft. Das mit Metall verstärkte Holz war über vier Fuß hoch und wog um die dreißig Pfund. Seine Armmuskeln begannen bereits zu schmerzen.
Es wurde Zeit, zum Gegenangriff überzugehen.
Der Gladius war nur etwa zwei Fuß lang und hatte damit eine erheblich kürzere Reichweite als der Dreizack. Er musste an Demos herankommen, bevor dieser das Netz werfen konnte. Wenn er sich darin verhedderte, war es vorbei.
Er stürmte vor. Demos' Augen weiteten sich vor Überraschung, damit hatte er nicht gerechnet. Castor wollte ihn mit dem Schild rammen. Sein Gegner hatte sich schneller wieder gefasst, als ihm lieb war, und wich aus. Knapp erwischte er ihn an der geschützten Schulter. Zu wenig, um Demos zu Fall zu bringen.
Getragen von seinem eigenen Schwung, geriet Castor ins Straucheln. Die aufgeregten Schreie der Zuschauer wurden lauter. Sie spürten, dass sich eine Entscheidung anbahnte.
Im selben Augenblick, als er wieder festen Halt gewann, spürte Castor einen schneidenden Schmerz in seiner rechten Wade. Instinktiv sprang er zurück, was ihn vor Demos' nächster Attacke rettete. Haarscharf zischten die scharfen Zinken an ihm vorbei. Warm und klebrig rann das Blut über sein Bein und färbte den hellen Sand der Arena rot. Jetzt blieb ihm kaum noch Zeit. Je mehr Blut er verlor, desto schwächer wurde er. Demos musste nur abwarten.
Toller Versuch, dachte er und knirschte mit den Zähnen.
Demos hatte offenbar beschlossen, dass er nicht warten wollte, denn er setzte sich in Bewegung und rannte auf ihn zu. Castor versuchte, Netz und Dreizack gleichzeitig im Auge zu behalten. Jetzt warf Demos das Netz. Ein Schatten tauchte über ihm auf. Er riss den Schild hoch, spürte, wie es daran abglitt.
Darauf hatte Demos nur gewartet. Der Dreizack zuckte vor. Nur seine schnellen Reflexe retteten Castor davor, dass er regelrecht aufgespießt wurde. Ein helles Sirren ertönte, als die Zinken gegen den Gladius krachten und von der Klinge abgelenkt wurden. Die Wucht des Aufpralls riss Castor das Schwert aus der Hand. Die Waffe landete ein paar Schritte entfernt im Sand, unerreichbar für ihn.
Durch den Lärmteppich der Zuschauer hörte er Demos' Triumphschrei. Sofort setzte der nach. Castor wehrte den erneuten Stoß mit dem Dreizack mit dem Schild ab. Demos hatte diesen Angriff mit aller Kraft geführt, und er taumelte zurück, verhedderte sich in seinen eigenen Beinen und fiel auf den Rücken. Der Aufprall presste ihm die Luft aus den Lungen.
Schon war Demos über ihm, trat ihm den Schild aus den Händen und richtete den Dreizack auf seine Brust. Er spürte die Metallspitzen auf seiner Haut. Jetzt musste sein Gegner nur noch zustechen.
Stattdessen hob er den Kopf und sah zur kaiserlichen Loge hinüber.
Castor begriff. Der Kaiser sollte entscheiden. Ein Zeichen von ihm bedeutete den Unterschied zwischen Leben und Tod.
Durch das Visier sah er etwas neben sich im Sand liegen.
Das Netz.
Ein Blick nach oben. Demos war abgelenkt, starrte Richtung Kaiser.
Castors Finger gruben sich in das Netz. Mit der freien Hand packte er den hölzernen Schaft des Dreizacks, drückte ihn zur Seite. Demos wandte sich ihm zu, sichtlich irritiert über die unerwartete Gegenwehr. Mit aller Kraft schleuderte Castor das Netz. Demos ließ den Dreizack los und hob schützend die Arme. Zu spät. Das Netz traf ihn am Oberkörper, hüllte ihn sofort ein. Castor trat zu, erwischte ihn mit voller Wucht am Knie. Mit einem Schmerzensschrei brach Demos zusammen.
Er rappelte sich auf, sprang vor und richtete den Dreizack auf das sich windende Paket im Sand. Als sein Gegner das Metall spürte, hielt er still.
Ein düsteres Lächeln umspielte Castors Lippen. Zu früh gefreut, mein Freund , dachte er. Während er Demos den Dreizack an die Kehle hielt, nagelte er ihn gleichzeitig mit einem Fuß am Boden fest. Jetzt war es an ihm, zum Kaiser zu blicken.
Er drehte den Kopf. Der Kaiser hatte sich von seinem Platz erhoben. Castor hatte Nero noch nie aus der Nähe gesehen, und auch jetzt war er zu weit entfernt, als dass er die Gesichtszüge hätte erkennen können.
Er spürte, wie ihn der Blutverlust mit jedem Moment weiter schwächte. Beeil dich , dachte er.
Als hätte er ihn gehört, gab Nero das Zeichen. Leben. Die Gladiatoren hatten ihn gut unterhalten, und auf diese Weise honorierte er das. Die Zuschauer quittierten die Entscheidung mit einem ohrenbetäubenden Jubel.
Castor warf den Dreizack in den Sand. Demos' Lippen bewegten sich. Durch den tosenden Lärm konnte er die Worte nicht verstehen. Dem giftigen Blick nach, den der Retarius ihm dabei zuwarf, handelte es sich nicht um eine Gratulation zum Sieg.
Immer noch floss das Blut aus der Wunde. Er fühlte sich schwach, begann zu taumeln. Dann wurde ihm schwarz vor Augen. Als er auf dem Sand aufschlug, hatte er bereits das Bewusstsein verloren.
†
Rodan spürte zwar den warmen Stein auf seiner Haut, doch es bedeutete ihm nichts. Genauso gut hätte er auf einem Eisblock liegen können. Heiß oder kalt, es machte für ihn keinen Unterschied. Er hatte die Therme auch nicht aufgesucht, um sich zu entspannen – tatsächlich war ihm das menschliche Bedürfnis nach Ruhe und Zerstreuung fremd.
Er hatte gefühlt, dass sie heute hier war. Die Frau, nach der er nun schon seit Tagen suchte. Wie sie aussah, wusste er nicht, und ebenso wenig kannte er ihren Namen, doch er nahm ihre Anwesenheit wahr. So intensiv, als stünde sie direkt vor ihm. Sie war nicht mehr fern.
Heute also würden sie aufeinandertreffen. Nicht mehr lange, und sie würde durch die Tür in den Raum treten, in dem er sich aufhielt. Er hatte dafür gesorgt, dass sie in diesem Teil der Therme allein waren. Keiner der anderen Besucher hätte es später begründen können, irgendetwas hielt sie davon ab, den von Öllampen nur notdürftig erleuchteten kleinen Raum mit den steinernen Ruhebänken und dem Wasserbecken zu betreten. Ein unsichtbarer Wächter, eine unheilvolle Präsenz, die ihnen trotz der angenehmen Temperaturen eine Gänsehaut über den Rücken trieb, wenn sie sich dem Bereich auch nur näherten.
Rodan schickte seinen Geist hinaus. Wie mit Spinnenfingern tastete er sich durch die belebten Straßen bis hinunter in die unterirdische Höhle, wo seine Getreuen voller Sehnsucht auf ihn warteten. Sie hatten heute noch nichts zu trinken bekommen und waren unruhig. Nun, sie würden noch ein wenig warten müssen.
Seine Stirn legte sich in Falten, als ihn die Erinnerung an sein Missgeschick von vor zwei Tagen heimsuchte. Diese kleine Schlampe Justina war ihm tatsächlich entkommen. Er hatte seinen Durst in jener Nacht an einer anderen gestillt. So etwas durfte ihm nicht noch einmal passieren. Es war unbedingt notwendig, dass er unentdeckt blieb. Die Menschen waren zwar schwach, doch ihre schiere Masse allein konnte ihm gefährlich werden. Sie durften ihn erst bemerken, wenn es bereits zu spät war. Vielleicht sollte er nach ihr suchen.
Das Platschen nackter Füße auf Marmor drang an seine Ohren und unterbrach seine trüben Gedanken. Seine Lippen verzogen sich zu einem düsteren Lächeln. Das war sie.
In diesem Augenblick erschien die Frau in der Tür. Sie war groß und schlank und hatte lange schwarze Haare, die ihr in seidigen Locken über die Schultern fielen. Ihre Haut wies die charakteristische vornehme Blässe einer Angehörigen der Oberschicht auf. Ihr Gesicht war ebenmäßig, mit großen, blauen Augen, vollen roten Lippen und einer schmalen Nase. Wie sie dort stand, wirkte sie wie ein Engel. Rodan wusste, dass sie alles andere als das war. Sein Blick gilt über ihren Körper. Volle Brüste, schlanke Hüften, lange, wohlgeformte Beine. Wie er war sie nackt.
Er spürte Verlangen in sich aufsteigen. Fleischliche Genüsse dieser Art gönnte er sich nur gelegentlich. Die körperliche Vereinigung war für ihn lediglich ein Vorspiel, bevor er seine Zähne in das Fleisch seiner unglücklichen Partnerin trieb. Das war das Einzige, das ihm tatsächlich Lust verschaffte.
Mit ihr könnte es anders werden.
Sie schenkte ihm ein verführerisches Lächeln, das er erwiderte. Mit einer lässigen Bewegung stieß sie sich vom steinernen Türrahmen ab und schritt auf ihn zu.
»Ist auf dieser Bank ein Platz frei?«, fragte sie. Für eine Frau hatte sie eine recht tiefe Stimme, was ihren Reiz noch steigerte.
»Dieser Platz ist frei, für eine wahre Schönheit wie dich«, entgegnete er.
In ihren Augen blitzte etwas auf. Sie setzte sich neben ihn, strich mit ihren Fingerspitzen über seine haarlose Brust. Die warme Luft hatte seine Haut aufgeheizt, sodass sie die Kühle, die von ihm ausging, nicht wahrnehmen konnte. Er spürte ein ziehendes Gefühl in seinen Lenden.
»Wer bist du, schöner Mann?«, hauchte sie.
»Ich bin Rodan. Und du?«
»Mein Name ist Delia.«
»Ich grüße dich, Delia. Du bist allein hier?«
Sie nickte. »Ich gönne mir die Stunden der Freiheit, um meinem Zuhause zu entfliehen.«
Ihre Hand verließ seine Brust und näherte sich seinem Bauch.
»Ist es denn ein Gefängnis, dein Zuhause?«
»Weniger ein Gefängnis, denn ein Hort der Langeweile. Mein Mann ist eine hochgestellte Persönlichkeit, und all sein Interesse gilt mehr seinem Amt denn seiner Frau. Und wenn er einmal bei mir liegt, ist es stets ein unerfreuliches Erlebnis. Er wälzt sich auf mich, quickt wie ein Schwein, und dann ist es auch schon zu Ende.«
»Du sprichst sehr offen, Delia. Ist es nicht unschicklich für die Frau eines Mannes, der ein hohes Amt bekleidet, sich ohne Begleitung in die Therme zu begeben?«
»Ich habe den Eindruck, dass du ein Mann bist, der Offenheit zu schätzen weiß.« Ihre Hand hatte jetzt seinen Nabel erreicht. »Und was heißt schon unschicklich in diesen Zeiten? Wenn selbst der Kaiser jede in sein Bett holt, die nicht bei drei auf dem Baum ist, warum sollte da eine unbedeutende Frau wie ich nicht Zerstreuung in den Armen eines fremden Mannes suchen dürfen?«
»Ich habe viel von eurem Kaiser gehört.«
»Unserem Kaiser? Ist er denn nicht auch der deine?«
»Ich bin mein eigener Kaiser. Niemand befiehlt mir.«
Kurz löste sich ihre Hand von seinem Körper, und sie wackelte vor seinen Augen mit dem Zeigefinger. »Deine Worte sind gefährlich. Neros Ohren sind überall, und wenn er vernähme, was du gerade gesagt hast, würde das nicht gut für dich enden. Hin und wieder treffe ich mit ihm zusammen. Höre auf das, was ich dir rate.«
Er nahm ihre Hand und führte sie zu seinem Unterleib.
»Wir sind allein. Du würdest mich doch nicht verraten?«
Ihr Gesicht näherte sich dem seinen. »Niemals«, hauchte sie, und dann presste sie ihre Lippen auf seinen Mund.
Als sie fertig waren, stand sie auf, nahm seine Hand und zog ihn hinter sich her in das Becken. Wie die Luft war das Wasser angenehm temperiert. Sie schwamm eine Runde, dann umarmte sie ihn, schlang ihre Beine um seine Hüften und schmiegte ihren Kopf an seine Brust.
»Das war außergewöhnlich, und wenn ich so etwas sage, hat es etwas zu bedeuten.« Sie kicherte. »Hin und wieder nehme ich Geld für meine Dienste, aber nicht von dir.«
»Du nimmst Geld? Hält dein Mann dich so kurz?«
»Oh nein, ich habe alles, was ich mir wünschen könnte. Es bereitet mir schlicht Vergnügen, wenn die Männer nach mir geifern, wenn ihre Finger immer tiefer in ihren Geldbeuteln versinken und sie bereit sind, beinahe alles zu zahlen, damit ich sie in meine Pforte einlasse.« Wieder kicherte sie.
»Ich könnte dir etwas geben, was mit Geld nicht zu bezahlen ist.«
»Was sollte das sein? Alles ist mit Geld zu bezahlen.«
Er nahm ihr Kinn zwischen Daumen und Zeigefinger und hob ihren Kopf an, sodass sie ihm in die Augen blickte. »Du täuschst dich, Delia. Ewiges Leben, vereint mit uneingeschränkter Macht, ist etwas, das niemand kaufen kann. Sämtliche Goldvorräte des Reiches würden dafür nicht ausreichen. Dies ist ein Gut, dass nur geschenkt werden kann.«
»Ewiges Leben?« Jetzt umspielte ein spöttisches Lächeln ihre Lippen. »Allein die Götter leben ewig.«
Sein Blick verfinsterte sich, als sie die verhassten Götter erwähnte. »Ja, sie leben ewig. Allmächtig sind sie nicht.«
»Du bist ein seltsamer Mann, Rodan.«
»Möchtest du dieses Geschenk annehmen?«, fragte er, ohne auf ihre Bemerkung einzugehen.
»Lieber möchte ich, dass du es mir noch einmal besorgst«, antwortete sie und krallte ihre Hände in seine Pobacken.
Rodan neigte den Kopf. Ihre Lippen öffneten sich, erwarteten seinen Kuss. Als er seine Zähne bleckte und sie die langen Hauer bemerkte, blitzte Furcht in ihren Augen auf. Sie versuchte sich loszureißen. Seine Finger wühlten sich in ihr Haar, fixierten ihren Kopf. Sie schrie auf, als sich seine Zähne in ihren Hals bohrten, schlug um sich, strampelte mit den Beinen. Das Wasser spritzte auf, während ihr Blut in seinen Rachen strömte. Schon bald wurden ihre Bewegungen langsamer, bis sie schließlich reglos in seinen Armen hing.
Er musste sich zwingen, aufzuhören, um sie nicht völlig auszusaugen. Wenn er das getan hätte, würde sie nicht mehr erwachen. Es musste ein Rest Blut in ihrem Körper verbleiben, damit sie sich mit seinem Keim infizieren konnte.
Blut strömte aus den zwei Löchern in ihrer Kehle und vermischte sich mit dem warmen Wasser. Er hielt sie weiter fest. Erfahrungsgemäß würde es nicht lange dauern, bis sie sich verwandelte, und er wollte, dass sie in seinen Armen die Augen aufschlug.
Die Zeit verrann. Schon fürchtete er, zu gierig gewesen zu sein, als sie sich zu regen begann. Erst war es nur ein kurzes Zucken mit den Fingern ihrer linken Hand unter Wasser. Erleichterung breitete sich in ihm aus. Dann endlich öffnete sie die Augen. Ihr Blick war nun kalt, der leidenschaftliche Ausdruck war verschwunden und hatte purer Bosheit Platz gemacht.
»Ich verstehe jetzt, was du gemeint hast«, sagte sie. »Und ich danke dir für dieses Geschenk.«
»Eine große Aufgabe liegt vor uns, Delia.«
»Ich werde an deiner Seite sein?«
»Ja, das wirst du. Zunächst musst du dich zurück nach Hause begeben. Höre meinen Plan.«
»Später.«
Sie presste ihre Lippen auf seinen Mund, und schon spürte er wieder das Ziehen unterhalb seiner Hüfte.
Diese Frau war wirklich außergewöhnlich.
†
»Castor Pollux?«
Castor öffnete die Augen. Neben seiner Pritsche stand ein Prätorianer, ein Gardist des Kaisers, unverkennbar an der schwarzen Rüstung. Der Mann mochte an die vierzig Jahre alt sein, tiefe Falten kerbten sein Gesicht. Eine rötliche Narbe verunzierte seine linke Wange, nicht unähnlich jener, welche Castor unter dem rechten Auge trug. Er hatte sie sich gleich bei seinem ersten Kampf in der Arena zugezogen. Die Spitze des gebogenen Kurzschwerts eines Thrakers hatte sich in seine Haut gegraben und eine immerwährende Erinnerung hinterlassen.
»Wer will das wissen?«, knurrte er. Er mochte die Prätorianer nicht, schon während seiner Zeit als Legionär hatte er wenig für sie übrig gehabt. Die Angehörigen der Garde hockten in Rom wie die Maden im Speck, wurden besser bezahlt, schliefen in bequemeren Unterkünften und zogen so gut wie nie in die Schlacht. Sie hielten sich für etwas Besseres, und das ließen sie jeden gewöhnlichen Legionär deutlich spüren.
»Der Kaiser«, antwortete der Prätorianer knapp. »Folge mir. Du wirst erwartet.«
Castor hob die Brauen. Mit dieser Nachricht hätte er am allerwenigsten gerechnet. Der Kaiser wollte ihn sehen? Ihn? Das konnte nur ein Irrtum sein.
»Bist du sicher, dass du den Richtigen gefunden hast? Ich kann mir nicht vorstellen, was der Kaiser mit mir bereden möchte.«
Der Prätorianer verdrehte genervt die Augen. »Bist du Castor Pollux?«
Er nickte.
»Dann steh auf und folge mir. Wenn ich es noch einmal sagen muss, schleife ich dich an den Haaren zum Palast.«
Castor warf einen Blick an dem Prätorianer vorbei. In der Tür standen mindestens zwei weitere Gardisten, vielleicht noch mehr von ihnen auf dem Flur. Es hatte keinen Sinn, sich zu widersetzen.
Mürrisch stand er auf, streifte sich die Tunika über und schlüpfte in seine Sandalen. Dabei warf er einen Blick auf den Verband um seine rechte Wade. Der Stoff war sauber, kein Blut zu sehen. Das war ein gutes Zeichen, es bedeutete, dass die Wunde zugeheilt war. Bald würde er ihn entfernen können, und damit wäre seine Auszeit von dem mit Training angefüllten Alltag im Ludus beendet. Dabei lag der Kampf mit Demos kaum zwei Wochen zurück. Ein Vorteil des Lebens hier war neben der regelmäßigen Verpflegung die erstklassige medizinische Versorgung.
»Hast du irgendwelche Habseligkeiten?«, schnarrte der Prätorianer.
Castor schüttelte den Kopf. »Nur das, was ich am Leib trage.«
»Gut. Dann komm.«
Castor trat auf den Flur. Dort hatten sich insgesamt vier Gardisten versammelt. Der Lanista Kajus, der Besitzer der Gladiatorenschule, stand neben einem von ihnen und nahm gerade ein Ledersäckchen entgegen. Castor hörte das Klirren von Münzen und runzelte die Stirn. Was ging hier vor?
Kajus, ein hagerer Mann mit dichtem weißem Haar und den Augen eines Wolfs, nickte ihm zu, um sich dann abzuwenden und mit ausladenden Schritten hinter der nächsten Biegung zu verschwinden. Das Nicken war Castor wie eine Geste des Abschieds vorgekommen.
»Los«, befahl der Prätorianer, der ihn aufgeweckt hatte.
Er selbst ging voraus, die anderen Gardisten nahmen Castor in die Mitte. Sie verließen den Trakt mit den Unterkünften und überquerten den Hof. Die Nachmittagssonne strahlte so hell, dass er mit der Hand die Augen abschirmen musste. Wie immer waren die Gladiatoren mit ihrem Training beschäftigt, bereiteten sich auf den nächsten Kampf vor, wobei sie Übungswaffen aus Holz benutzten. Angestrengtes Ächzen und Stöhnen und das Krachen von hölzernen Schwertern auf Schilde erfüllten die warme Luft. Er entdeckte Demos, der sich gerade mit einem Secutor unterhielt. Als sich ihre Blicke trafen, verzerrte sich sein Gesicht zu einer hasserfüllten Fratze.
Castor wusste, dass der Retarius es ihm übel nahm, dass er ihn um seinen Sieg gebracht hatte, indem er ihn mit seinem eigenen Netz übertölpelt hatte. Dies sei unfair und eines Gladiators nicht würdig gewesen, hatte Demos getobt. Nur mit Mühe hatten ihn die anderen davon abhalten können, sich auf Castor zu stürzen, als dieser auf einer Trage zurück in die Gladiatorenschule gebracht worden war. Demos fühlte sich in seiner Ehre gekränkt, und er war kein Mann, der das verzeihen konnte. Castor war sich darüber im Klaren, dass er sich an diesem Tag einen Todfeind geschaffen hatte.
Sie verließen die Schule und marschierten durch die Straßen in Richtung Palatin. Vorübereilende Passanten warfen ihnen verstohlene Blicke zu. Einige erkannten ihn und riefen ihm etwas zu. Eine stark geschminkte Frau in einem dunklen Gewand streckte ihm die Zunge heraus und bewegte sie hin und her, als wäre sie eine Schlange. Ein eindeutiges Zeichen dafür, was sie sich von ihm wünschte.
Castor schüttelte den Kopf. Das Leben eines Gladiators hatte viele Facetten. Wer tapfer kämpfte, konnte es zum Liebling der Massen bringen, bejubelt von den Männern und begehrt von den Frauen. Gleichzeitig nahmen die Gladiatoren in der gesellschaftlichen Hierarchie den niedrigsten Rang ein, noch unter den Sklaven. Im Ludus wurden sie gehegt und gepflegt, nur um in der Arena so lange aufeinander einzuschlagen, bis einer von ihnen im Sand lag. Sie waren Helden, Verachtete und Gebrauchsgegenstände gleichzeitig, ihr Wert wurde ausschließlich von ihrem Kampfesgeschick bestimmt.
Er hatte sich dieses Leben nicht ausgesucht, doch er hatte keine Wahl gehabt. Tod in der Arena oder kämpfen in der Arena, das waren seine Optionen gewesen. Er hatte sich für Letzteres entschieden. In dieser Hinsicht war er Demos gleich.
Sie hatten den Palatin erreicht. Vor ihnen erhob sich der Kaiserpalast. Castor war wie immer beeindruckt von dem prachtvollen Bau. Wie man sich erzählte, war das, was sich in diesen Tagen hinter den Mauern abspielte, weit weniger prachtvoll. Die Geschichten, die sich um frühere Kaiser wie Tiberius oder Caligula rankten, waren dazu geeignet, jeder Vestalin, den keuschen Priesterinnen der Göttin Vesta, die Schamesröte ins Gesicht zu treiben. Nero sprengte alle Grenzen.
Was wollte der Kaiser von ihm? Er fand keine Erklärung, und seine Brust wurde ihm eng, als er zwischen den Prätorianern die Treppe zum Palast hinaufschritt. Ob er das Gebäude lebend wieder verlassen würde? Nach allem, was er gehört hatte, konnte eine Audienz bei Nero höchst unerfreuliche Folgen für den Besucher nach sich ziehen.
Die Prätorianer, die den Zugang zum Palast bewachten, gaben anstandslos den Weg frei, als ihre kleine Gruppe am Ende der Treppe angekommen war. Sie durchschritten eine mit Marmor ausgelegte Halle, in der es nach der Hitze des Frühsommertags angenehm kühl war. Zwei ältere Männer, die sich angeregt miteinander unterhielten, kamen ihnen entgegen. Sie trugen weiße Togen, die sie kunstvoll um ihre Körper geschlungen hatten, und waren vermutlich Senatoren oder Ritter.
Sie bogen in einen Korridor ein, und Castor bestaunte die kunstvollen Mosaiken an den Wänden. Wenn schon der Flur so aussah, welche Pracht mochte dann erst in den kaiserlichen Räumen herrschen? Beinahe kam er sich vor, als sei er in eine andere Welt eingetaucht. Draußen das lärmende Rom mit seinen engen Straßen, dem allgegenwärtigen Gestank menschlicher Ausdünstungen, dem Geschrei und dem Lärm und der Hitze. Hier drinnen Ruhe und Reichtum, dazu eine angenehm temperierte Luft, die nach Veilchen statt nach Unrat roch.
Vor einer mächtigen Holztür, die rechts und links von zwei weiteren Gardisten flankiert wurde, hielten sie an. Der Anführer drehte sich zu ihm um. »Du redest nur, wenn der Kaiser dich anspricht. Du antwortest auf seine Fragen und verzichtest auf ausschweifende Erklärungen. Nero langweilt sich schnell, und wenn er sich langweilt, kommt er manchmal auf Ideen, die ... sehr interessant sein können. Verstehst du, was ich dir sagen will?«
Castor nickte.
Der Prätorianer wandte sich den Türwächtern zu. »Öffnet.«
Mit einem Ächzen zog einer der Männer einen der Türflügel auf. Sie schlüpften durch die Öffnung.
Unwillkürlich hielt Castor den Atem an. Der Saal war kleiner, als er erwartet hatte. Unübersehbar war, dass es sich um einen Hort der Macht handelte. Er sah weißen und schwarzen Marmor, edle Teppiche bedeckten den Boden, Dutzende Öllampen tauchten den Raum in ein warmes Licht. Links und rechts standen mehrere Prätorianer an der Wand aufgereiht, das Kinn erhoben, die Augen geradeaus gerichtet, wie lebende Statuen. Am Kopfende befand sich ein Podium, das sich über die gesamte Breite erstreckte und über drei flache Stufen zu erreichen war. Darauf hatte sich eine bunte Schar aus vielleicht zwei Dutzend Männern und Frauen um einen Mann versammelt, der in lässiger Pose auf einem mit Tierfellen ausgelegten Thron aus Marmor saß. Das musste Nero sein.
Alle Augen richteten sich auf Castor. Er war es von den Kämpfen im Circus Maximus gewohnt, begafft zu werden. In der Arena pflegten die Zuschauer für ihn zu einer gesichtslosen, infernalisch lauten Masse zu verschmelzen. Hier war es anders. Er sah Frauen, die in durchsichtige schwarze Gewänder gekleidet waren, die Augen dick mit Ruß umrandet, sodass sie wie Albtraumgestalten wirkten. Einer standen die Kopfhaare ab wie die Stacheln eines Igels, was den schaurigen Eindruck noch verstärkte. Zwei junge Burschen waren bis auf einen Lendenschurz nackt und bedachten Castor mit einem lüsternen Blick.
Direkt hinter dem Kaiser standen vier hochgewachsene Männer, die alle anderen Anwesenden um beinahe einen Kopf überragten. Ihre Körper waren muskulös, ihre blonden Haare fielen ihnen auf die Schultern, die langen Bärte reichten ihnen bis auf die Brust. An ihren Hüften baumelten Langschwerter. Das mussten Angehörige der germanischen Leibgarde sein, die Nero zu seinem persönlichen Schutz unterhielt.
Der Kaiser selbst wirkte beinahe unauffällig. Er war nicht besonders groß und trug eine weiße Toga, deren Ränder mit Gold besäumt waren, über seinen Schultern lag ein purpurfarbener Mantel. Die kurzen Haare waren nach römischer Art in Wellen gelegt, das Gesicht war breit und erinnerte Castor an einen Teigfladen mit Nase, die Ohren standen ein wenig ab. Nero fixierte ihn aus flackernden Augen, wobei er den Kopf so weit geneigt hielt, dass er trotz des Höhenunterschieds zwischen ihnen nach oben schauen musste. Eine Mischung aus Neugier, Skepsis und Verachtung lag in seinem Blick.
»Das ist er also?« Die Stimme des Kaisers war hoch, beinahe weibisch.
Der Prätorianer trat einen Schritt vor. »Ja, Herr, dieser Mann ist Castor Pollux.«
»Gut«, erwiderte Nero. »Lasst uns allein.«
Die Gardisten, die ihn hergebracht hatten, drehten sich auf dem Absatz um und eilten aus dem Saal, gefolgt von ihren Kameraden. Auch die Männer und Frauen auf dem Podium beeilten sich, dem Befehl des Kaisers nachzukommen. Einer der Burschen im Lendenschurz zwinkerte Castor zu, als er an ihm vorbeiging.
»Ich auch, mein Lieber?« Das war die Frau mit den Stachelhaaren. Sie hatte das Podium noch nicht verlassen. Sie und ein älterer Mann in einer weißen Toga, der sich am äußersten linken Rand postiert hatte.
»Auch du, Cassia. Es tut mir leid, es gibt Geheimnisse, die ich nicht einmal deinen hübsch geformten Ohren anvertrauen kann.«
Das war also Cassia, Neros geheimnisvolle Muse. Castor hatte schon von ihr gehört.
Die Frau zog einen Schmollmund. Im Hinausgehen bedachte sie Castor mit einem verheißungsvollen Blick, was ihm aufgrund der Geschichten, die über sie kursierten, eine Gänsehaut über den Rücken trieb. Mit einem lauten Krachen fiel die Tür hinter ihr zu.
Für eine Weile herrschte Schweigen. Neros Blick schien sich förmlich an ihm festgesaugt zu haben. So musste sich jemand fühlen, der in der Arena ohne Waffen einem Raubtier gegenüberstand. Trotz der Kühle bildete sich ein dünner Schweißfilm auf Castors Stirn. Der Mann in der Toga fixierte ihn ebenfalls. Er strahlte Ruhe und Gelassenheit aus.
Nero erhob sich, trat auf ihn zu und umrundete ihn, wobei er seinen Blick nicht einen Moment von ihm abwendete.
»So sieht er also aus, der neue Bezwinger der Finsteren.«
Nur mit Mühe konnte Castor verhindern, dass er zusammenzuckte. Der Kaiser stand hinter ihm und hatte ihm die Worte direkt ins Ohr gesprochen. Nero gab einen enttäuschten Laut von sich. Offenbar hatte er erwartet, dass sich Castor erschrecken würde.
»Ja, mein Kaiser, das ist er.« Der Mann mit der Toga hatte zum ersten Mal das Wort ergriffen. Er war hochgewachsen und wohlgenährt, aber nicht dick. Seine Gesichtszüge waren streng, doch etwas Gütiges ging von ihm aus. Er trug einen kurzen, grauen Bart. »Er ist Aurel wie aus dem Gesicht geschnitten.«
Aurel? Meinte er seinen Vater? Castor hatte ihn nie kennengelernt. Kurz nach seiner Geburt war er bei einer Schlacht in Germanien ums Leben gekommen. So hatte es ihm seine Mutter Laurentia erzählt, die in seinem fünften Lebensjahr an einer Krankheit gestorben war. Nach ihrem Tod war Castor auf dem Landgut seines Onkels Nilus und seiner Tante Balbina, seinen einzigen noch lebenden Verwandten, vor den Toren Roms aufgewachsen.
Nero baute sich vor ihm auf. Ihre Gesichter waren weniger als einen Fuß voneinander entfernt. Der Atem des Kaisers roch säuerlich.
»Du hast große Schuld auf dich geladen. Was hast du dazu zu sagen?«
Castor musste nicht lange darüber nachdenken, worauf Nero anspielte. »Herr, ich war es nicht, der Zenturio Maurus erschlagen hat.«
»Deine Kameraden waren da anderer Meinung. Sie haben dich schwer belastet.«
»Sie haben Optio Lomikus unterstützt, weil sie Maurus hassten, der ihnen nichts hat durchgehen lassen. Das Contubernium war vollkommen im Arsch und ...«
»Du vergisst dich«, kreischte Nero.
Diesmal konnte er nicht verhindern, dass er zusammenzuckte.
»Du stellst die Integrität deiner Kameraden infrage«, fuhr der Kaiser mit schriller Stimme fort. »Ihr lebtet in einem Zelt, habt Seite an Seite gegen die Barbaren gekämpft, und du sagst, eure Zeltgemeinschaft sei im Arsch gewesen?«
»Herr, sie hatten vergessen, wofür sie eigentlich kämpften. Sie taten es nur noch für sich, nicht mehr für Rom.«
Nero starrte ihn an. Castors Herz sank in seiner Brust. Es konnte tödlich sein, dem Kaiser zu widersprechen. So viel hatte er verloren, er war nicht gewillt, auch noch seine Ehre zu verlieren, indem er die Lüge unwidersprochen ließ. Er hatte Lomikus gemeldet, weil er gegen jeden Befehl bei einer Strafexpedition ein germanisches Mädchen vergewaltigt und getötet hatte. Lomikus hatte daraufhin Maurus ermordet, bevor dieser die Nachricht an den Primus Pilus, den obersten Zenturio ihrer Legion, weitergeben konnte. Anschließend hatte er Castor den Mord in die Sandalen geschoben, mit tatkräftiger Unterstützung seiner Kameraden, diesem aufeinandergestapelten Haufen Scheiße. Dass man ihm die Wahl gelassen hatte, sofort zu sterben oder sich als Gladiator zu verdingen, war ihm wie ein Wunder vorgekommen. Normalerweise wurde man für ein solches Verbrechen umgehend hingerichtet.
Wollte Nero das Urteil revidieren?
»Mein Kaiser, lasst die alten Geschichten ruhen.« Der Mann in der Toga kam die Stufen hinab und gesellte sich zu ihnen. »Es ist jetzt wichtiger, an die Gegenwart zu denken.«
Nero wandte seinen Blick ab, woraufhin Castor innerlich aufatmete.
»Du hast recht, Senator Urbanus«, gestand er ein. »Was soll uns ein armseliger Zenturio kümmern, wo das Schicksal des Reichs auf dem Spiel steht.«
Er ging zu seinem Thron und begann an dem Fell zu nesteln. Aus den Augenwinkeln bemerkte Castor, dass Urbanus ihn anlächelte. Als Nero zurückkehrte, hielt er einen Ring in seiner Hand.
»Nimm ihn«, befahl er.
Castor streckte die Hand aus. Der Kaiser legte ihm den Ring auf die Handfläche. Das Schmuckstück war aus Gold gefertigt und mit einem Siegel bestückt.
»Steck ihn an.«
Vorsichtig steckte er den Ring an einen Finger seiner linken Hand.
»Du trägst nun die Insignien des Kaisers«, klärte Nero ihn auf. »Wohin immer deine Mission dich führt, zeige den Ring vor, und man wird erkennen, dass ich es bin, der dich gesandt hat. Nur bei den Barbaren solltest du das vielleicht vermeiden, es wäre für sie wie ein Einladungsschreiben, dir die Haut abzuziehen. Bei lebendigem Leib, versteht sich.«
Er wandte sich ab und nahm mit einem Ächzen auf seinem Thron Platz. »Castor Pollux, ab heute bist du der Bezwinger der Finsteren, so wie dein Vater Aurel es gewesen ist, der treu in den Diensten Roms stand bis zu seinem Tod.«
Castor vermied es, die Stirn zu runzeln, um nicht erneut Neros Zorn zu entfachen. Schon wieder dieser Begriff. Bezwinger der Finsteren.
»Ich kann mir denken, dass du jetzt tausend Fragen hast. Urbanus, erkläre du es ihm, ich fühle mich ein wenig erschöpft.«
Nero lehnte den Kopf zurück und schloss halb die Augen.
»Castor, die Welt, in der wir uns befinden, ist nicht die einzige, die existiert«, begann Urbanus. »Damit meine ich nicht die Welt der Götter. Ich spreche von einem dunklen, schrecklichen Ort, an dem sich unsere Albträume versammelt haben. Kreaturen des Bösen, Diener des Unheils, Schattenwesen, die des Nachts durch unsere Straßen kriechen und mit ihren Klauen nach uns greifen. Ihr Ziel ist es, Tod, Leid und unfassbares Unheil über uns zu bringen, um uns dereinst zu beherrschen. Das allein ist der Grund, warum sie existieren. Wir nennen sie die Finsteren.«
Castor erwiderte nichts.
»Es existiert ein Tor zwischen ihrer Welt und der unseren«, fuhr Urbanus fort. »Du darfst es dir nicht wie das Tor zu einer Festung oder zu einem Lager vorstellen. Es ist mehr wie ein Riss zwischen den Welten. Niemand weiß, wo er sich befindet. Vor siebenundzwanzig Jahren, im Jahr deiner Geburt, gelang es deinem Vater, diesen Riss zu schließen. Unsere Welt und die Menschen darin waren in Sicherheit.«
Castor wusste nicht viel von seinem Vater, außer dass er ein Mann von hohem Ansehen und ein guter Kämpfer gewesen war, der es bis zum Zenturio gebracht hatte. So jedenfalls hatten es ihm seine Tante und sein Onkel erzählt.
Von den Finsteren hatten sie nie etwas erwähnt.
»Ich weiß, was du dich jetzt fragst«, schien Urbanus seine Gedanken zu erraten. »Deine Verwandten kennen nicht die ganze Wahrheit. Dein Vater gehörte nicht der regulären Armee an, das ist nur die offizielle Version. Er war im Auftrag von Kaiser Tiberius unterwegs, so wie du nun von Kaiser Nero entsendet wirst. Denn der Riss scheint sich wieder geöffnet zu haben. Es gab Zeichen. Du erinnerst dich an das Unwetter vor vier Wochen?«
Ja, er erinnerte sich. Das Gewitter hatte volle drei Tage lang getobt, Dutzende Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Selbst tagsüber war der Himmel nachtschwarz gewesen.
»Dieses Gewitter war kein gewöhnliches, und es war nur eines von vielen Omen. Und nun diese Morde ... Alles spricht dafür, dass eingetreten ist, was ich immer befürchtet hatte. Du musst die Aufgabe deines Vaters fortführen. Dies, Castor, ist deine Bestimmung. Ich habe dich all die Jahre beobachten lassen. Nun ist die Zeit gekommen.«
Welche Morde? Ihm wurde leicht schwindelig. Von einem Moment auf den anderen schien sein Leben auf dem Kopf zu stehen. Ein Riss zwischen den Welten? Eine Bestimmung? Waren sie alle verrückt geworden?
»Ich weiß, wie sich das in deinen Ohren anhören muss«, räumte Urbanus ein. »Heute Abend werde ich dich ausführlich instruieren. Du wirst die nächste Zeit bei mir wohnen, bis wir etwas Eigenes für dich gefunden haben.«
Nero öffnete die Augen und setzte sich auf. »Urbanus ist die Verbindung zwischen mir und dir. Aus seinem Mund wirst du meine Worte hören. Du erstattest ihm Bericht, als ob du mir Bericht erstatten würdest. Ist das klar?«
Castor nickte mechanisch.
»Dann eines noch. Du wirst zu niemandem ein Wort über diese Angelegenheit verlieren, es sei denn, es ist für die Erfüllung deiner Mission unerlässlich. Das Volk darf von dieser Bedrohung nichts erfahren, niemals. Es würde sie in Panik versetzen, und damit würden wir den Finsteren nur in die Hände spielen. Hast du das verstanden?«
Wieder nickte er.
»Gut«, sagte Urbanus und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Wir sind dann fertig. Draußen wartet ein Sklave auf dich. Er wird dich zu meinem Haus führen, dir dein Zimmer zeigen und dir etwas Anständiges zum Anziehen geben. Diese Tunika ist ... Nun ja, sie riecht ein wenig streng. Du kannst jetzt gehen.«
Castor nickte ein drittes Mal, dann drehte er sich um. Wie auf ein geheimes Kommando wurde von draußen die Tür geöffnet. Mit weichen Knien verließ er den Thronsaal.
†
»Das sind sie also.«
Delia ließ ihre Blicke über die Wogen der Wesen schweifen. Fasziniert beobachtete sie, wie sie langsam auf sie zukrochen, wobei sie stetig darum rangelten, die vorderen Plätze zu erobern.
Rodan, der sich ein Stück neben Delia postiert hatte, war zufrieden. Seine Bemühungen der vergangenen Tage zeigten erste Früchte, die Verfassung von vielen seiner Getreuen hatte sich deutlich verbessert. Die ersten konnten sogar schon wieder aufrecht gehen. Obwohl sie alle hungrig waren, hielten sich die Stärkeren zurück, ließen jenen den Vortritt, die bislang am wenigsten oder noch gar nichts getrunken hatten.
Das Mädchen, das über seiner Schulter lag, begann sich zu regen. Er lächelte. Er hatte es Delia überlassen, sie zu überwältigen, und sie hatte die Aufgabe mit Bravour erledigt. Es waren erst einige Stunden vergangen, seit sie sich verwandelt hatte. Es schien ihm, als habe sie schon immer zu ihm gehört.
»Sie kommt zu sich«, sprach er in die Dunkelheit.
Delia wandte sich ihm zu. Ihre Augen glühten in einem tiefen Rot. »Gib sie mir.«
Er packte das Mädchen am Halsausschnitt seiner Tunika und reichte es Delia, die es so mühelos entgegennahm, als handele es sich um einen Apfel oder eine Handvoll Trauben. Dann stellte sie die junge Frau auf die Füße und hielt sie an den Schultern fest, damit sie nicht zusammenbrach. Rodan bemerkte, dass ihre Lider flatterten. Sie machte die Augen auf.
»Wo bin ich?« Ihre Stimme, hell, kraftlos, voller Angst.
»Bleib ganz ruhig, meine Liebe«, sagte Delia.
Sie zuckte zusammen, denn in der Finsternis konnte sie Delia nicht sehen.
»Wer bist du?«
Eine der Kreaturen war nahe herangekrochen, ihre Klauen strichen über Delias Knöchel. Sie holte aus und trat ihr so hart ins Gesicht, dass sie zurückgeschleudert wurde und zwischen den Wogen der anderen Blutsauger versank.
Gut , dachte Rodan. Sie zeigt ihnen, wer das Sagen hat.
»Hab keine Furcht«, flüsterte Delia der Frau zu. »Es ist gleich vorbei.« Dann versetzte sie ihr einen brutalen Stoß in den Rücken, sodass sie nach vorne taumelte und mit dem Gesicht voraus auf den Boden stürzte. Genau zwischen die Kreaturen.
Es vergingen nur wenige Augenblicke, bis ihre Schreie verebbten.
»Ich spüre etwas. Es ist unangenehm«, sagte Delia, während sie zusah, wie die Wesen ihrem Opfer gierig das Blut aussaugten. Ihr Schlürfen und Schmatzen erfüllten die Dunkelheit. Ein metallischer Geruch lag in der stickigen Luft.
»Das ist der Hunger«, erläuterte ihr Rodan. »Auch du musst trinken. Sorge dich nicht, deine erste Mahlzeit ist nicht mehr fern.«
»Dein Plan, wie lautet er?«
Rodan trat zu ihr und strich ihr übers Haar. Wie gut es sich unter seinen kalten Fingern anfühlte.
»Wir können die Menschen nicht alle auf einmal angreifen, deshalb werden wir sie unterwandern. Wir werden jene, die sie führen, zu unseresgleichen machen. Die, die sich Senatoren nennen, und schließlich den Kaiser selbst. Wenn unsere kleine Armee hier unten wieder bei Kräften ist, lassen wir sie heraus. Meine Diener werden sich auf die Menschen stürzen, und diese werden sich in ihrer Panik an jene wenden, die ihnen befehlen. Die wahren Herren sind dann längst wir, und wir werden sie ins Verderben führen. Rom wird brennen, und das ist nur der Anfang. Die Legionen werden das Reich ein zweites Mal erobern, und die Standarten, die sie mit sich tragen, werden uns geweiht sein. Blut wird die Straßen tränken, die Toten auf den Schlachtfeldern werden sich erheben und sich uns anschließen, auf dass wir diese Welt endgültig beherrschen.«
Delia lachte auf. »Das hört sich gut an. Sehr gut.« Sie wandte sich von den Wesen ab, die gerade die letzten Tropfen aus dem Körper des Mädchens heraussaugten. »Und du wirst König sein?«
»Ich werde der Repräsentant des Bösen sein, der auf Erden wandelt. Selbst die Götter werden vor uns zittern, wenn unsere Triumphschreie ihre Ohren erreichen und sie endlich unsere wahre Macht erkennen.«
»Bin ich deine Königin oder nur eine Figur in deinem Plan, die du nach Belieben auf die Position schiebst, auf der sie dir am nützlichsten ist?«
Für einen Moment schwieg er. »Du wirst meine Königin«, antwortete er dann mit fester Stimme.
Delia stieß einen zufriedenen Laut aus. »Sag mir, Rodan, warum hast du gerade mich gewählt?«
»Du hast Zugang zum Palast. Du wirst alles ins Rollen bringen.«
Sie kicherte. »Nur deswegen?«
»Deine Seele ist dunkel, Delia. Schon als Mensch warst du verdorben, heimtückisch und skrupellos, auch gerissen. Bereit, alles an dich zu reißen, gleichzeitig klug genug, um im richtigen Moment zurückzustecken. Denk nur an deinen Mann.«
»Marcus?«
»Du verachtest ihn, und dennoch bist du bei ihm geblieben. Weil es seine Gnade war, die dir dein privilegiertes Leben erst ermöglichte. Nur deshalb gabst du dich ihm hin. Um es gleichzeitig hinter seinem Rücken mit so vielen Männern zu treiben, wie dir in die Fänge gerieten. Männer, die dir hörig sind und die alles für dich tun würden.«
»Es gibt viele Frauen, die so sind wie ich. Zumindest hier in Rom.«
»Du bist perfekt. Ich habe deine Aura gespürt und wusste sofort: Das ist sie. Du bist eine Kriegerin, genau wie ich.«
Als sie lächelte, entblößte sie ihre frischen Eckzähne. »Das ist wirklich alles?«
Ihre Hand fuhr unter sein Gewand. Ein leises Stöhnen entrang sich seiner Brust. Delia veränderte alles. Niemals zuvor hatte er eine solche Begierde nach einem anderen Wesen verspürt, obwohl er schon seit Jahrhunderten existierte. Sie war vollkommener, als er es zu hoffen gewagt hatte.
»Du bist die Schwärze selbst«, flüsterte er, dann packte er sie und riss ihr das Gewand vom Leib. Sein Mund verschmolz mit dem ihren. Sie sanken in die Knie. Als sie sich über die feuchte Erde wälzten, gruben sich ihre Fingernägel in seinen Rücken und hinterließen tiefe Furchen, die sich kurz darauf wieder schlossen.
Die Kreaturen hatten ihr Mahl beendet und sahen ihnen zu.
†