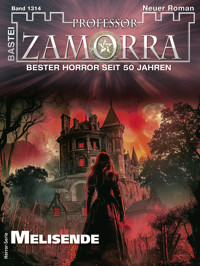2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Castor Pollux
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrtausenden ruhte er in undurchdringlicher Dunkelheit. Geschaffen, um zu vernichten, war er von seinen Schöpfern in einen tiefen Schlaf versetzt worden, ohne auch nur einem einzigen Feind gegenübergetreten zu sein. Doch er verspürte deshalb keinen Gram, keine Enttäuschung. Denn er war nur ein Werkzeug ohne eigenen Willen. Er existierte allein zu dem Zweck, den Befehlen seiner Götter zu gehorchen und ihnen zu dienen.
Der Zerstörer kannte weder Furcht noch Flucht - und keine Gnade. Er war der ultimative Krieger. Und schon bald würde er erwachen, um zu tun, was seine Bestimmung war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Tod aller Finsteren
Schusswort
Fußnoten
Impressum
Tod aller Finsteren
von Michael Schauer
Seit Jahrtausenden ruhte er in undurchdringlicher Dunkelheit. Geschaffen, um zu vernichten, war er von seinen Schöpfern in einen tiefen Schlaf versetzt worden, ohne auch nur einem einzigen Feind gegenübergetreten zu sein. Doch er verspürte deshalb keinen Gram, keine Enttäuschung. Denn er war nur ein Werkzeug ohne eigenen Willen. Er existierte allein zu dem Zweck, den Befehlen seiner Götter zu gehorchen und ihnen zu dienen.
Der Zerstörer kannte weder Furcht noch Flucht – und keine Gnade. Er war der ultimative Krieger. Und schon bald würde er erwachen, um zu tun, was seine Bestimmung war.
WIE WAR´S WIRKLICH?
Dieser Band spielt zu großen Teilen in einer anderen Welt und muss deshalb weitgehend ohne historische Bezüge auskommen. Trotzdem gibt es einige Begriffe und Anspielungen, die es sich zu erläutern lohnt.
In einem der Wälder fallen Castor und Salma seltsame stachelartige Gebilde auf, die an Ästen hängen und die sie beide an römische Krähenfüße erinnern. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine besonders auffällige Deformation, sondern um sogenannte Fußangeln aus Metall. Sie verfügten über vier scharfe Spitzen und waren so konstruiert, dass immer eine Spitze nach oben zeigte, wenn sie auf den Boden geworfen wurden. Eine simple, aber sehr effektive Verteidigung gegen heranstürmende Feinde. Wer schon einmal auf einen Reißnagel getreten ist, mag annähernd die Schmerzen des Unglücklichen nachempfinden, dem sich eine solche Fußangel in die Sohle bohrte.
Zweimal wird im Kontext einer Schlacht eine Testudo erwähnt. Dabei handelte es sich um die sogenannte Schildkrötenformation der römischen Armee, bei der sich ein Trupp Legionäre auf allen Seiten mit seinen Schilden gegen feindlichen Beschuss abschirmte. Die Kameraden in der Mitte hielten dabei ihre Schilde über die Köpfe. Es muss ein beeindruckender und – aus der Sicht der Gegner – ebenso beunruhigender Anblick gewesen sein, wenn sich eine solche Testudo näherte.
In den Gesprächen mit Urbanus erwähnt Nero, dass er mit einer Griechenlandreise liebäugelt, die Stadt aber nicht für längere Zeit verlassen will, bevor die Finsteren besiegt sind. Tatsächlich brach er im Sommer 66 nach Griechenland auf und kehrte erst sechzehn Monate später nach Italien zurück. Damit der Kaiser an den olympischen Spielen teilnehmen konnte, wurden diese extra seinetwegen um zwei Jahre verschoben. Von wem und wie die Regierungsgeschäfte in seiner Abwesenheit geregelt wurden, ist nicht überliefert.
Angesichts der Schreckensgestalten über dem Himmel Roms zieht Nero kurzzeitig einen Selbstmord in Erwägung, von dem ihn Urbanus jedoch abbringen kann. Der vom Künstlertum bekanntlich begeisterte Nero äußert daraufhin, dass mit ihm ja auch ein großer Künstler zugrunde gehen würde. Diesen Satz soll er sinngemäß tatsächlich gesagt haben, und zwar 68 n. Chr., als er endgültig jeden Rückhalt verloren hatte und auf ein Landgut fliehen musste. Es war klar, dass er nicht lebend davonkommen würde, denn die Prätorianer waren ihm auf den Fersen. Selbstmord galt als ehrenvolle Alternative zu Ermordung oder Hinrichtung, und so ließ er sich nach langem Hadern von einem seiner Begleiter einen Dolch in den Hals stoßen. Seine letzten Worte lauteten angeblich: »Welch ein Künstler geht mit mir zugrunde.«
Michael Schauer
Tod aller Finsteren
Das gurgelnde Stöhnen, das aus dem See der vergessenen Seelen drang und die Halle erfüllte, klang lauter und vielstimmiger als gewöhnlich. Fast kam es Bonifazius vor, als könnten die Verdammten den Beginn des Rituals kaum erwarten. Dutzende bleiche Hände durchbrachen die blutrote Oberfläche des Sees. Klauenartige Finger öffneten und schlossen sich, versuchten nach etwas zu greifen, das nur ihre Besitzer sahen.
Ein dünnes, freudloses Lächeln umspielte die zernarbten Lippen des Obersten der Richter. Jeder der Unglücklichen dort unten hatte einst von ihm sein Urteil entgegengenommen. Im See der vergessenen Seelen zu landen, war in der Welt der Finsteren die härteste aller Strafen und wurde vor allem für Versagen und Ungehorsam verhängt. Dort sein weiteres Dasein zu fristen, war trostlos, schmerzhaft und währte ewig.
Die Erweckung des Zerstörers stellte für die Verdammten ihre einzige Chance dar, diesem Elend zu entkommen. Ihre Energie würde ihn aus seinem langen Schlaf reißen, und sie würden in seiner gewaltigen Hülle weiterexistieren, damit er seine Kraft aus ihnen speiste. Es war ihre neue und zugleich letzte Aufgabe, die nur mit seiner Vernichtung enden konnte.
Wozu es nie kommen würde. Denn dafür war der Zerstörer zu mächtig.
Bonifazius bemerkte eine Bewegung unterhalb der Empore, auf der die vier anderen Richter und er sich versammelt hatten. Fünf Gestalten hatten die Halle betreten und näherten sich über den schmalen Pfad entlang des Sees. An ihrer gelben Haut und den roten Gewändern erkannte er vier von ihnen als Jägerinnen. Zwei gingen voraus, gefolgt von einem schwarz gekleideten Mann mit eisgrauem Haar, das ihm bis auf die Schultern fiel. Die beiden anderen hinter ihm hielten ihre Speere auf ihn gerichtet.
Sie hatten Marton gefangen genommen.
Allein die Tatsache, dass ihnen das nach so kurzer Zeit gelungen war, stellte in Bonifazius’ Augen einen Beweis für das Unvermögen des Druiden dar. Wie lange dagegen waren Taschs Kriegerinnen schon hinter Cassia her? Obwohl sie über weit weniger Macht verfügte als Marton, war sie stets aufs Neue entkommen und hatte viele von ihnen vernichten können.
Wahrlich, Elat hatte seine Wahl gut getroffen.
Als die kleine Gruppe die Plattform unterhalb der Empore erreicht hatte, blieb sie stehen. Bonifazius beugte sich über die Brüstung. Marton hatte den Kopf in den Nacken gelegt und sah zu ihm herauf. Ein Ausdruck der Verbitterung lag auf seinem schmalen Gesicht mit den scharf geschnittenen Zügen.
»Ich dachte, wir seien Verbündete«, stieß er hervor. Bitterkeit lag in seiner Stimme. »Habe ich nicht für Ballurats Vernichtung gesorgt, wie du es gewünscht hast?«
»In der Tat, diese Ehre gebührt dir«, gestand Bonifazius freimütig ein. »Doch gleichzeitig hast du zugelassen, dass Moronor von Castor Pollux vernichtet wurde.* Und du hast nichts unternommen, um ihn daran zu hindern. Stattdessen hattest du dich abgesetzt, noch bevor es zum Kampf kam. Würde dich jemand dafür einen Feigling nennen, so könnte ich dem kaum widersprechen.«
Der Druide zuckte zusammen, erwiderte aber nichts.
Natürlich schweigt er, dachte Bonifazius. Weil er weiß, dass es die Wahrheit ist.
»Dessen ungeachtet war nicht ich es, der deine Ergreifung befohlen hat, sondern der von allen gepriesene Elat«, fuhr er fort. »Eine große Aufgabe steht dir bevor, bei der selbst du nicht versagen wirst.«
»Er will den Zerstörer erwecken«, zischte Marton. »Das halte ich für einen großen Fehler.«
Aufgeregtes Gemurmel brach unter den Richtern hinter Bonifazius aus. Mit einer beiläufigen Bewegung brachte er sie zum Schweigen, obgleich er ihre Empörung nachvollziehen konnte und sie auch teilte.
»Ich glaube nicht, dass es an dir ist, die Handlungen unserer Götter infrage zu stellen, Marton«, grollte er.
»Lass mich mit Elat sprechen«, verlangte der Gefangene. »Er muss einsehen, dass ich ihm lebend nützlicher bin als tot. Immerhin habe ich ihm all die Jahre treu …«
»Schweig!«, unterbrach ihn Bonifazius barsch. Niemand durfte wissen, dass der Druide in Wahrheit nicht Ballurat gedient hatte, wie jeder glaubte, sondern Elat selbst. Bei ihrer jüngsten Unterredung hatte dieser es als gescheitertes Experiment bezeichnet, sich mit einem Sterblichen eingelassen zu haben. Ein Experiment, von dem keiner erfahren sollte, was auch für die anderen Richter sowie für die Jägerinnen dort unten galt. »Dein Schicksal ist besiegelt. Zusammen mit den vergessenen Seelen wirst du dem Zerstörer neues Leben einhauchen, und dies für alle Zeiten.«
Der Ausdruck in Martons Miene veränderte sich. Sein Zorn verschwand und machte nackter Furcht Platz, wie Bonifazius in einer Mischung aus Verachtung und kalter Befriedigung feststellte. Mit einem Nicken in Richtung der Jägerinnen erteilte er ihnen einen stummen Befehl, woraufhin sie einen Schritt von dem Druiden zurücktraten.
Ein schrilles Pfeifen durchschnitt die Luft. Vier mit schwarzen Saugnäpfen bewehrte rote Tentakel schossen von der Hallendecke herab und auf Marton zu. Bevor er reagieren konnte, hatten sie ihn an Armen und Beinen gepackt und rissen ihn empor, bis er zehn Fuß über dem See schwebte. Sein Gesicht war der Oberfläche zugewandt. Die Tentakel waren stark genug, um ihn in Stücke zu reißen, doch war das weder ihre Absicht noch ihre Aufgabe.
Weitere Fangarme folgten und tauchten in den See ein, der gleich darauf zu brodeln begann. Gelblicher Dampf stieg empor und verteilte sich in der Halle. Die Tentakel, die den Druiden festhielten, pulsierten jetzt in einem schnellen Rhythmus. Fasziniert beobachtete Bonifazius, wie sich die Saugnäpfe in Martons Fleisch gruben. Ein grässlicher, schmerzerfüllter Schrei entrang sich dessen magerer Brust.
Das Stöhnen der vergessenen Seelen wurde lauter und steigerte sich zu einem kreischenden Crescendo, bevor es abrupt verstummte. Dann war nur noch ein Schmatzen und Schlürfen zu hören, das seinen Ursprung in den Tentakeln hatte. Marton hing schlaff in ihrem Griff und wimmerte vor sich hin. Seine Haut war viel bleicher als gewöhnlich.
Bonifazius wandte sich ab und verließ die Empore. Das Ritual benötigte Zeit und würde sich eine Weile hinziehen. Umso wichtiger war, dass es endlich begonnen hatte.
Die dunklen Götter würden zufrieden sein.
Rom,65n. Chr.
»Mir ist nicht wohl dabei«, sagte Florentina. Ein feuchter Schimmer lag auf ihren Augen. »Ich weiß, es ist nicht das erste Mal, dass du gehst, um gegen die Finsteren zu kämpfen, aber diesmal … Es fühlt sich …« Sie rang nach Worten. »… irgendwie anders an.«
Sanft legte Castor Pollux seine Hände auf ihre schmalen Schultern.
»Mit etwas Glück wird es das letzte Mal sein. Wenn wir den Riss finden, muss ich dich nie wieder verlassen. Dann liegt all das Unheil, das uns von Anfang an begleitet hat, endlich hinter uns.«
Er hatte gehofft, sie mit dieser Aussicht trösten zu können, doch anscheinend hatte er eher das Gegenteil erreicht. Eine Träne lief ihre Wange hinab, gefolgt von einer zweiten.
»Dein Vater hatte dieselbe Mission und ist nicht davon zurückgekehrt«, schluchzte sie.
»Ich weiß, aber ich werde wiederkommen, hörst du? Ich verspr…«
»Nein«, fiel sie ihm ins Wort. »Gib mir kein Versprechen, das du vielleicht nicht halten kannst. Auf eine gewisse Weise würde das meinen Schmerz nur vergrößern. Sag mir einfach, dass du alles dafür tun wirst, dass wir uns wiedersehen.«
»Das werde ich. Ich schwöre es bei den Göttern.«
Er beugte sich vor, küsste sie und hoffte inständig, dass es nicht das letzte Mal gewesen war.
Hinter ihm räusperte sich Kimon.
»Wenn wir heute noch in See stechen wollen, sollten wir allmählich aufbrechen«, mahnte er.
Castor nickte und löste sich von Florentina. Sein griechischer Freund sowie die beiden Veteranen Columbus und Kandidus und der junge Korse Petru standen auf der Straße vor der Villa und sahen ihn erwartungsvoll an. Flankiert wurden sie von der Gladiatorin Salma, die Kimons Schwert an ihrem Gürtel trug, sowie seiner Erzfeindin Cassia.
Letztere hatte die Nacht eingesperrt und bewacht in einer Kammer verbracht. Auch wenn sie bei ihrer bevorstehenden Mission Verbündete waren, hätte sich niemand damit wohlgefühlt, sie unter demselben Dach frei herumlaufen zu wissen. Cassia hatte keine Einwände erhoben und sich widerspruchslos einschließen lassen.
Castors Befürchtung, es könne zwischen Florentina und Salma zum Streit kommen, hatte sich zum Glück nicht bewahrheitet. Zwar hatte ihm seine Geliebte den Seitensprung mit der Nubierin verziehen, aber er glaubte kaum, dass sie ihn vergessen hatte. Trotzdem war ihr kein Wort der Eifersucht über die Lippen gekommen, als er ihr eröffnet hatte, dass Salma ihn mit den anderen nach Korsika begleiten würde. Dorthin, wo sich der Riss befand, auf den Petru zufällig gestoßen war.**
Urbanus tauchte hinter seiner Tochter auf. Die Miene des Senators mit dem kurzen grauen Bart war ernst.
»Kehre heil zurück, Castor«, bat er ihn. Und an seine Begleiter gerichtet, sagte er: »Das gilt für euch alle. Solltet ihr die Finsteren endgültig schlagen können, werde ich ein Fest ausrichten, wie es dieses Haus nie zuvor gesehen hat.«
»Da bin ich gerne dabei«, erwiderte Kimon und grinste, wenn auch etwas schief.
Wie aufs Stichwort drängte sich Julia an Urbanus vorbei. Ihr Gesicht war gerötet. Für einen Moment glaubte Castor, sie wolle seinen Freund zum Abschied umarmen. Doch im letzten Augenblick besann sie sich anders und hielt inne.
»Auch ich würde mich freuen, euch alle gesund wiederzusehen«, sagte sie hastig, wobei es nur zu offensichtlich war, dass sie vor allem Kimon meinte, der ihr zur Antwort lediglich knapp zunickte.
Innerlich verdrehte Castor die Augen. Den Entschluss des Griechen, sich mit keiner Frau mehr einlassen zu wollen, in allen Ehren, aber allmählich fand er das Getue zwischen den beiden anstrengend. Nach ihrer Rückkehr würden Kimon und Julia eine Lösung für die Situation finden müssen. Als die junge Römerin unter dem Bann der Hexe Valonia gestanden hatte, hatte Kimon diesen mit einem Kuss brechen können. Was sehr bezeichnend war, wie Castor fand.
Er hob eine Hand zum Gruß, dann wandte er sich ab und gab seinen Begleitern das Zeichen zum Abmarsch. Schweigend schwangen sie sich auf ihre Pferde und ritten los. Sie erreichten den Hafen von Ostia am frühen Nachmittag und hatten das Glück, schon bald darauf ein Schiff zu finden, auf dem es sowohl für sie als auch für die Tiere ausreichend Platz gab. Zudem würde es bereits in zwei Stunden ablegen.
Die Matrosen musterten Salma misstrauisch, was sie zu amüsieren schien. Entweder hatten die Männer von der Amazone aus der kaiserlichen Gladiatorenschule gehört, oder sie hatten noch nie eine Frau mit schwarzer Haut und zudem einem Schwert am Gürtel gesehen. Castor tippte auf Letzteres.
Die Überfahrt verlief reibungslos, sodass sie am Abend in der korsischen Hafenstadt Bastia ankamen. Da die Dämmerung anbrach, schlug Columbus vor, dass sie sich für die Nacht eine Herberge suchen sollten.
»Bei Dunkelheit weiterzureiten, ist zu gefährlich«, meinte er. »Wie überall im Reich treiben sich auch auf Korsika Banditen herum. Eine Reisegruppe mitten in der Nacht wäre für die Burschen geradezu eine Einladung. Auch wenn wir uns zur Wehr setzen können, sollten wir es besser auf keinen Kampf ankommen lassen. Wir wollen ja vollzählig unser Ziel erreichen.«
»Ich stimme dir zu«, erwiderte Castor. »Davon abgesehen müssen wir damit rechnen, dass sich die Wesen, von denen du erzählt hast, in der Nähe dieser Lichtung herumtreiben. Meiner Erfahrung nach können die Finsteren im Dunkeln besser sehen als wir. Sie könnten uns also mit Leichtigkeit überrumpeln.«
Während der Rest in einer Taverne wartete, ging Columbus los und fand bald eine Herberge mit genug freien Unterkünften und einer ausgezeichneten Küche, wie Castor feststellte, als sie dort ihr Abendessen einnahmen. Kimon bestand darauf, Cassia erneut in ihrem Zimmer einzuschließen, was sie schulterzuckend akzeptierte.
In dieser Nacht fand Castor nur schwer Schlaf. Er hoffte, sein Vater Aurel würde ihm wie neulich in seinem Traum erscheinen und ihm ein paar hilfreiche Ratschläge mit auf den Weg geben, doch er wurde enttäuscht. Stattdessen träumte er von dem Monster, das er in seinem Spiegel gesehen hatte. Deutlich erkannte er die kraterähnliche Wunde am Schädel und den langen, dolchartigen Zeigefinger, mit dem es ihm zu drohen schien.
Als er am nächsten Morgen aufwachte, hoffte er, ihm niemals leibhaftig gegenübertreten zu müssen.
Das Licht war so grell, dass es eine Weile dauerte, bis sich Elats Augen daran gewöhnt hatten. In seinem Reich war er stets von Dunkelheit umgeben, doch dies war der Götterhimmel. Für seine einstigen Mitgötter konnte es kaum hell genug sein, erinnerte er sich. Als wollten sie damit die Schatten ihrer Unzulänglichkeiten kaschieren.
Er stand in einem riesigen Tal, das von einer fernen Bergkette umschlossen wurde. Der wolkenlose Himmel war von einem hellen Blau, der glatte Stein unter seinen Füßen weiß wie Kreide. Ihm war bewusst, dass er sich auf dem göttlichen Schlachtfeld befand, das Mars vor Ewigkeiten erschaffen hatte. Jedoch hatte auf dem sogenannten Feld der Helden noch nie ein Kampf getobt, kein Tropfen Blut war hier je vergossen worden. Weil es nie jemanden gegeben hatte, der sich gegen die Götter erhoben und es auf eine kriegerische Auseinandersetzung hatte ankommen lassen.
Jedenfalls bis jetzt.
Wie aus dem Nichts stand Jupiter plötzlich vor ihm. Er trug ein langes, weißes Gewand und darüber einen goldenen Brustharnisch, was Elat als Hinweis auf die Wehrhaftigkeit des Götterhimmels interpretierte. Für Symbolik hatte Jupiter schon immer eine Schwäche gehabt. Auf seinem kahlen Schädel glitzerte es, als hätten sich dort Regentropfen verteilt, die von der Sonne beschienen wurden. Ein verkniffener Ausdruck lag auf dem Gesicht mit den groben Zügen eines Bauern, der erkerartigen Nase und den fleischigen Lippen. Die durchdringenden blauen Augen waren auf Elat gerichtet.
Elats Ansicht nach war es kaum verwunderlich, dass sich der Göttervater stets in Gestalt eines Tieres seinen weiblichen Eroberungen zu nähern pflegte. Zumindest, wenn es sich dabei um eine der als wählerisch bekannten Sterblichen handelte. Aus menschlicher Perspektive gesehen, konnte man ihm ein attraktives Äußeres nämlich nun wirklich nicht nachsagen.
»Ich sehe, du bist meinem Ruf gefolgt«, stellte Jupiter das Offensichtliche fest.
Huldvoll neigte Elat den Kopf. »Wie könnte ich dich, den größten aller Götter, warten lassen?«
»Gib dir keine Mühe mit unnötigen Schmeicheleien, ich kaufe sie dir sowieso nicht ab«, wurde er angeblafft. »Bevor du dich noch vor mir auf die Knie fallen lässt, lass uns lieber direkt zur Sache kommen. Wie ich hörte, haben du und deine Spießgesellen vor, den Zerstörer aus seinem Schlaf zu holen.«
Elat gab sich größte Mühe, so bestürzt wie möglich dreinzuschauen.
»Nichts als infame Lügen. Warum sollten wir so etwas tun?«
Jupiter stieß ein trockenes Lachen aus, das dem Meckern einer Ziege gleichkam.
»Warum, fragst du? Mir würde der eine oder andere Grund einfallen. Zum Beispiel könntest du versucht sein, ihn auf die Menschheit zu hetzen. Oder du hast vor, den Götterhimmel selbst anzugreifen. Oder beides zusammen. Raus damit, welche finsteren Pläne schleppst du mit dir herum?«
»Verzeih, wenn ich deutlich werde, Jupiter, aber ich kam nicht her, um mich von dir vor den Kopf stoßen zu lassen.«