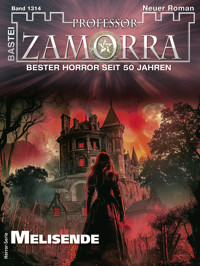1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: John Sinclair
- Sprache: Deutsch
Als Milli Peaches beschloss, in dem idyllischen irischen Küstenstädtchen Dunquin ihren Urlaub zu verbringen, konnte sie nicht ahnen, dass ein mysteriöser alter Mann ihre Reise von Grund auf verändern würde.
Seine bloße Anwesenheit sorgte für Unruhe im Dorf, und die Bewohner bemühten sich verzweifelt, seine Existenz zu vertuschen. Doch als Milli mehr über ihn herausfinden wollte, wurde sie entführt und auf eine abgelegene, geheimnisvolle Insel gebracht.
In den Fängen einer mysteriösen Kolonie musste Milli sich dem grausamen Schicksal der Inselbewohner stellen, die sich auf einer Mission des Schreckens befanden, denn sie waren
zum Sterben geboren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Zum Sterben geboren
Briefe aus der Gruft
Vorschau
Impressum
Zum Sterben geboren
von Michael Schauer
»Die Iren kommen. Es sind Hunderte. Du musst uns helfen, Barrit.«
Ein spöttisches Grinsen umspielte die rissigen Lippen des Dämons. »Du denkst, du kannst mir befehlen? Du magst ein großer Krieger sein, Sax, doch du bist ein Narr, wenn du das glaubst. Du musst mir etwas dafür bieten. Lange genug habe ich dir meine Gunst gewährt, ohne eine Gegenleistung einzufordern.«
Sax wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Jeden Moment konnten die Feinde die Siedlung erreichen. Allein durch ihre pure Überzahl würden sie einfach über ihn und seine Männer hinwegfegen.
Zum vielleicht ersten Mal in seinem Leben verspürte er Furcht.
»Sag mir, was du verlangst, und ich werde es tun.«
Der Dämon stieß ein zufriedenes Knurren aus. »Ich will Seelen, Sax. Viele Seelen. Und du wirst sie mir verschaffen.«
Der frische Wind zerzauste Milli Peaches' kurze blonde Haare. Mit geschlossenen Augen genoss sie die kühle Luft, den salzigen Geruch des Nordatlantiks und das unablässige Rauschen, mit dem sich die Wellen an den Klippen brachen. Sie stand auf einem winzigen Stück Sandstrand, nur ein paar Schritte vom Meer entfernt. Manchmal strömten die Wellen so weit heran, dass sie beinahe Millis Stiefel erreichten. Der Himmel war grau und düster. Wenigstens war es an diesem späten Nachmittag trocken, nachdem es beinahe den ganzen Tag geregnet hatte.
Milli öffnete die Lider. Das Meer war etwas, an dem sie sich kaum sattsehen konnte. Bis jetzt hatte sie es keine Sekunde bereut, dass sie sich diesen Urlaub gegönnt hatte. Dabei hatte sie erst dazu überredet werden müssen.
Über Monate hinweg hatte das neue Produkt, eine besondere Wertanlage für vermögende Kunden, ihre Abteilung in Atem gehalten. Nicht nur einmal hatten sie und ihre Kollegen stark daran gezweifelt, es zum vom Vorstand vorgegebenen Zeitpunkt auf den Markt bringen zu können. Kaum hatten sie ein Problem beseitigt, war ein neues aufgetreten. Doch am Ende hatten sie das Projekt pünktlich abschließen können, was nicht zuletzt Millis Einsatz zu verdanken gewesen war. Wochenlang hatte sie Überstunden geschoben und war mehrmals sogar sonntags ins Büro gekommen. Ihr Ehrgeiz und nicht zuletzt die Zweifel der Leute aus den anderen Abteilungen hatten sie angetrieben. Niemand hatte an sie und ihr Team geglaubt.
Sie hatten es allen gezeigt.
Ihr direkter Vorgesetzter Dan Bender war entsprechend voll des Lobes gewesen und hatte Milli dazu ermuntert, einige Tage auszuspannen. Erst hatte sie abgelehnt, weil es noch ein paar letzte Details zu erledigen gegeben hatte, doch er hatte nicht lockergelassen.
»Das machen Tom, Peter und Jenny nebenbei«, hatte er gesagt. »Himmel, Milli, den Kram könnte sogar unser pickeliger Auszubildender erledigen. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet und sollten sich erholen. Eine Woche Ruhe wird Ihnen guttun. Wenn ich das anmerken darf, Sie sind ganz blass um die Nase.«
Womit er recht hatte, wie sie feststellte, als sie nach dem Gespräch ihr Spiegelbild einer kritischen Musterung unterzogen hatte. Also hatte sie eingewilligt und einen Urlaubsantrag eingereicht, der bereits rekordverdächtige zehn Minuten später bewilligt wurde.
War nur die Frage geblieben, wo sie ihre freien Tage verbringen sollte. Ihre Kollegin und Freundin Jenny Longford hatte ihr Irland empfohlen. Vor fünf Jahren hatte sie mit ihrem damaligen Freund Tim in dem Küstenort Dunquin einen ihren eigenen Worten nach traumhaften Urlaub verbracht.
Wie so häufig war Milli Jennys Rat gefolgt und hatte einen Flug und ein Zimmer in Dunquins einziger Pension Littlefield House gebucht. Vorgestern Nachmittag war sie am Shannon Airport gelandet, hatte einen knallroten Ford Fiesta gemietet und war knapp hundertzehn Meilen und zweieinhalb Stunden später an ihrem Ziel eingetroffen.
Jenny hatte wieder einmal recht gehabt. Die Gegend war zwar rau, aber gleichzeitig wunderschön. Von ihrem Zimmer bis zur Küste war es kaum eine Viertelmeile, und vom Rauschen der Brandung abgesehen, herrschte eine wohltuende Stille.
Die Betreiber der Pension hatten sich als reizendes älteres Ehepaar entpuppt, und das Essen im 0›Haras, dem einzigen Pub im Ort, war schlicht, aber köstlich. Dass die Einheimischen sie dort staunend beäugten, störte Milli nicht. Sicher gab es nicht viele junge Frauen, die hier ganz allein einen Urlaub verbrachten, also war sie für die Leute wohl so etwas wie eine kleine Sensation. Wobei an einem abgelegenen Ort wie diesem, in dem die Zeit an vielen Ecken stehengeblieben zu sein schien, wohl jede noch so geringe Abweichung von der Norm eine kleine Sensation war.
Die beiden ersten Tage hatte sie mit Lesen, Schlafen und spazieren gehen verbracht. Für morgen hatte sie sich vorgenommen, mit dem Fiesta die Gegend zu erkunden. Als sie beim Frühstück ihrer Vermieterin Mrs. Pulver davon erzählt hatte, hatte sie ihr sofort einige Tipps gegeben. Zuerst würde Milli den Loch Gal ansteuern, einen gut zwanzig Meilen entfernt gelegenen See. Er sei nicht besonders groß, die Umgebung dafür aber ganz reizend, wie ihr Mrs. Pulver wortreich versichert hatte. Nun, sie war gespannt.
Was war das?
Milli hatte einen Schatten auf dem Meer bemerkt. Sie kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Tatsächlich, auf den Wellen schaukelte ein kleines Boot. Nein, kein Boot, eher ein Floß, keine hundert Yards mehr vom Strand entfernt. Eine Gestalt lag darauf und rührte sich nicht.
Milli hob die Hand und winkte, erhielt jedoch keine Reaktion.
Sie runzelte die Stirn. Es war auszuschließen, dass der Passagier ein Nickerchen hielt. Dafür war der Wellengang zu stark. Ob er ohnmächtig geworden war? Und wo kam er eigentlich her? Vielleicht ein Schiffsbrüchiger?
Sie spielte mit dem Gedanken, nach Dunquin zurückzulaufen und die Polizei zu verständigen. Erst heute Morgen war sie an der kleinen Wache vorbeispaziert. Doch das Floß kam schnell näher und würde den Strand in Kürze erreicht haben. Zu dumm, dass sie ihr Mobiltelefon in ihrem Zimmer gelassen hatte.
Eine mächtige Welle trieb das Floß bis auf wenige Schritte heran.
»Hallo?«, schrie Milli, so laut sie konnte, um das Rauschen des Meeres zu übertönen.
Immer noch keine Reaktion.
Sei's drum, dachte sie und watete bis zu den Knien in die Fluten. Eiskaltes Wasser umspülte ihre Beine und drang in ihre Schuhe ein. Milli biss die Zähne zusammen, beugte sich vor und streckte die Hand nach dem Floß aus. Es war aus grob zugerichteten dicken Ästen gebaut, die mit Leinenstreifen notdürftig zusammengebunden waren. Die Konstruktion sah so fragil aus, dass es an ein Wunder grenzte, dass sie nicht längst auseinandergebrochen war.
Bei der Gestalt handelte es sich um einen Mann. Er lag mit dem Gesicht zu ihr gewandt auf der Seite. Seine Augen waren geschlossen. Der Schädel war kahl, der Körper so ausgemergelt, dass Milli deutlich die Schulterknochen erkennen konnte, die sich durch die pergamentartig wirkende Haut drückten. Bis auf eine Art Lendenschurz war er nackt.
Bei der nächsten Welle bekam sie das Floß zu fassen. Ihre Finger gruben sich in das feuchte Holz. Sie war erstaunt, wie leicht es war. Augenblicke später hatte sie es an Land gezogen. Milli ging in die Knie, fasste den Mann an der Schulter und drehte ihn sanft auf den Rücken.
Er musste wenigstens sechzig Jahre alt sein, wenn nicht älter. Tiefe Falten durchfurchten sein hageres Gesicht. Ihr fielen drei kleine schwarze Dreiecke auf, die nebeneinander auf seiner Stirn prangten. Eine Tätowierung? Die Haut war blass und eiskalt, die Lippen waren blau angelaufen. Kein Wunder bei dem Wind und den Temperaturen, denen er praktisch ohne Kleidung ausgesetzt gewesen war. Bestimmt war er unterkühlt.
Wenn er überhaupt noch lebte. Milli tastete nach seiner Halsschlagader.
Ruckartig schlug er die Augen auf. Ein gequältes Stöhnen entrang sich seinem halb geöffneten Mund.
»Wo ... bin ... ich?«, fragte er. Die Worte waren kaum mehr als ein Hauch.
»In der Nähe von Dunquin«, antwortete Milli, streifte ihre Jacke ab und breitete sie auf seinem Oberkörper aus. »Kennen Sie diesen Ort?«
»Runa ... Müssen Runa retten. Und die anderen.«
Er sprach mit einem seltsamen Dialekt, den sie nie zuvor gehört hatte.
»Wer ist das?«
»Insel ... Die Insel ... Nicht sehr weit von hier.«
»Hören Sie, ich muss Sie jetzt allein lassen, um Hilfe zu holen. Das Dorf ist ganz in der Nähe, ich bin gleich ...«
Seine klauenartigen Finger schlossen sich um ihren Unterarm. Der Griff war überraschend kraftvoll.
»Nicht gehen ...«
Sie lächelte ihm aufmunternd zu. »Ich muss aber. Sie sind unterkühlt und müssen dringend ins Warme.«
In seinen Augen blitzte etwas auf. Der Griff um ihren Unterarm wurde schlaff. Milli legte dem Mann eine Hand auf die Stirn. Sie war glühend heiß. Seine Augen schlossen sich, der Kopf kippte zur Seite. Er hatte das Bewusstsein verloren. Erneut tastete Milli nach seiner Halsschlagader. Sein Puls war schwach, kaum noch zu ertasten.
Sie stand auf und rannte zurück nach Dunquin.
Als der Wächter in ihre Richtung blickte, wandte sich Runa ab. Aus leidvoller Erfahrung wusste sie, dass es besser war, nicht seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie waren sehr erfindungsreich darin, ihren Sklaven Schmerzen zuzufügen. In der Regel, um sie zu bestrafen – und Gründe dafür gab es viele –, manchmal auch einfach nur, weil ihnen danach war.
Mit gesenktem Blick setzte Runa ihren Weg fort. Ihr Ziel war das große Gemüsefeld am anderen Ende des Dorfes. Alle aus ihrer Schicksalsgemeinschaft kümmerten sich um das Feld, und dafür durfte sich jeder an den Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten und Salaten bedienen, die dort wuchsen. So war es schon seit Jahrhunderten. Hin und wieder wurde einigen der Männer erlaubt, auf die Jagd oder zum Fischen zu gehen. Das waren stets Festtage, an denen jeder die Gelegenheit nutzte, sich ordentlich den Bauch vollzuschlagen.
Das Feld maß in Länge und Breite jeweils etwa fünfzig Schritte. Gerade groß genug, um die etwa vierzig Bewohner des Dorfs zu versorgen und ausreichend Vorräte für den Winter anzulegen. Ein hüfthoher Zaun aus mit geflochtenen Grashalmen zusammengebundenen Ästen schützte das Feld vor den Tieren, die sich nachts in der Nähe herumtrieben. Die meisten waren harmlos, aber es gab auch einige, vor denen man sich in Acht nehmen musste. Angeblich hatten sie lange Reißzähne und gelbe Augen, die in der Dunkelheit glühten. Einem solchen Tier war Runa noch nie begegnet, doch die Älteren pflegten die Jüngeren in regelmäßigen Abständen vor ihnen zu warnen.
Es knarrte leise, als sie das Gatter öffnete. Außer ihr war noch jemand auf dem Feld. Unwillkürlich musste Runa schmunzeln, als sie Loga erkannte. Loga war sieben und damit etwa einen Sommer jünger als sie. Wie alle Bewohner des Dorfes ähnelten sie sich äußerlich. Doch in ihrem Wesen waren sie vollkommen verschieden.
Loga war furchtlos und aufmüpfig, was ihr schon mehrfach Prügel durch die Wächter eingebracht und sie mehrere Zähne gekostet hatte. Dennoch dachte sie gar nicht daran, ihr Verhalten zu ändern. Die Wächter hätten sie mühelos töten können, doch jeder wusste, dass sie so etwas nur äußerst selten taten. Und noch seltener töteten sie Frauen, denn die wurden besonders gebraucht.
Als Runa näher kam, sah Loga auf und lächelte, wodurch sich die kleinen Falten in ihrem Gesicht vertieften. Seit einigen Tagen zeigten sich erste silbrige Strähnen in ihrem dichten schwarzen Haar, das ihr beinahe bis zu den Hüften reichte. Das Leuchten ihrer Augen erinnerte Runa an die Sterne in wolkenlosen Nächten.
»Hallo, Runa«, rief sie. »Kühl heute, nicht wahr?«
Runa zog sich ihren Fellmantel fester um die Schultern, bevor sie neben ihr in die Knie ging und damit begann, nach späten Kartoffeln zu graben.
»Solange es nicht regnet, ist es auszuhalten«, antwortete sie und sah sich in alle Richtungen um.
Manchmal war für einen Wächter allein die Tatsache, dass sie außerhalb ihrer Hütten miteinander sprachen, Grund genug, um auf sie einzuschlagen. Zu ihrer Erleichterung war weit und breit niemand zu sehen.
»Wie geht es Carr?«, fragte Loga und senkte dabei ihre Stimme, obwohl niemand in der Nähe war, der sie hätte belauschen können. »Ich habe ihn seit zwei Tagen nicht mehr gesehen.«
Natürlich war auch Runa aufgefallen, dass Carr verschwunden war. Nur war es ihr bis jetzt gelungen, jeden Gedanken daran zu verdrängen. Sicher hatten ihn die Wächter auf die Jagd geschickt. Carr war ein sehr guter Jäger und kehrte niemals ohne Beute zurück.
Jedoch war noch nie war ein Jäger über Nacht fortgeblieben.
Sie wusste genau, dass sie sich bloß etwas einredete.
Anscheinend hatte er es tatsächlich getan. Oft genug hatte er darüber gesprochen. Wenn sie merkten, dass er weg war, würden sie sie holen, um sie nach ihm zu befragen. Natürlich hatten sie mitbekommen, dass Runa und Carr ein besonderes Verhältnis zueinander pflegten.
Die Angst davor legte sich wie eine eiskalte Hand um ihr Herz.
»Glaubst du, er hat es versucht?«, raunte Loga.
Runa biss sich auf die Lippen, zog eine unförmige Knolle aus dem Boden und befreite sie mit den Fingern von Erdresten.
»Was meinst du?«, fragte sie zurück, obwohl sie genau wusste, was Loga meinte.
»Versucht zu fliehen.«
Runa hob den Kopf und sah ihr in die Augen. Obwohl sie alle dasselbe Schicksal teilten, hatte es in der Vergangenheit den einen oder anderen gegeben, der sich Vorteile davon erhofft hatte, wenn er für die Wächter spionierte. Runa hatte sich oft gefragt, welche Vorteile das wohl sein sollten, und sie vermutete, dass nicht einmal die Verräter selbst diese Frage hätten beantworten können. Wahrscheinlich waren sie von der verzweifelten Hoffnung auf irgendeine noch so geringe Verbesserung ihres jammervollen Daseins angetrieben worden.
Aber Loga war keine Spionin. Niemals.
»Hat er dir davon erzählt?«, raunte sie zurück.
»Er hat etwas angedeutet. Aber bereits eine Andeutung ist mehr, als die meisten von uns wagen würden, wie du sehr wohl weißt.«
Da hatte sie recht. Alle anderen in ihrer Gemeinschaft hatten sich in ihr Schicksal ergeben, so wie die Generationen davor es getan und die nachfolgenden es ebenso tun würden. Loga und Carr waren Ausnahmen. Runa war überzeugt, dass es Loga eines Tages selbst versucht hätte, wenn da nicht das große Wasser gewesen wäre. Es war eines der wenigen Dinge, vor denen sie sich fürchtete.
»Vermutlich hat er es getan«, erwiderte sie. »Er ging fort, ohne sich zu verabschieden.«
Daraufhin verstummten sie und gruben wortlos weiter. Runas kleiner Korb begann sich zu füllen.
»Wie ist es wohl da draußen?«, brach sie nach einer Weile das Schweigen.
Loga antwortete, ohne von ihrer Arbeit aufzusehen. »Es sollen schon Menschen von draußen hergebracht worden sein. Sie sahen anders aus als wir, trugen seltsame Kleidung, und die Worte aus ihren Mündern klangen merkwürdig.«
»Ich kenne die Geschichten. Nur weiß ich nicht, ob ich sie glauben kann ... Ich ... Ich ...«
»Raus mit der Sprache«, verlangte Loga.
»Ich habe mich nur gefragt, ob es das Risiko wert ist. Wie viele Jahre bleiben Carr und mir noch, bevor wir sterben werden? Nicht viele, so viel ist sicher. Es ist noch nie jemand älter als vierzehn geworden. Und nun ist er fort und kehrt vielleicht nicht mehr zurück. Wozu?«
In ihrer Kehle hatte sich ein Kloß gebildet, und sie musste gegen die Tränen ankämpfen. Sie wollte nicht weinen.
»Ich bin wieder schwanger«, eröffnete ihr Loga.
Runa wischte sich über die Augen. »Das ist das dritte Mal, oder?«
Sie überlegte, wann sie ihr letztes Kind geboren hatte. Das war im vergangenen Sommer gewesen. Was bedeutete, dass man sie bald wieder in die Hütte des Barrit bringen würde. Nach der anstrengenden Geburt gewährte man den Frauen eine Pause, damit sie wieder zu Kräften kommen konnten. Ihre war beinahe vorbei.
Viele Kinder starben innerhalb von zehn Tagen, auch ihre beiden ersten hatten es nicht überlebt. Wenn das geschah, wurden die Wächter zornig, doch sie konnten nichts daran ändern.
»Ja, und ich bin nicht sicher, ob ich mir wünschen soll, dass es diesmal überlebt«, sagte Loga bitter. »Unsere Kinder haben keine Zukunft, und genau das ist der Grund, warum sich Carr aufgemacht hat. Er hat es nicht nur für dich getan, sondern für uns alle. Für ein Leben in Freiheit.«
»Um frei zu sein, müssen sie besiegt werden. Was, wenn das nicht möglich ist?«
»Ich glaube ...«
»Was treibt ihr Huren da drüben?«
Ihre Köpfe flogen herum. Einer der Wächter hatte sie bemerkt und stapfte auf sie zu. In seinen schwarzen Augen funkelte der Zorn. Die Wächter waren immer zornig, und wenn sie richtig wütend wurden, begannen ihre Augen rot zu glühen.
»Wir sollten jetzt besser gehen«, schlug Loga vor und erhob sich.
»Es war wirklich seltsam«, sagte Milli Peaches und roch an dem Brandy, den Mrs. Pulver ihr eingeschenkt hatte.
Über ihren nackten Beinen lag eine flauschige graue Decke, ihre Füße steckten in einer großen, orangefarbenen Plastikschüssel, die mit einer milchigen, warmen Flüssigkeit gefüllt war.
»Was war seltsam?«, fragte Mrs. Pulver und musterte sie neugierig.
Hinter den großen Brillengläsern wirkten ihre grünen Augen leicht vergrößert. Ihr graues Haar fiel ihr in sanften Wellen auf die Schultern.
Sie saßen in dem etwas altmodisch, aber behaglich eingerichteten Wohnzimmer ihrer Vermieter. Milli hatte auf der Couch Platz nehmen dürfen, die Hausherrin saß in einem der beiden Sessel. Nachdem Milli den Constable verständigt hatte, war sie in die Pension geeilt. Da hatten ihre nassen Füße bereits Eiswürfeln geglichen. Sie hätte sich den Tod geholt, wenn sie so zum Strand zurückgekehrt wäre.
Mrs. Pulver hatte gerade gestaubsaugt, und als Milli von den Knien abwärts pitschnass und frierend eingetreten war, hatte sie keine Sekunde gezögert, sie an die Hand genommen und sie – keine Widerrede – in ihre gute Stube geführt. Bereitwillig war Milli ihrer Aufforderung nachgekommen, Jacke, Schuhe, Socken und Hosen auszuziehen, während Mrs. Pulver in die Küche eilte, um das Fußbad vorzubereiten.
Erst hatte sie geglaubt, Milli sei zu nahe ans Wasser gegangen und von einer Welle erwischt worden. Nachdem sie gehört hatte, was sich wirklich abgespielt hatte, gehörte Milli ihre volle Aufmerksamkeit.
Milli nippte an ihrem Brandy, bevor sie antwortete. Der Alkohol brannte in ihrer Kehle, tat aber gut und wärmte von innen.
»Na ja, ich meine, wie kommt ein alter Mann auf ein solches Floß? Sie hätten es sehen müssen. Als hätte es ein Kind gebaut. Damit hätte ich mich nicht mal auf die Themse gewagt. Und dann diese kleinen schwarzen Dreiecke auf seiner Stirn. Ich frage mich, was die zu bedeuten hatten.«
Mrs. Pulver erwiderte nichts. Täuschte sich Milli, oder hatte sie sich gerade etwas versteift?
»Außerdem hat er eine Insel erwähnt, und er nannte einen Namen. Muna oder Luna, ich kann mich nicht genau erinnern. Kennen Sie eine Insel, die so heißt?«
Ihr Gegenüber schüttelte wortlos den Kopf. Seltsam, dachte Milli, sie schien ein wenig blass geworden zu sein und hinter den Brillengläsern flatterten ihre Lider. Täuschte sie sich, oder zitterten Mrs. Pulvers Hände?
»Vielleicht ein Schiffbrüchiger, der so lange auf See war, dass er darüber verrückt geworden ist«, mutmaßte sie mit ungewohnt brüchiger Stimme.