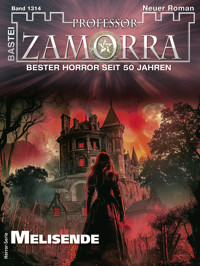29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Castor Pollux
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in die finstere Welt des Römischen Reiches zur Zeit Kaiser Neros. In diesem exklusiven Sammelband sind alle zwölf packenden Episoden der ersten Staffel von Castor Pollux vereint.Castor Pollux, ein ehemaliger Legionär und Gladiator, steht als Bezwinger der Finsteren zwischen unserer Welt und dem Reich der Schatten. Mit einem von Mars persönlich geschmiedeten Schwert und unterstützt von seinem treuen Freund Kimon, stellt er sich den albtraumhaften Kreaturen entgegen, die das Imperium bedrohen.Erleben Sie, wie Castor Pollux gegen Vampire auf Kreta kämpft, finstere Kulte in den Katakomben Roms aufdeckt und sich uralten Dämonen stellt, die die Grundfesten der Weltmacht erschüttern. Jede Episode verbindet historische Authentizität mit fesselndem Grusel und entführt Sie direkt ins Herz einer längst vergangenen Epoche.Castor Pollux bietet eine unvergessliche Mischung aus Geschichte und Horror, die Ihnen Gänsehaut und schlaflose Nächte bescheren wird. Wagen Sie es, dem Schrecken der Antike ins Auge zu blicken!Enthaltene Episoden:
- Gladiator der Finsternis
- Im Reich des Dämons
- Die Verlorenen
- Vampire auf Kreta
- Verführt und verdammt
- Totenfresser in Rom
- Der Rächer
- Das Unheil aus der Tiefe
- Der Sturm der Genoveva
- Im Bann des Spinnenkults
- Auf der Spur des Bösen
- Tod allen Finsteren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1771
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
BASTEI LÜBBE AG
Vollständige eBook-Ausgaben der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgaben
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2023/2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Covergestaltung: Tanja Østlyngen
Titelbild: Mario Heyer (MtP Art) unter Verwendung von KI Software
ISBN: 978-3-7517-8328-6
https://www.bastei.de
https://www.luebbe.de
https://www.lesejury.de
Castor Pollux Staffel 1
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Castor Pollux 1
Titel
Zum Einstieg
Gut zu wissen
Gladiator der Finsternis
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 2
Titel
Zum Einstieg
Im Reich des Dämons
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 3
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Im Reich des Dämons
Fußnoten
Castor Pollux 4
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Vampire auf Kreta
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 5
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Verführt und verdammt
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 6
Titel
Liebe Leserinnen und Leser
Totenfresser in Rom
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 7
Titel
Der Rächer
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 8
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Das Unheil aus der Tiefe
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 9
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Der Sturm der Genoveva
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 10
Titel
Im Bann des Spinnenkults
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE
Fußnoten
Castor Pollux 11
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Auf den Spuren des Bösen
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Castor Pollux 12
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Tod aller Finsteren
Schlusswort
Fußnoten
Guide
Start Reading
Contents
Gladiator der Finsternis
von Michael Schauer
Römisches Reich, 64 n. Chr.
Zwischen unserer und der Welt der Finsteren hat sich ein Riss aufgetan. Immer wieder kommt es zu Angriffen albtraumhafter Kreaturen. Der ehemalige Legionär und Gladiator Castor Pollux ist der Einzige, der die Wesen aus dem Reich des Schreckens aufhalten kann. Seine mächtigste Waffe ist ein Schwert, das vom Kriegsgott Mars persönlich geschmiedet wurde. Im Dienste Kaiser Neros stellt er sich gemeinsam mit seinem griechischen Freund Kimon den Attacken der Dämonen entgegen. Denn das ist seine Aufgabe, die er von seinem verschollenen Vater Aurel geerbt hat.
Castor Pollux ist der Bezwinger der Finsteren!
Dieser Roman ist Laura gewidmet. Für immer im Herzen.
Zum Einstieg
Zugegeben, die Idee ist nicht neu. Ein Mann ist dazu auserkoren, gegen Geister und Dämonen zu kämpfen. Wenn Sie gerne Gruselromane lesen, dann haben Sie sicher schon einmal von »John Sinclair«, »Professor Zamorra« oder »Tony Ballard« gehört. Deren Mission ist dieselbe.
Doch im Gegensatz zu diesen Helden lebt Castor Pollux nicht in unserer Gegenwart, sondern im Rom des 1 . Jahrhunderts, und genau das macht die Serie »Castor Pollux – Dämonenjagd im alten Rom« außergewöhnlich. Castor hat keine Pistole, sondern ein Schwert, er reist nicht mit Auto und Flugzeug, sondern mit Pferd und Schiff, Informationen verbreiten sich nicht per Internet, sondern durch Boten. Buchstäblich alles ist anders, als wir es heute kennen und gewohnt sind.
Mein Kollege und Mitautor Rafael Marques und ich geben uns große Mühe, die Welt und die Menschen von damals so authentisch wie möglich zu schildern. Wenn uns das nicht immer gelingt, sehen Sie es uns bitte nach, denn wir sind Autoren und keine Historiker. Zudem ist ein wenig dichterische Freiheit manchmal unumgänglich.
Begleiten Sie also den Bezwinger der Finsteren auf seinen Abenteuern, und tauchen Sie ein in eine längst vergangene Zeit.
Michael Schauer
Aquae Mattiacorum, April im Jahre 2023 n. Chr.
D ie brennenden Öllampen malten flackernde Schatten auf das Gesicht der alten Frau. Mit einem leisen Kichern erhob sie sich von ihrem Stuhl und ging zu der großen Truhe, die in einer Ecke des Zimmers stand. Der Deckel knarrte vernehmlich, als sie ihn öffnete. Eine Weile kramte sie in der Truhe, dann hatte sie gefunden, wonach sie gesucht hatte. Mit ihren knochigen Händen ergriff sie die kleine Holzkiste, kehrte zum Tisch zurück, ließ sich auf den Stuhl sinken und klappte sie auf. Darin lag der skelettierte Daumen eines Säuglings. Seiner Größe nach konnte das Kind nicht viel älter als zwei Monate gewesen sein.
Ein nachdenklicher Ausdruck huschte über ihr von tiefen Falten durchzogenes Antlitz. Der Daumen war das letzte Stück, das noch übrig war. In nicht allzu ferner Zeit musste sie Nachschub besorgen. Dafür würde sie eine etwas weitere Reise auf sich nehmen müssen. Zwar befand sich das nächste Dorf in der Nähe ihrer Hütte, doch es war Vorsicht geboten. Die wenigen Bewohner ließen sie zwar in Ruhe. Doch wenn sie sich an ihren Kindern vergriff, würden die Männer kommen und ihre Behausung niederbrennen, und zwar mit ihr darin. Mit ihren geschwächten Kräften würde sie einen wütenden Mob nicht aufhalten können.
Früher war das anders gewesen. Damals hatte sie noch ihre alte Stärke besessen und Furcht und Schrecken verbreitet. Diese Zeit war aber lange vorbei.
Bei dem Gedanken verfinsterte sich ihre Miene. Das Bild des verhassten Druiden erschien vor ihrem geistigen Auge. So deutlich, als würde er leibhaftig vor ihr stehen, konnte sie seine gefeilten Zähne und die langen, eisgrauen Haare sehen, die ihm über die knochigen Schultern fielen. Für ihren beklagenswerten Zustand war allein er verantwortlich. Sicher hatte er sie längst vergessen, hatte sie hinter sich gelassen wie einen Wegstein, an dem man während einer langen Reise vorbeimarschierte. Sie dagegen würde ihn niemals vergessen. Eines Tages würde er es büßen.
Sie legte den Knochen in die kleine, mit einem roten Sud gefüllte Schale, die vor ihr auf dem Tisch stand. Augenblicklich begannen rötliche Dämpfe aus der Flüssigkeit emporzusteigen. Blasen blubberten mit einem Mal an der Oberfläche, als sei sie rasend schnell erhitzt worden. In der Hütte wurde es dunkler, als würde sich ein Schatten vor die Lampen schieben.
Die Dämpfe waberten nicht davon, sondern vereinten sich über der Schale zu einem aufrecht in der Luft stehenden Oval von der Größe eines Männerkopfs. In dessen Zentrum erschien ein leuchtender Punkt, der sich rasch zu einer spiegelnden Fläche auswuchs. Für einen Moment sah sich die Alte selbst darin, dann wurde der Spiegel milchig trüb. Schatten und Formen zeichneten sich darin ab. Gesichter, Gebäude und Landschaften materialisierten sich, um sich gleich darauf wieder aufzulösen und neuen Bildern Platz zu machen.
Gut zu wissen
Wer ist Castor Pollux?
Castor Pollux ist ein ehemaliger Legionär und Gladiator und der Sohn von Aurel Pollux, der einst einen Angriff der Geister und Dämonen (hier die Finsteren genannt) abwehren und sie zurückdrängen konnte. Aurel verschwand spurlos, als Castor noch ein Kind war. Jahre später hat sich erneut ein Riss zwischen den Welten aufgetan, und die Finsteren streben nun wieder auf die Erde.
Der römische Kaiser bestimmt Castor zum Nachfolger seines Vaters und übergibt ihn in die Obhut von Senator Urbanus, einst Aurels engster Vertrauter. Castors mächtigste Waffe ist ein Schwert, das von Kriegsgott Mars persönlich geschmiedet wurde. Begleitet wird er von dem Griechen Kimon, ehemals Sklave in Urbanus’ Hausstand und inzwischen sein bester Freund. Außerdem hat Castor eine Liebschaft mit Urbanus’ Tochter Florentina.
Seine hartnäckigsten und gefährlichsten Feinde sind der Druide Marton, den Sie in diesem Band kennenlernen, sowie die Halbdämonin Cassia.
Der erste Roman »Der Vampir von Rom« spielt 63 n. Chr., im vorliegenden Band neigt sich das Jahr 64 n. Chr. seinem Ende zu. Amtierender Kaiser und damit der mächtigste Mann der Welt ist Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, kurz Nero genannt. In den »Castor Pollux«-Romanen taucht Nero immer wieder auf, so auch in diesem. Dass er getarnt nach Britannien gereist ist, um sich einen Gladiator anzusehen, ist natürlich eine Erfindung – zuzutrauen wäre es ihm aber gewesen.
Die ersten acht Bände von »Castor Pollux« sind in der Reihe »Gespenster-Krimi« erschienen:
Band 80 »Der Vampir von Rom«
Band 84 »Angriff der Nebelreiter«
Band 88 »Stirb in der Arena, Castor Pollux!«
Band 94 »Medusas Sohn«
Band 101 »Ein Tor in die Finsternis«
Band 106 »Die schwarze Galeere«
Band 115 »Brennen muss Rom«
Band 126 »Tod der weißen Hexe«
Gladiator der Finsternis
Ein dünner Schweißfilm bildete sich auf ihrer hohen Stirn. Einen Blick in die Zukunft zu werfen, gelang ihr nur sehr selten, und selbst wenn, erkannte sie häufig nur schemenhafte Fetzen, die keinen Sinn ergaben. Außerdem zehrte die Prozedur so sehr an ihren Kräften, dass sie sich danach für Stunden ausruhen musste. Einmal hatte sie sogar geglaubt, es würde sie ihr Leben kosten. Trotzdem versuchte sie es immer wieder. Es war eine der wenigen Fähigkeiten, die ihr geblieben waren.
Diesmal sah sie etwas. Etwas sehr Interessantes.
So schnell die Flamme erlischt, wenn eine Kerze ausgeblasen wird, so unvermittelt verschwand der Spiegel, und gleich darauf lösten sich auch die Dämpfe auf. Die Schale war leer, die Flüssigkeit darin war verdampft, und mit ihr der skelettierte Daumen des Säuglings.
Obwohl sie sich unendlich schwach fühlte, umspielte ein düsteres Lächeln ihre dünnen, beinahe weißen Lippen. Die Anstrengungen hatten sich gelohnt. Endlich.
Schwindel ergriff sie. Sie musste sich hinlegen.
Ein angestrengtes Stöhnen entrang sich ihrer dürren Kehle, als sie sich in die Höhe stemmte. Ihre Beine zitterten und schienen aus Brei zu bestehen. Keuchend schleppte sie sich zu ihrem Lager. Weiße Flecken tanzten vor ihren Augen, als sie sich niedersinken ließ. Auf dem Rücken liegend, starrte sie an die Decke und wartete, bis der Schwächeanfall vorüber war.
Ein Römer würde nach Eboracum kommen. Das erst vor zwei Jahren gegründete Legionslager war kaum einen halben Tagesritt entfernt. Dort gab es eine Menge Römer, aber dieser war anders als die anderen. Er war der Mächtigste von allen. Ihn zu töten, würde sie in der Gunst der Finsteren rasant aufsteigen lassen. Was bedeutete, dass sie womöglich ihre alten Kräfte wiedererlangen konnte. Ja, das wäre durchaus möglich.
Beinahe noch besser war, dass sich der verfluchte Druide in der Nähe befand, um einen neuen Diener zu rekrutieren. Bestimmt würde er von der Ankunft des Römers erfahren und selbst versuchen, seiner habhaft zu werden. Wenn sie ihm zuvorkam, würde das für ihn eine gewaltige Demütigung und für sie einen noch größeren Triumph bedeuten.
Kein Zweifel, das Schicksal hatte ihr endlich die Chance zukommen lassen, auf die sie so lange gewartet hatte. Sie musste sie nur ergreifen.
Doch wie sollte sie es anstellen? Dieser Mann würde sicher gut bewacht werden, und sie hatte einem Schwert oder einem Speer wenig entgegenzusetzen, denn geschwächt, wie sie war, war sie so verletzlich wie jeder andere Mensch. Was sich schrecklich anfühlte, jedoch nicht ändern ließ.
Jedenfalls noch nicht.
Die junge Frau fiel ihr ein.
Manchmal wurde sie von Einheimischen aufgesucht, die sie um Hilfe baten. Meistens ging es um Krankheiten, manchmal um Streitigkeiten oder eine unerhörte Liebe. Hin und wieder ließ sie sich darauf ein und braute einen geeigneten Trank, wofür sie sich mit einigen Münzen entlohnen ließ.
Für das Problem ihrer Besucherin von heute Morgen war ihr zunächst keine Lösung eingefallen. Sie hatte ihr befohlen, am Abend wiederzukommen, damit sie darüber nachdenken konnte. Was sie bis jetzt nicht getan hatte. Eigentlich hatte sie die Sache schon fast wieder vergessen. Die lächerlichen Probleme dieser Leute langweilten sie.
Aber diesmal …
Diese Frau konnte ihr nützlich sein. Sehr nützlich sogar. Wenn sie es recht überlegte, war ihr Auftauchen eine glückliche Fügung. Wahrlich, das Schicksal schien es endlich wieder gut mit ihr zu meinen.
Während sie weiter an die Decke starrte und sich dabei langsam erholte, reifte in ihrem Kopf ein Plan.
Trotz der kühlen Luft schwitzte Malvo Purus unter dem schweren Helm. Schweißtropfen rannen ihm in die Augen, doch er konnte sie nicht wegwischen. Bis auf die beiden runden Sehschlitze war der Helm rundum geschlossen. Abnehmen konnte er ihn nicht mehr, denn soeben hatte sein Gegner die Arena betreten.
Lediglich der rechte Arm des Retiarius wurde von einem Schienenpanzer geschützt. Ansonsten war er bis auf die Stiefel und den Lendenschurz nackt. Seine Bewaffnung bestand aus einem Dreizack und einem Netz, das er während des Kampfs seinem Gegner überzuwerfen versuchte. Wer sich darin verfing, war in kürzester Zeit wehrlos und konnte von Glück sagen, wenn er mit dem Leben davonkam.
Ein Secutor wie Malvo war mit einem Armeeschild und einem Kurzschwert, dem Gladius, ausgerüstet. Um seinen rechten Arm und die Hand waren dicke Stoffstreifen gewickelt. Am linken Bein trug er eine Schiene aus Eisen, auf dem Kopf den Helm mit dem charakteristischen Kamm.
Wer noch nie einen Gladiatorenkampf verfolgt hatte, musste den Retiarius für chancenlos halten. Dieser Eindruck täuschte jedoch, wie Malvo sehr wohl wusste. Gerade wegen ihrer leichteren Ausrüstung waren die Retiarii flinker und wendiger als ihre Gegner und zudem äußerst geschickt im Umgang mit Netz und Dreizack. Eine kleine Unaufmerksamkeit des anderen genügte ihnen, um den Kampf für sich zu entscheiden.
Der Retiarius vor ihm hieß Nilus Pulpidus und war ein verurteilter Verbrecher, der die Arena der Hinrichtung vorgezogen hatte und auf verschlungenen Wegen in Eboracum gelandet war. Als Gladiator schien er seine wahre Bestimmung gefunden zu haben. Der mit mächtigen Muskeln bepackte Hüne kämpfte mit einer Wildheit und Leidenschaft, die ihresgleichen suchte. Als Malvo noch ein freier Mann gewesen war, hatte er einige seiner Kämpfe gesehen und ihn bejubelt. Nie hätte er sich träumen lassen, dass er eines Tages gegen ihn würde antreten müssen.
Bis vor drei Monaten war Malvo ein römischer Legionär gewesen. Ursprünglich stammte er aus Capri, wo das Leben wenig Perspektiven für ihn bereitgehalten hatte, weswegen er zur Armee gegangen war. Voller Stolz hatte er die rote Tunika übergestreift, bereit, Rom und dem Kaiser zu dienen. Nicht lange nach seinem Eintritt war seine Einheit nach Britannien abkommandiert worden. Das Land galt als rau und wild, die Bevölkerung als überwiegend feindselig. Malvo hatte sich nie beschwert und seine Pflicht getan.
Bis zu jener schrecklichen Nacht.
Warum er während seiner Wache eingeschlafen war, konnte er sich bis heute nicht erklären. Er hatte sich nicht mal besonders müde gefühlt. Trotzdem war es passiert, und er war erst aufgewacht, als ihn der Optio so hart ins Gesicht geschlagen hatte, dass es ihn beinahe von den Füßen gerissen hätte. Bei einem Feldzug hätte das sein Todesurteil bedeutet, so hätten sie ihn wahrscheinlich nur für einige Tage ins Loch gesteckt. Jedoch war er in Panik geraten, hatte, ohne nachzudenken, mit dem Speer nach dem Optio gestoßen und ihn an der Schulter verletzt.
Am nächsten Tag hatten sie ihn vor die Wahl gestellt. Arena oder Tod.
Im Prinzip hatte ihn damit dasselbe Schicksal wie Nilus ereilt, doch im Gegensatz zu diesem hasste er sein neues Dasein. Der Ton unter den Legionären war rau, jedoch nichts im Vergleich zu den Sitten, die bei den Gladiatoren herrschten. Für Malvo waren sie Abschaum. Tiere, die ihren Instinkten folgten und für die Gewalt lebten.
Notdürftig blinzelte er den Schweiß weg. Durch den Helm hörte er das Johlen und die Anfeuerungsrufe des Publikums nur gedämpft. Verglichen mit dem Circus Maximus in Rom war die Arena vor den Toren von Eboracum lächerlich klein. Nur machte es natürlich keinen Unterschied, ob man vor hundertfünfzigtausend Menschen starb oder vor tausend.
Aber er würde nicht sterben. Der Druide, der ihn vor zwei Wochen in seiner Zelle aufgesucht hatte, hatte es ihm versprochen. Er hatte ihm die Freiheit und das ewige Leben angeboten, wenn Malvo nur schwor, ihm zu dienen. Was er mit Freuden getan hatte. Zwar hatte er keine Ahnung, was Marton, so hatte sich der Druide genannt, mit ihm vorhatte, und der hatte es ihm auch nicht verraten. Aber es war ihm gleich, er hätte einfach alles getan, um hier rauszukommen. Nichts konnte schlimmer sein, als weiterhin mit den Gladiatoren eingesperrt zu sein und auf den sicheren Tod im Sand der Arena zu warten.
Marton hatte ihm versprochen, dass er nach diesem Kampf frei sein würde. Was nur bedeuten konnte, dass ihm der Sieg über Nilus gewiss war. Zwar hatte er keine Ahnung, wie er das anstellen sollte, doch irgendwie würde es schon funktionieren. Dieser Druide verfügte über magische Kräfte. Wie sonst hätte er wie aus dem Nichts in seiner verschlossenen Zelle auftauchen können, um danach genauso geheimnisvoll und plötzlich wieder zu verschwinden? Hatte sich aufgelöst wie Frühnebel.
Der Retiarius nahm eine geduckte Haltung ein und trat einen Schritt auf ihn zu, was die Zuschauer mit begeistertem Jubel quittierten. Ein feines Lächeln umspielte seine wulstigen Lippen. Das Netz hielt er locker in der linken Hand, die scharfen Spitzen des Dreizacks waren auf seinen Kontrahenten gerichtet.
Als Legionär war Malvo für den Kampf ausgebildet worden, nur würde ihm das gegen Nilus wenig nutzen, denn die Gladiatoren hatten eine völlig andere Technik. Während die Soldaten in der Regel Schulter an Schulter auf dem Schlachtfeld standen und darauf gedrillt waren, in Sekundenschnelle Formationen zu wechseln, kämpfte ein Gladiator stets für sich allein.
Nilus sprang auf ihn zu. Malvo riss den Schild hoch. Doch es war nur eine Finte gewesen, und der Angriff blieb aus. In dem Lärm konnte er zwar nichts hören, er registrierte aber, dass ihn sein Gegner auslachte. Erste Buhrufe mischten sich unter das Johlen der Zuschauer. Ihm war klar, dass sie ihm galten. Das Publikum hatte nicht viel Geduld mit ihm.
Der nächste Angriff war nicht nur vorgetäuscht. Der Retiarius machte einen schnellen Schritt nach links und stieß mit dem Dreizack zu. Im letzten Augenblick riss Malvo den Schild herum. Der Stoß war so wuchtig, dass er ihn beinahe fallengelassen hätte. Blindlings ließ er sein Schwert vorzucken, doch Nilus war längst außer Reichweite und schlug mit dem Netz nach ihm. In Höhe seiner Knie sauste es auf Malvo zu. Nur mit einem schnellen Sprung in die Luft konnte er verhindern, dass er getroffen wurde. Das schwere Netz hätte ihn glatt von den Beinen geholt.
Ein unwilliger Ausdruck erschien auf Nilus’ kantigem Gesicht. Offenbar hatte er fest damit gerechnet, Malvo zu erwischen.
Freiheit. Ewiges Leben.
Malvo zuckte zusammen. Das war die Stimme des Druiden gewesen, und er hatte die Worte so deutlich gehört, als würde er direkt neben ihm stehen. Aber bis auf Nilus und den Schiedsrichter, der den Kampf in gebührendem Abstand beobachtete, befand sich niemand in der Arena.
Er musste es beenden. Er wollte endlich hier raus.
Mit einem Aufschrei stürzte er auf Nilus zu und zielte mit dem ausgestreckten Schwert auf dessen ungeschützte Brust. Die Augen des Retiarius verengten sich. Blitzschnell wich er zur Seite aus und ließ ihn ins Leere laufen.
Plötzlich drehte Malvo seinem Gegner den Rücken zu. Er wirbelte herum. Zu spät! Durch die Sehschlitze sah er einen Schatten auf sich zufliegen. Im nächsten Moment warf ihn das Netz zu Boden.
Sofort war Nilus heran. Malvo wollte den Schild heben, als er bemerkte, dass er ihn verloren hatte. Sein Schwert hielt er noch in der Hand, aber da sich sein Arm im Netz verfangen hatte, war es nutzlos. Er konnte sich kaum bewegen.
Mit einer geradezu aufreizenden Lässigkeit näherte sich ihm Nilus. Sein Gegner konnte ihm nicht entkommen, also hatte er keinen Grund zur Eile. Deutlich zeichnete sich sein muskulöser Oberkörper vor dem trübgrauen Himmel ab. Mit siegesgewisser Miene hob er den Dreizack.
Die Menge auf den Rängen explodierte förmlich.
Malvos Gedanken rasten. Das war nicht möglich. Hatte Marton ihn betrogen? Aber wieso? Weshalb hatte er ihn den Eid schwören lassen? Tot würde er ihm nichts nutzen.
Nilus ließ den Dreizack sinken. Die scharfen Spitzen schoben sich unter die Kante des Helms. Malvo spürte das kühle Metall auf seinem Hals.
Wenn ein Gladiator einen guten Kampf lieferte, wurde er begnadigt. Vielleicht war das seine Chance. Dann registrierte er, was die Zuschauer lautstark forderten, und seine Hoffnung schwand.
Sie wollten seinen Tod.
Der Retiarius ließ sich nicht lange bitten. Seine Muskeln spannten sich, dann stach er zu. Ein scharfer Schmerz ließ Malvo keuchen. Er schmeckte Blut, und ihm wurde kalt. Das Bild vor seinen Augen verschwamm.
Neros neuer Palast war kleiner und weniger prunkvoll als der alte, der beim großen Brand im Sommer ein Opfer der Flammen geworden war. Der Kaiser bewohnte ihn jedoch nur übergangsweise, bis die Domus Aurea fertiggestellt war, was noch einige Jahre dauern würde. Was wenig verwunderlich war angesichts der Dimensionen dieses Projekts, überlegte Castor Pollux, als er an der Seite von Senator Urbanus die Stufen zum Eingang hinaufstieg. Nach seiner Fertigstellung würde es das gewaltigste Bauwerk sein, das man je in Rom errichtet hatte.
Einer der vier Prätorianer, die den Eingang bewachten, stellte sich ihnen in den Weg. »Wohin wollt ihr?«, blaffte er.
»Ich bin Senator Urbanus, und das ist Castor Pollux«, antwortete Urbanus ruhig. »Der Kaiser wünscht uns zu sprechen.«
»Das kann jeder behaupten.«
Kommentarlos hob Castor die Hand und präsentierte ihm den Ring, den ihm Nero bei ihrer ersten Begegnung ausgehändigt hatte. Im ganzen Reich kam das Schmuckstück mit dem kaiserlichen Siegel einem Türöffner gleich.
Der Prätorianer erbleichte, nickte knapp und gab den Weg frei.
»Vielen Dank«, sagte Castor und gab sich Mühe, die beiden Worte möglichst ironisch klingen zu lassen. Schon als er selbst noch Legionär gewesen war, hatte er wenig für die kaiserlichen Gardisten übriggehabt. Nicht nur in seinen Augen waren sie aufgeblasene Wichtigtuer, die sich in Rom ein schönes Leben machten, während die gewöhnlichen Soldaten in allen Teilen des Reichs ihre Haut riskierten. Und dafür kassierten sie auch noch einen höheren Sold.
Ihre Schritte hallten von den Wänden wider, während sie durch den langen Gang marschierten. Castor fiel ein, dass er Nero das erste Mal an seinem neuen Amtssitz aufsuchte. Ganz im Gegensatz zu Urbanus, der sich seit dem Feuer viel häufiger als früher im Palast aufhielt und dabei half, die Wiederaufbauarbeiten zu koordinieren. Umso verwunderlicher, dass ihn der Prätorianer nicht erkannt hatte. Vermutlich war er neu in der Truppe.
Die Arbeiten gingen viel schneller voran, als Castor und vermutlich die meisten Einwohner erwartet hatten. Bereits jetzt waren in vielen Bereichen der Stadt die Spuren der Vernichtung, die der Feuerdämon Colso hinterlassen hatte, beseitigt worden. Der Kaiser leistete ganze Arbeit, das musste ihm Castor lassen.
Er fragte sich, warum Nero ihn und Urbanus zu sich hatte rufen lassen. Selbst der Senator wusste es nicht, obwohl er gewöhnlich bestens informiert war. Heute Morgen war ein Bote in der Villa erschienen und hatte ihnen befohlen, sich um die Mittagszeit im Palast einzufinden.
Sie steuerten auf eine große Tür zu, vor der zwei von Neros germanischen Leibwächtern postiert waren. Große, muskulöse Männer mit langen blonden Haaren, die ihnen über die breiten Schultern fielen. Ihre struppigen Bärte reichten ihnen bis zur Brust. Bewaffnet waren sie mit mächtigen Langschwertern, die in Holzscheiden an ihren Gürteln baumelten. Mit finsteren Blicken musterten sie die Neuankömmlinge, machten aber keine Anstalten, sie aufzuhalten. Stattdessen öffnete einer von ihnen die Tür und bedeutete ihnen mit einer Geste, dass sie eintreten durften.
Auch Neros Thronsaal war kleiner als der vorherige. Der Kaiser trug eine einfache weiße Tunika und saß auf einem Thron aus Marmor. Öllampen tauchten den Raum in ein fahles Licht. An der Wand hinter ihm hatten vier weitere Leibwächter Aufstellung bezogen. Auf einem Tischchen neben dem Thron stand ein silbernes Tablett, auf dem sich mit Obst, Brot und Käse gefüllte Schalen sowie ein Krug befanden. In der Hand hielt Nero einen goldenen Kelch. Als er Castor und Urbanus hereinkommen sah, huschte ein Lächeln über sein breites Gesicht.
»Da seid ihr ja«, begrüßte er sie mit seiner hohen Stimme, die so gar nicht zu seiner stämmigen Gestalt passen wollte. »Wie geht es dir, Castor? Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen.«
In einer ehrerbietenden Geste senkte Castor den Kopf, bevor er antwortete. »Seit den Ereignissen am Tempel der Vestalinnen ist es zu keinen weiteren Angriffen der Finsteren gekommen, Herr.«
Inzwischen waren beinahe zwei Monate vergangen, seit seine Erzfeindin Cassia und die Kreaturen, die sich Jägerinnen nannten, in Rom aufgetaucht waren. * Beide waren auf der Suche nach Merle gewesen, die im Tempel der Vestalinnen Unterschlupf gefunden hatte. Er und Kimon hatten nicht verhindern können, dass Cassia die weiße Hexe vor ihren Augen getötet hatte. Wenn er daran dachte, hatte er das Gefühl, als läge ihm ein kalter, großer Stein im Magen.
»Das ist sehr gut«, riss ihn Neros Stimme aus seinen Erinnerungen. »Vielleicht haben sie es endlich aufgegeben, diese Finsteren.«
Davon war Castor alles andere als überzeugt, jedoch behielt er seine Meinung für sich. Widerspruch war etwas, mit dem der Kaiser gar nicht gut umgehen konnte. Die Finsteren würden niemals aufgeben, und das bereitete ihm Kopfschmerzen. Schließlich würde er nicht ewig leben und sich ihnen entgegenstellen können. Wenn es ihm nicht gelang, den Riss zu finden und ihn zu schließen, würde es eines Tages einen neuen Bezwinger geben müssen.
Castor hatte seine Mission von seinem Vater Aurel geerbt, den er nie kennengelernt hatte. Doch er scheute davor zurück, selbst einen Sohn und damit einen möglichen Nachfolger in die Welt zu setzen. Ein Kind wäre eine Schwachstelle, die die Finsteren mit Sicherheit gnadenlos ausnutzen würden. Urbanus’ Tochter Florentina war schon mehrfach in Gefahr geraten, nur weil sie mit ihm das Bett teilte. Was ihm zuweilen schlaflose Nächte bereitete.
»Was können wir für dich tun?«, richtete Urbanus die naheliegende Frage an den Kaiser.
Nero trank einen Schluck, bevor er antwortete. »So kenne ich dich, Urbanus. Du redest nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommst gleich zur Sache. Genau das schätze ich an dir. Ich verachte Männer, die sich am Klang ihrer eigenen Stimme berauschen, und davon gibt es gerade von deinem Stand viel zu viele.«
Urbanus nickte knapp, verzichtete jedoch auf eine Antwort. Es war kein Geheimnis, dass das Verhältnis zwischen Kaiser und Senat nicht eben von Herzlichkeit geprägt war. In Neros ersten Amtsjahren war das anders gewesen. Doch seitdem sich sein alter Lehrmeister Seneca vom Hof zurückgezogen hatte, lebte er seine Selbstherrlichkeit offen aus. Der Senat war ihm dabei kaum mehr als ein lästiger Splitter im Finger.
»Ich will euch von eurer Neugier, die ihr zweifellos hegt, erlösen«, fuhr er fort. »Wie ihr wisst, bin ich ein begeisterter Anhänger der Gladiatorenkämpfe.«
Auch das war keine Neuigkeit. Neros Begeisterung für die Gladiatoren wurde nur von der für die Wagenrennen übertroffen. Der Ludus Magnus, die kaiserliche Gladiatorenschule, war die größte ihrer Art in der Stadt.
»Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Britannien einen vielversprechenden jungen Kämpfer gibt. Einen Mann, wie man ihn sich in der Arena wünscht. Schnell, furchtlos, aggressiv und dabei von schlanker Gestalt, nicht so fett und unförmig wie die meisten anderen. Sein Name ist Godric. Ein Einheimischer, der einen unserer Steuereintreiber verprügelt hat. Man sagt, vier Legionäre seien nötig gewesen, um ihn zu bändigen. Er wurde nach Eboracum gebracht und in die Arena geschickt. Bis jetzt hat er keinen Kampf verloren, was wirklich erstaunlich ist, denn er hat schon wenigstens ein halbes Dutzend bestritten, und das in rascher Folge.«
Er machte eine Pause und sah Urbanus erwartungsvoll an. Der Senator legte den Kopf schief.
»Du möchtest diesen Godric nach Rom bringen lassen?«, fragte er.
Nero stellte seinen Becher auf dem Tablett ab und klatschte in die Hände. »Beinahe noch mehr als deine Direktheit schätze ich deinen Scharfsinn«, rief er begeistert aus. »Du hast es voll und ganz erfasst, Urbanus.«
Und was haben wir damit zu tun? , dachte Castor.
Nero gab ihm die Antwort. »Ich möchte ihn mir erst ansehen und mich persönlich von seinen Qualitäten überzeugen. Wie ihr wisst, reden die Leute viel, wenn der Tag lang ist. Nichts wäre peinlicher für mich, als ihn als Attraktion anzukündigen, und dann entpuppt er sich als schwächlicher Feigling.«
Castor musste sich beherrschen, um nicht die Stirn zu runzeln. Hatte er gerade richtig verstanden? Der Kaiser wollte nach Britannien? Um sich einen Gladiator anzusehen?
»Du … möchtest nach Britannien?«, fragte Urbanus, dem seine Verwirrung deutlich anzusehen war.
»Ganz recht, mein Freund. Ich werde zwar die Saturnalien verpassen, aber was soll’s? Nach dem, was vergangenes Jahr geschehen ist, sind sie mir sowieso vergällt.«
Damals hatten Anhängerinnen der Medusa den Sohn der Gorgone wiedererweckt. Um ein Haar wäre Castor in eine steinerne Statue verwandelt worden. Bei dem Gedanken überkam ihn ein Schauer.
»Aber … äh, mein Kaiser …«, stammelte der Senator.
Nero wedelte mit der Hand, als wolle er eine lästige Fliege verscheuchen. »Ich weiß schon, was du sagen willst. Gefährlich, beschwerlich und so weiter und so fort. Jedoch vermisse ich das Reisen. Ich muss mal wieder raus, und in Britannien war ich noch nie. Es hat Rom viel Mühe gekostet, diese seltsame Insel zu erobern, da möchte ich wenigstens ein einziges Mal dort gewesen sein.«
»Ich frage mich nur, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Der letzte Aufstand liegt nicht allzu lange zurück, wie du dich sicher erinnerst. Die Menschen könnten deinen Besuch als Provokation auffassen. Außerdem benötigen wir derzeit jeden Sesterz für den Wiederaufbau.«
»Sei unbesorgt, ich werde inkognito reisen. Mich unters einfache Volk mischen, wie man so schön sagt. Das ist billiger, und es wird mich niemand erkennen. Ich nehme lediglich vier meiner germanischen Leibwächter sowie Castor mit. Nur für den Fall, dass wir den Finsteren über den Weg laufen. Ach ja, Kimon sollte auch dabei sein. Nach allem, was ich gehört habe, wird ihm etwas Abwechselung guttun. In meiner Abwesenheit wirst du, Urbanus, die Wiederaufbauarbeiten leiten. Haben wir uns verstanden?«
Urbanus war der Mund offen stehengeblieben. Als er wieder das Wort ergriff, klang seine Stimme matt.
»Wie erklärst du dem Volk und dem Senat deine Abwesenheit?«
»Offiziell fahre ich mit meiner Frau Poppaea nach Antium. Zur Erholung, die vergangenen Wochen waren sehr fordernd für mich. Nur ich, sie und meine Germanen. Und ich wünsche, nicht gestört zu werden. In Wahrheit fährt sie natürlich allein.«
»Aha. Und du bist sicher, dass du eine solche Reise auf dich nehmen willst? Für einen Gladiator?«
»Selbstverständlich bin ich sicher, schließlich bin ich der Kaiser. Jetzt raus mit euch, ich habe viel zu tun heute. In einer Woche brechen wir auf. Und zu keinem ein Wort, versteht sich. Es herrscht strengste Geheimhaltung. Nicht einmal Poppaea weiß über mein tatsächliches Ziel Bescheid.«
Als sie den Palast verlassen hatten, schüttelte Urbanus den Kopf. »Das ist kaum zu glauben. Seine Einfälle werden immer verrückter«, grollte er. »Als ob wir sonst keine Sorgen hätten. Wo soll das noch hinführen?«
Castor zuckte mit den Schultern. Er versuchte, das Ganze so gelassen wie möglich zu nehmen. »Ich gebe Kimon Bescheid«, sagte er. »Er wartet am Tempel der Vestalinnen auf mich.«
Wenige Minuten, nachdem sie sich getrennt hatten, erreichte er den Tempel. Kimon stand mit hängenden Schultern am Fuß der Treppe und starrte auf eine weiße Rose zu seinen Füßen. Castor wusste, dass er selbst sie auf die Stufen gelegt hatte. Genau an dieser Stelle war Merle gestorben.
Seinem Freund hatte die weiße Hexe, die er beim Kampf gegen die Nebelreiter in Britannien kennengelernt hatte, viel bedeutet. Damals war sie in einen tiefen Schlaf gefallen, und niemand hatte sagen können, ob sie wieder erwachen würde. Zurück in Rom, waren Kimon und seine Landsfrau Zoe ein Paar geworden. Nach Merles Tod hatte sie ihn verlassen und war in ihre Heimat zurückgekehrt.
Es war der bitterste Tag in Kimons Lebens gewesen.
Castor legte ihm eine Hand auf die Schulter. Er zuckte zusammen, als sei er aus einem Traum erwacht.
»Wie war’s?«, wollte er wissen.
Sein Gesicht schien in den vergangenen Wochen um mehrere Jahre gealtert zu sein. Falten hatten sich auf der vorher glatten Haut gebildet, und das Strahlen aus seinen Augen war verschwunden.
»Wir haben einen neuen Auftrag«, erklärte ihm Castor.
»Hier ist es unheimlich, Lucius«, protestierte Ida und sah sich argwöhnisch um, wobei sie ihren Oberkörper mit den Armen umschlungen hielt.
»Ach was, hier gibt es höchstens ein paar Geister«, erwiderte Lucius und grinste. »Wenn wir Glück haben, wollen die nichts von kleinen Mädchen.«
»Du bist gemein«, zischte sie und boxte ihm gegen den Oberarm, was ihn abermals zum Kichern brachte. Daraufhin zog sie einen Schmollmund. Lucius kannte die hübsche Britannierin inzwischen gut genug, um zu wissen, dass er es nicht zu weit treiben durfte. Wenn er sie verärgerte, würde sie ihn nicht ranlassen. Dann wären all seine bisherigen Mühen umsonst gewesen.
Mit seinen einundzwanzig Jahren war er einer der jüngsten Legionäre in Eboracum. Ida hatte er bei der Rückkehr von einer Patrouille kennengelernt. Sie lebte mit ihrer Familie in der Siedlung vor den Toren des Lagers.
Bei seiner Ankunft vor einem knappen Jahr hatte er sich über die vielen Hütten im Schatten der Palisaden gewundert. Sein Freund Alban, ein Veteran und über zehn Jahre älter als er, hatte ihm erklärt, dass sich in der Nähe der römischen Befestigungen immer Einheimische ansiedelten. Nicht zu Unrecht hofften sie, an den Soldaten gutes Geld zu verdienen, indem sie Lokale und Bordelle betrieben oder Waren feilboten. Solche Siedlungen konnten sich im Laufe der Zeit zu großen Städten auswachsen, in denen es auch Badehäuser und andere Annehmlichkeiten gab. Nach Albans Einschätzung war die Siedlung auf dem besten Weg dorthin. Und in der Tat schienen jeden Tag neue Hütten wie Pilze aus dem Boden zu wachsen.
Inzwischen gab es sogar einen Circus, in dem regelmäßig Gladiatorenkämpfe stattfanden. Zur Begeisterung der Legionäre, die für jede Zerstreuung dankbar waren. Auch viele Einheimische hatten daran Gefallen gefunden.
Mit ihren langen blonden Haaren und ihren Augen, die so blau waren wie ein wolkenloser Sommerhimmel, war ihm Ida sofort aufgefallen. Er hatte sie angelächelt, und sie hatte es erwidert. Sehr zum Unmut ihres Vaters, einem grobschlächtigen Kerl, der sie augenblicklich ins Haus befohlen hatte.
Doch die Saat zwischen ihnen war bereits gesät gewesen.
In den folgenden Tagen hatte es immer wieder zufällige Begegnungen zwischen ihnen gegeben. Lucius hatte jede freie Minute genutzt, um einen Abstecher in die Siedlung zu machen, was ihm bald zweideutige Kommentare seiner Kameraden eingebracht hatte. Natürlich ahnten sie, dass etwas im Busch war. Liebeleien zwischen Soldaten und den einheimischen Frauen waren längst überall alltäglich. Manchmal endeten sie, wenn ein Legionär abkommandiert wurde. Oft aber folgte die Frau ihrem Auserwählten und heiratete ihn, sobald seine Dienstzeit beendet war.
Ida sprach erstaunlich gut Latein, was die Sache einfacher machte, bei Lucius aber die Frage aufwarf, ob er der erste Römer war, mit dem sie sich einließ. Vermutlich nicht, und aus irgendeinem Grund behagte ihm der Gedanke nicht.
Er nahm sie in die Arme. »Ich beschütze dich«, sagte er ernst.
»Gegen Geister wird selbst ein römischer Legionär wenig ausrichten können.«
»Da kennst du uns Legionäre aber schlecht.«
Er zog sie an sich und küsste sie. Willig öffnete sie die Lippen. Als sie sich an ihn schmiegte, konnte er ihre Brüste spüren. Innerlich jubilierte er. Diesen Moment hatte er herbeigesehnt, seit er Ida zum ersten Mal begegnet war.
Lächelnd löste sie sich von ihm. »Ich glaube, der kleine Soldat möchte befreit werden«, flüsterte sie.
Er grinste. »So klein ist er gar nicht.«
Mit der flachen Hand strich sie über die deutlich sichtbare Beule unter seiner Tunika, was ihm ein Stöhnen entlockte.
»Fühlt sich ganz so an. Es ist recht kühl. Er sollte dringend ins Warme.«
Lucius’ Mund war trocken geworden. »Gleich hier?«
»Einen besseren Ort werden wir auf diesem Friedhof kaum finden, glaubst du nicht?«
Da hatte sie allerdings recht.
Idas Vater betrieb eine kleine Schenke, und obwohl er kein Problem damit hatte, den Soldaten für sauren Wein und dünne Suppe ihr Geld aus der Tasche zu ziehen, konnte er die Römer nicht leiden. Entsprechend wütend wurde er, wenn er Lucius auch nur in Idas Nähe erwischte. Einmal hatte er ihn sogar beschimpft und drohend die Faust in seine Richtung geschüttelt.
Was Lucius vor das Problem stellte, dass der Alte sie nicht zusammen sehen durfte. Ins Lager konnte er Ida nicht mitnehmen, Frauen waren dort verboten. Es war Alban gewesen, der ihn auf die Idee mit dem kleinen, an die Arena angrenzenden Gladiatorenfriedhof gebracht hatte. Dort trieb sich nachts niemand herum, sie würden also ungestört sein.
»Der ideale Ort, um die Kleine aufs Kreuz zu legen«, hatte Alban gesagt. »Im Schatten der Mauer sieht euch keiner, selbst wenn jemand daran vorbeimarschiert.«
Zuerst war Lucius die Idee etwas absonderlich vorgekommen. Doch als er eine Weile darüber nachgedacht hatte, hatte er zugeben müssen, dass Albans Vorschlag etwas für sich hatte.
Es hatte eine Weile gedauert, um auch Ida davon zu überzeugen, doch schließlich hatte sie eingewilligt.
Sie legte sich auf den Rücken und schob ihr Kleid hoch. Deutlich zeichnete sich ihre dunkle Scham auf ihrer hellen Haut ab.
»Kommst du?«, gurrte sie.
Hastig streifte er sich seine Tunika über den Kopf und legte sich auf sie. Aus dem Augenwinkel bemerkte er einen Grabstein, der so nahe war, dass er ihn mit ausgestreckter Hand hätte berühren können. Für einen Moment überkam ihn Scham darüber, es direkt neben einem Grab zu treiben. Dann umfasste Idas kühle Hand sein Glied und führte es zwischen ihre Beine.
Als er in sie eindrang, bohrten sich ihre Fingernägel in seinen Rücken. Er hatte sich gefragt, ob sie noch Jungfrau war. Nun, das konnte er definitiv verneinen, denn sie bewegte sich unter ihm so geübt wie die Huren, die er gelegentlich aufsuchte.
Plötzlich hielt sie inne.
»Warte«, flüsterte sie.
Er runzelte die Stirn. »Was ist?«
»Da war ein Geräusch.«
»Sicher nur ein Tier.«
Als er sie küssen wollte, drehte sie den Kopf weg.
»Das war kein Tier. Es hörte sich an, als ob jemand ein Schwert zieht.«
»Hier hat nur einer ein Schwert, und das werde ich vorläufig ganz sicher nicht rausziehen.«
»Hör auf mit dem Unsinn, ich meine es ernst. Bitte, steh auf und sieh nach.«
»Ida, wir sind …«
Er verstummte. Ihr Blick hatte sich auf etwas hinter ihm gerichtet. Ihre Augen weiteten sich. Blankes Entsetzen stand darin.
Er rollte sich von ihr herunter und auf den Rücken. Schlagartig fiel seine Erektion in sich zusammen.
Keine fünf Schritte entfernt stand ein Gladiator im silbernen Mondlicht. Er trug den Helm eines Secutors, in seiner ausgestreckten rechten Hand hielt er das Kurzschwert. Die kreisrunden Sehschlitze waren auf Lucius gerichtet. Reste von trockener Erde klebten an seinem Helm und an seinem Körper.
Lucius stieß einen lautlosen Fluch aus. Das war einer seiner Kameraden, der sich einen blöden Scherz erlaubte. Wahrscheinlich hatte Alban rumerzählt, dass er sich mit Ida auf dem Friedhof treffen würde. Irgendwie war der Kerl an die Ausrüstung gekommen.
Oder steckte sein Freund am Ende selbst unter dem Helm?
So ein Drecksack!
Mit wachsendem Ärger rappelte er sich auf. »Was soll der Scheiß?«, blaffte er. »Ich bin beschäftigt. Findest du das etwa witzig?«
Eigentlich hatte er erwartet, dass der Mann spätestens jetzt in Gelächter ausbrechen würde. Doch er rührte sich nicht.
Lucius trat auf ihn zu. Ein seltsamer Geruch stieg ihm in die Nase. Inzwischen war er jedoch so wütend, dass er nicht darauf achtete.
»Ich war gerade mittendrin, und das im wahrsten Sinne des Wortes«, zischte er so leise, dass es Ida nicht hören konnte. »Du weißt, dass ich für jeden Scherz zu haben bin, aber das geht zu weit. Verschwinde, bevor ich dir Beine mache.«
In einer blitzschnellen Bewegung rammte ihm der Gladiator das Schwert in den Bauch. Ein glühender Schmerz raste durch seine Eingeweide. Lucius hörte noch Idas gellende Schreie, bevor er zusammenbrach.
Sie waren mit zwei von Pferden gezogenen Karren unterwegs. Im vorderen saßen Nero, Castor und Kimon, gefolgt von den vier Germanen. Bis auf ihr Gepäck waren die Wagen leer. Abwechselnd machten es sich jeweils zwei Germanen auf der Ladefläche gemütlich, da der Kutschbock nicht genügend Platz für die vier großen Männer bot.
Ihre Namen lauteten Alpin, Peredur, Morcant und Gandor. Sie ähnelten sich nicht nur äußerlich, sondern waren auch gleichermaßen schweigsam. Seit ihrem Aufbruch hatten sie kaum mehr als ein paar Handvoll Sätze mit ihren Reisegefährten gewechselt. Latein beherrschten sie leidlich. Wenn sie sich untereinander unterhielten, dann in ihrer eigenen Sprache, sodass Castor kein Wort verstand.
Wenn ihnen jemand begegnete, gaben sie sich als Händler aus, die in Britannien Waren kaufen wollten, um sie in Rom unter die Leute zu bringen. Nero hatte einen falschen Namen angenommen und nannte sich Tiron Valvus. Die Germanen fungierten als Sklaven, weswegen sie ihre Waffen unter einer Plane verbargen. In Eboracum angekommen, würden sie die Tarnung wechseln. Dann würde Nero ein Gesandter der kaiserlichen Gladiatorenschule und sie seine Begleiter sein.
Nach einer äußerst stürmischen Überfahrt waren sie gestern auf der Insel gelandet und jetzt auf dem Weg Richtung Lager. Wenn Castor an die raue See zurückdachte, wurde ihm jetzt noch übel. Mehrmals hatte er sich übergeben müssen, worüber sich die Germanen köstlich amüsiert hatten. Die Karren, mit denen sie in Rom aufgebrochen waren, hatten sie im Hafen gelassen und sich auf der Insel neue besorgt. Das Schiff war zu klein für sie gewesen.
Anfangs hatte sich Nero äußerst zurückhaltend gegeben und sein Gesicht die meiste Zeit des Tages mit der Kapuze seines Mantels verhüllt, da er fürchtete, erkannt zu werden. Das änderte sich, nachdem sie Italien hinter sich gelassen hatten. Wenn sie in einer Schenke Rast machten, suchte er das Gespräch mit den Einheimischen und trank und lachte mit ihnen. Nie zuvor hatte ihn Castor so entspannt erlebt.
Wie man sich erzählte, hatte Nero früher großen Gefallen daran gefunden, in Rom mit seinen Freunden durch die Tavernen zu ziehen, was nicht selten in einer Schlägerei geendet hatte. Offenbar liebte er es, sich unter das gewöhnliche Volk zu mischen.
Mit jedem Tag wurde er ausgelassener, und Castor hoffte inständig, dass seine gute Laune nicht umschlug und er mit jemandem Streit anfing. Ihre Mission war heikel genug. Nicht wenige Britannier hätten bestimmt großen Gefallen daran gefunden, dem römischen Kaiser eigenhändig die Kehle durchzuschneiden.
Es war ein seltsames Gefühl, Seite an Seite mit dem mächtigsten Mann der Welt durch das Land zu reisen. Auch seinen Begleitern gegenüber gab sich Nero völlig ungezwungen. Einmal hatte er sogar von Castor wissen wollen, wie Florentina im Bett war. Nur mit Mühe hatte Castor seinen Ärger unterdrückt und war der Frage so lange geschickt ausgewichen, bis er endlich Ruhe gegeben hatte.
»Da vorne«, rief Nero aus und deutete auf ein Gebäude am Wegrand, das etwa zweihundert Schritte entfernt war. »Sicher ein Gasthaus. Dort machen wir Rast. Es wird bald dunkel, und wer weiß, ob wir etwas Besseres finden. Auf keinen Fall will ich im Freien übernachten.«
Castor nickte. Tatsächlich neigte sich der trübe Tag allmählich seinem Ende zu. Seit dem Morgen verdeckten tiefgraue Wolken den Himmel, und es wehte ein leichter, aber kühler Wind, der unter ihre Mäntel kroch. Er sehnte sich nach einer warmen Mahlzeit und einem weichen Bett.
Neros Vermutung erwies sich als richtig. Zum blutigen Schwein stand in ungelenker Schrift auf einem Schild, das über den Eingang genagelt worden war. Das Gebäude hatte zwei Stockwerke, was darauf schließen ließ, dass hier Zimmer vermietet wurden. Neben die Schenke hatte man einen Stall gebaut. Ein paar Pferde standen darin und mampften gemütlich ihr Heu, wie Castor durch das halb geöffnete Tor erkennen konnte.
Ihre kleine Reisegruppe kletterte von den Karren und betrat die Schenke, wobei Castor ihnen voranging. Der Gastraum war geräumiger, als es von außen den Anschein hatte. Es gab beinahe zwanzig Tische, von denen nur drei besetzt waren. Hinter dem Tresen stand ein stämmiger Mann, der den Kopf hob, als er die Tür knarren hörte.
»Was kann ich für euch tun?«, rief er ihnen auf Griechisch zu.
»Wir brauchen ein Essen und ein Bett für die Nacht«, antwortete Castor.
»Wie viele seid ihr?«
»Sieben. Drei Händler und vier Sklaven. Außerdem haben wir vier Pferde, die versorgt werden müssen.«
»Gaswan!«, brüllte der Wirt.
Ein junger Bursche trat hinter einem Vorhang neben dem Tresen hervor. Sein Haar war zerzaust, sein Gesicht schmutzig, seine Kleidung zerrissen. Das linke Auge war halb geschlossen und von einem rotblauen Schatten umrandet. Scheinbar hatte er erst vor Kurzem eine Tracht Prügel kassiert.
Der Wirt zeigte stumm mit dem Kinn zur Tür, worauf der Bursche an ihnen vorbei und nach draußen eilte. Castor entging nicht, dass er sein linkes Bein nachzog.
»Ich habe nur noch vier Zimmer frei«, erklärte ihnen der Wirt. »Eins müssen sich eure Sklaven teilen, es ist groß genug. Allerdings werden zwei auf dem Boden schlafen müssen.«
»Das ist kein Problem«, schaltete sich Nero ein. »Bring uns etwas zu essen und Wein, wir setzen uns dort drüben hin.«
Kaum hatte er die Worte ausgesprochen, steuerte er auf den größten Tisch zu. Die beiden Bänke boten Platz für wenigstens zehn Personen. Mit einem behaglichen Seufzen ließ sich Nero nieder. Castor, Kimon und die Germanen taten es ihm gleich.
Keine Minute später kam der Wirt mit einem großen Tablett und verteilte zwei große Krüge und sieben Tonbecher auf dem Tisch, bevor er wortlos wieder davonstapfte.
Castor sah sich um. Die übrigen Gäste saßen auf der anderen Seite des Raums. Bei ihrer Ankunft waren sie von ihnen neugierig beäugt worden, jetzt hatten sie das Interesse verloren und waren in ihre Gespräche vertieft. Das war ihm nur recht.
Einer der Germanen griff nach dem Krug und schenkte allen Wein ein. Nero nahm seinen Becher, prostete ihnen in einer affektierten Geste zu, trank einen Schluck und verzog das Gesicht.
»Sauer wie Essig«, murrte er. »Nur Barbaren können so etwas trinken.«
Einer der anderen Gäste hob den Kopf und warf ihnen einen finsteren Blick zu.
»So etwas solltest du nicht so laut sagen«, mahnte Kimon mit gesenkter Stimme.
Nero schnaufte, nippte ein weiteres Mal und schwieg.
Kurz darauf kehrte der Wirt mit einem dampfenden Topf zurück, den er in ihre Mitte stellte. Neugierig riskierte Castor einen Blick. Sein Herz sank. Er hatte nicht mit einem Festmahl gerechnet, doch die breiartige Pampe sah nicht so aus, als ob sie auch nur annähernd lecker schmecken würde.
»Eintopf«, erklärte der Wirt knapp und ging.
Castor fragte sich, ob von ihnen erwartet wurde, dass sie mit den Händen aus dem Topf aßen, als der Vorhang erneut beiseitegeschoben wurde und eine blonde junge Frau dahinter hervorkam. Das dicke Haar hatte sie zu zwei Zöpfen geflochten, ihr braunes Gewand saß eng und brachte ihre Figur und vor allem ihre großen Brüste zur Geltung. In den Händen trug sie einen Stapel Holzschalen sowie mehrere Löffel.
Als sie sich ihnen näherte, bemerkte Castor, dass Nero sie mit leicht geöffnetem Mund anstarrte. Er ließ sie nicht aus den Augen, während sie die Schalen und die Löffel auf dem Tisch verteilte.
»Verstehst du Griechisch?«, richtete er das Wort an sie.
Castor versteifte sich. In ihren Gesichtszügen hatte er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Wirt erkannt. Er wäre jede Wette eingegangen, dass es sich bei ihr nicht um eine Hure, sondern um dessen Tochter handelte.
Schweigend schüttelte sie den Kopf.
»Ich kenne eine Sprache, die jeder versteht«, erwiderte Nero, und bevor es jemand verhindern konnte, packte er sie, zerrte sie auf seinen Schoß und betatschte mit einer Hand ihre Brüste, während er sie mit der anderen festhielt.
Die Frau schrie auf. Köpfe flogen herum. Die Männer auf der anderen Seite sprangen von ihren Bänken. Mit hochrotem Gesicht eilte der Wirt heran. In seiner schwieligen Hand hielt er einen äußerst stabil wirkenden Holzknüppel.
»Lass sie sofort los«, knurrte er Nero an.
»Was soll die Hure kosten?«, fragte dieser stattdessen in gelassenem Ton. »Ich nehme sie für die ganze Nacht.«
»Sie ist meine Tochter.«
»Das stört mich nicht. Also, wie viel willst du?«
Der Wirt stieß einen wütenden Schrei aus und schwang den Knüppel. In einer blitzschnellen Bewegung verpasste ihm einer der Germanen einen Stoß gegen die Brust, der ihn zurücktrieb.
Ein vielstimmiges metallisches Scharren war zu hören. Die anderen Gäste hatten ihre Schwerter gezogen. Es waren etwa ein Dutzend, und von ihrer Gruppe waren nur Castor und Kimon bewaffnet. Ihm wurde klar, dass der römische Kaiser kurz davorstand, bei einer Wirtshausprügelei getötet zu werden.
Das schien auch Nero begriffen zu haben, denn er hatte endlich die Frau losgelassen. Schluchzend rannte sie davon und verschwand hinter dem Vorhang.
Drohend richtete der Wirt den Knüppel auf ihn. »Ihr alle werdet mein Haus jetzt verlassen. Ihr habt die Wahl, ob ihr dabei auf euren eigenen Füßen gehen oder hinausgetragen werdet.«
»Was erlaubst du dir?«, zischte Nero. »Ich bin …«
»Ein Kaufmann, dem der Wein zu schnell zu Kopf gestiegen ist«, fiel ihm Kimon ins Wort. »Es ist nicht nötig, Gewalt anzuwenden, Wirt. Wir entschuldigen uns für den Vorfall und gehen.« Aus einem Beutel an seinem Gürtel nahm er ein paar Münzen und warf sie auf den Tisch. »Das sollte für den Wein und den Eintopf reichen.«
Mit diesen Worten packte er Nero am Arm, zog ihn hoch und in Richtung Tür hinter sich her. Während sie ihm folgten, hielten die Germanen die Bewaffneten im Auge. Castor verließ die Schenke als Letzter.
Kaum waren sie draußen, riss Nero seinen Arm los. »Wie kannst du es wagen?«, fauchte er Kimon an.
»Herr, ich habe dir schon einmal das Leben gerettet, und ich glaube, gerade habe ich es wieder getan«, entgegnete Kimon ungerührt. »Du hättest ihnen beinahe verraten, wer du bist. Was glaubst du, was dann passiert wäre?«
Nero funkelte ihn an. »Und was machen wir jetzt?«
»Zurück können wir jedenfalls nicht, und es dämmert bereits«, antwortete Castor. »Wir werden uns wohl oder übel einen Schlafplatz im Freien suchen müssen.«
Der junge Bursche mit dem blauen Auge war gerade dabei, den Stall auszumisten, und staunte nicht schlecht, als sie ihre Pferde wieder einspannten. Wenige Minuten später waren sie unterwegs und fanden bald in einem Wäldchen eine Lichtung, wo sie die Nacht verbringen konnten. Mit knurrendem Magen hüllte sich Castor in seine Decke und hoffte, dass es wenigstens trocken blieb.
Etwa eine Stunde später weckten ihn die ersten Regentropfen.
»Einen Becher Wein, Lupo?«, fragte Amatus Macitus und goss bereits ein. Der Kommandant von Eboracum kannte seinen Stellvertreter gut genug, um zu wissen, dass der zu einem guten Tropfen niemals Nein sagte. Erst vor zwei Wochen war ihm aus Rom ein halbes Dutzend Amphoren geliefert worden, darunter drei ausgezeichnete Falerner. Um das Gesöff, das sie in dem schäbigen Gasthaus vor den Toren des Lagers ausschenkten, machte Amatus einen weiten Bogen.
Lupo Fulvius schnalzte mit der Zunge, nahm den Becher und trank einen kräftigen Schluck. Er war nicht nur zehn Jahre jünger als Amatus, sondern auch fast einen Kopf kleiner und so dürr, dass ihn sein massiger Vorgesetzter hin und wieder scherzhaft mahnte, er solle bei zu starkem Wind aufpassen, dass er nicht davongeweht wurde. Doch vor allem war er ein kluger Kopf und der beste Stellvertreter, den man sich wünschen konnte.
Amatus fuhr mit den Fingern durch sein kurz geschnittenes Haar, das zu seinem Leidwesen beinahe vollständig ergraut war, und nahm selbst einen Schluck. Wie immer übte der Wein umgehend eine beruhigende Wirkung auf ihn aus. Was heute den zusätzlichen Effekt hatte, dass er schläfrig wurde. Vergangene Nacht war er von Albträumen geplagt worden und fühlte sich müde. Beinahe wäre er der Versuchung erlegen, für einen Moment die Augen zu schließen.
»Warum hast du mich rufen lassen?«, wollte Lupo wissen. »Sicher nicht nur, um mir diesen köstlichen Wein anzubieten.«
Amatus rieb sich mit zwei Fingern die Nasenwurzel, um die Müdigkeit zu vertreiben. »Scharfsinnig wie immer, Lupo. Ich sag’s kurz und geradeaus. Heute Morgen hatte ich Besuch von einem Boten aus Rom. Der Kaiser ist auf dem Weg hierher.«
Ein ungläubiger Ausdruck trat auf Lupos schmales Gesicht. »Nero kommt nach Eboracum?«
»So ist es. Ich konnte es auch erst kaum glauben, aber das Siegel war zweifellos echt. Allerdings nennt er sich Tiron Valvus.«
Das steigerte Lupos Verwirrung nur noch. »Was will er denn hier?«
»Sich einen Gladiator ansehen.«
Lupo schüttelte den Kopf. »Du treibst Scherze mit mir, Amatus.«
»Es ist mein bitterer Ernst. Es geht um einen der Einheimischen, diesen Godric.«
»Ein sehr guter Kämpfer. Meiner Meinung nach ist er der beste. Aus dem wird noch was Großes.«
»Was sich wohl bis nach Rom herumgesprochen hat. Nero will sich mit eigenen Augen von seinen Qualitäten überzeugen. Schätze, dass auf Godric eine Karriere im Circus Maximus wartet.«
»Und nur deswegen nimmt er eine solche Reise auf sich? Das klingt absurd.«
»Nach allem, was man so hört, hat Nero eine gewisse Neigung zu, sagen wir mal, unkonventionellen Ideen. Aber das ist noch nicht alles. Er ist inkognito unterwegs, und wir beide sollen dafür sorgen, dass das so bleibt. Er will im Lager Quartier beziehen, möchte aber nicht, dass die Männer mitbekommen, dass ihr Kaiser unter ihnen weilt. Und die Britannier natürlich erst recht nicht.«
»Hm.« Lupo schürzte die Lippen. »Wie will er sicherstellen, dass ihn niemand von unseren Leuten erkennt?«
Amatus zuckte mit den Schultern. »Das ist ein Risiko, das wir wohl eingehen müssen.«
»Bei den Göttern, wenn die Britannier davon erfahren …«
»Das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Sollte Nero in Eboracum etwas passieren, könnte uns das den Kopf kosten.«
»Was ist mit dem Boten? Weiß er, was für eine brisante Nachricht er da befördert hat?«
»Da ist Nero auf Nummer sicher gegangen. Zum einen war das Schreiben versiegelt und der Bote des Lesens nicht mächtig. Und selbst wenn er es gelesen hätte, hätte er es niemandem erzählen können. Er war nämlich stumm.«
»Dennoch …«
Amatus hob eine Hand. »Inzwischen ist er außerdem tot. In dem Brief stand, dass er sofort nach Aushändigung hinzurichten sei.«
»Die berühmte römische Gründlichkeit.«
»So kann man es ausdrücken.«
»Der Kaiser hätte sich keinen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Unsere Leute sind wegen dieser Morde ziemlich nervös, und die Einheimischen auch.«
Mit einem Seufzer lehnte sich Amatus auf seinem Stuhl zurück. Wie meistens hatte Lupo recht. Der erste Vorfall war gerade acht Wochen her. Ein junger Legionär namens Lucius hatte sich mit einer hübschen Britannierin ausgerechnet auf dem Gladiatorenfriedhof vergnügt, als ihm sein unbekannter Mörder ein Schwert in die Brust gerammt hatte. Die Frau hatte fliehen können und behauptet, Lucius sei von einem Gladiator angegriffen worden. Ihrer Beschreibung nach musste es sich um einen Secutor handeln. Allerdings gab es gerade keinen Secutor in Eboracum. Vielleicht hatte sie ihn mit einem Murmillo verwechselt, die sahen so ähnlich aus. Nur wurden die einzigen beiden Murmillos – von denen einer Godric war – nachts eingesperrt.
Eine Woche später hatte sie mit ihrer Familie die Siedlung verlassen. Es hieß, sie habe sich nicht mehr aus dem Haus getraut.
Einige Tage später waren zwei weitere Legionäre ermordet worden. Man fand sie in der Nähe des Friedhofs. Die Woche danach war ein Einheimischer aufgeschlitzt worden. Inzwischen hatte es vierzehn Opfer gegeben. Alle hatte man auf oder in der nahen Umgebung dieses verdammten Friedhofs gefunden. Amatus hatte ihn eine Zeit lang bewachen lassen, woraufhin es keine weiteren Vorfälle gegeben hatte.
Bis vorgestern, zwei Tage, nachdem er die Wachen wieder abgezogen hatte. Diesmal hatte das Opfer entkommen können. Der Legionär, ein Mann namens Julius Tullius, hatte Stein und Bein geschworen, dass sich ihm ein Secutor in den Weg gestellt habe, als er auf dem Nachhauseweg gewesen sei. Er hatte nur entkommen können, weil er sofort die Flucht ergriffen hatte, anstatt sich auf einen Kampf einzulassen. Nicht besonders mutig, wie Amatus fand.
Wenigstens wussten sie jetzt, dass die Britannierin keinen Hirngespinsten erlegen gewesen war. Die Beschreibung des Angreifers, die Julius dank der klaren Vollmondnacht hatte liefern können, hatte höchst beunruhigend geklungen. Demnach hatte der Körper des Mannes verwest ausgesehen. An einigen Stellen wären die blanken Knochen zu sehen gewesen.
Obwohl er ein Mann der schnellen Entscheidungen war, wusste Amatus diesmal nicht, was er tun sollte. Fürs Erste hatte er den Befehl gegeben, dass sich nachts ab sofort niemand mehr in der Nähe des Friedhofs herumtreiben durfte. Was bedeutete, dass die Männer einen Umweg in Kauf nehmen mussten, wenn sie in die Schenke wollten, denn vom Lager aus führte der Weg dorthin direkt daran vorbei.
Der Friedhof lag neben der Arena. Nicht auszudenken, wenn der Unheimliche auftauchte, während sich der Kaiser dort aufhielt. Amatus hatte sogar mit dem Gedanken gespielt, die für in zehn Tagen angesetzten Spiele abzusagen. Das konnte er sich jetzt wohl aus dem Kopf schlagen. Nero würde Godric auf jeden Fall in Aktion erleben wollen.
Es war ein elendes Dilemma.
»Wann wird er in Eboracum eintreffen?«, riss ihn Lupo aus seinen Überlegungen.
»Vermutlich in einer Woche«, antwortete er. »Die Männer werden sich fragen, warum sich Zivilisten im Lager aufhalten. Sag ihnen, er wäre ein Abgesandter des kaiserlichen Ludus, der sich Godric anschauen möchte. Aus einer gewissen Perspektive heraus ist das sogar die Wahrheit und außerdem Neros offizielle Tarnung, was ebenfalls in dem Brief stand. Noch einen Becher Wein?«
»Nach den Neuigkeiten kann ich einen zweiten vertragen.«
Als Godric aus seiner Zelle ins Freie trat, war der Himmel wolkenverhangen, wie eigentlich immer an diesen kühlen Wintertagen. Über seinem breiten Gürtel trug er eine dicke Tunika, den Hals schützte er mit einem Schal vor der morgendlichen Kälte.
Nilus Pulpidus erwartete ihn bereits auf dem Übungsplatz. Natürlich mit nichts als seinem Lendenschurz und den Stiefeln bekleidet. Er behauptete stets, dass ihm die Kälte nichts ausmache. Godric glaubte, dass das lediglich einer seiner vielen Kniffe war, um seine Gegner zu beeindrucken und zu verunsichern. Was das anging, war der Retiarius außerordentlich geschickt. Stand sein nächster Kontrahent fest, zog er alle Register, damit dieser sich schon vor dem Kampf in die Tunika machte. Einmal hatte er für einen unendlich lang scheinenden Moment ein glühendes Kohlestück in die Hand genommen und fest mit seinen kräftigen Fingern umschlossen. Sein Gegner, ein Scissor, war bei dem Anblick kreidebleich geworden. Der Kampf am nächsten Tag hatte nicht lange gedauert.
An Godric prallte das alles ab. Er konzentrierte sich ausschließlich auf sich selbst. Damit war er bis jetzt gut gefahren.
»Na, Süßer, ob wir beim großen Schlachtfest wohl aufeinandertreffen werden?«, empfing ihn Nilus. »Wird Zeit, dass endlich alle sehen, dass ich besser bin als du.«
Godric ignorierte die Provokation. Mit Schlachtfest hatte Nilus die Spiele gemeint, die bald stattfinden würden. Der Ausrichter, irgendein britannischer Edelmann, hatte sich etwas Besonderes ausgedacht. Fünf Gladiatorenpaare sollten gegeneinander antreten. Vier der Gewinner kämpften anschließend gegeneinander, während der fünfte sich ausruhen durfte. Wer das sein würde, durfte das Publikum entscheiden. Er musste erst wieder gegen den Mann antreten, der auch die zweite und dritte Runde gewonnen hatte.
Godric war davon überzeugt, dass er diese letzte Runde erreichen würde, und er hielt es für mehr als wahrscheinlich, dann gegen Nilus antreten zu müssen. Seinen ersten Kampf würde er gegen einen anderen Gladiator bestreiten, das wusste er bereits.
Bislang hatten sich er und Nilus noch nie miteinander gemessen. Er wusste, dass ihn der Retiarius hasste. Früher war nämlich er der beliebteste Kämpfer in Eboracum gewesen. Diese Zeiten waren vorbei, inzwischen hatte Godric die meisten Anhänger. Dass er ein Einheimischer war, verstärkte die Demütigung für Nilus nur noch. Der Römer machte keinen Hehl daraus, dass er die Britannier für Tiere hielt, gerade mal gut genug für die Sklaverei.
Als sie ihn damals in die Unterkünfte der Gladiatoren gebracht hatten, hatte Godric zunächst nicht geglaubt, lange durchzuhalten. Zu seinem eigenen Erstaunen hatte er sich als überragender Kämpfer erwiesen. Eine Karriere, auf die er jedoch gerne verzichtet hätte.
Schweigend zog er das Holzschwert aus seinem Gürtel. Auch Nilus hatte eine Übungswaffe aus Holz, die Spitzen der Zinken waren zudem stumpf. Schmerzhaft bei einem Treffer, aber nicht lebensgefährlich.
»Fangen wir an, Süßer«, blaffte er und stürmte auf Godric zu.
Obwohl er blitzschnell zur Seite auswich, erwischte ihn der Dreizack am Oberarm. Nur mit Mühe verbiss er sich einen Schmerzenslaut.
»Tut weh, was?«, fragte Nilus und kicherte.
»Das war unfair. Ich habe meinen Schild und meinen Helm noch nicht an mich genommen«, sagte Godric. Beides lehnte an einer Wand am Rand des Übungsplatzes.
Ein höhnischer Ausdruck erschien auf Nilus’ Gesicht. »Und wenn schon. Machen wir’s etwas spannender heute.«
Wieder zuckte der Dreizack auf ihn zu. Godric sprang rückwärts und entging nur knapp der Attacke. Diesmal hatte der Mistkerl auf seinen ungeschützten Kopf gezielt.
Nilus spuckte in den Sand. »Mehr hast du nicht drauf?«
Aus dem Augenwinkel bemerkte Godric, dass die anderen Gladiatoren ihre Übungen eingestellt hatten und ihnen interessiert zuschauten.
Unvermittelt riss Nilus das Netz hoch und schwang es über seinem Kopf. Sofort wich er nach links aus, doch es war ein Täuschungsmanöver gewesen. Diesmal erwischte ihn der Dreizack an den Rippen. Ein zischender Laut entfuhr ihm. Das hatte mächtig wehgetan.
Sein Gegner zeigte ihm ein breites Grinsen. »Bist nicht gut in Form, was? Hattest wohl gestern Besuch von deinem Weibchen?«