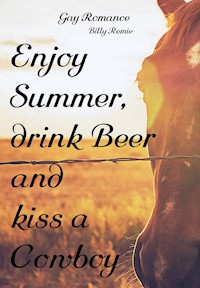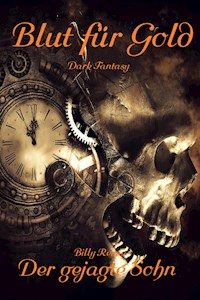5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zane & I
- Sprache: Deutsch
Neue Schule – Neues Glück? Von Wegen! Ich wollte nur meine Ruhe, doch dann schickten mich meine Eltern auf ein Drill-Internat und ich fand mich eingepfercht mit übellaunigen Nachwuchskriminellen in der Hölle wieder. Meine Schüchternheit, meine geringe Intelligenz und meine Akne hatten mich mein Leben lang zum Ausgegrenzten gemacht, womit ich eigentlich ziemlich zufrieden war, doch dann traf ich auf Grünauge, der mich auf jede erdenkliche Art reizte, wie man einen anderen Menschen nur reizen konnte. Dieser bipolare Mistkerl verwirrte mich von der ersten Minute an, denn so arrogant und herrisch er auch sein konnte, war er plötzlich auch der einzige Mensch, der meine tiefsitzenden sozialen Ängste zu verstehen schien. Das Problem war nur, dass er mir von allen anderen am meisten Angst einflößte, weil er die Macht besaß, mir am meisten wehzutun.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 951
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Billy Remie
how I feared love
Gay - Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Impressum neobooks
Vorwort
*~*~*
Für dich, auch wenn du mich nicht kennst (und vermutlich nicht einmal weißt, dass ich existiere), weil ich glaube, dass du genau wie ich weißt was es bedeutet, Angst zu haben.
*~*~*
Diese Geschichte ist rein fiktiv (auch wenn sie aus der Ich-Form erzählt wird) alle Personen, Orte, und das Institut sind natürlich frei erfunden, Ähnlichkeiten mit echten Personen, Handlungen und Ereignissen wären völlig zufällig und unbeabsichtigt.
Ich nutzte den Erzähler dieser Geschichte ausschließlich, um durch ihn einige persönliche Erfahrungen mit der Angst, Ausgrenzung und dem Leben mit Akne einfließen zu lassen.
Prolog
Im schwummrigen Halbdunkel leuchtete die orangene Flamme so hell auf, dass sie wie Nadeln in die Augäpfel stach. Glühendrot, wie der Schlund eines feuerspeienden Drachen, glomm die Spitze der Zigarette auf, gefolgt von einem leisen Knistern in der tiefen Stille.
»Danke«, presste ich emotionslos hervor und unterdrückte mühsam den Hustenreiz, der mir die Tränen auf die Lider trieb. Das Licht des auf »mute« geschalteten Fernsehers zuckte über mein Gesicht, nur durchbrochen von der »smooth« Funktion der LED-Lampe, die ihre Farben neben mir im gemächlichen Rhythmus wechselte.
Mein Sitznachbar nahm das Feuerzeug herunter, sein Blick klebte an meinem Profil, hoffend und flehend zugleich, ich möge ihn ansehen. Mein passives Verhalten machte ihn nervös. Doch meine abweisende Art lag nicht an ihm. Nicht nur. Ich war abgelenkt von meinen eigenen Gedanken. Dem Warten auf die dumpfe Reue.
Mühsam schluckte ich und räusperte mich, betrachtete dabei angestrengt die Zigarette, nachdem ich den Rauch ausgestoßen hatte. Es fühlte sich an, als hätte ich Sand inhaliert. Meine gesamte Lunge brannte und meine Kehle war eng, auch mehrfaches Schlucken brachte da nichts. Von dem scheußlichen Geschmack auf meiner Zunge ganz zu schweigen. Mir war übel, aber nicht nur vom Rauchen. Eigentlich war mir ständig übel, seit ich geboren wurde.
Nachdenklich starrte ich auf die glühende Spitze des weißen Sargnagels, der zwischen meinen feingliedrigen, aber kurzen Fingern steckte. Zwei Fragen jagten mir in diesem Moment durch den Kopf. Zum einen, wann verfickt noch mal meine Hände so alt geworden waren. Und was zum Teufel ich hier eigentlich machte, ich hatte doch schon vor Jahren das Rauchen aufgehört.
Aber eine weitere schlechte Entscheidung machte den Braten jetzt wohl auch nicht mehr fett, dachte ich in jenem Moment und nahm noch einen Zug. Der zweite ging schon leichter, als ob mein Körper sich daran erinnerte, sich nicht gegen das Gift zu wehren, sondern sich einfach zu ergeben. Das Nikotin wirkte sofort und gaukelte mir vor, ich hätte den winzigen Rausch vermisst. Aber das hatte ich nicht. Na ja, vielleicht ein paar Mal in den ersten Jahren, doch danach immer seltener. Eine Zeitlang hatte ich zu große Angst vor den Auswirkungen auf Herz und Lunge, als dass ich es hätte vermissen können. Selbsterhaltungstrieb konnte eine so wundervolle Sache sein.
Doch der wurde in den letzten Tagen, Wochen – vielleicht begann es auch schon vor Monaten – immer leiser und leiser…
Da hatte ich meine Antwort. Ich rauchte wieder, weil es mir plötzlich egal war, ob ich lebte.
Vielleicht war das der Moment, als ich langsam aufwachte. Rückblickendbetrachtet war dieser Augenblick dort auf dem fremden Sofa zumindest das erste Mal, dass ich bewusst dachte: ich bin unglücklich.
Aber das, was ich dort getan hatte, machte mich auch nicht glücklicher. Nur irgendwie… freier.
»Deine Finger zittern.« Seine sanfte Stimme holte mich aus meinen Gedanken. Ich zog eine Augenbraue hoch und schielte zur Seite.
Ein molliges Gesicht betrachtete mich. Selbst das spärliche Licht und eine halbe Flasche Chardonnay konnten es nicht annähernd »hübsch« erscheinen lassen. Rund wie ein Vollmond, dunkle Barthaare, darunter Krater und leuchten rote Punkte, eine Monobraue. Aber treudoofe, liebevolle Augen, die so intensiv nach Liebe und Nähe flehten, dass ich mir am liebsten eine Knarre an die Schläfe gesetzt hätte, weil ich so ein verficktes Arschloch war, dass ich nicht einmal zum Schein zurücklächeln konnte, damit er sich nach der Aktion nicht völlig ausgenutzt vorkam.
Ich sah auf meine Hände und ballte die eine zur Faust, um das Beben in den Gliedern zu unterdrücken. Mein Herz raste, ich bekam kaum Luft. »Nur die Anstrengung«, murmelte ich monoton. Mehr hatte ich nach einem Blowjob nicht zu sagen.
Ich spürte sein fettes Grinsen. »War echt geil. Nächstes Mal würde ich dich gern ficken.«
Mir fuhren die Worte wie Hagelschauer über den Rücken, gingen mir durch und durch, aber nicht auf die schöne Art. Ficken. Mich. Meine Übelkeit verstärkte sich. Plötzlich ekelte ich mich vor ihm, obwohl ich doch vor einer halben Stunde nichts mehr genossen hatte, als mal wieder angeschmachtet zu werden.
Ich bin nämlich auch kein Schönheitsideal, nicht einmal mehr guter Durchschnitt. Ich bin mollig geworden, ich bin klein, ich bin fast dreißig und besitze die unreine Haut eines Fünfzehnjährigen, auch mein Gesicht war mit Kratern durchzogen und mein Bartwuchs ähnelte dem eines Werwolfes in der Pubertät. Kurz um, ich war auch kein Hauptgewinn. Aber Mann, ich weiß, wie man eine Pinzette benutzt, um vor dem Fickdate die Augenbraue von einer dunklen Linie in zwei zu verwandeln.
Er schien die Veränderung meinem harten Gesicht abzulesen. »Alles okay?«, fragte er mich erneut, deutlich kleinlauter, und nahm eines der muffig riechenden Sofakissen, um es sich wie einen Teddy vor den stark gewölbten Bauch zu halten. Seine Statur war nicht einfach nur »kräftig«, er war fett. Ganz einfach. Fett. Wie eine Schwangere im sechsunddreißigsten Monat, die bald ein voll entwickeltes Kleinkind gebären würde.
Okay, okay. Ich bin gemein! Ich weiß das! Eigentlich war mir seine Statur egal, ich mag keine Muskelmänner, keine Adonisse, keine Fitnessfreaks. Und sind wir ehrlich, in der Schwulenscene bekam man solche Elitestuten auch nur ab, wenn man selbst aussah wie ein griechischer Gott – oder wie ein gerade volljähriger Twink mit Pfirsichhaut. Ich meine, die ganze Pornoindustrie ist ja nicht nur auf Lügen aufgebaut, sie gibt der Fantasie, was sie wirklich will.
Dass er und ich hier saßen, verdankten wir zwei Umständen. Wir waren beide keine Schönlinge und ich war ein betrügerischer Wichser, der seine Einsamkeit ausgenutzt hatte, um sich für zwei Sekunden gut zu fühlen.
»Willst du ein Glas Wasser?«, fragte er fürsorglich. Offenbar spürte er instinktiv, was ich gerade über ihn dachte, denn er starrte mich bereits mit so verletzten Augen an, dass ich kotzen wollte.
Wegen mir, nicht wegen ihm. Er war ein toller Kerl, der mir – obwohl wir uns so gut wie fremd waren – immer zuhörte, immer verständnisvoll und warm mit mir sprach. Er verdiente Besseres.
Jetzt tu wenigstens so, als ob du ihn magst!, schimpfte ich mit mir selbst. Es ging ja nur darum, ihm ein gutes Gefühl zu geben, nachdem er mir einen geblasen hatte! Das war ja wohl das Mindeste!
»Ich sollte gehen«, sagte ich kurz angebunden. Es war gar nicht nötig, ihn dabei anzusehen, ich konnte förmlich spüren, wie etwas in ihm zerbrach.
Fuck. Das tat mir selbst weh. Ich hasste mich. Aber so sehr ich mich auch zu einem Lächeln zwingen und ihn anschauen wollte, ihm signalisieren wollte, Kumpel, das war geil, du bist toll, du bist ein ganz wunderbarer Mensch, auch ohne Muskeln … Ich konnte mich nicht überwinden, empfand nur noch Ekel für uns beide.
Er starrte mich tieftraurig an, als ich die Kippe zwischen die Lippen steckte und wegen dem Qualm die Augen zusammenpetzte, um mir eilig mein noch feuchtes Geschlecht in die Hose zu stopfen und diese zu schließen. Das alles im Aufstehen. Wenn es darum ging, zu flüchten, war ich Profi. In vielerlei Hinsicht.
Er stand auch auf. »Soll ich dich fahren?«
Ich schnappte meine Jacke auf dem Weg nach draußen. »Schon gut, ich laufe, ist ja quasi um die Ecke.«
»O…okay«, stammelte er verwirrt.
Scheiße, ich musste hier raus. Das war alles, was ich wusste. Ich musste einfach nur da raus, aus seiner winzigen, stickigen Bude. Es war nur der ausgebaute Keller unter dem Haus seiner Eltern.
Ich verurteilte ihn nicht, ich war auch ein Versager.
»Wir schreiben dann, okay?«, fragte er an der Kellertür.
»Klar«, sagte ich. Immerhin diese Lüge kam mir über die Lippen. Wobei, er würde mir bestimmt schreiben und ich war kein Mensch, der es einfach ignorieren würde. Na ja, nicht mehr.
Nein, nein, stattdessen würde ich mir eine saudumme Geschichte ausdenken, so wie ich es immer tat, um andere loszuwerden.
Es ist schließlich mein Job, mir Geschichten aus dem Hut zu ziehen, die man mir einigermaßen abkauft.
In meinem Kopf ratterte es bereits auf der Suche nach einer guten Abfuhr, ohne ihn noch mehr zu verletzen, während ich die letzten Stufen aus dem feuchten Keller nahm und in einen frühsommerlichen Abend eintauchte. Am Ende entschied ich, ihm dann doch einfach die Wahrheit zu erzählen, sie würde die Bekanntschaft mit ihm am effektivsten im Keim ersticken.
Ich bin vergeben, Kumpel, sorry.
Mir ist an dieser Stelle bewusst, dass ich gerade alle möglichen Sympathiepunkte verloren habe, deshalb möchte ich gleich einwerfen, dass ich kein notorischer Fremdgänger bin! Ich bin sehr treu und ich habe in sexueller Hinsicht eigentlich keinen Grund, fremdzugehen, denn genau genommen kann ich sexuell nicht mithalten und ich muss mich schon ziemlich ins Zeug legen, damit ich keinen Grund liefere, betrogen zu werden.
Warum ausgerechnet ich fremdgebumst habe, obwohl ich um jede Pause eigentlich froh war, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Und es würde nicht das letzte Mal bleiben.
Ich bin kaputt, in jedweder Hinsicht. Damals, heute, immer schon. Vermutlich hatte es selten jemanden gegeben, dessen Psyche derart zerstört ist wie die meine. Auch wenn ich kein Serienmörder bin, ganz richtig bin ich auch nicht. Ich zerfetze in Serie mein eigenes Leben, dabei sollte ich so verflucht dankbar sein, dass ich jede Sekunde meines Dasein damit zubringen sollte, den Boden unter den Füßen meiner Mitmenschen zu küssen, die mich immer noch ertrugen und durchfütterten, weil ich allein überhaupt nicht lebensfähig bin.
Dankbar zu sein ist jedoch höllisch anstrengend und zudem stielt es einem auch das Recht auf die eigene Freiheit. Dankbar zu sein bedeutet, die Pflicht zu haben, dem anderen etwas schuldig zu sein.
Ich tu was für dich, also tust du auch was für mich.
Aber ich greife zu weit vorweg. Dort, an diesem Frühsommerabend, als ich mit der geschnorrten Kippe von meinem Seitensprung – dessen Namen ich nach nur wenigen Monaten gar nicht mehr wusste; Mario? Martin? Ma… Mi… Mo… Ach, Fuck, keinen Schimmer, Mann – die Landstraße entlangschlenderte und mir die Panik in den Nacken kroch, als hätte ich einen Tausendfüßler unter meiner Kleidung – dort, in diesem Moment, dachte ich seit Jahren das erste Mal wieder bewusst zurück.
Wenn du jemanden Dank schuldest, hast du kein Recht, ihm etwas auszuschlagen.
Kapitel 1
~*~
Das schlimmste aller Gefühle,
das ich je kennengelernt habe,
ist das Gefühl,
keine freie Wahl zu haben.
Du musst.
Zwei Worte, die mich katatonisch werden lassen.
Damals wie heute.
~*~
Mir war übel. Eine Mischung aus Angst, Fahrtübelkeit und Restalkohol beherrschten meinen Magen. Ich werde wohl nie das Gefühl vergessen, in diesem Transporter zu sitzen und verzweifelt zu versuchen, mich nicht vollzukotzen, während mir der Benzingeruch in der Nase biss.
Die Landschaft zog an den vergitterten Fenstern vorbei und verschmolz zu einem verwaschenen Bild. Rückblickend war es wohl eine meiner dümmsten Ideen, nach draußen zu starren, doch die dicke Scheibe fühlte sich wohltuend kühl an, weshalb ich meine Stirn dagegen lehnte. Diese leichte Kälte auf meinem Gesicht verhinderte, dass es mir endgültig hochkam. Schwindel erfasste mich und ich wusste nicht, ob ich kurz vor einer Ohnmacht stand oder ob ich mich jeden Moment doch übergeben musste.
Ich saß allein auf der angeschraubten Holzbank. Autositze gab es nicht – bis auf die gepolsterte Bank hinter dem Armaturenbrett natürlich. Meine Hände befanden sich auf meinem Rücken, das Kabelband schnitt in meine Haut und meine Fingerspitzen kribbelten bereits blutleer, doch ich wagte nicht, mich zu beschweren.
Der Fahrer nahm jedes Schlagloch mit Vollgas, Abbremsen kannte er nicht. Ich war – und bin es heute noch – der festen Überzeugung, dass er eine sadistische Freude daran hatte, mein schweißnasses, teigiges Gesicht zu betrachten, wenn ich nach jedem Schlagloch angestrengt schluckte.
Der Transporter ruckelte über die Straße und die holprige Fahrt rüttelte mich ordentlich durch. Vermutlich waren wir erst zehn oder zwanzig Minuten unterwegs, zumindest erkannte ich die Gegend noch, also konnten wir nicht so weit gefahren sein, aber es kam mir vor, als säße ich schon stundenlang auf dieser unbequemen Bank und würgte immer wieder meinen eigenen Mageninhalt runter.
Tja daran war ich wohl auch selbst schuld, aus dummen Trotz hatte ich am Vorabend ordentlich gesoffen. Aber selbst, wenn ich brav wie ein Chorjunge schon um 07:00pm im Bett gelegen hätte, wäre mir trotzdem schlecht geworden. Wenn ich Panik bekomme, habe ich es immer mit dem Magen.
Das schlimmste für mich war – und ist es heute noch – nicht zu wissen, was auf mich zukam. Ich wusste zwar, wohin ich gebracht wurde, aber ich wusste nicht, wie es dort aussah, was von mir erwartet wurde, was für Leute ich treffen würde, wie die Toiletten aussahen, die Schlafgelegenheiten, wie der Tagesablauf dort war. Und all das Ungewisse machte mich irre.
Ich war, bin und würde wohl auch immer ein Gewohnheitstier sein. Jedwede Abweichung hatte mich schon als Kind zutiefst verunsichert.
Zu meiner Übelkeit gesellten sich bald auch hämmernde Kopfschmerzen, außerdem wurden meine Hände zunehmend tauber und meine eine Schulter war derart verdreht, dass ich einen heißen Schmerz spürte und mich immer wieder unruhig wandte, um diesen zu mildern. Der Fahrer registrierte mein Unwohlsein, doch er lächelte nur zufrieden.
Ja, warum sollte man mit mir auch Mitleid haben?
Krämpfe malträtierten meinen Magen, darauf hatte ich nur gewartet. Es reichte ja nicht, dass ich vor lauter Panik schon kurz vor dem Kotzen stand, nein, mein Körper dachte sich, es wäre doch lustig, wenn mein Mageninhalt drohte, aus zwei Öffnungen zu schießen.
Mir brach der Schweiß aus, gefolgt von einem unkontrollierten Zittern. Doch ich sagte immer noch nichts, wagte es einfach nicht. Ich hatte von Zuhause aus beigebracht bekommen, meine Emotionen in mich reinzufressen und still vor mich hinzubrodeln. Du musst, wenn man dir etwas sagt.
So etwas nannte man bei uns Respekt vor den Älteren.
Um mich von meinem Elend abzulenken, starrte ich auf den staubigen Boden des Transporters und erinnerte mich an das Gespräch mit meiner Familie, als mir eröffnet wurde, dass ich meine bekannte Umgebung – meine Schule und mein Zuhause – verlassen musste. Kurz um, als man mir den ohnehin wackeligen Boden, auf dem ich wandelte, einfach unter den Füßen wegriss.
Sie haben mich vor vollendete Tatsachen gestellt, ich konnte noch so sehr dagegen sein. Ich musste weg. Und ja, es fühlte sich an, als hätten sie mich abgeschoben.
Nein, heute weiß ich, sie haben mich abgeschoben, weil ich ihnen zu anstrengend geworden war.
Und weil meine Mutter sich von der prüden, kalten Familie meines Vaters bequatschen hat lassen, dass es das Beste für mich wäre, wenn andere mich erziehen würden.
Ich erinnere mich noch genau, wie sie mich vom Sofa wegholten. Damals schaute ich jeden Nachmittag eine Animeserie. Das fanden sie extrem seltsam. Anime. In meinem Alter. »Zeichentrick« war laut meinem Vater nur etwas für Kleinkinder. Aber jedweder Versuch, ihm in seiner festgefahrenen Ansicht zu erleuchten, erstickte jäh im Keim, weil die Meinung seines dümmsten Kindes ja nicht zählte, sondern nur belächelt wurde.
Sie müssten mit mir reden, hieß es. Es war meine Mutter, die mich in die Küche zitierte. Auch meine Bitte, die zehn Minuten zu warten, bis meine Serie zu Ende war, stieß auf taube Ohren. Jetzt. Du musst. Dass es mich störte und wütend machte, hatte weniger mit der Serie, als mehr mit der Tatsache zu tun, dass ich meine Routine durchbrechen musste. Schule, Mittagessen bei der Nachbarin, bis meine Mutter von der Arbeit kam, Hausaufgaben – die mich frustrierten und ich eh nicht machte – meine Serie, mich im Zimmer verstecken, bevor mein Vater auf die Idee kam, mir irgendwelche Aufgaben zu geben, weil einfach rumsitzen und sich mit sich selbst beschäftigen für ihn ein Unding war. Arbeit, Arbeit, Arbeit, seit wir laufen können. Arbeit. Langeweile? Oh, wenn meine Eltern auch nur ahnten, ich könnte mich mal langweilen, dann war die Hölle bei uns los. Und ich vermutete, dass es an diesem Abend wieder genau darum ging.
Im Grunde ging es auch darum, aber auch um meine schulischen Leistungen. Wobei bei mir von Leistungen nicht die Rede sein konnte. Ich war miserabel. Und zwar in jedem Fach. Aber vor allem in Mathe und Englisch. Ich konnte kaum ein einziges Wort richtig schreiben, das riss natürlich meine Noten runter. Meine Eltern waren mit ihrem Latein am Ende, ich würde durchfallen. Schon wieder. Die Lehrer wussten sich auch nicht mehr zu helfen. Aber für meine Familie stand fest, ich war nicht dumm, nein, ich war einfach nur faul.
Es tat irgendwie immer schon weh, das von ihnen ins Gesicht gesagt zu bekommen, aber statt zu protestieren, habe ich gelächelt. Faul klang wesentlich freundlicher als dumm. Wobei ich mich heute frage, ob ich nicht lieber »dumm« gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht wo anders Hilfe gesucht.
Ich weiß noch, wie ich dort auf dem Stuhl in unserer Küche saß, mich ganz klein und ausgeliefert fühlte, als mir meine Mutter erklärte, wohin ich geschickt werden würde. Dieses Programm für schwererziehbare Jugendliche, von dem meine Tante – natürlich die Schwester meines Vaters – meinen Eltern berichtet hatte, nachdem sie es im Fernsehen gesehen hatte. Eine Einrichtung, ähnlich wie ein Internat, soviel habe ich verstanden.
»Du wirst da von morgens bis abends betreut«, erklärte meine Mutter unteranderem. Doch was ich heraushörte war bloß, dass ich nicht einfach nur auf irgendeine neue, spezielle Schule käme. Nein, ich wurde abgeschoben. Ganztägig. Ganzwöchig sogar. Ich würde wegfahren, weg von Zuhause, weg von allem, was ich kannte. Fort von meinem geliebten Hund, einfach weg. Während meine Familie hier blieb, ohne mich, und weiter eine Familie war. Nur eben… ja, ohne mich.
Ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte mich dagegen wehren. Was habe ich doch gewütet, aber sie ließen nicht mit sich reden. Ich rannte gegen eine Wand, obwohl ich verzweifelt beteuerte, mich zu bessern, sie sollten mir nur noch eine Chance geben. Ihre kalten und entschlossenen Blicke sind mir bis heute in Erinnerung geblieben, vielleicht war da auch Erleichterung im Blick meiner Mutter. Ich war immerhin das Sorgenkind und wegen mir hatten meine Eltern ständig Streit. Ja, vielleicht war sie froh, die Verantwortung abgeben zu können. Es ging nicht nur um meine Noten, ich war ein sonderbares Kind, immer schon gewesen. Keiner in meiner Familie hatte mir je das Gefühl gegeben, mich gern zu haben. Ich war ja nicht blöd, bei Familientreffen spürte ich natürlich, dass sich alle lieber mit meinen Geschwistern beschäftigten. Ich war zu jähzornig für Brettspiele, zu exzentrisch, zu eigenbrötlerisch. Ich sagte nicht ordentlich Hallo, ich blickte niemandem in die Augen, ich ging auf niemanden zu. Ich war ein sonderbarer Einzelgänger, der immer nur vor sich hinträumte und Selbstgespräche führte. Zuhause habe ich einsame Theaterstücke aufgeführt, wenn sie reingeplatzt sind – Abschließen war bei uns verboten – habe ich ihre erschrockenen Gesichter bemerkt, weil sie nicht wussten, was ich da eigentlich tat.
Dabei habe ich mir bloß in meinem Kopf Geschichten ausgedacht und sie nachgespielt. Damals hatte ich noch keine Ahnung, was ich sonst mit meiner sprudelnden Fantasie anfangen sollte. Bücher waren mir fremd, meine Schwester war die Leseratte, aber ich hatte dafür als Kind noch keine Geduld. Länger als zwei Minuten konnte ich mich selten auf eine Sache konzentrieren, dann spielte in meinem Kopf schon wieder die nächste Figur eine Hauptrolle. Ich habe Serien und Filme geliebt, das war ein Festfressen für meinen Verstand. Ich flüchtete immer in andere Welten, in andere Charakter. Bloß ich selbst wollte ich nie sein. Nie.
Warum das so war, das weiß ich bis heute nicht. Aber auch dieses Verhalten war einer der Gründe, weshalb sie mich wegschickten und hofften, ich würde als »richtiges« Kind zurückkommen, für das man sich nicht schämen müsste.
Aber natürlich war das nicht alles. Nein. »Diese Sache«, sagte meine Mutter noch, »es ist besser, wenn du ohne Gerüchte neuanfangen kannst.«
Diese Sache, von der sie sprach, hieß Anna. Mir wich alle Farbe aus dem Gesicht und ich blieb matt auf meinem Stuhl sitzen. Natürlich hätte ich wissen müssen, dass alles damit zusammenhing. Oder dass sie zumindest das Fass zum Überlaufen gebracht hatte.
»Ihr glaubt mir nicht«, hörte ich mich dumpf sagen.
»Doch«, beteuerte meine Mutter pikiert, »natürlich glauben wir dir, aber für dich ist es doch unter diesen Umständen auch nicht mehr schön, da diese Gerüchte nun umgehen.«
Sie hatte keine Ahnung, dass es in der Schule für mich unter keinen Umständen jemals irgendwie schön gewesen war. Dabei könnte sie es sich denken. Ich war ein Sonderling, man hatte mich schon so oft verprügelt und gemobbt, dass meine Mutter Stammgast im Lehrerzimmer war.
Nicht, dass ich hier auf Mitleid machen will. Ich war wirklich ein Sonderling, ich habe immer irgendwelche Geschichten erzählt, ich sei adoptiert, meine Eltern wären Spione, ich bin ein orientalischer Prinz, so einen Scheiß, später waren es dann Freundinnen, die ich angeblich hätte. Und Lügner wurden eben fertig gemacht. So einfach war das, so lief das in der Schule. Vielleicht hatte ich es verdient, dass mich keiner mochte. Keine Ahnung, wer bin ich, das zu beurteilen? Ich weiß nur, ich habe es nicht böse gemeint. Das Leben kam mir nur so langweilig und trist vor…
Während dem Gespräch mit meinen Eltern, saß mir meine Schwester gegenüber, damals überheblich am Grinsen. Und ich wusste noch, wie wütend es mich machte, dass sie da einfach saß und zufrieden mit anhörte, dass ich den Entscheidungen unserer Eltern schutzlos ausgeliefert war. Es war so ungerecht, warum ergriff sie nie für mich Partei? Warum stand sie immer hinter unserer Mutter? Warum konnte sie denn nicht ein einziges Mal versuchen, mich zu verstehen? Sie war froh, dass ich von ihrer Schule flog, auch wenn sie bald auf das College ging. Trotzdem war sie froh, denn ich war ihr peinlich. Dass mich ihre Freundinnen für sonderbar hielten, war ihr peinlich. Ich wusste es und es tat weh, denn ich liebte sie als Schwester. Ich wollte immer nur, dass sie mich auch liebte.
»Hör auf, so schadenfroh zu grinsen, du blöde Schlampe«, zischte ich sie an. Ich hatte sie noch nie eine Schlampe genannt. Tja, meine Mutter hatte mich auch noch nie geohrfeigt, aber als ich meine heilige Schwester beleidigte, ist ihr dann doch die Hand ausgerutscht.
Ich bin natürlich mit brennenden Augen in mein Zimmer verbannt worden. Und ich habe tagelang mit niemanden geredet.
Ich wollte mich umbringen. Meine Angst vor dieser Einrichtung war so groß, dass ich jedweden Ausweg in Erwägung zog. Alle möglichen Horrorgeschichten über Internate und Camps kamen mir in den Sinn. Gehirnwäschen und so ein Zeug. Weglaufen wäre auch eine Option gewesen, aber wohin? Und was würde mir blühen, wenn sie mich wieder einfingen? Als ich damit drohte, nannte meine Mutter mich nur eine Dramaqueen. Empathie? Das konnte man bei uns mit der Lupe suchen. Ich war doch sowieso nur das lügende Kind. Für sie dachte ich mir meine Gefühle immer nur aus.
Kann ich es ihnen verübeln, dass sie mir nie etwas glaubten? Vermutlich nicht, ich habe wie gesagt oft irgendwelche Geschichten erfunden. Aber es macht einen trotzdem irre, wenn man damit droht, sich etwas anzutun, und man bekommt nur ein Schnauben zu hören. Sie sagten: »Hör auf so einen Scheiß zu erzählen!« Damit war die Sache erledigt.
Interessierte es sie vielleicht nicht, ob ich mir was antat oder nicht?
Wie man sieht, habe ich mich nicht umgebracht. Ich bin eben auch ein Feigling. Aber der Wunsch war da, nicht nur wegen dieser Abschiebung. Es war so viel mehr, was schon immer gebrodelt hatte. Ich fühlte mich fehl, fremd und ungewollt. Sie waren mit ihrer Entscheidung so erleichtert, ich konnte es in den nächsten Tagen spüren, als ob sie meine Abreise kaum abwarten konnten.
Von den Eltern weggeschickt zu werden, das machte was mit mir. Ich hatte mich noch nie so allein gefühlt wie nach diesem Gespräch, denn ich wusste, sie standen nicht hinter mir. Hatten sie nie.
Ich betete fast, dass ich einfach nicht mehr aufwachen würde.
Am Abend vor meiner Abreise hatte ich dann die grandiose Idee mit dem Alkohol. Der Weinkeller meiner Eltern, die edlen Tropfen aus der Heimat. Selbst schuld, sagten sie, als ich das Bad vollkotzte.
Ich wünschte mir so sehr, der nächste Morgen würde niemals kommen.
Doch er kam – und das viel zu schnell. Sie brachten mich zur Abholstelle. Mir zitterten so sehr die Knie, dass ich kaum aus dem Wagen steigen konnte. Als ich dann den Transporter erblickte, legte sich irgendein Schalter um. Ich konnte das einfach nicht. Ich wollte es nicht!
Deshalb hatte ich die Kabelbinder um meine Handgelenke. Ich habe mich gewehrt, als der Fahrer mir eine Hand auf die Schulter legte und in seinen Wagen dirigieren wollte. Aus Panik hatte ich ihn weggeschlagen, was zur Folge hatte, dass meine Wange kurz darauf die Motorhaube geküsst hatte.
So lief das also ab sofort ab.
Das beruhigte mich kein Bisschen. Ich hatte mich gefühlt wie damals, als ich als Kind beim Zahnarzt Panik bekommen hatte und mich drei Arzthelferinnen auf dem Stuhl festhielten.
Niedergerungen, festgenagelt, hilflos ausgeliefert.
So begann mein neues Leben.
Ich habe sie dafür gehasst. Dafür, dass sie mir keine Wahl gelassen hatten. Ich musste tun, was sie für mich beschlossen, weil ich nur ein Kind war. Ich war ihren Entscheidungen hoffnungslos unterlegen. Sie konnten über mich bestimmen, als wäre ich ihr Sklave, ihr Haustier. So etwas wie Selbstbestimmung, Rechte, das besaß man als Kind gegenüber seinen Eltern nicht.
Ja, ich war ein schwerer Fall, das gebe ich zu. Aber auch heute denke ich, dass ich nichts so Schlimmes verbrochen hatte, um in so ein Programm abgeschoben zu werden.
Aber so mussten sie sich wenigstens nicht mehr mit mir auseinandersetzen und konnten die Verantwortung anderen überlassen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Sie hatten ja noch zwei kluge andere Kinder, die sie vorzeigen konnten.
Das habe ich ihnen nie verziehen. Ich war nicht das Kind, was sie sich gewünscht hatten, sie haben mich nicht verstanden, deshalb war ich in ihren Augen ein Fall für die »Reparatur«.
Aber manches kann man nicht reparieren.
Nur weiter zerstören.
*~*~*
Ein weiteres tiefes Schlagloch riss mich aus meinen Gedanken, denn meine Stirn knallte dabei gegen die Scheibe und verstärkte meine hämmernden Kopfschmerzen. Um uns herum war plötzlich Wald, also hatte ich eine Weile erfolgreich Zeit in meinem Kopf vertrödelt. Wie viele Minuten vergangen waren, konnte ich jedoch nicht sagen. Mir kam aber die Gegend um uns herum nicht mehr bekannt vor. Ab und zu glaubte ich, mich zu erinnern, schon einmal diese Straße entlang gefahren zu sein, doch sicher war ich mir nicht. Nach ein paar Abbiegungen kam ich mir völlig fremd vor.
Meine Übelkeit verschwand leider nicht und der Druck in meinem Kopf fühlte sich an, als hätte ich einen rostigen Nagel in der Hirnrinde, der sich langsam und knirschend drehte. Von der Lava in meinem Darm ganz zu schweigen.
Angestrengt versuchte ich gegen mein Leid anzuatmen. Sog die Luft tief ein und ließ sie langsam entweichen, hoffte sogar, wenn ich die Augen schließen würde, würde es besser werden. Doch das war ein Fehler, es wurde nur schlimmer.
Es war Sommer, entsprechend stickig war es in dem Transporter. Ein heißer, trockener Sommer. Mir lief der Schweiß über das blasse Gesicht. Ich hatte das Gefühl, zu schmelzen. Hitze hatte ich noch nie gut vertragen. Der Fahrer hatte das Fenster heruntergekurbelt und sein Arm lag locker auf der Tür, ich konnte sein hellblaues Hemd im Windzug flattern sehen, doch ich bekam hinten von der frischen Luft so gut wie nichts ab.
Es war ein Kampf gegen mich selbst. Gerne würde ich berichten, dass ich ihn gewonnen hätte, doch die Fahrt wollte und wollte nicht enden.
Zuerst dachte ich, ich würde ohnmächtig. Der Schwindel erfasste mich mit einer Intensität, dass ich bereits nach vorne schwankte und Sternchen sah. Doch dann kam es mir hoch und ich erbrach einen Schwall säuerliche, gelbe Flüssigkeit über meine Brust und Beine, eher es mir gelang, den Boden zwischen meinen Füßen zu treffen.
Der Fahrer sah in den Rückspiegel, fluchte und schüttelte tadelnd den Kopf. Ich nahm all das im Augenwinkel wahr, denn kaum hatte ich mich übergeben, überkam mich die Scham und ich schielte befürchtend zur Fahrerkabine.
»Zu viel rumgezogen, kleiner Junkie, was?« Seine raue Stimme triefte vor Schadenfreude. Er kurbelte auch das Beifahrerfenster herunter, um den sauren Gestank nicht ertragen zu müssen. »Glaub ja nicht, ich putz dir jetzt wie Mommy das Mäulchen ab – ach Fuck, schon wieder?«
Ich hatte noch gedacht, meine Übelkeit sei wie durch Zauberhand verschwunden, doch dann kam es mir erneut. Sich zu übergeben, wenn einem die Hände auf dem Rücken gefesselt waren, war wirklich ein seltsames Gefühl. Mein Körper krampfte, ich hatte keinen Halt, wenn ich mich zu weit nach vorne lehnte, wäre ich auf die Nase gefallen, direkt in meine Kotzpfütze. Noch nie hatte ich mich so beschämt und so hilflos gefühlt. Na ja, zumindest bis zu diesem Moment.
Ich hatte ja keine Ahnung…
Es schoss mir eine Weile aus Mund und Nase. Nicht nur der Alkohol war schuld, auch meine überirdische Angst. Während ich mich übergab, verkrampfte ich so stark, dass ich teilweise glaubte, ich würde ersticken oder mir eine Rippe brechen. Ob das wirklich möglich war, wusste ich nicht, es fühlte sich jedenfalls so an. Das Krampfen hatte mich so in seinem Griff, ich hatte panische Angst, dass etwas in die Hose gehen würde. Buchstäblich.
Die Hitze, die Übelkeit, das Ruckeln des Wagens, die Lava in meinen Eingeweiden. Es war die Hölle – und dabei war ich noch nicht einmal da.
Irgendwann schien es gut zu sein, erschöpft lehnte ich mit dem Hinterkopf an der vergitterten Scheibe und atmete einfach nur. Nur atmen.
An uns zog ein dichter Wald vorbei. Und zwar ein richtiger Wald, nicht wie diese winzigen, zahmen deutschen Wälder, in denen immer nach drei Metern irgendein Pfad und nach spätestens einer halben Stunde eine Straße auftauchte, egal in welche Richtung man ging. Nein, es war ein richtiger Wald, in dem man sich wahrhaftig tagelang verirren konnte, von Bären angefallen, verloren gehen und verrecken konnte. So ein Wald war das. Und wir fuhren immer tiefer und tiefer auf dieser schmalen Straße hinein, auf der uns kein anderer Wagen entgegenkam. Stundenlang, nur ich, der Fahrer und der Transporter, der uns beherbergte.
Ich war so fertig davon, mich zu übergeben, dass mir zumindest für den Rest der Fahrt alles andere vollkommen gleichgültig war.
*~*~*
Das änderte sich jedoch, als wir ankamen.
Auf der Fahrt musste ich irgendwann vor Erschöpfung eingeschlafen sein, denn mich weckte das vorüberstreifende Licht eines Scheinwerfers, als mein Fahrer von der Straße abbog. Neugierig richtete ich mich auf und ein stechender Schmerz fuhr mir in die Schulter, weil sie noch immer unangenehm eingedreht war.
Es war dunkel geworden und wir fuhren an einem großen, eingezäunten Gelände entlang. Der Zaun wirkte massiv und hoch, war mit Stacheldrahtrollen versehen, in der Ferne sah ich Taschenlampen umhergehen. Die Anlange wurde nachts also bewacht. Weit und breit gab es nur dichten Wald um den Zaun herum, ich wagte also zu bezweifeln, dass man weit genug kommen würde, selbst wenn es jemanden gelingen würde, den Zaun zu überwinden. Die Wildnis um die Anlage herum mochte wie ein gutes Versteck erscheinen, doch ich war in einem solchen Wald aufgewachsen und ich wusste, dass er ebenso gut der eigene Tod bedeuten konnte. Vor allem wenn man auf der Flucht war, war er eine Stolperfalle, und sich in der Wildnis den Fuß zu verstauchen war fast ein Todesurteil. Man würde ja auch nicht schreien, wenn man auf der Flucht war. Aber selbst wenn, es könnte Tage oder Wochen dauern, bis man gefunden wurde, wenn man kein wildes Raubtier anlockte.
Es war Vollmond, ich konnte am Horizont über den dunklen Spitzen der Bäume die Schemen einiger Berge erkennen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es hier Berglöwen gegeben hätte. Pumas.
Ich hatte überlegt, einfach wieder von hier abzuhauen. Doch im wahren Angesicht mit der Wildnis war mir doch nicht mehr so sehr danach. Zumal ich nicht glaubte, dass man mich so einfach ungesehen mit einer Zange an den Zaun heranspazieren lassen würde.
Und wo hätte ich auch hin sollen?
Wir passierten mehr als ein Tor. Der Wagen hielt an, ruckelte wieder los, hielt an, während zwischen meinen Schuhen mein Erbrochenes schwamm. Die Pfütze war an den Rändern schon getrocknet und die Oberfläche mit Haut überzogen. Bisschen wie Pudding, ich ekelte mich vor mir selbst, vor allem als ich an mir runter sah und meine besudelte Vorderseite bemerkte.
Ich war nur heilfroh, dass ich die Lava in mir einhalten konnte, das wäre ja noch peinlicher gewesen.
Die Fenster vorne standen noch offen und ein etwas milderer Durchzug streifte mein Gesicht, es roch nach Sommerabend auf dem Land. Frische, Gras, Wälder. Eigentlich ein guter Geruch, doch meine Freude darüber hielt sich in Grenzen. Ich wollte nicht hier sein.
Draußen tauchten langsam die Gebäude auf. Zuerst wirkte auf mich alles wie ein typisches Sommercamp. Es gab längliche Holzhütten, die wie Baracken aussahen. Ein Sportplatz war von einem hohen Zaun umgeben. Aber es gab auch Gebäude aus grauen Beton mit vergitterten Fenstern, sie waren wie ein U aufgebaut, und wir hielten darauf zu. Vielleicht nur der Verwaltungstrakt, ich wusste es nicht. Jedenfalls sah die Anlage weder nach Schule, nach Internat noch nach einem spaßigen Sommercamp aus.
Ich wurde immer nervöser, je mehr Tore sich hinter uns wieder schlossen. Zum ersten Mal erhaschte ich einen Blick auf die Wachleute, oder was sie waren. Alle in dunkelgraue Uniformen mit Hüten gehüllt, sie hatten Hunde bei sich und schwere, große Taschenlampen, die die Form eines Knüppels besaßen.
Der Transporter hielt mit einem Ruck und plötzlich erstarb der Motor. In diesem Moment machte mir die Stille Angst, mir fuhr ein Kribbeln in die weichen Beine.
Der Fahrer öffnete seine Tür. »Du bleibst sitzen«, befahl er und schien froh zu sein, aus dem vollgekotzten Wagen aussteigen zu können.
»Ich muss mal aufs Klo«, traute ich mich endlich zu sagen.
»Du wartest.«
»Aber… es ist dringend!«
Er schlug die Tür einfach zu, als ob ich nicht kurz davor gewesen wäre, mir buchstäblich die Hosen vollzumachen.
Ich reckte den Hals, um zu erkennen, wohin er ging, doch er war zu schnell verschwunden und es liefen plötzlich mehrere Personen um den Transporter herum, die mich noch nervöser machten.
Ich war in einem Gefängnis.
Und meine Eltern hatten mich dorthin geschickt.
*~*~*
Zwei Männer holten mich ab, als mir vom Einhalten bereits wieder der Schweiß über das Gesicht rann. Sie nahmen mich in ihre Mitte, wie einen Schwerverbrecher, und zogen mich grob hervor. Sie waren deutlich größer und breiter gebaut als ich, ihre Hände hätten meine Arme wie Zweige zerbrechen können. Ich stolperte hervor und stieß beinahe mit der Nase fast auf den dunklen Kiesweg, der mich erwartete.
Vermutlich hatte der Fahrer von meinem verzweifelten Versuch, dem Transporter zu entkommen, erzählt, und sie hielten mich für einen schwierigen Fall.
»Vorwärts«, brummte der rechte Kerl nur genervt und riss mich weiter.
So aufgeliefert war ich im ersten Moment wie erstarrt. Das musste alles ein Scherz sein. Gleich würden meine Eltern irgendwo hinter einer der schweren Türen auftauchen und mich auslachen. Oder mir sagen, dass ich meine Lektion hoffentlich gelernt hätte – und mich nach Hause bringen.
Aber es warteten nur leere, sterile Räume hinter den Türen. Und mehr fremde Männer, denen ich nicht wagte ins Gesicht zu blicken. Sie trugen Stiefel, wie man sie vom Militär kannte, die Hosen in die Schäfte gesteckt.
Wir mussten auf einem Flur warten, die beiden Typen bewachten mich gelangweilt, einer neben mir, einer mir gegenüber. Wir saßen auf Plastikstühlen, die festgeschraubt waren.
Knast, dachte ich wieder. Das hier war nicht mehr als ein Knast.
Irgendwann hielt ich es wirklich nicht mehr aus. »Darf ich auf die Toilette?«, rang ich mir ab. Meine Sozialphobie war damals schon stark ausgeprägt, aber ich musste wirklich dringend und hatte nur die Wahl, über meinen Schatten zu springen, oder mich noch mehr einzusauen. Aber es fiel mir wirklich nicht leicht, zu sprechen. Ich hatte immer schon Angst vor erwachsenen Männern. Niemand wusste, warum.
Der Typ mir gegenüber brummte genervt, stellte aber die Beine auseinander. Ich kann mich heute kaum noch an sein Gesicht erinnern, ich weiß nur noch, es war bullig und er hatte dunkle Augenbrauen.
Ich durfte auf die Toilette, nur er begleitete mich, blieb aber in der Tür stehen und hielt sie mit einem Fuß auf, den er dagegenstemmte.
Es war mir in meinem ganzen Leben noch nie so unangenehm gewesen, aufs Klo zu gehen. Ich verschwand in der Kabine und jeglicher Versuch, meine Qualen zu verbergen, scheiterte natürlich.
»Hast du´s bald?«, fragte er irgendwann genervt.
Ich konnte früher nicht einmal pissen, wenn jemand mit mir auf ein und derselben Etage war. Es ging einfach nicht. Aber dieser Moment dort auf dem Klo hatte mich eines Besseren belehrt, es floss einfach. Aber nicht aus meinem Schwanz.
Ich sagte nichts, die Laute sprachen für sich.
»Jetzt mach schon!«
Als ich hervorkam, glühte mein Gesicht und ich war sicher, dass ich wie eine Tomate leuchtete. Ich wagte nicht, ihn anzusehen. Vielleicht erinnere ich mich deshalb kaum noch daran, was für Züge er gehabt hatte.
»Wasch dich ein bisschen, du stinkst, als ob jemand mit dir den Boden einer Kneipe aufgewischt hätte.«
Ja, weil ich voll mit Weinkotze war und mir der Schädel brummte, als würde ihn jemand mit einem Vorschlaghammer bearbeiten.
Wortlos trat ich an die Waschbecken. Es gab keine Spiegel. Ich nahm ein paar Papierhandtücher zur Hand, befeuchtete sie und schruppte ein wenig von der getrockneten Kotze von meinem weißen T-Shirt und meinen lockeren Shorts.
»Das reicht«, sagte er. »Los jetzt!«
*~*~*
Als wir zurückkamen, stand plötzlich mein Fahrer neben Typ Nr. 2. Er hatte einen Eimer und einen Lappen dabei und ich wusste, was mir bevorstand.
Während der Fahrer mit Typ Nr. 1 und Typ Nr. 2 draußen auf dem umzäunten Parkplatz im Scheinwerfer Licht stand und die frische Luft in seinem blonden Pferdeschwanz genoss, – und sie rauchten und sich brummend unterhielten – kniete ich mit aufsteigender Übelkeit im stickigen Transporter und schruppte meine eigene Kotze weg.
Ich wischte mir den Schweiß mit dem Unterarm von der Lippe. Mein Kreislauf war im Keller, dass ich blitzende Sterne sah. Aber natürlich wusste ich, dass alles Jammern nichts bringen würde.
Weil man mir nie glauben würde, das kannte ich ja von zuhause. »Stell dich nicht so an«, würde es heißen.
»Beeil dich mal«, rief der Fahrer höhnisch.
Als ich über die Schulter blickte, sah ich die drei Typen über mich grinsen.
Wut und Scham überkamen mich, ich presste die Lippen zusammen und machte einfach weiter, zu feige, um zu rebellieren. Immerhin… war ich hier ganz allein ohne jeden Rückhalt durch Freunde oder Familie.
Meine Aufpasser waren nicht die einzigen Zuschauer. Über dem Transporter befand sich ein hellerleuchteter Flur, andere Jungen drückten von innen ihre Nasen gegen die großen Scheiben. Sie trugen alle dieselbe Kleidung, wie im Knast – oder besser gesagt, wie in einer Kaserne. Weiße T-Shirts, die feinsäuberlich in khakifarbenen Hosen steckten, rasierte Schädel, schadenfrohe Gesichter.
Sie sahen belustigt auf mich herab und ich wollte im Erdboden versinken. Mein Plan, einfach nicht aufzufallen, war bereits gründlich schiefgegangen. Dabei wollte ich doch nur vermeiden, irgendwie angreifbar zu sein.
Dort im Transporter auf den Knien in meinem eigenen Erbrochenem, das ich aus dem Lappen wrang, kam ich mir vor, wie ein verletztes Rehkitz, das auf einer Lichtung zusammengebrochen war, während die Krähen schon über mir kreisten.
Ihre Blicke kitzelten in meinem verschwitzten Nacken, auch wenn ich versuchte, sie zu ignorieren.
Einfach nicht aufblicken, einfach weiter machen. Stell dir vor, du bist wo anders.
Mein Lebensmotto. Manchmal funktionierte es sogar, leider nicht in diesem Moment.
Als ich endlich fertig war, rauchten die drei Typen schon wieder je eine Zigarette und ich sollte warten. Mit dem Eimer in der Hand. Ich wollte ihn abstellen, aber ich wurde angeschnauzt. »Bist du eine Pussy, oder was? Halt das Ding gefälligst fest!« Typ Nr. 2 konnte also auch reden. Wortlos hielt ich den Putzeimer mit den gut zehn Litern Wasser fest, während mir die Arme zitterten. Ich hatte noch nie im Leben Kraftsport gemacht, meine Armmuskeln waren wie Pudding.
Der Sportplatz hinter dem Zaun war hellerleuchtet. Ein Mann stand in der Mitte auf dem Platz, lässig die Hände in den Hüften gestemmt, eine natürlich überlegene Ausstrahlung ging von ihm aus, er trug eine Uniform wie die anderen Aufseher, aber das Hemd über dem weißen T-Shirt stand halb offen und er hatte keine Mütze auf seinem dunklen Haar. Mehr konnte ich nicht erkennen, mein Interesse lag auch mehr auf dem einzelnen Jungen, der einsam seine großen Runden lief und von dem Aufseher immer mal wieder derart grob angebrüllt wurde, wenn er langsamer wurde oder stolpernd vor Erschöpfung hinfiel, dass sogar ich zusammenzuckte.
Der Läufer war groß und sein dunkles Haar kurzgeschoren, er trug das weiße Shirt, die Militärhosen und Stiefel wie die anderen Jungen, die ich schon gesehen hatte, doch auf seiner Brust befand sich etwas, das mich stutzig machte. Blut. Es waren dicke, rote Flecken frisches Blut. Als er an uns vorbeilief, fing er meinen Blick ein. Das Blut lief ihm aus der Nase über die vollen Lippen. Er grinste, seine Zähne waren rot und er leckte sie provokant ab. Lachte mich beim Vorübergehen wie irre an.
Mir wurde wieder übel, während ich ihm nachsah.
»Komm«, riss mich Typ Nr. 1 aus meiner Starre, und ich musste ihm folgen, um den Eimer und den Lappen zu säubern.
*~*~*
Wir saßen danach wieder eine Weile auf dem Gang, die hellen Lampen bereiten mir erneute Kopfschmerzen, dieses Mal fühlte es sich jedoch mehr wie ein Stechen, statt ein Hämmern an. Mein leerer und geschundener Magen rumorte lautstark und der Uniformierte neben mir – Typ Nr. 2 – schielte mich genervt an.
Es war mir so unangenehm, ich hasste es, aufzufallen. Zumal ich nun wirklich nichts dagegen unternehmen konnte.
Alles, was ich je wollte, war in Ruhe in der Menge unterzugehen und niemals gesehen, angesprochen oder beachtet zu werden. Ich wollte einfach nur nicht auffallen. Nie. Und ich hatte so sehr gehofft, mir würde das auf meiner neuen »Schule« gelingen.
Von Schule konnte natürlich kaum die Rede sein. Ich war in einem Erziehungslager, das wusste ich, auch wenn meine Eltern diesen Begriff gekonnt nie verwendet hatten. Und ja, hier landeten nicht nur kriminell gewordene Jugendliche, diese Camps oder Einrichtungen waren für alle Teenager von Eltern, die aus verschiedenen Gründen nicht weiterwussten. Ich hatte mich in den Tagen vor der Abfahrt informiert, wohin ich gebracht wurde.
Ob du nun aufmüpfig, aggressiv oder einfach nur auffallend deprimiert warst. Ob du still warst oder schlicht ein Einzelgänger. Schlechte Noten, Probleme bei der Konzentration, sozialzurückgezogen, Mobbingopfer, Mobbingtäter, das genügte bereits. Deine Eltern entschieden, wenn du minderjährig warst. Ähnlich wie eines dieser Boot Camps, damit können einige vielleicht etwas anfangen. Wobei diese Einrichtung, zu der ich kam, es bevorzugte, »Institut« genannt zu werden. Im Sinne der Geschichte nennen wir es also einfach »Institute S.« Das S steht für Schule.
Sie prahlten auf ihrer Internetsite mit ihren außerordentlichen Erfolgen, verhaltensgestörte Kinder auf die richtige Bahn zu bringen, sie Disziplin zu lehren, ihre Motivation zu fördern. Mehr als achtzig Prozent der Abgänger gingen danach auf das College.
College.
Wenn du nicht auf dem College warst, bist du ein Nichts.
Ist einfach so. Dann kannst du höchstens auf einen Barista Job hoffen, wenn du Glück hast.
Ich hatte Bilder der Einrichtung gesehen, Jungen in Reih und Glied, wie beim Militär, alle sportlich, die Baseball spielten. Bilder von Jungen an festgeschraubten Tischen und Bänken beim Essen in einer großen Mensa, sie lachten fröhlich. Jungen in Klassenräumen konzentriert am Arbeiten, der »Lehrer« in Uniform, um sie am Kommunizieren zu hindern.
Was ich nicht auf diesen Bildern gesehen hatte, waren die Zäune und die bulligen Wachleute.
Was erwartete mich hier? Und wie lange mussten wir noch auf dem Gang sitzen? Was, wenn ich wieder kotzen oder auf die Toilette musste? All das ging mir durch den Kopf und machte mich nervös. Ich spürte erneute Übelkeit, nervös rieb ich meine geröteten Handgelenke, die noch die Abdrücke des Kabelbinders zeigten. Noch einmal würde ich es nicht über mich bringen, zu fragen, ob ich noch einmal auf die Toilette dürfte.
Warum wurde ich bewacht? Und wo war meine Tasche?
Die Tür neben uns öffnete sich und ein weiterer Uniformierter ragte vor mir auf. »Reinkommen«, befahl er schroff und drehte schon auf dem Absatz um, die Tür ließ er offen.
Bevor ich mich bewegen konnte, wurde ich hochgerissen. Typ Nr. 1, der mir gegenübergesessen hatte, erhob sich gelangweilt, folgte uns in den kleinen Raum und schloss die Tür.
Drei riesige Männer Bauwerk Typ Ochsen und ein etwas zu klein geratener Teenager zusammen in einen winzigen Raum gepfercht. Ich kam mir noch kleiner vor, als ich ohnehin schon war.
Es war kühl durch die Klimaanlage, und grell. Weiße Schränke, ein Waschbecken und eine Liege befanden sich an den kahlen Betonwänden, ähnlich wie in einem Untersuchungszimmer.
Der dritte Uniformierte stand mit dem Rücken zu mir und studierte eine Akte. Meine Akte?
»Ausziehen«, sagte er. Es dauerte einen Moment, bis ich kapierte, dass er mit mir sprach.
Mein Arm wurde losgelassen. Mir raste das Herz, aber ich gehorchte. Einfach tun, was sie sagen, dann würden sie mich schon bald in Ruhe lassen. Zumindest hoffte ich das.
In der Annahme, dass ich vermutlich meine vollgekotzten Kleider loswerden sollte, zog ich Schuhe, Shorts und Shirt aus und ließ alles auf einem Haufen neben mir liegen. Angewidert nahm der schweigsame Typ Nr. 2 die Kleider und steckte sie in einen grauen Sack.
Vielleicht ein Wäschesack, aber irgendwie hatte ich Angst, sie könnten sie wegwerfen.
»Wo ist meine Tasche?«, fragte ich kleinlaut. Ich fühlte mich nackt.
Niemand antwortete.
Nur in Socken und Unterhose stand ich da, als der Uniformierte mit der Akte sich umdrehte. Er legte die braune Mappe offen zur Seite und nahm ein Maßband.
Es war sehr unangenehm von einem Fremden in Uniform mit einem Blick, der sogar einen Panzer in Frontansicht sympathisch aussehen gelassen hätte, ausgemessen zu werden. Er kam mir zu nah. Mir glühte das Gesicht, als er meine Beine auseinandertrat und seine Fingerknöchel gegen meine Eier stießen, als er die Innenseite meiner Schenkel ausmaß.
Er ging zur Akte, trug etwas ein und sagte über die Schulter ein paar Ziffern. Vermutlich meine Kleidergröße, denn Typ Nr. 2 ging nach draußen
»Den Rest auch ausziehen«, befahl Typ Nr. 3.
Mein Kopf schoss zu ihm herum. Er zog sich gerade einen Gummihandschuh über die Rechte.
»Was?«, fragte ich dümmlich, verstand nicht, wozu. Aus Mangel an Optionen sah ich hinüber zu Typ Nr. 1, der genau wie bei meinem Toilettengang an der Wand lehnte, die Arme verschränkt. Doch in diesem Moment grinste er seltsam.
Die genossen das, schoss es mir durch den Kopf, mich zu demütigen.
»Ausziehen und umdrehen«, sagte Typ Nr. 1, während ich ihn noch bleich anstarrte. »Oder muss ich nachhelfen?«
Nachhelfen?
Wo zum Teufel bin ich hier gelandet?
Ich hatte keine Wahl, zog mich mit zitternden Fingern aus. Sollte mich umdrehen, nackt über die Liege beugen. Arschbacken auseinander.
Ist kein Witz, soll auch nicht irgendwie erotisch rüberkommen. Das war es nicht, ich hatte mich bis zu diesem Moment noch nie so nackt und ausgeliefert gefühlt.
Drogenkontrolle nannten sie es. Ich nenne es heute noch: mit-dem-Finger-im-Arsch-bohren. Ich sollte doch tatsächlich husten. Hätte das nicht genügt? Nein, es ging nicht um Drogen, ich sollte wissen, dass sie jetzt jede Macht über mich besaßen. Und wenn es hieß, Hose runter, ausziehen, Arsch auseinander, Drogenkontrolle – dann hatte ich zu gehorchen.
Mir wurde bis zu diesem Moment noch nie etwas rektal reingeschoben, bis auf die Zäpfchen früher, wenn ich krank war, aber das war schon eine Weile her. Die Rektalkontrolle war eine andere Nummer; fremde Typen, die dir den Finger bis zum Anschlag reinbohren. Nicht »einführen«, es war ein Bohren, und es tat weh und war beschämend.
Als ob ich meinen Hintern wirklich als Drogenschmugglerhöhle missbraucht hätte!
Typ Nr. 1 wusste doch, dass ich mir kurz zuvor die Seele aus dem Leib gekotzt und geschissen hatte! Doch vermutlich nahmen sie deshalb erst recht an, ich hätte etwas reinschmuggeln wollen. Ich traute ihnen sogar zu, dass sie das Toilettenwasser auffingen und durchsuchten.
Danach kam Typ Nr. 2 mit Kleidern zurück. Weißes T-Shirt, Khakihose, Militärstiefel. Die Unterhose war so kratzig, als würde ich in Schleifpapier steigen, aber ich war unendlich froh, als ich sie anziehen durfte und nicht mehr nackt zwischen diesen fremden Ochsen stand.
Dann wollten sie mir die straßenköterblonden Haare abrasieren. Ich sagte Nein! Die Vorstellung, dass ich meine picklige Fratze nicht mehr unter meinem kinnlangen Haar verstecken konnte, war mir unerträglich. Meine Haare waren mein Vorhang, ich brauchte sie! Wie sollte ich mich sonst in der Öffentlichkeit versteckt fühlen?
Typ Nr. 2 war nicht zimperlich, als er mir den Arm auf den Rücken drehte. Ich kannte das aus Filmen, da sah dieser Handgriff immer supercool aus. Aber als er mich packte und mir fast die ohnehin schmerzende Schulter auskugelte, war daran überhaupt nichts mehr cool. Ich schrie auf, ein Stechen fuhr mir durch den Arm.
Sie rasierten mir den Schädel und entschuldigten es damit, dass sie eine Ausbreitung möglicher Kopfläuse verhindern wollten. Ich hatte Tränen aus Wut und Scham in den Augen, weshalb sie sich über mich amüsierten. Sie nannten mich »Pussy«.
Mir die Haare abzurasieren und das sogar gegen meinen Willen zählt zu Körperverletzung? Das dachte ich mir auch, brodelte innerlich und schwor mir, dass ich das zur Anzeige bringen würde. Das Problem war nur, dass meine Eltern bereits unterschrieben hatten. Verzichtserklärungen und sowas. Ich war minderjährig und ihren Beschlüssen ausgeliefert. Im Grunde gehörte ich meinen Eltern und sie gaben die Erlaubnis. Man legte mir Kopien von den Dokumenten vor und unterrichtete mich über meine »Rechte«. Mir war es untersagt, ein Handy zu benutzen, sie hatten es konfisziert, mit zahlreichen anderen Dingen aus meiner Tasche, die ich erst sehen würde, wenn ich »eingegliedert« wäre. Kontakt zur Außenwelt war strikt verboten, ich durfte nur mit meinen Eltern reden, meine Briefe würden geöffnet und untersucht, sollte ich nach draußen schreiben wollen. Ich musste meine Haare kurzhalten, durfte nur die Kleidung tragen, die sie mir zur Verfügung stellten. Ich hatte die Pflicht, meine Kleidung sauber und intakt zu halten, ansonsten würde ich für den Schaden aufkommen. Natürlich galt gleiches für die Einrichtung des Institutes, wenn ich etwas zerstörte – ob mutwillig oder nicht – würde ich dafür zur Rechenschaft gezogen. Mir waren Telefongespräche mit meinen Eltern erlaubt, die Nummer würde für mich gewählt werden. Sie durften mich besuchen, aber nur in vorgesehenen Besucherräumen.
War ich vielleicht doch im Knast gelandet?
Ich hatte meine Eltern nie so sehr gehasst, wie in diesem Moment. Wie konnten sie mir das nur antun? Wussten sie, was mich hier erwartete? Meine Mutter kannte doch meine Sozialphobie…
Aber natürlich! Sie hatte sich von diesem Institut S bestimmt erhofft, ich würde danach von all diesen Problemen »geheilt« sein.
Wütend, schweigend und fast ohnmächtig gegenüber dieser Ungerechtigkeit, wurde ich weiter reingeführt und durfte die Nacht allein in einem Raum mit Fliesenwänden verbringen. Dieser besaß eine Pritsche, ein Waschbecken und eine nicht abgetrennte Toilette. Eine Krankenstation?
Ich war zum Glück allein. Quarantäne hieß es, weil ich mich übergeben hatte. Sie wollten nicht, dass sich eine Magen-Darm-Grippe ausbreitete.
Mir war es nur recht, ich war froh, als die Tür hinter mir zufiel und ich allein war.
Typ Nr. 1 brachte mir noch Abendessen. Es sah aus wie Chili mit trockenem Brot, dazu ein Krug Wasser, alles im Plastikgeschirr.
Ich aß nichts, ich bekam nichts runter. Und obwohl ich allein von der Anfahrt so fertig war, dass ich kaum aufrecht sitzen konnte, fand ich einfach keinen Schlaf.
Ich wollte nach Hause, das war alles, was ich wusste.
Einfach nur nach Hause.
Aber das ging nicht, ich hatte keine Wahl.
Ich musste dort sein. Es gab für mich kein Entkommen, ich war alledem tatsächlich hilflos ausgeliefert.
Und das war ja erst der Anfang.
Kapitel 2
~*~
Mir wurde beigebracht,
die Realität zu fürchten.
~*~
Übermüdet durfte ich am nächsten Tag »eingegliedert« werden. Sprich, sie hoben die Quarantäne auf, da ich nicht noch einmal gekotzt hatte und trotz Schlafmangel auch eine recht gesunde Gesichtsfarbe besaß. Kein Fieber und auch sonst keine Auffälligkeiten, allerdings musste ich noch einige Tests schreiben. Mathe, Englisch, Geschichte; die Grundfächer eben. Und das noch vor dem Frühstück, nachdem ich unsanft geweckt worden war.
Die Pritsche war hart und unbequem gewesen, die grauen Laken rau wie einlagiges Toilettenpapier.
Noch vor dem Waschen saß ich an einem Tisch und versuchte, mich auf die Aufgaben zu konzentrieren, was mir unter normalen Umständen schon schwergefallen wäre. Dabei beobachtete mich Aufseher P. Rogers. So hatte er sich vorgestellt. Er war groß, im mittleren Alter, von den Zehenspitzen bis zum Scheitel durchtrainiert, sodass seine graue Uniform spannte, während er mit verschränkten Armen aus seinen kleinen Schweinsaugen auf mich herabsah und mich regelrecht durchbohrte. Sein Haar war blond und zurückgegelt, und er schaute mich an, als wartete er nur darauf, mich zurechtzuweisen. Ich durfte ihn nur mit Sir anreden. Das wusste ich, seit ich benommen aus dem Bett zu ihm aufgeschaut und ein dümmliches »Hä« von mir abgegeben hatte, als er hereingeplatzt war und gebellt hatte: »Aufstehen!«
»Hä? Was heißt hier hä? Spricht man bei euch so mit Erwachsenen?« Er hatte mir die raue Decke entrissen und auf den Boden geworfen. »Das heißt ab heute Ja, Sir! Mit dem größten Vergnügen, Sir! Und jetzt aufstehen, du Schwachkopf!«
Für mein Hä hatte ich zu Tagesbeginn ein paar Liegestütze machen dürfen. Ich hatte bis dorthin noch nie Liegestütze gemacht, trotzdem brüllte er mich an und beschimpfte mich als Pussy, weil ich es falsch machte. Danach befahl mir Aufseher Rogers, das Bett zu machen. Er sah mir zu, sagte nichts. Als ich fertig war, riss er alles wieder runter und nannte mich eine schlampige Schlampe.
Noch mal.
Und noch mal.
Er war unnachgiebig und ich musste es so lange neumachen, bis er zufrieden war. Ich hatte ab dem fünften Mal nicht mehr mitgezählt, aber je öfter er die Decke und das Kissen wieder herunterriss und mich zur Schnecke machte, je mehr Wut keimte in mir auf.
Wenig später saß ich dann mit ihm als Aufpasser ein paar Flure weiter in einem kahlen Betonraum ohne Fenster, damit mich ein Blick nach draußen nicht ablenkte, und hätte nach einigen Minuten schwören können, dass ich die Uhr an seinem Handgelenk ticken hören konnte, so still war es.
Zu still.
Wenn ich mich auf dem Stuhl nur leicht bewegte, konnte ich meine neue Kleidung rascheln hören. Zudem starrte er mich unentwegt an, es wurde ihm dabei offensichtlich nicht langweilig. Mein Magen knurrte, ich hatte ja auch seit vierundzwanzig Stunden nichts mehr gegessen. »Etwa hungrig, Schwabbelbacke?«
Ich war nicht fett, als Teenager hatte ich einen guten Stoffwechsel und erfreute mich einer eigentlich gesunden und annehmbaren Statur, ich war nur eben nicht muskulös. Ich war klein und weder dünn noch dick, als Kind war ich im Sport der Schnellste meiner Schule gewesen und bevor man mich gemobbt und immer zuletzt ins Team gewählt hatte, war ich auch gerne zum Sportunterricht gegangen.
Selbstverständlich war seine Frage keine ernstgemeinte Frage gewesen und ich antwortete auch nicht darauf, er wollte mich bloß provozieren, damit ich wütend wurde und etwas Dummes tat. Es schien ihn zumindest zu amüsieren, wie ich verbissen mit den Kiefern mahlte.
All das machte mich zu sehr nervös, ich kreuzte irgendwelche Antworten auf den Blättern an und wollte einfach nur noch fertig werden. Es war mir egal, welche Ergebnisse ich erzielen würde.
Als Rogers meine Tests überflog, meinte ich ein Zucken in seinen Mundwinkeln erkennen zu können, die mir nicht behagten. Ich erwartete, dass er mir auftragen würde, alles noch einmal neu zu machen, aber er nickte mir nur zu. »Stift ablegen und mitkommen.«
Noch immer hatte ich meine Tasche nicht erhalten, durfte mich aber auf der Krankenstation kurz waschen und auf die Toilette.
Danach betrat ich das erste Mal die riesige Mensa.
Mehrere hundert Jungen saßen an den langen Tischen und nahmen das frühe Mittagessen gemeinsam ein, natürlich unter Beobachtung von mehreren Aufsehern, die durch die Reihen gingen und hier und dort streng schauten oder auch mit erhobener Stimme die Jungen zurechtwiesen.
Sie schauten mich alle an, ich konnte es spüren, obwohl ich angestrengt zu Boden starrte.
Als ich hereingebracht wurde, saßen alle bereits mit ihren Tabletts auf den Bänken, während ich von Rogers Hand – die auf meiner Schulter lag – zur Essensausgabe dirigiert wurde.
Es gab undefinierbaren Brei, der aussah wie pürierter Beton, so grau wie die Uniformen der Bewacher. Es war wohl Kartoffelpüree oder so etwas, dazu Wasser.
Rogers führte mich zu »meiner Einheit«. So nannte er das. Wir waren alle in »Einheiten« aufgeteilt, und meine Einheit war Einheit J.
J wie Jackals.
Und so sahen mich die anderen etwa fünfundzwanzig – oder weniger – Jungen auch an. Wie Schakale, die Blut gewittert hatten. Ich blickte nicht auf, als ich auf der Bank bei ihnen Platz nehmen sollte, aber ich spürte ihre bohrenden Augen auf meinem Gesicht. Meine Haare fehlten mir, ich fühlte mich ausgeliefert.
Obwohl ich nicht aufsah, erkannte ich im Augenwinkel, wer neben mir saß. Der Junge vom Sportplatz. Zuerst hatte ich nur so eine Ahnung, dass ich ihn kannte, denn ohne das Blut in seinem Gesicht brauchte mein Verstand einen Moment länger, das Gefühl, ihn zu kennen, mit der Erinnerung zu vereinen, da er nicht mehr so irre grinste, sondern sehr ernsthaft und fast grüblerisch dreinblickte. Aber das war er, ohne jeden Zweifel. Das dunkle, kurzgeschorene Haar, die stechendgrünen Augen in seinem männlichen und harten Gesicht. Er hatte dicke Augenringe, auf beiden Seiten violette Veilchen und ein Pflaster auf der Nase. Er beobachtete mich ohne jede Zurückhaltung, aber nicht auf eine freundliche und neugierige Art, wie man einen Fremden ansah, dem man nur nach seinem Namen fragen wollte. So als studierte er mich.
Er schob sich eine Gabel in den Mund und beobachtete mich kauend, während ich trotz leerem Magen durch so viel Aufmerksamkeit nur angespannt in meinem Essen stocherte.
Warum starrte er mich so intensiv an? Wartete er auf etwas? Sollte ich Hallo sagen? Mich freundlich vorstellen?
Das konnte ich nicht. Ich war nicht unhöflich, doch ich konnte noch nie von selbst auf andere Menschen zugehen und zuerst eine Begrüßung äußern. Noch ein Grund, weshalb meine Eltern mich abgeschoben hatten, damit ich »Manieren« lernte.
Ehrlich gesagt sahen mich die anderen auch nicht gerade so an, als erwarteten sie von mir, dass ich mich ihnen vorstellte. Je länger ich dort saß und ihren Blicken ausgeliefert war, je mehr hatte ich den Eindruck, dass es ihnen nicht passte, dass ich bei ihnen saß.
Sie sahen sich untereinander an, ich konnte die stummen Unterredungen fast mitanhören, sie schielten unauffällig zu den Aufsehern. Erst als der große Typ mit der gebrochenen Nase neben mir kaum merklich den Kopf schüttelte, schienen sie sich ruhig zu verhalten und weiter zu essen.
Mir lag ein heißer Stein im Magen.
Auch wenn ich nun nicht mehr angestarrt wurde, bekam ich kaum einen Bissen runter. Ich aß damals ohnehin sehr wenig, eine Mahlzeit pro Tag, bei der alten Nachbarin, die ihr Gemüse selbst anbaute. Frühstück gab es bei uns gar nicht, Mom und Dad waren beide vollzeitarbeiten, um uns über die Runden zu bringen. Arbeit ging bei meinen Eltern immer über alles, und ich war zu faul, mir morgens etwas mitzunehmen, und in der Schulkantine wollte ich nicht essen, weil ich sowieso nicht wusste, wo ich sitzen sollte. Es tat gut, mich außerhalb des Unterrichts zu verkrümeln und mal Pause vom Spott zu bekommen.