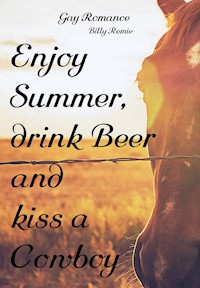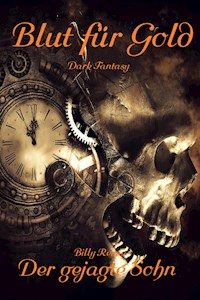Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Legenden aus Nohva 2
- Sprache: Deutsch
Die Reise ihres Lebens führt die Männer des M'Shier Ordens über das Meer zu gespenstischen Insel und wilden Eislandschaften. Im Land des Schnees lauert bereits ein alter Feind auf sie, der nach der Macht des Blutdrachen trachtet. Und während sie versuchen, zu überleben, droht die größte Gefahr innerhalb ihrer Gemeinschaft, denn Eifersucht macht Freunde blind, und Missverständnisse lassen den Zusammenhalt wanken. Allahad, der einstmalige Meuchelmörder, steht vor der Frage seines Lebens: Kann er die Vergangenheit ruhen lassen und den hartnäckigen Jäger Luro so lieben, wie dieser es von ihm verlangt, um nicht nur diesen, sondern auch sich selbst zu retten? *Gay Fantasy Romance
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1063
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Billy Remie
Im Land der Schatten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Epilog
Impressum neobooks
Prolog
Das Reich der Götter bestand aus kristallenem Glas. Vor seinem inneren Auge sah er noch das Lichtspiel, das durch die Fenster fiel und bunt auf den hellen Marmorböden tanzte, während in seinem Kopf nun reger Schwindel herrschte.
Er war die Schwere der Welt der Sterblichen nicht gewöhnt, er hatte sie nie erleben dürfen, und nun, da er ohne Vorwarnung aus dem Himmel gestoßen worden war, drohte ihn diese Schwere zu erdrücken.
Im Reich der Götter gab es nur Leichtigkeit, Liebe und Wärme, mehr hatte er nie kennen gelernt. Sein einziges Wissen über die Welt der Sterblichen beschränkte sich auf die Schriftrollen, die er auf seinen heimlichen Gängen durch die Bibliothek des Himmelsschlosses angesehen hatte. Er kam nicht umhin sich zu fragen, wie die Sterblichen diese Schwere all die Jahre ihres Daseins ertrugen. Für ihn war es purer Schmerz. In seinen Venen floss plötzlich Blut, das er als Gottkind nicht gebraucht hatte, und es fühlte sich wie Sand in seinem Körper an. Rauer Sand, der durch trockene Venen floss. Er wollte schreien vor Schmerzen, doch sein Mund wollte sich nicht öffnen.
Und es war kalt! So kalt! Im Reich der Götter gab es keine Kälte, kein Wetter.
Die Last dieser Welt drückte ihn unermüdlich nieder, sodass er nicht imstande war, auch nur einen Finger zu rühren. Er musste atmen, um zu leben, auch das war ihm unbekannt. Diese Welt schien ihn erdrücken zu wollen, als stünde ihr einziges Bestreben darin, seinen Tod herbeizuführen.
Aber sterben konnte er nicht. Nicht mehr. Er verstand nur einfach nicht, wieso. Von Geburt an hatte er sich beweisen müssen, ohne zu verstehen, was falsch an ihm war. Dabei hatte er stets nur das getan, was auch seine Brüder taten: er strebte die Liebe zu den Schöpfern an. Doch er wollte mehr als nur einer unter vielen sein, also war sein größtes Ziel gewesen, die Schöpfer zu beeindrucken, sie von seinem Können zu überzeugen. Er wollte ihr Lieblingsgott werden. Dafür musste er fallen.
»Geh und beweise dich, mein Sohn«, haben sie ihm aufgetragen. »Dann darfst du zu uns zurückkehren.«
Er hatte die Schöpfer mehr geliebt als alles andere, aber sie sahen in ihm stets nur eine große Bedrohung. Von dem Tage an, als er geboren wurde, war sein Schicksal bereits besiegelt. Während alle anderen die Wahl zwischen Göttlich und Sterblich treffen durften, wurde er nun mit der Unsterblichkeit bestraft, für ein Vergehen, das er selbst nicht begangen hatte.
Und trotzdem liebte er sie. Liebte die Schöpfer und das Reich des Himmels so sehr, dass er, trotz der Schmerzen, die rot unterlaufenen Augen aufzwang, um zum Himmel hinauf zu blicken, von wo er gekommen war. Er fand Trost im Anblick des wolkenverhangenen Himmels. Er lächelte, doch vor Erschöpfung fielen seine Augen wieder zu.
Es tat so unendlich weh, ein Sterblicher zu sein, dass er es nicht in Worte fassen konnte. Das Leben begann für ihn als einziger, großer Schmerz ...
Und dann war da ein dunkler Schatten, der sich über sein Gesicht legte. Ein schweres Schnauben ertönte über ihm.
Müde zwang er erneut seine Augen auf. Ein großer Hengst ragte über seinem am Boden liegenden Körper, die samtweiche Schnauze des Rosses war so schwarz wie das Portal zur Unterwelt. Das Tier blähte die Nüstern auf und schnupperte an ihm.
Lederne Zügel knirschten, als der Reiter sein Pferd herumlenkte und auf den Gefallenen hinabsah.
»Bei den Göttern ...«, hauchte der Reiter ungläubig.
Er war ein junger Sterblicher, mit dunklen Locken, schulterlang, die er mit einem braunen Lederband hochgebunden trug, einige Strähnen hingen ihm im Schlamm verkrusteten Gesicht.
Als der Gefallene den Reiter erblickte, seine stechend grünen Augen in seinem markanten Gesicht, da musste er unwillkürlich lächeln. Trotz der Qual erkannte er die Schönheit dieser Welt: die sterblichen Wesen darin.
***
Lugrain hatte es nicht glauben können, als er bei der Jagd mit seinen Brüdern einen Himmelskörper hinabstürzen sah. Seine Brüder wollten ihm keine Beachtung schenken, aber Lugrain war zu neugierig gewesen. Erst einen Mond zuvor hatte die weise Stammesmutter eine Vision gehabt. Sie erzählte ihrem Stamm von einem Stern, der am Tage vom Himmel fallen würde.
Lugrain sollte nicht überrascht sein, bisher hatte die Stammesmutter doch immer Recht behalten. Jedoch waren ihre Visionen immer auf verschiedene Weisen zu deuten. Denn der Stern war nicht aus Gestein, wie die üblichen Himmelskörper, sondern ein Wesen aus Fleisch und Blut. Ein gefallener Engel, gesandt von den Göttern, wie Lugrain glaubte.
Er schwang das lange Bein über den Hals seines treuen Pferdes und landete mit einem ›Platsch‹ im aufgeweichten Boden.
Mit dem Rücken lag der Gefallene auf einer Lichtung im braunen Matsch, um ihn herum war eine Kuhle, die davon zeugte, dass sein Aufprall hart gewesen sein musste.
Lugrain stützte den Jagdspeer auf dem Boden ab und ging neben der Kuhle in die Knie.
Das Wesen war ein strammer junger Mann, etwa im Alter von sechzehn überstandenen Wintern; nur drei Winter jünger als Lugrain selbst. Er war groß und sein nackter Körper blass, er schien ausschließlich aus Muskeln und Sehen zu bestehen, keine Narben, er war so unberührt wie eine frisch erblühte Sommerblume. Kurzes Haar, so dunkel wie Rabenfedern, helle Augen, blau mit einer gräulichen Blässe, die fiebrig schimmerten.
Der Junge sah mit einem erschöpften Lächeln zu Lugrain auf, seine schmalen Lippen bewegten sich, aber kein Ton kam heraus. Er schien verletzt, aber Lugrain konnte keine äußeren Wunden ausmachen. Es grenze ohnehin an ein Wunder, dass der Gefallene den Sturz überlebt hatte.
Über der Lichtung, auf der sich die beiden Männer befanden, zogen sich die dunklen Wolken zusammen, die schon seit drei Mondauf- und Monduntergängen drohend über Nohva hingen; es fing leicht zu regnen an. Die ersten dünnen Tropfen landeten auf den scharfkantigen Gesichtszügen des Gefallenen. Er zitterte, seine Lippen wurden allmählich blau.
Lugrain rammte seinen Speer in den Boden und löste den Knoten seines Umhangs, der aus dickem Wolfspelz bestand. Einen Arm unter den zitternden Jungen schiebend, brachte er ihn in eine aufrechte Position und wickelte ihm den Pelz um die Schultern, ungeachtet der Tatsache, dass er selbst nur noch mit seinem Lendenleibchen dem kalten Regen ausgesetzt war.
Mit Fingern, die sich zusammenkrampften, zog der Gefallene den Umhang enger um sich und lehnte seinen kraftlosen Körper gegen Lugrains warmes Fleisch.
Lugrain beschloss, ihn zum Stamm zu bringen. Die Stammesmutter würde schon wissen, was sie nun mit dem Gefallenen tun sollte. Sein Volk mochte keine Fremden in ihrer Mitte, doch Lugrain sah darüber hinweg, weil die Stammesmutter eine Vision von diesem Ereignis gehabt hatte. Lugrain fand es weiterhin klüger, ihn mitzunehmen, bevor andere Stämme von anderen Völkern ihn hier schutzlos fanden.
Doch bevor er den Jungen hochheben und auf den Rücken seines Pferdes setzen konnte, erklang eine sanfte Stimme, so lieblich wie ein Glockenspiel im Wind: »Ihr habt ein großes Herz, junger Sterblicher.«
Erschrocken sah Lugrain auf, doch ihn blendete ein plötzlich aufkommendes Licht.
Vor ihnen stand der Umriss eines großen Mannes, dessen Rücken von einem gelben Schein angestrahlt wurde, der so kräftig war, dass Lugrain die Augen zusammenpetzen musste.
»Wer seid Ihr?«, fragte Lugrain in der Gemeinsprache, da er die Sprache der Götter nicht beherrschte.
»Einer der fünf Schöpfer dieser Welt, Sterblicher.«
Lugrain blinzelte nur in den Lichtstrahl. Er wusste nicht, ob er den Worten Glauben schenken konnte.
»Reitet zurück und sprecht mit Eurer Stammesmutter, Sterblicher«, trug das leuchtende Wesen freundlich auf. »Sagt zu ihr, das Himmelsreich wird Eurem Stamm gewogen sein, wenn er unserem gefallenen Sohn dabei hilft, die Welt der Sterblichen kennen zu lernen.«
Lugrain war immer noch nicht im Stande, etwas zu sagen. Doch die Worte aus dem Mund des Wesens waren ohnehin bedeutungslos, da Lugrain bereits für sich entschieden hatte, dem Hilflosen zu helfen.
»Ihr müsst ihm beibringen, in dieser Welt zu überleben, bevor er sich auf seine Reise begeben kann«, erklärte das Wesen im Lichtstrahl. Es drehte sich um und trug Lugrain freundlich jedoch trotzdem nachdrücklich auf: »Geht nun, Sterblicher, und kümmert Euch gut um diesen Halbgott, denn eines Tages hängt vielleicht das Schicksal eurer Welt von ihm ab.«
1
Teil1: Insel der Vergangenheit.
»Folge den Spuren der Vergangenheit und du wirst verstehen. Doch die Grenze zwischen Lüge und Wahrheit verschwimmt, je nachdem, wer die Geschichte erzählt.«
Nach einem langen Ritt durch unbewohntes Gebiet, schlugen sie ihr Lager nahe einer Süßwasserquelle auf. Er beugte sich hinab zu dem Quell, der aus einer grauen Felsspalte floss, und schöpfte mit der Hand Wasser in seinen Mund, das im letzten Schein der Sonne glitzerte.
Nachdem er seinen Durst gestillt hatte, richtete sich der in schwarz gekleidete Mann auf und fuhr sich mit dem Handrücken über die schmalen Lippen.
Er sah sich um.
Dichter Urwald drängte sich um ihn, wechselnde Schatten in den bunten Baumkronen, der Duft von feuchtem Boden, der Gestank eines nahen liegenden Moors, klagende Rufe verschiedener Raubvögel, das düstere Fauchen einer Nachtschattenkatze.
Beinahe könnte er sich vorstellen, in der Heimat zu sein. Aber leider nur beinahe. Die Heimat lag so weit entfernt, dass auch nur der leiseste Gedanke an sie, seine Stimmung verdüsterte.
Wobei seine Laune zurzeit ohnehin mieser Natur war.
Nachdem er seinen Wasserschlauch mit kühlem Wasser aus der Quelle aufgefüllt hatte, ging er zum Lager zurück. Sie hatten es absichtlich einige Fußschritte entfernt aufgeschlagen, damit sie die Tierwelt nicht von ihrem Wasserplatz vertrieben.
Vier seiner Gefährten tummelten sich im aufgeschlagenen Lager. Der Jäger entzündete das Feuer für seine erlegte Beute – zwei hundsgroße Echsen –, der große Barbar und seine Gefährtin mit den spitzen Ohren tränkten die ermüdeten Pferde, und der Schurke saß auf einem überwucherten Stück Felsen und schärfte die Klingen seiner Krummschwerter mit einem Wetzstein, sein zotteliges und braunes Haar verbarg halb sein schmales Gesicht, nur die Nasenspitze und sein Ziegenbart waren zu erkennen. Neben dem Schurken im hohen Gras lag ein greinendes Bündel, das nach Aufmerksamkeit und Essen verlangte. Um das Bündel herum, war die schwarzweiße Nachtschattenkatze geschlungen, die jedes Mal fauchte, wenn auch nur jemand zu nahe an dem Kind vorbeilief.
Mit Unbehagen eilte er an dem Kind und ihrer Beschützerin vorbei, er ignorierte das Fauchen aus dem wolfsähnlichen Maul – und die giftigen Zähne, die in den Kiefern lauerten – und ging hinüber zum Feuer.
Der junge Jäger, so drahtig und dünn, dass er fast schon lieblich wirkte, hob nur kurz den Blick an und nickte ihm stumm zu.
Alle waren schlechter Laune, alle hatten eine lange Reise hinter sich, und es hob nicht gerade die allgemeine Stimmung, dass er sie nun durch dieses heimtückische Gebiet führte. Giftspinnen und Giftschlangen lauerten hier überall, in jedem noch so kleinsten Grasbüschel. Ganz zu schweigen von den großen Echsen, die äußerst aggressiv auf Eindringlinge reagierten.
Keiner seiner Gefährten wollte hier sein, das ließen sie ihn auch deutlich spüren, sie straften ihn mit misstrauischen Blicken und eisernem Schweigen. Doch das kümmert ihn nicht, auch nicht die Gefahr, in die er sie alle brachte, weil sein ganzes Bestreben nur auf diesen einen Tag hingearbeitet hatte. Nun stand der ersehnte Tag so kurz bevor, er war so kurz vor dem Ziel und er erkannte …, dass es zu einfach gewesen war.
Deshalb war seine Stimmung so düster, weil sein Verstand und die Erfahrung ihm sagten, dass es zu einfach gewesen war. Irgendetwas Schreckliches würde geschehen, noch bevor sie ihr Ziel erreichten, er spürte es tief in den Knochen.
Er setzte sich ans Feuer und beobachtete den jungen Jäger, wie dieser die Echsen hintereinander auf einen gewaltigen Stock steckte und sie auf die Vorrichtung über dem Lagerfeuer hing. Der Duft von brutzelnden Schuppen stieg bald auf und ließ seinen Magen knurren.
»Neun Monate auf See«, klagte der Jäger und stocherte in der Glut des Feuers, sodass es Funken sprühte. »Neun Monate nur Pökelfleisch und Fisch – Und jetzt nur Echsen. Ich hatte auch auf Wildgemüse oder wenigstens Obst gehofft.«
»Es gibt reichlich Obst hier«, erwiderte er auf das Genörgel des Jägers hin.
»Aber keines, das mich nicht nach dem Verzehr umbringt.«
Grinsend lehnte er sich zurück und stützte seinen strammen Körper auf die spitzen Ellenbogen. »Ihr habt vielleicht einfach zu hohe Ansprüche, junger Jäger.«
Der dunkelhaarige Jäger warf ihm aus großen Augen einen entnervten Blick zu. Gleich darauf wurden die zarten Züge in dem jungen Gesicht melancholisch. Ein bedauernder Blick starrte in die züngelnden Flammen. »Wisst Ihr, was ich am meisten vermisse? Die Törtchen. Im Palast gab es immer Törtchen. Törtchen zusammen mit frischer, noch warmer Kuhmilch. Wisst Ihr, wie lange wir keine Milch mehr getrunken haben?«
Den Blick zu Boden richtend, schüttelte er den Kopf. Er konnte sich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wann er das letzte Mal etwas anderes als in der Wildnis entsprungenes Wasser getrunken hatte. Oder – wie in den letzten Monaten auf hoher See, nachdem das letzte Fass mit Trinkwasser geleert war – seinen eigenen Urin.
»Es ist eine Ewigkeit her«, flüsterte der Jäger ermüdet. Wie ein Kind saß er in der Hocke vor dem Feuer, die Beine mit einem Arm umschlungen, das Kinn auf den Knien ruhend, während seine andere Hand mit einem Stock im Feuer herumstocherte, als sähe er einen Gegner in den Flammen, den er erstechen wollte.
Ja, die letzten Jahre waren nicht gut zu ihnen gewesen. Angefangen mit Verrat, Flucht und schließlich ihre Verbannung aus der eigenen Heimat. Und keiner von ihnen hatte auch nur geahnt, wie beschwerlich so eine Seereise sein würde. Aber welche Wahl hatten sie denn schlussendlich gehabt? Einvernehmlich hatten sie zugestimmt, die Heimat hinter sich zu lassen, ohne zu wissen, was vor ihnen lag. Und alles hätte gut werden können, hätten sie nur bedacht, dass ihnen auf halbem Wege die Vorräte ausgingen. Keiner hätte voraussehen können, dass sie gleich drei Tage hinter einander in heftige Seestürme gerieten und die Hälfte an Fracht verloren. Und dann diese Krankheit, die die Schiffsbesatzung ausgelöscht hatte, herbeigeführt von zu viel Fleisch und zu wenig Obst, bis keiner außer ihnen mehr übrig war, sodass sie notgedrungen die Kunst des Segelns selbst erlernen mussten. Was nicht einfach gewesen war, jeder von ihnen hatte mit anpacken müssen.
»Wir dürfen nicht vergessen, welch Glück wir hatten«, sprach er auf den jungen Jäger ein.
»Er hat Recht.« Der Schurke stand auf einmal neben ihnen, seine dunkle Stimme wies einen schnurrenden Akzent auf. Mit seiner Anwesenheit leuchteten sogleich die Augen des jungen Jägers glücklich auf. Doch das Strahlen wurde nicht erwidert, der Schurke beachtete es gar nicht. »Wir leben noch, wir sollten zusehen, dass es so bleibt.«
Der Schurke hob einen Bogen vom Boden auf, dazu die letzten verbliebenen Pfeile in einem halbleeren Köcher, den er sich über den Rücken hing. »Ich spähe die Gegend aus. Es wird bald dunkel, und ich will nicht von irgendwelchen Wilden überrascht werden, oder diversen Raubtieren zum Opfer fallen.«
»Du solltest nicht alleine gehen«, warf der Jäger besorgt ein.
»Allein bin ich schneller und leiser.«
Schamesröte stieg dem jungen Jäger in die Wangen, als er schnell den Kopf senkte. Der Schurke hatte niemand im Speziellen angesprochen, doch allgemein war bekannt, dass der Jäger in ihrer Gemeinschaft der Redseligste war, und selten still sein konnte.
»Wo sind eigentlich unsere erlauchten Anführer?«, fragte er seine Gefährten schließlich.
Der Schurke schnaubte belustigt. Als er antwortete, verzogen sich seine Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen: »Sie ›jagen.‹«
***
Spätabendlicher Wind raschelte durch die bunten Blätter des Waldes, Sonnenschein fiel durch die Baumkronen und zeichnete Schattenspiele auf das Gesicht eines scheinbar schlafenden Mannes. Die Melodie der Tierwelt wehte zu seinem Ohr. Das Summen der Fliegen, das Quaken der Amphibien nahe dem Moor, das Singen der Vögel in den Ästen weit über seinem Kopf, sein eigenes Tier tief in seinem Selbst vergraben, das grollend schlummerte.
Ruhe. Einsamkeit. Erholsamer Schlaf, nach einem Kraftakt, der Erfüllung geschenkt hatte.
Milder Abendwind, der über seinen verschwitzten Körper glitt, ohne das Auskühlen zu spüren, dank des Feuers in seiner Seele.
Sich selbst spüren. Wegdämmern, ohne sich im festen Schlaf zu verlieren. Immer wachsam.
Die Präsenzen des Waldes spüren, als seien sie Teil von einem. Die Augen geschlossen halten, den Puls hinunter atmen, trotz zuckenden Lenden nicht die gewillten Finger zur pochenden Männlichkeit bewegen.
So tun, als würde er schlafen.
Sinne schärfen. Spüren, hören, sogar schmecken, wo sich der andere befand. Die Augen auf sich fühlen, die aus dem Unterholz herausstarrten. Hören, wie sich Schatten durch das Dickicht bewegten. Den Duft schmecken, den er auf der Haut des anderen hinterlassen hatte.
Desiderius runzelte belustigt die Stirn, während er krampfhaft versuchte, sich schlafend zu stellen.
Oh, er täuschte den anderen Mann nicht von Beginn an. Er hatte tatsächlich geschlafen. Doch ein halbes Leben als Vagabund hatte ihn gelehrt, jede Bewegung, jede Veränderung um sich herum, wahrzunehmen, auch im tiefsten Schlaf. Manchmal vermisste er die Einsamkeit seines früheren Daseins, die Freiheit, hinzugehen, wohin er wollte. Allein. Und doch wollte er seine Freunde, seine Familie, nicht mehr missen. Selbst dann, wenn er wieder spürte, wie sehr ein Mann manchmal das Alleinsein benötigte.
Gefühle zu zulassen war harte Arbeit, und Emotionen konnten reichlich anstrengend sein. Sie stets richtig zu deuten war schwer. Und doch hatte er sich mittlerweile gut daran gewöhnt. Aber mit anderen Lebewesen, Tag ein und Tag aus, zu jeder Tages- und Nachtzeit zusammen zu sein, zerrte an seinen Nerven. Der Umgang mit anderen war stets schwer für ihn gewesen, nicht einmal die Liebe und Freundschaft zu anderen hatten ihn davor bewahrt. So war er nun mal einfach, er konnte nicht ständig unter anderen Lebewesen sein, er genoss die Zeit mit sich alleine ganz gerne, und sei es nur für wenige Augenblicke, in denen er vor sich hindösen konnte. Nur er und das Tier in ihm, das niemals verschwand.
Er vermisste es nicht unbedingt, nur für sich selbst da zu sein, und doch spürte er gelegentlich seine Geduld schwinden; seine Laune wurde schlechter, je öfter er sich mit anderen Lebensformen umgab. Dann, aber wirklich nur dann, brauchte er eine Pause und Zeit für sich allein. Seine Gefährten wussten darum und ließen ihm seinen Freiraum. Trotzdem hatte er jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn er sich zurückzog. Jedoch war es besser, wenn er vor Gesellschaft floh, als seine düstere Stimmung ungewollt grob an seinen Freunden auszulassen. Oder – Schöpfer bewahre – an seinem innigen Geliebten.
»Ha!« Der Schatten sprang aus dem Dickicht neben Desiderius’ Schlafstätte – einem monströsen Mammutbaum – und warf sich auf ihn.
Schmunzelnd fing er den geschmeidigen Körper des anderen Mannes noch im Flug ab, warf ihn herum und rollte sich über ihn.
»Ach nein, das ist so ungerecht!« Der Blonde mit dem gelockten Goldhaar trommelte mit zwei eisernen Fäusten auf Desiderius‘ nackte Brust. »Wie kannst du das gewusst haben!«
Leise in sich hineinlachend, schob Desiderius seine Hüfte zwischen die Schenkel des Angreifers.
»Ich habe es genauso gemacht, wie du es mir gezeigt hast!«, beklagte sich Wexmell.
Es stimmte, er hatte sich gut angestellt. Mit einem mitfühlenden Lächeln beugte sich Desiderius zu ihm hinab und fuhr die Linien des vollen Mundes mit der Zungenspitze nach, ehe er nachsichtig versicherte: »Es ist nicht deine Schuld, dass ich eine gute Wahrnehmung besitze. Du hast dich gut geschlagen, ich hätte dich fast nicht kommen gehört.«
Er warf ihm Krümel zu, obwohl nichts davon stimmte. Weshalb er auch der falsche Mann dafür war, um Wexmell irgendetwas beizubringen. Desiderius war gegenüber seinem Prinzen zu nachsichtig, zu inkonsequent. Wenn Wexmell etwas lernen sollte, musste er ihn an seine Grenzen bringen. Nicht nur beim Schleichen, nicht nur beim Jagen, vor allem im Schwertkampf. Nur gut, dass Bellzazar den jungen Prinzen im Zweikampf trainierte. Seither war Wexmell viel besser geworden, und die harte Arbeit eines Seemanns hatte ihm einen starken und durchtrainierten Körperbau beschert, sodass es viel leichter für ihn war, größere Schwerter und nun auch Schilde zu führen.
Vergessen war die Niederlage, nachdem Zungenstrich starrten Wexmells eisblaue Augen wollüstig zu Desiderius auf. »Selbst im Schlaf verlierst du nicht an Härte«, bemerkte Wexmell. Seine Worte unterstreichend, rieb er seinen ledernen Waffengürtel über Desiderius’ pochender Männlichkeit, die zwischen ihren Körpern eingeklemmt war.
Ein grollender Laut entrann sich Desiderius’ Kehle. Er schob einen Arm unter Wexmells goldenen Haarschopf und legte sich genüsslich auf dessen Körper. Schlanker, kleiner als sein eigener Leib.
»Du hast mich einfach schlafend allein gelassen«, beklagte sich Desiderius, ohne den Vorwurf wirklich ernst zu meinen. »Nackt, verschwitzt und der wilden Tierwelt ausgeliefert.«
Um Wexmells volle Lippen spielte ein heiterer Ausdruck. »Vergebung, ich ahnte nicht, dass Ihr so schutzlos seid, holde Maid.«
Desiderius schmunzelte düster. »Oh, das wirst du bereuen.«
»Ach ja, wirklich?« In Wexmells Blick lag pure Provokation. »Denkt Ihr, ich habe Angst vor einem nackten Mann, mein edler Ritter?«
An den Rittertitel würde Desiderius sich nie gewöhnen, zumal es jetzt ohnehin keine Bedeutung mehr hatte, ebenso wenig wie Wexmells königliches Blut in seinen Adern. Ob Prinz, Ritter, Dieb, Meuchelmörder, Barbar oder Dämon ... all diese Titel, ob schmeichelhaft oder beleidigend, bedeuten rein gar nichts mehr so weit ab der Heimat. Seit Wexmells vorgetäuschtem Tod und Desiderius’ Verbannung aus Nohva, waren sie alle nur noch eines: Flüchtlinge, die ums Überleben kämpfen mussten.
Desiderius fuhr mit der Hand über Wexmells erhitzte Stirn und strich ihm das goldgelockte Haar zurück. Es war kühl und seidig, ohne eine Spur von spröden Spitzen oder gekräuselten Strähnen. Trotz aller Strapazen verlor Wexmells Erscheinungsbild nicht an Schönheit. Er war so hinreißend perfekt wie eine Statue, bis auf die Narben unter seinem braunen Lederwams, aber selbst die waren in Desiderius’ Augen keine Makel.
»Unterschätze niemals einen nackten Mann, Wex.« Desiderius klang ernst, als er seinem Geliebten diesen Rat gab.
Sofort verschwand jegliche Belustigung aus Wexmells zaghaftem Gesicht. Nachdenklich legte er den Kopf schief und musterte Desiderius’ markante Züge. »Wieso?«
Lüstern schmunzelnd bewegte Desiderius eine Hand an Wexmells Seite hinab, fühlte das Leder der Rüstung, spürte die kalten Riemen, die sie zusammenhielt, tastete an der leeren Schwertscheide vorbei und schob sie unter Wexmells warmen Körper, um sich deutlich aber nicht grob um die sinnliche Rundung seiner prallen Pobacke zu legen.
»Weil ...«, er schmiegte das Gesicht an Wexmells, » ... sie dir gefährlicher werden können als jeder Mann mit einer Waffe.«
Ein heiseres Keuchen entfloh Wexmells Mund, als er seine Lippen teilte. Desiderius zupfte liebevoll daran, ließ anschließend die Zunge in den süß schmeckenden Mund seines Prinzen gleiten. Unterdessen spürte er bereits Wexmells Hände, die sich an seinen Schultern festkrallten und ihn hinabzogen. Drängend rieben sich ihre Körper aneinander, der eine heiß und nackt, der andere ungeduldig und in Rüstung.
Die Reibung seiner harten Männlichkeit über Wexmells Lederwams sandte ungeahnt lustvolle Impulse durch Desiderius’ Körper. Widerstrebend löste er sich trotzdem von Wexmells Lippen.
Einen protestierenden Laut ausstoßend, flehte Wexmell: »Bitte, nicht aufhören ...«
Auflachend rollte sich Desiderius von ihm runter und landete mit dem Rücken wieder auf dem schwarzen Umhang, den er für sie auf dem Boden ausgebreitet hatte, bevor sie wie Hunde über einander hergefallen waren, wild und unbändig in ihrer Leidenschaft.
Dreimal hatte er mit Wexmell Erfüllung gefunden, bevor er in dessen Armen weggedöst war. Auch im Schlaf hatte er noch das drängende Pochen seines Glieds gespürt, das, seit der Entdeckung des Tiers in ihm, nie zur Ruhe zu kommen schien.
Aber für heute hatte er genug. Er war schon ganz wund, der Kopf seiner Männlichkeit leuchtete rot und hob sich deutlich vom Rest des Schafts ab. Rot gescheuert von zu wilder Behandlung, worüber er sich nicht beklagte. Aber ein Mann wusste, wann es genug war.
Wexmell rollte sich auf die Seite und stützte den Kopf auf eine Hand. Mit der anderen strich er über das wulstige Narbengewebe auf Desiderius’ Arm und Schulter, wo ihn einst magisches Feuer verbrannt hatte.
Noch heute, nach all den Monaten, schmerzten die Narben. Und laut seinem Halbbruder Bellzazar, würde er mit diesen Schmerzen vermutlich leben müssen. Es waren jedoch nicht die einzigen Narben, die vom Kampf um Nohva, den sie verloren hatten, geblieben waren.
Desiderius hob seine Hände vor sein Gesicht und betrachtete die länglichen Narben in den Innenflächen. Tiefe Einschnitte hatten diese Zeichen auf seiner Haut hinterlassen, er hatte sie sich selbst zugefügt, um das Schwert aufzuhalten, das sich quälend langsam in seine Brust geschoben hatte. Wie zur Erinnerung an dieses Ereignis, stach die Narbe über seinem Herzen.
Wexmell legte den Kopf an Desiderius’ Schulter, seine Locken kitzelten an Hals und Schlüsselbein. »Tut es weh?«, fragte der Prinz und hob nun seinerseits eine Hand, um mit dem Finger über die Narbe in der linken Hand zu streichen.
»Nein.« Desiderius ballte die Hände zu Fäusten, dann ließ er die Arme fallen. Er drehte den Kopf und lächelte Wexmell traurig an. »Und selbst wenn, kein Schmerz war, ist oder wird je so groß sein wie jener Schmerz, den ich spürte, als ich dachte, dich verloren zu haben.«
Zwischen Wexmells Augen entstand wieder eine tiefe Sorgenfalte, wie jedes Mal, wenn dieses Thema aufkam. »Ich wünschte, ich könnte dir die Erinnerung daran nehmen. Dein Kummer ist für mich schwerlich zu ertragen.«
Desiderius strich ihm übers Kinn, hauchte ihm einen federleichten Kuss auf die Stirn. »Zu düstere Erinnerung für einen so schönen Abend, lass uns über andere Dinge sprechen.«
»Und worüber?«
»Vielleicht darüber« - Desiderius schmunzelte belustigt in sich hinein - »was wir den anderen erzählen, weshalb wir keine Jagdbeute mitbringen.«
Wexmell schaute düster drein. »Sagen wir die Wahrheit: ich kann einfach nicht jagen.«
Desiderius hatte Mitleid mit ihm und stützte sich auf der Seite liegend auf. »Wex, es ist nie leicht, eine neue Fertigkeit zu lernen.«
Aber Wexmell ließ sich mit solchen Floskeln nicht aufmuntern. Er ließ sich auf den Rücken fallen und starrte stur in den Himmel auf. »Was bin ich für eine Art Mann, wenn ich nicht einmal ein Tier erlegen kann? Ich fühle mich wie ein Kind, das nie erwachsen wird.«
»Benutz das nächste Mal die Fangzähne, statt eines Bogens«, scherzte Desiderius, um seinen Prinzen wieder zum Lächeln zu bringen. Er fuhr sich mit der Zunge über die eigenen Fangzähne, die seinem Volk – den Luzianern – eigen war, als Wexmell ihn forschend musterte, und wackelte anschließend mit den Augenbrauen.
»Ich meine es ernst, Derius!« Wexmell bat um Aufrichtigkeit. »Was siehst du in mir? Nur einen jungen Jüngling, der beschützt werden muss?« Die Vorstellung, Desiderius könnte so von ihm denken, schien ihm nicht zu gefallen. »Das will ich aber nicht«, sagte er wütend, ohne eine Antwort abzuwarten. »Ich will ein Mann sein.«
»Nicht die Fähigkeit des Jagens macht einen Mann aus dir!«, warf Desiderius ein. Er bohrte einen Finger in Wexmells Brust und betonte seine Worte, indem er die Spitze des Fingers immer wieder in das rissige Leder der Rüstung stieß. »Was ein Mann fühlt und was ein Mann denkt macht ihn aus. Nicht die Fähigkeit zu jagen, oder wie ein Schwein zu grunzen.«
Wexmell lachte schnaubend auf.
Eindringlich erklärte Desiderius seine Ansicht: »Ist ein Mann, der einen Hammer in der Schmiede schwingt, denn mehr ein Mann als jener, der auf der Straße einen Pinsel über ein Bild gleiten lässt, nur, weil der Schmied gegenüber dem Maler eine körperliche Überlegenheit besitzt? Nein! Ein Mann ist ein Mann, wegen dem, was er fühlt und was er denkt.« Er strich mit einem Finger über Wexmells stoppliges Kinn und schmunzelte verschmitzt. »Nicht die Fähigkeiten, nicht einmal das Äußere macht einen Mann aus, sondern nur das, was in ihm steckt.«
Und so gesehen war Wexmell mehr Mann als alle Männer die sie kannten zusammen, weil in ihm eine Größe wohnte, die keiner von ihnen besaß. Er war derjenige, der sie anführte, der die wirklich schweren Entscheidungen treffen und mit den Konsequenzen leben musste. Der Mann, der für jede Situation eine diplomatische Lösung suchte, ehe er zum Schwert griff.
Es war leicht, Gewalt anzuwenden, es war leicht, Kämpfe zu beginnen, aber zu versuchen, einen Sieg ohne Blut zu vergießen für sich zu gewinnen, das konnte nur Nohvas rechtmäßiger Erbe. Für Desiderius zeugte dieser Charakterzug, der ihm selbst fehlte, nicht nur von Größe, sondern auch von besonderem Mut. Es ist nämlich einfach, in Rüstung und mit gezogener Klinge seinem Feind entgegenzutreten, doch wirklich mutig waren jene Männer, die in einen Kampf nur Worte mitbrachten.
Er hatte sich schon oft ein Stück von Wexmells scheinbar immer gelassener Art abschneiden wollen, jedoch war sein Temperament strikt dagegen. Nur gut, dass sie zusammengehörten, so glichen sie die Schwächen des jeweils anderen aus.
Wexmell lächelte so lieblich, dass es ein Hasenkind an Niedlichkeit weit übertraf, und fragte: »Bin ich also männlich genug, um ein Mann zu sein?«
Statt die Frage zu beantworten, erwiderte Desiderius: »Das hängt ganz davon ab, wie der Betrachter Männlichkeit definiert.«
Wexmell legte den Kopf schief. »Und du? Hältst du mich für einen Mann?«
Diese Frage beantwortete Desiderius, indem er sich zu ihm hinabbeugte und ihn genüsslich küsste. Er ließ zu, dass Wexmells Hände bald darauf in sein dunkles Haar glitten und sich festkrallten, ihn über sich zogen, wo Desiderius sich rittlings über Wexmells stramme Schenkel setzte.
Als sie sich lösten, bemerkte Wexmell mit vor Lust dunkler Stimme: »Das war keine Antwort.«
»Das war eine deutliche Antwort«, widersprach Desiderius. Er richtete sich auf und sah schmunzelnd zu Wexmell hinab, spürte die Härte unter Wexmells Rüstung, die sich seinem nackten Körper entgegendrängte. »Denn ich würde dich doch nicht küssen wollen, wärest du kein Mann.«
Froh lächelnd verschränkte Wexmell die Arme hinter dem Kopf. »So? Und wenn mich ein böser Zauber morgen in eine Frau verwandelt, verlässt du mich dann?«
»Das habe ich nicht gesagt«, warf Desiderius ein. »Nur, dass ich dich nicht küssen wollen würde, wärest du kein Mann.«
»Dann bleibst du bei mir, ohne mich zu küssen?« Wexmell schien verwirrt.
»Lass es mich versuchen, zu erklären.« Desiderius beugte sich wieder zu ihm hinab, rieb die Nasenspitze an Wexmells Wange und bahnte sich einen Weg aus Küssen über die zarte Wange bis hin zu einem blassen Ohrläppchen, an dem er knabberte, bis seine Fänge Kerben in der verletzlichen Haut hinterließen.
Wexmell keuchte leise unter ihm, bewegte die Hüften auffordernd und rieb sich an seinem bloßen Fleisch, das erneut an Härte gewann.
Mit dem Mund an Wexmells Ohr, flüsterte Desiderius: »Mein Körper begehrt nur Männer, doch für dich hege ich Gefühle. Wärest du eine Frau oder würdest plötzlich eine werden, hätte ich diese Gefühle trotzdem, auch wenn mein Fleisch sich nach Männern sehnt. Gefühle, wie die Liebe, sind nicht an das fleischliche Begehren gebunden. Jedenfalls nicht, wenn man mich fragt. Gefühle sind immer individuell, so wie jedes Zusammensein.
Ich kann mich also mit dir vereinen, unsere Seelen und auch unsere Körper, selbst dann, wenn dein Körper weibliche Rundungen hätte, weil du es bist, den ich mehr ersehne, als jedes Stück Fleisch, das mir begegnet. Du und ich hatten einfach nur Glück, dass wir sowohl gegenseitig unsere Körper als auch unser Selbst begehren.«
Aber konnte er in ihrem Fall wirklich von Glück sprechen? Sofern er Bellzazars Erklärungen über die Anker und Gegenstücke richtig verstanden hatte, war es von den Göttern so gewollt, dass er sich in Wexmell verliebte, und umgekehrt. Sie hatten die Seele des Prinzen absichtlich in den Körper eines Mannes gelegt, weil sie wussten, es würde die Verbindung zwischen Desiderius und Wexmell stärken. Die Götter hatten sich vielleicht einfach nur einen Plan zurechtgelegt, der in ihren Augen ohne Hindernisse aufgehen würde.
Nur eines verstand Desiderius noch immer nicht: Warum wollten die höheren Wesen überhaupt, dass er und Nohvas rechtmäßiger Thronerbe zusammenfanden?
Was hatten sie davon und welch unergründliche Pläne verfolgten die Götter noch für das Leben in der Welt der Sterblichen?
Das Unbehagen dieser ungeklärten Fragen abschüttelnd, vergrub Desiderius sein Gesicht in der Kuhle zwischen Wexmells Hals und Schulter, um sich noch ein letztes Mal an diesem Tag der Fleischeslust unter freiem Himmel hinzugeben, trotz seiner wunden Männlichkeit, ehe sie zurück zu ihren Gefährten gingen. Nichts ahnend, dass er bei seinem Liebesakt mit seinem Prinzen aus neugierigen Augen beobachtet wurde, begann er, Wexmell spielerisch die Rüstung abzustreifen.
2
»Bringt diese Made zur Tür herein!«, donnerte der Kaiser mit erhobener Stimme durch den funkelnden Gerichtssaal. Der Thron, auf dem sein schmaler Arsch festgewachsen zu sein schien, seit er zum Kaiser gewählt worden war, bestand aus glänzendem Marmor, die hohe Rückenlehne und die Armlehnen waren mit den edelsten Diamanten und Edelsteinen geschmückt, die es innerhalb und außerhalb des Reichs gab.
Ashen atmete tief ein und schloss die Augen, als die schweren Türen im Saal geöffnet wurden. Scharniere knarrten unter dem Gewicht des massiven Gesteins, als die Wachen unter Aufwand bloßer Körperstärke die Torbögen aufzogen. Zwei Ackergäule wären nötig gewesen, um sie in angemessener Eile zu öffnen, doch der Kaiser duldete kein Vieh in den Gebäuden; auf die massiven und schön verzierten Gesteinstürbögen hatte er trotzdem nicht verzichten wollen.
Dust, Ashens Schwester, legte ihre kühlen Finger über Ashens im Schoß gefaltete Hände und drückte aufmunternd zu. »Der Kaiser wird unserem Gebieter vergeben«, flüsterte sie zuversichtlich.
Nicht, dass Ashen irgendetwas an seinem Gebieter gelegen hätte. Um schonungslos ehrlich zu sein, mochte er ihn nicht einmal. Und doch, was würde aus ihnen, den Sklaven, werden, sollte der Kaiser ihren rechtmäßigen Besitzer hinrichten?
Sie würden allesamt getrennt und an andere Herren verkauft werden, wo sie eine weniger lobenswerte Position bekommen würden. Vermutlich würde Ashen unter täglicher Prügel die Latrinen niederster Bediensteter leeren müssen. Er sah sich schon in Lumpen bis zu den Knien in Scheiße stehen. Dabei war er kein Junge, der an körperliche Arbeit gewöhnt war, er konnte nicht einmal ein Fass Wein anheben ohne einen größeren, stärkeren Sklaven um Hilfe zu bitten. Für schwere Arbeit war er ohnehin nie ausgebildet worden.
Zwei gepanzerte Ritter der kaiserlichen Garde schleppten einen gefolterten Mann herein. Er trug nur ein zerrissenes, bräunlich verdrecktes Hemd aus Leinen, und beschmutzte Unterhosen, keine Stiefel, er war barfuß, seine blanken Fußsohlen waren blutig und wund. Auf dem hellen Marmorboden hinterließ er eine Schleifspur aus roter und brauner Flüssigkeit, der Gestank von Fäkalien und Tod wehten ihm hinterher.
Ashen senkte den Blick, weil er es seltsam fand, seinen Gebieter so zu sehen, er wollte nicht hinterher dafür bestraft werden, geglotzt zu haben, falls der Kaiser ihren Herrn doch am Leben ließ.
Dust drückte erneut seine Hände, auch sie senkte den Kopf.
Auch wenn man ihrem Herrn jegliche Güter abgenommen hatte – Palast, Ländereien, die gefüllten Schatzkammern, das Vieh in den Ställen, das Korn aus den Vorratskellern, selbst die Kleidung, die er bei seiner Verhaftung getragen hatte – waren die Sklaven aus Valerius Tewes’ Haus noch bestens gekleidet und herausgeputzt. Jedenfalls bis zur offiziellen Verurteilung, oder vielleicht hatte der Kaiser noch keine Zeit gehabt, anzuordnen, auch ihnen die weißen Gewänder und schmucken Haarreife abzunehmen.
Valerius Tewes war bekannt für gut erzogene Sklaven, die er mit Vorliebe ankleidete und schmückte, als seien sie Puppen. Nicht, dass Ashen und Dust die hübschen Tuniken und die funkelnden Haarreife und Halsketten ihr Eigen nennen durften, nein, sie mussten alles wieder abgeben, wenn der Tag vorüber war und sie in ihre Kammern gebracht wurden, bis der Morgen graute und sie wieder herauskommen durften.
Sie waren keine Lebewesen, sie waren Besitztümer.
Eines hatte dieses Dasein an sich, das Ashen als durchaus vorteilhaft anerkennen musste: sie konnten nicht wegen Verfehlungen ihres Gebieters angeklagt werden. Ihr Herr musste sich für seine Taten alleine verantworten und wenn er hingerichtet wurde, würden sie ihm nicht folgen, sondern der Kaiser würde sie für sich beanspruchen oder verkaufen, um die Reichskassen zu füllen; wie es eben mit Besitztümern gehandhabt wurde.
Keine Lebewesen – Sklaven. Und Sklaven waren immer ein Besitz und kein fühlendes, liebendes, verletzbares Wesen.
Ashen hatte diese Wahrheit von Geburt an gelernt, er kannte kein anderes Leben. Doch das bedeutete nicht, dass er sein Dasein unbedingt so mochte, wie es jetzt war.
Er schielte zu seiner älteren Schwester, genau wie er, trug sie über ihrer blassen Haut eine schneeweiße Tunika, die über der rechten Schulter mit einer Spange gehalten wurde und um die Taille mit Stoffgürteln umschlungen war. Ihr langes haselnussbraunes Haar war zu einem langen Zopf geflochten, ein perlenbesetzter Reif schmückte ihren schmalen Kopf, ihre weichen Züge hatten etwas Puppenhaftes, ihre großen, kindlichen Augen waren von langen Wimpern umrandet, ihre spitzen Ohren waren mit Schmuck durchlöchert. Sie sah so jung, so zart, so lieblich aus, doch Ashen kannte das wahre Wesen hinter diesem unschuldigen Gesicht. Dust hatte es faustdick hinter den Ohren, sie war so viel stärker und mutiger als er. Ashen schob es immer auf die fünf Jahre Altersunterschied, jedoch wussten sie beide insgeheim, dass er, im Gegensatz zu ihr, einfach nicht genug Mumm besaß.
Suchend tasteten seine Finger nach denen seiner Schwester, sie verschränkten die Hände miteinander und er fand Trost in ihrer Nähe, in ihrer Stärke. Egal was geschah, niemand würde sie beide trennen, dafür würde Dust schon sorgen. Sie hatte es versprochen, und sie war wirklich gut darin, andere zu manipulieren. Valerius Tewes hatte sie von Geburt an darin geschult, ihre Weiblichkeit zu nutzen, um Männer dazu zu bekommen, ihre Wünsche zu erfüllen, noch bevor sie sie deutlich zum Ausdruck brachte. Diese Gabe hatte Valerius bis zu Letzt bei jedem seiner Verbündeten genutzt, um seine eigenen selbstsüchtigen Wünsche durchzusetzen.
Das Gesicht des Kaisers war von seinen glatten und schulterlangen Haaren eingerahmt, wie schwarze Vorhänge aus glänzender Seide bewegten sie sich bei der Bewegung, ohne dass sich je eine einzelne Strähne herauslöste, fast so, als wäre des Kaisers Haar eine einzige Struktur, ähnlich einer Matte. Er rieb sich das glatt rasierte Kinn; es war sehr lang und spitz, genau wie der Rest seines Gesichts. Er hatte etwas Verkniffenes an sich, seine Augen waren stets zu schmalen Schlitzen verengt, als kämpfe er mit ständigen Sorgen. Um seine dünnen und spröden Lippen lag ein harter Ausdruck, der von der Macht seines Amtes zeugte. Er war der unangefochtene Herrscher des Reichs, die wohlhabenden Bürger hatten ihn selbst gewählt und niemand wagte es, sein Recht auf den Kaiserthron anzuzweifeln, hat er doch als General des letzten Kaisers gut gedient und Ruhm und Ehre erlangt. Nur durch ihn hat das Reich sich soweit ausbreiten und seine Macht stärken können. Die Herrscher und die Könige der anderen Kontinente zitterten schon in Anbetracht der Tatsache, dass der Kaiser, sollte er es wünschen, ihre ganze Welt erobern könnte; nur mit klugem Vorgehen und unerwarteten Zügen auf dem Feld. Aber übernehmen will der Kaiser die Welt nicht, noch nicht jedenfalls. Wenn man dem Geschwätz auf dem Markt Glauben schenken durfte, wollte der Kaiser lediglich ein vereintes Reich gründen, ein Reich, das ihm zu Füßen lag. Gerüchten zu folge, wollte der Kaiser die Könige und Königinnen der anderen Kontinente nicht absetzen, er wollte, dass sie vor ihm niederknieten und im friedlichen Einverständnis unter seiner Herrschaft dienten, auf dass alle den gleichen Göttern huldigten und Frieden herrschte.
Dass die Völker der Menschen sich dagegen wehren würde, war keine Vermutung, sondern eine allgemeine Gewissheit. Selbst Ashen, der so jung war und von Politik keinen Schimmer hatte, wusste, dass der Kaiser von Elkanasai die Menschenvölker unter seiner Herrschaft versklaven würde, weil in der Geschichte der Elkanasai nichts unreiner und böser sein konnte als diese Wesen mit ihren seltsam runden Ohren.
Aber des Kaisers angebliche Pläne konnte auch nur dummes Geschwätz auf dem Markt sein.
Ashen maß sich nicht an, die Gedanken der Mächtigen zu kennen. Er selbst wusste nur eines mit Sicherheit: wenn es Krieg gab, würden zuerst die Sklaven sterben. Und er war ein Sklave.
Der Griff um die Hand seiner Schwester wurde fester, als der Kaiser mit seiner elegant klingenden und doch einschüchternden Stimme zu sprechen begann.
»Valerius Tewes.« Er spukte den Namen aus, als sei er Gift auf seiner Zunge. »Es wurden schwere Anschuldigen gegen Euch erhoben.«
Valerius hob das von Folter gezeichnete Gesicht unter seinem langen Haarschopf an. Das Blond seiner Strähnen wirkte deutlich blasser als üblich. »Ich versichere Euch, sie sind alle haltlos erfunden – Uhrrgt.«
Ein Ritter trat ihn mit dem gepanzerten Fuß in den Bauch. »Du sprichst nur, wenn der Kaiser es dir erlaubt, Gefangener!«
Hustend hielt sich Valerius den Magen, wo der Tritt ihn getroffen hatte. Nur Ashen glaubte, das aufflammen puren Hasses in den Augen seines Meisters zu erkennen.
Das untere Diener, wie ergebene Ritter, ihn duzten und traten und sich anmaßen, ihm Befehle zu geben, war zusätzliche Demütigung zu der Schmach, die Valerius ohnehin verspüren musste, weil er vor jemanden knien sollte, den er hasste.
Ein fieses Lächeln lag auf den Lippen des Kaisers. Zufrieden über den gedemütigten Valerius, lehnte er sich in seinem Thron zurück, die silberne Krone auf seinem schwarzen Haupt, die einen Granz aus Nussbaumästen mit runden Blättern darstellte, verrutschte dabei leicht.
Valerius Tewes und seine Familie waren dem Kaiser und allen anderen reichen Bürgern des Reichs stets ein Dorn im Auge gewesen, selbst die Sklaven wussten das. Das Haus der Tewes’ entstammte aus einem Zweig mit menschlichen Vorfahren. Ein Uhrgroßvater Valerius Tewes’ soll ein wilder Barbar aus dem Eisland Carapuhr gewesen sein, der es im Kaiserreich Elkanasai zu Reichtum geschafft hatte. Von der menschlichen Abstammung sah man Valerius nichts mehr an, er war durch und durch ein Elkanasai mit langen und schlanken Gliedmaßen, blasser Haut und spitzen Ohren, doch sein Name – sowohl Ruf- als auch Familienname – zeugte von dem menschlichen Blut in seinen Venen.
»Ihr behauptet also, der Minister würde lügen?«, fragte der Kaiser. Er warf einen Blick zu dem Mann neben sich, der arrogant eine Augenbraun hochzog und zu Valerius hinabstarrte.
Valerius sah vom Minister zum Kaiser und antwortete gefasst: »Ja, mein Kaiser.«
Staunen war von den Anwesenden zu hören, die reichen Damen schlugen ihre Hände vor die weit aufgerissenen Münder. Kaum vorstellbar, wie anmaßend Valerius doch war!
»Lasst mich sprechen, ich bitte Euch, mein Kaiser!«, flehte Valerius demütig.
Der Kaiser machte eine wenig einladende Handbewegung, es war ihm zuwider, dem nachzugeben, doch er ließ sich darauf ein, damit niemand hinterher behaupten konnte, er würde Verurteilen ohne alle Fakten zu kennen.
Valerius kniete weiterhin auf dem kalten Boden, hätte die Folterung genug Kraft in ihm gelassen, wäre er sicher aufgestanden, um wie üblich stolz zu gestikulieren.
Ashen hielt die Luft an, jetzt war es soweit ...
»Der Minister wirft mir vor, ich hätte ein Versprechen gegeben und dann gebrochen, jedoch kann ich bezeugen, dass ich ihm nie die Hand meiner Cousine versprach, er nahm sie sich gegen meinen Willen, also nahm ich, was mir zuvor gestohlen wurde, zurück.«
Der Minister donnerte eine Faust auf seine Stuhllehne und sprang auf. »Das ist eine Ungeheuerlichkeit! Ich war mit Eurer Cousine bereits vermählt, als ihr sie umbringen ließet!«
»Setzt Euch, Minister«, trug der Kaiser gelangweilt auf.
Der Tod einer Frau kümmerte ihn nicht, solange es nicht jene war, die er begehrte. Und soweit man hörte, sollte er selbst seine Angetraute nicht sonderlich lieben. Sie war nur für ihn notwendig, um ihm Kinder zu schenken.
»Mein Kaiser«, wandte sich der aufgebrachte Minister an seinen Herrscher, »Valerius Tewes hat gerade selbst zugegeben, einen Mord begangen zu haben.«
»Um die Ehre der Familie herzustellen, so wie es jeder gute Mann getan hätte!«, schaltete sich Valerius ein. Er wandte sich erneut an den Kaiser, der verbissen mit den Zähnen mahlte. »Ihr selbst habt Eure erstgeborene Tochter hinrichten lassen, als sie mit einem Eurer Kommandanten davonlaufen wollte. Es liegt im Recht eines Mannes, die Frauen seiner Familie zu verheiraten. Meine Cousine verlor ihren Vater, mein Onkel bat mich auf seinem Sterbebett, für sie zu sorgen. Doch sie beschmutzte mich, mein Haus und unsere Familie, als sie gegen meinen Willen die Verbindung zu diesem Mann einging. Es war mein gutes Recht.«
Damit war der Kaiser in einem Zwist, denn er konnte Valerius nicht wegen Mordes anklagen, es sei denn, er gab zu, selbst ein Mörder zu sein, da er die nichtbewilligte Heirat seiner Tochter auch bestraft hatte. Er nagte lange an seiner Lippe.
Der Minister warf sich vor dem Kaiser auf die Beine, Tränen in den Augen. »Ich habe meine junge Frau geliebt! Und sie liebte mich. Valerius gab uns seinen Segen, bevor wir den Bund eingingen. Nur weil er die Mitgift zurückhaben wollte, ließ er sie töten. Er will mir ein Verbrechen anhängen, weil er meine Ländereien begehrt. Er ist ein Mörder, mein Kaiser!«
»Unsinn! Ich würde doch niemals eine Heirat genehmigen, wenn die Frau bereits mit mir den Bund eingegangen war!«, rief Valerius.
Raunen ging durch die anwesenden Zuhörer.
Der Kaiser entzog sich ruckartig der Hände des Ministers, die seine Finger flehend umklammerten. »Habt Ihr Beweise für die genehmigte Eheschließung?«
Der Minister senkte den Kopf, Wut flackerte in seinem schmalen Gesicht auf. »Ich hatte ein Schriftstück mit Valerius’ Unterschrift, doch es ist spurlos verschwunden.«
»Wie überaus ärgerlich«, knurrte der Kaiser. Er sah hinab zu Valerius, in dessen Augen der Triumph bereits funkelte. »Und Ihr? Könnt Ihr denn beweisen, dass die Heirat gegen Euren Willen geschah?«
»Natürlich!« Valerius neigte ergebend sein Haupt. »Ich würde nie ohne Beweise eine Verteidigung vorbringen, mein Kaiser.« Valerius’ Hand deutete hinter sich, er zeigte direkt auf Ashen und Dust.
Jetzt war es soweit. Nur zu diesem Zweck durften die beiden Sklaven überhaupt dieser Verhandlung beiwohnen.
Der Kaiser bedeutete ihnen, aufzustehen.
Mit ergebend hängenden Köpfen standen Dust und Ashen von ihren Bänken auf, alle Augen waren auf sie gerichtet, was seltsam war, da sie die meiste Zeit über unsichtbar blieben.
»Sprecht, Sklaven!«, forderte der Kaiser auf. »Aber seid gewarnt, lügen ist ein schweres Vergehen. Solltet ihr mich, euren Kaiser, anlügen, werde ich euch dafür mit dem Tod bestrafen.«
Er sagte das so eindringlich, das Ashen tatsächlich überlegte, die Wahrheit zu sagen.
Aber unmerklich stieß ihm Dust einen spitzen Ellenbogen in die Rippen, als wüsste sie, was in ihm vorging.
Dust sprach zuerst: »Mein Gebieter war stets gegen das Gesuch des Ministers, die Cousine meines Gebieters zur Frau zu nehmen, da der Onkel meines Gebieters bereits die Hand seiner Tochter meinem Gebieter versprach.«
»Entspricht deine Aussage der Wahrheit, Sklavin?«
Dust nickte demütig.
»Schwörst du das auch unseren Göttern?«
Erneut nickte sie.
»Setz dich«, trug der Kaiser ihr auf.
Dust setzte sich.
Nun war Ashen an der Reihe.
»Was sahen deine Augen und was hörten deine Ohren, Sklave?«
Ashen log erstaunlich vortrefflich: »Ich war dabei, als mein Gebieter den Bund mit seiner Cousine einging, ich selbst sah zu, wie das Schriftstück zum Beweis dieser Ehe unterschrieben wurde.
Die Frau meines Gebieters lief nur zwei Nächte danach davon und heiratete gegen den Willen der Götter den Minister. Ich schwöre bei Krassus, dem Gott der Aufrichtigkeit, dass mein Gebieter nur ein Verbrechen gesühnt hat, das ihm angetan wurde.«
»Setz dich, Sklave.«
Ashen setzte sich.
Dust nahm wieder seine Hände, beugte sich zu ihm und flüsterte stolz: »Das hast du gut gemacht.«
Doch Ashen fühlte sich unwohl dabei, zu lügen.
Es war genauso, wie der Minister es vermutete. Alles war eine große Intrige, nur damit Valerius die Ländereien zugesprochen bekam, weil man ihm angeblich Unrecht getan hatte.
Nichts von alledem war wahr, er hatte die Heirat gebilligt und hinterher alles so gedreht, dass der Minister der Verbrecher und Sünder war.
»Außer Euren Sklaven habt Ihr nichts?«, fragte der Kaiser. »Warum sollten wir Euren guterzogenen Haustieren Glauben schenken?«
Düsteres, gemeines Lachen ging durch die Zuhörer.
Ashen sah sich mit gesenktem Kopf um, er hasste sie alle dafür, dass er für sie nichts weiter war als ein Ding, über dessen willenloses Dasein sie sich lustig machen konnten.
»Mein Bruder hat die Urkunde der Heirat mitgebracht, mein Kaiser«, erklärte Valerius.
Der Kaiser nickte widerwillig. »Er soll sie reinbringen.«
Erneut wurden die schweren Türen unter grunzenden Wachen geöffnet. Sahrian Tewes, ehemaliger Kommandant in der Kaiserlichen Armee, heute nur noch ein Wrack, der auf einem rollenden Stuhl herumgefahren werden musste, kam herein, geschoben von zwei wunderschönen Sklavinnen aus Valerius’ Haus.
Keiner sagte etwas, alle hielten die Blicke gesenkt, während der ehemalige Kommandant, Liebling aller Soldaten, reingeschoben wurde, sabbernd und nur halb Herr seiner Sinne, gelähmt und mehr tot als lebendig, der Duft von Unrat haftete ihm an.
Er war in einer Schlacht um Zadest schwer verwundet worden, doch statt das die Götter ihm einen ruhmreichen Tod auf dem Schlachtfeld gewährten, hatten sie ihn leben lassen; sofern man das, was er war, lebendig nennen konnte.
Der Humor der Götter konnte grausam sein. Einen Kommandanten wie Sahrian Tewes hatte es in der Geschichte noch nie gegeben. Trotz Unterlegenheit hatte er seine Truppen weiter nach Zadest hereingebracht als jeder andere. Doch skrupellos war er nicht, selbst seine Feinde huldigten ihm Respekt, weil er ein Ehrenmann war. Zadest konnte nach Sahrians Verwundung nicht eingenommen werden, die kaiserliche Armee wurde zurückgedrängt.
Jetzt war von dem einstig großen Kommandanten nur noch eine sabbernde Hülle übrig, die sich auf die Versorgung seines Bruders verlassen musste.
Der Kaiser stand auf und kam von seinem Thron herunter. Selbst er zollte dem einstmals großen Krieger Respekt, indem er ihm die Hände auf die Schultern legte und ein paar nette, geflüsterte Worte mit ihm austauschte. Dann besah er sich das Schriftstück an, das Ashen zusammen mit Dust gefälscht hatte.
Nachdem Sahrian wieder nach draußen geschoben wurde, nahm der Kaiser wieder Platz und überschlug die dürren Beine.
Der Minister sah sich panisch um.
»Nun denn«, begann der Kaiser. »angesichts der Beweise, bleibt mir keine andere Wahl als Valerius Glauben zu schenken.«
»Was? Nein!« Unglauben trat in die Augen des Ministers.
»Nehmt den Minister fest, sein Kopf rollt im Morgengrauen, als Warnung für all jene, die ihren Nachbarn die Frau stehlen wollen.«
»Mein Kaiser, nein!«, protestierte der Minister, aber da wurde er schon von Leibwachen gepackt und aus dem Saal geschleift.
Mit vor Zorn bebender Stimme brüllte der Minister: »Dafür wirst du bluten, Valerius! Die Götter werden deine Lügen nicht hinnehmen, Unreiner!«
Unrein wurden diejenigen genannt, deren Blut mit Menschenvölkern vermischt worden war. Die Beleidigung traf Valerius hart, er knirschte mit den Zähnen, zeigte aber keine Angst vor dem Zorn der Götter, denen er ohnehin nicht huldigte. Jedenfalls nicht, wenn ihn nicht gerade der Kaiser beobachtete.
Ashen sah dem Minister nach, wohlweißlich, dass er eine Teilschuld an dessen Tod trug. Es machte ihm das Herz schwer ...
»Ich danke Euch für Eure Großzügigkeit, mein Kaiser.« Valerius verneigte sich und sah sich schon im Sieg.
»Was Euch betrifft, werde ich es nicht billigen, dass Ihr ohne meine Erlaubnis ein Urteil gefällt habt!«, beschloss der Kaiser.
Valerius wurde blass. »Mein Kaiser?«
»Der Mord an Eurer Frau wird keineswegs unbestraft bleiben, Valerius. Ihr hättet mir dieses Verbrechen vortragen und mein Urteil abwarten müssen, stattdessen habt Ihr Euch über mich hinweggesetzt.«
Oh nein, wenn alles umsonst gewesen war, würde Ashen nie wieder ruhig schlafen können ... Wozu all die Lügen, wenn ihr Gebieter doch hingerichtet wurde?
Der Kaiser dachte lange nach, sah dabei durch die Säulen nach draußen in die Hitze Elkanasais. Dann breitete sich ein bösartiges Schmunzeln auf seinem Gesicht aus.
»Valerius Tewes, ich schicke Euch mit all Euren Untertanen, Vorräten und Gütern auf eine Reise zu einem gefährlichen Ort. Die Reise werdet Ihr aus eigener Tasche zahlen.«
Ashen konnte deutlich sehen, dass die Haut in dem Gesicht seines Gebieters noch blasser wurde als sie ohnehin schon war. »Ihr meint doch nicht etwa ...?«
»Geht und beweist Euren Wert für unser Volk, Valerius«, trug der Kaiser ihm auf. »Ihr wisst, wo von ich spreche, und wohin die Reise gehen wird. Brecht sofort auf und kommt nicht mit leeren Händen zurück. Bringt mir, was ich suche, und Ihr erhaltet nicht nur Eure Länder zurück, sondern auch die des Ministers.«
Ashen wusste nicht, worum es ging, doch er spürte an der Anspannung im Saal, dass es keine leichte Aufgabe war, die der Kaiser Valerius übertrug.
Wie zu sich selbst sagte der Kaiser mit starrem Blick an die Wand hinter den Zuhörerbänken: »Viel zu lang war diese Schmach eine offene Wunde in der Geschichte unseres Volkes.«
»Es ist ein unmögliches Vorhaben, mein Kaiser«, warf Valerius ein, es war ihm sehr deutlich anzumerken, dass ihn die Vorstellung, seine gemütlichen Palasträume zu verlassen, ängstigte.
Doch der Herrscher über das Kaiserreich Elkanasai ließ sich nicht abbringen. Knurrend verlangte er von Valerius: »Bringt mir den Mann, der unserem Volk einst Nohva stahl!«
3
Verängstigt sah sich der Gefallene um.
Die große Strohhütte war mit dicken Pelzen und Fellen ausgeschmückt, ein Lagerfeuer prasselte in der Mitte, dahinter saß eine gealterte Frau mit grauem Haarschopf, den sie unter einem Wolfmantel versteckte. Tote, leere Augen starrten zu dem Gefallenen aus dem ermordeten Wolfsgesicht herab, der Anblick war seltsam für ihn, es war die erste Leiche mit einem Gesicht, die der Gefallene erblickte.
Unangenehm. Falsch. Er konnte den Tod in dieser Welt riechen, mehr noch als er das Leben um ihn herum wahrnehmen konnte.
Tod. Überall Tod. Nicht wie im Reich der Götter. Dort gab es nichts so Endgültiges.
Noch immer hatte er große Schmerzen, konnte nur mit Mühe aufrecht sitzen. Kälte, Angst bestimmten seine Gedanken.
Wo war der Mann, der ihn gerettet hatte? Wo war der Reiter, der ihn auf dem schwarzen Ross aus den Regen brachte? Wo war sein Retter, dessen Pelzumhang er noch immer trug?
Panisch sah er sich um und fand ihn unweit von sich entfernt, nahe des Eingangs.
»Das kann nicht dein Ernst sein, Lugrain!«, fauchte eine dunkle Männerstimme.
Bevor der Angesprochene etwas erwidern konnte, hob die Alte auf der anderen Seite des Feuers stumm eine Hand, und alle im Raum richteten ihre Aufmerksamkeit auf sie. Ihr Blick lag über den züngelnden Flammen und begegnete, aus wissenden aber von altersschwachen trüben Augen, dem Blick des Gefallenen. Das Leuchten des Feuers erhellte das unter dem Wolfskopf halbverborgene Gesicht und ließ die Alte fürchterlich aussehen, zum Gruseln, wie ein wahrgewordener Alptraum.
»Mutter, es war so, wie du vorhergesagt hast«, erhob nun Lugrain, der Retter des Gefallenen, das Wort an die Alte. »Er fiel am Tage vom Himmel, ich sah es.«
»Wir sahen beim Jagen lediglich etwas hinabstürzen, es war reiner Zufall, dass du an jener Stelle einen schäbigen Fremden fandst!«, knurrte wieder der andere Mann. Er war groß und seine vom Sommer gebräunte Haut glänzte verschwitzt im Schein der Flammen, sie wirkte im düsteren Zeltinnerem viel dunkler als sie eigentlich war. Wie Lugrain, besaß auch er dunkles Haar, jedoch – so wie auch die anderen Stammesmänner – war sein Haar kurz. Harte und erfahrene Züge zeichneten sein kantiges Gesicht, Entschlossenheit und auch etwas Wildheit lag in seinen grünen Augen, die denen Lugrains so ähnlich waren, dass die Verwandtschaft der beiden nicht anzuzweifeln war. Er flößte dem Gefallenen allein durch seinen Anblick gehörigen Respekt ein, ganz zu schweigen von dem verachtenden Blick, mit dem er den Gefallenen zwang, die Augen von ihm abzuwenden.
»Bruder, du hast selbst gesehen, wie er vom Himmel fiel.« Lugrain ließ sich nicht dazu hinreißen, wie sein älterer Bruder die Stimme zu erheben, er bliebt sachlich, wofür der Gefallene ihm dankbar war; denn Zorn kannte er genauso wenig wie Tod und Schmerz.
»Und was soll er deiner Meinung nach sein? Ein funkelnder Stern?«, spuckte der andere Mann aus und zog, auf den Gefallenen hinabstarrend, verächtlich seine Oberlippe hoch. »Er ist ein verdreckter Mensch, ausgestoßen von diesem Stamm in der Nähe. Und wenn selbst die ihn nicht wollen, brauchen wir ihn erst recht nicht.«
Der Gefallene schloss für einen Moment die Augen und atmete tief durch. Zu sehr störten ihn die Blicke der anderen Anwesenden, die bisher der Diskussion stumm um das Feuer herumsitzend beigewohnt hatten. Da war eine junge Frau, schlank und nur mit Lederbändern bekleidet, die ihre untere Körperregion verhüllten, jedoch nicht ihre kleinen, spitzen Brüste, deren dunkle Spitzen lockend emporstanden.
Da war ein zierlicher junger Mann, mit lieblichen Zügen, blondem Haar und blauen Augen, die mitfühlend den Gefallenen beobachteten.
Aber auch weitere Krieger saßen und standen um das Feuer herum, alle trugen um die Lenden nur Pelze und Leder, das von Bändern gehalten wurde, drohende Speere in den Händen; viele grünäugige Männer mit dunklem Haar, alle schienen von der gleichen Blutlinie abzustammen. Jedoch störte ihn am meisten der harsche Blick aus den harten Augen einer jungen Frau mit hochgebundenem Zopf. Sie sah unnachgiebig und grob aus, sie war die einzige Frau, die ihre Rundungen unter einem größeren Fetzen Stoff verbarg, darunter konnte der Gefallene einen aufgedunsenen Leib erkennen. Sie trug die Frucht des Lebens unter ihrem Herzen. Aus irgendeinem Grund verstörte ihn das am meisten. Und warum überhaupt starrte sie ihn an, als sei er ihr Feind, obwohl er noch kein Wort gesprochen hatte?
Er wollte aufstehen und gehen, weil es ihm nicht behagte, an einem Ort zu sein, wo er ungewollt war, doch seine Beine bewegten sich nicht. Zu schmerzhaft lag die Last dieser Welt noch auf ihm, ohne Hilfe seitens Lugrain konnte er nicht aufstehen, und im Augenblick wagte er es nicht, sich hilfesuchend nach seinem Retter umzudrehen.
»Ich sah einen Mann, der sich Schöpfer nannte, und von Wohlwollen sprach, wenn wir den Gefallenen aufnehmen«, erzählte Lugrain seinem Stamm. Er wandte sich an die Alte, die noch immer kein Wort gesprochen hatte, sondern nur die Hand hob, bevor der Streit eskalieren konnte. »Mutter, ich habe mir das nicht eingebildet. Würde er uns verstehen, würde er sicher bestätigen, dass dort ein Licht und ein Mann war, der mir sagte, was zu tun ist.«
»Du glaubst also, ein Gott sprach zu dir, Bruder?«, fragte ein anderer Krieger, der am Feuer stand und sich lustig machte.
Lugrain ließ ausatmend die Schultern hinabsinken. »Ich weiß nicht, welches Wesen es war, ich weiß nur das, was ich gesehen habe. Und ich lüge nicht, so gut kennt ihr mich.«
»Ja, wir kennen dich, Lugrain«, knurrte nun die schwangere Frau. Sie sah mit hasserfüllter Miene zu Lugrain auf und fuhr fort: »Und wir wissen um deine Naivität.«
Lachen durchfegte die Runde, nur die andere Frau, die Alte und der blonde Jüngling stimmten nicht in das Gelächter ein.
Lugrain gab unerwartet harsch zurück: »Dein verletzter Stolz passt nicht hierher, geliebtes Weib.«
Sauer stand sie auf, erstaunlich leichtfüßig für eine Frau mit einem derart ausladenden Bauchumfang, die Niederkunft musste kurz bevorstehen. »Dann habe ich, nur, weil ich deine Frau bin, rein gar nichts dazuzusagen?«
»Natürlich hast du eine Meinung, aber behalt sie weitestgehend für dich, wenn ich spreche!«
Düsteres Lachen erklang von den Kriegern.
Die schwangere Frau sah sich wütend um, woraufhin die Männer beschämt die Köpfe senkten. Schnell war zu erkennen, dass die Schwangere auch von den männlichen Wesen in ihrem Stamm gefürchtet wurde.
Wieder suchte sie Lugrains Blick, der ihr unnachgiebig entgegenstarrte. »Andere Frauen in diesem Stamm haben das gleiche Mitspracherecht wie Ihre Männer.«
»Aber du bist nun mal nicht die Frau der anderen Männer, sondern meine!«, donnerte Lugrain stolz zurück. »Meine Vorfahren gründeten diesen Stamm, es war mein Clan, der euren in einem schlimmen Winter aufnahm, ihr habt eine Schuld bei uns! Und jetzt verlangst du Mitspracherecht bei Dingen, die nur die Stammesführer etwas angeht?« Lugrain nickte auf den stolzen Krieger, den er Bruder nannte. »Dann bitte, sag das auch meinen Brüdern.« Ein weiteres Nicken deutete auf die Alte hinter dem Feuer. »Sag es unserer Großmutter. Sag ihnen, dass du jetzt auch eine von uns bist, nur, weil du das Zelt mit mir seit dem letzten Frühlingsfest teilst.«
Die Schwangere verstummte, angesichts der harten Miene aus Lugrains Bruders Gesicht.
Etwas einfühlsamer schloss Lugrain den Streit mit den Worten: »Niemand behauptet, du dürftest deine Meinung nicht aussprechen, aber bei wichtigen Fragen entscheidet immer noch der Clan, der den Stamm gründete. So ist es nun mal Brauch.«
»Und wenn er ein Dämon ist?«, zischte sie Lugrain an. Ohne sich die Frage beantworten zu lassen, stampfte sie aus der Hütte.
Kalter Wind und Nässe traf auf den Rücken des Gefallenen, als sie die Behausung verließ.
Einen Moment blieb es still, die Anwesenden warfen sich unbehagliche Blicke zu.
Die andere Frau stand auf und zurrte den Ledergurt um ihre Hüften fest, ihre bloßen Brüste hüpften bei jeder Bewegung. Entschlossen trat sie neben Lugrain und den Gefallenen und verkündete: »Ich stehe hinter Lugrains Entscheidung.«
»Wie kann es auch anders sein«, murmelte jemand.
Sie warf einen scharfen Blick in die Runde, aber keiner wollte zugeben, diesen Ausruf verlauten gelassen zu haben. Dann drehte sie sich zu Lugrain und umfasste liebevoll seinen Kopf. Es war das erste Mal, dass der Gefallene sah, wie Lippen auf andere Lippen trafen, er hörte das Schmatzen eines feuchten Kusses, und erkannte das Unbehagen in Lugrains Augen.
Mit einem Lächeln verschwand nun auch die andere Frau.