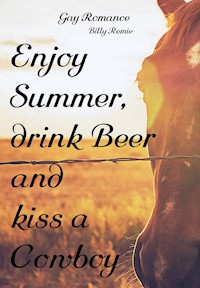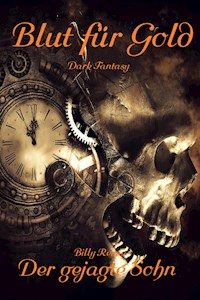7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Bruderschaft
- Sprache: Deutsch
Fürchtet den schwarzen Nebel. Und die Gleichgültigkeit der Sterblichen. Der Finale Band der Chroniken der Bruderschaft Einst war er ein Prinz, ein mächtiger Zauberkundiger, Sohn des Blutdrachen, Bruder, Geliebter und letztlich der Dunkle König. Doch seine Vergangenheit hat für Riath kaum noch eine Bedeutung, seit er Fäule entkommen ist. Zumindest dachte er, dass er alles hinter sich lassen und einen neuen Weg einschlagen könnte, wäre da nicht der eine Mann, dem einst sein Herz gehörte und der ihn vor siebzehn Jahren verraten hat. Kacey vermag es, alte Wunden wieder aufzureißen, und er ist fest entschlossen, Riath zu finden, während die Welt in Dunkelheit und Tod versinkt und nur noch Götter die Auslöschung allen Lebens aufhalten können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1676
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Billy Remie
Geliebte Götter
Das Herz der Unterwelt
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Teil 1: Hartnäckige Schatten
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Teil 2: Abgründe und Brücken
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Teil 3: Von Aufstieg und Fall
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Epilog
Epilog 2
Nachwort
Impressum neobooks
Prolog
Sein Vater würde ihn für den Rest seines Lebens in Ketten halten.
Oder in einem Käfig. Zusätzlich zu den Ketten.
Vorausgesetzt, er würde das hier überhaupt überleben und unversehrt in einem Stück wieder zum Lager zurückfinden.
Schnaufend, blutend und bebend vor Kälte zog er sich durch die graubraunrote Matschmasse zu einem umgestürzten Baum und lehnte sich gegen den rauen Stamm. Schnee, Erdbrocken und Blut bedeckten ihn vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen, das Gemisch trocknete bereits zu einer harten Kruste, die bei jeder Bewegung wieder aufriss und von seiner Kleidung rieselte.
Mit letzter Kraft trat er das Monster von seinem schmerzenden linken Fuß. Das schwarze Fell der Bestie war verklebt von schwarzer Fäule, ein widerlicher Geruch der Verwesung ging von ihm aus. Nicht mehr lange und es würde sich erneut rühren, obwohl sein Kopf halb von seinem wurmartigen Körper getrennt war. Aber es war untot; zähe Fäule würde es wieder zusammenflicken.
Dann würde der verseuchte Whyrm erneut auf ihn losgehen.
Mit letzter Kraft hob Siderius seine blutigen und verschrammten Hände und nutzte den Nebel im Wald für eine Vorlage einer Illusion. Manchmal waren diese Monster dumm genug, auf einen magischen Vorhang hereinzufallen. Er zauberte um sich herum die Nachbildung des Waldes, nur ohne ihn als leichtes Ziel, das blutend und erschöpft am Boden saß.
Die Magie strömte warm durch ihn, doch sie wurde bald zur unerträglichen Hitze und ließ ihn keuchend zusammensacken. Die Illusion stand und zerrte zusätzlich an seinen letzten Kraftreserven, doch der Zauber war nicht halb so anstrengend wie der fruchtlose Versuch, davon zu laufen.
Eri wusste, dass er niemals schneller als ein Whyrm rennen würde, selbst wenn die Bäume enger gestanden und ihm Schutz geboten hätten.
War ja klar, dachte er mürrisch, legte eine Hand auf die klaffende Wunde unterhalb seines rechten Rippenbogens, und spuckte blutigen Schleim neben sich in den Schnee. Unter ihm war Fäule, auf ihm war Fäule. Er würde sich infizieren, er konnte beinahe spüren, wie die Krankheit bereits nach ihm griff und durch seine Wunden in seinen Körper eindrang. Er kramte in seinen Manteltaschen und spürte in der Innenseite die Feuchtigkeit, die Phiolen waren zerbrochen. »Dieses verhurte Miststück«, fluchte er. Der Whyrm hatte ihn mit dem peitschenden Schwanz auf die Brust geschlagen und ihn durch den Wald geschleudert. Dabei mussten die Heiltränke zerbrochen worden sein.
Seine Finger wühlten sich durch Scherben und zähflüssige Rückstände in seiner Brusttasche, auf der verzweifelten Suche nach einem intakten Trank. Als er sich an einer Scherbe schnitt, zuckte er zurück, zischte kurz und steckte sich den blutigen Finger in den Mund.
Lächerlich, schalt er sich gleich darauf, er blutete aus tieferen Wunden und sein ganzer Körper pochte vor Schmerzen, dieser winzige Schnitt war sein geringstes Problem.
»Scheiß drauf«, knurrte er durch die Zähne und rappelte sich auf. Dann würde er sich eben umso mehr beeilen müssen, eine Siedlung der Rebellen zu erreichen, bevor das Fieber ihn holte.
Unter ihm war ein Sumpf aus Blut, Schnee und Matsch, sodass er immer wieder wegrutschte, bis seine Beine aussahen, als hätte er ein kleines Schlammbad genossen.
Die Wunde, die das Biest mit seinem Schnabel unter seinen Rippen gerissen hatte, brannte mehr als die Heiltränke, wenn sie sich durch seine Eingeweide wieder nach draußen fraßen. Und das sollte schon etwas heißen.
Eri riss sein Hemd aus dem Bund der Hose und schnitt mit seinem verbliebenen Dolch einen Streifen halbwegs sauberen Stoff ab, um seine Wunde abzubinden.
Hinkend durchquerte er den Wald, als er bereits vernahm, wie der Whyrm sich knackend und schmatzend wieder zusammensetzte. Es ärgerte ihn bis ins Mark, dass er dieses Monster nicht vernichten konnte. Es hatte seinen besten Freund auf dem Gewissen. Sein treues Ross.
Die Schuld nagte mehr an ihm als es der Schmerz oder die Seuche es tun könnten. Es war allein sein Versagen, seine Dummheit, die seinem Pferd das Leben gekostet hatten.
Was hatte er sich nur dabei gedacht, allein hinauszureiten? Er hätte es besser wissen müssen, doch er war sich so sicher gewesen, dass ein einzelner Reiter tiefer vordringen und mehr auskundschaften könnte als ein ganzer Trupp.
Er war zu selbstsicher gewesen.
Oder zu selbstsüchtig.
Eri hatte einen langen Weg vor sich, um zu versuchen, eine Antwort darauf zu finden, warum er so unvernünftig gewesen war.
Er kannte die Wahrheit, er gestand sie sich auch ein. Aber er wollte das alles lieber nicht vor seinem Vater erklären müssen, ihm wäre wohler gewesen, er hätte ihm für seine Dummheit eine ehrenhaftere Absicht nennen können als die verdammte Wahrheit.
Leider war Eri kein Lügner. Und leider würde sein Vater auch jede Lüge durchschauen.
Aber der Weg zurück war – zu Fuß und so verletzt wie er war – deutlich länger und gefährlicher, vielleicht würde er gar nicht mehr zu einer Erklärung kommen, weil er nur noch als Leiche heimkehrte.
Seufzend lehnte Eri sich nach einigen Schritten wieder an einen Baum. Zwischen ihm und den schützenden Palisaden des Lagers lag eine schier endlos freie Fläche aus wässrigen Feldern und dampfenden Sümpfen, über jenen die verseuchten Whyrms kreisten und nur auf ihn warteten.
Ohne Pferd war der Rückweg reiner Selbstmord. Und ihm blieb vielleicht ein Tag, bevor die Seuche ihn holte…
»Ich bin der dümmste Prinz in der Geschichte Nohvas«, flüsterte er erschöpft und spuckte erneut Blut aus.
*
»Du hast dich verlaufen.«
Nebel waberte wie eine Masse geistartiger Wolken durch den finsteren Wald und ließ jeden Baum und jeden Stein zugleich fremd und identisch aussehen.
»So ein Unsinn, ich weiß genau, wo wir uns befinden.« Die Stimme des jungen Wachsoldaten klang noch immer selbstsicher, sodass zumindest herauszuhören war, dass der Bursche sich niemals selbst angezweifelt hätte.
»Wenn das so ist, weißt du sicherlich auch, wie wir wieder zurückkommen.«
Er drehte sich um und grinste auf diese charmante und attraktive Art, die jedes Herz am Hof, das noch dazu fähig war, zu schlagen, höherschlagen ließ. »Angst, Prinzessin?« Seine grünen Augen funkelten und blitzten sie feixend an, als er nach ihrer Hand griff und sich dabei vertraut zu ihr beugte. »Nur keine Sorge, wir haben das schon tausendmal gemacht, wir wissen genau, was wir tun. Es ist ungefährlich und wir werden euch beschützen.«
Unbeeindruckt blickte sie in sein Gesicht, dass jung und schön und so voller Kraft und Unbesonnenheit war, dass sie sich sofort darin verloren hatte. Er zog sie an, das war nicht zu leugnen, und davon hatte sie sich blenden lassen. »Ich glaube, du hast keine Ahnung, wo die Lichtung ist. Du und deine Freunde habt euch verlaufen.« Esi zog die Hand aus seinen zärtlichen Fingern und schalt sich dabei eine Närrin. Sie hatte gewusst, dass das eine dumme Idee gewesen war, aber dieses süße Lächeln und das ansehnliche Gesicht der Wache hatte sie verzaubert. Um es höflich auszudrücken. Aber um ehrlich zu sein, hatte die Aufmerksamkeit des Burschen sie einfach dumm und arglos gemacht, obwohl sie klüger war als das, was sie hier tat.
Wie hatte sie sich nur darauf einlassen können, sie war ja so ein Hohlkopf! Und das nur, weil er ihr seit einiger Zeit versuchte, den Hof zu machen, und sie keine Spielverderberin sein wollte.
Zu ihrer Verteidigung sei gesagt, es gab nicht viele Männer, die keine Getreuen waren, und fähig waren, einer Frau den Kopf zu verdrehen. Es gab wenige lebendige Wesen um sie herum. Und sie war eben noch so furchtbar jung. Die Wache hatte etwas von einer Lichtung erzählt, auf der noch echte Blumen blühen sollten. Er hatte ihr versprochen, mit ihr durch die Blüten zu reiten, hatte mit seiner Reitkunst angegeben und sein teures Ross angepriesen, das er vor Plünderern beschützt hatte. Es sei der letzte Hengst aus den Fruchtbaren Hügeln, es gäbe diese Rasse seit der Fäule gar nicht mehr. Ein Pferd, das gesehen werden musste.
Götter, wie leicht zu beeindrucken sie doch war, solange diese Worte nur aus einem hübschen Mund drangen!
Simth, die junge Wache mit den blassgrünen Augen und dem dunkelbraunen Haar, das fast schwarz wirkte, sah an ihr vorbei. »Eure Schwester ist nicht leicht zu beeindrucken, mein Prinz.«
Simths Freunde lachten. Etwas, dass sich Jungs nur dann erlaubten, wenn niemand sie deshalb zur Rechenschaft ziehen würde. Die Pferde, die sie bei sich führten, schnaubten wieder unruhig, was Esi überhaupt nicht gefiel. Der schwarzbraune Hengst von Simth legte die Ohren an und tänzelte, er war der unruhigste von allen, in seinen traumatisierten Augen stand die Angst. Es zerriss ihr das Herz. Die beiden Stuten – eine goldene, eine weiße – beruhigten sich schneller wieder und legten den Gleichmut von Eseln an den Tag.
»Vielleicht müsst Ihr Euch nur etwas mehr anstrengen«, sagte Dragith hinter ihr und trat an ihren Rücken heran, das entwaffnende Lächeln hatte er von ihrem Vater geerbt, und sie musste sich nicht erst umdrehen, um zu wissen, dass es auf seinem perfekten Gesicht lag, sie hörte es in seiner charismatischen, hellen jungen Stimme. »Wie wäre es, wenn Ihr uns beeindruckt, indem Ihr auf Euer Pferd steigt und uns zur Lichtung führt, um uns endlich Eure Reitkünste vorzuführen?« Sie spürte, wie er mit dem schmalen Kinn über ihre Schulter auf den Hengst deutete. »Wenn er schon dort war, kennt er den Weg dorthin doch blind. Welches Pferd würde eine Oase frischen Grases vergessen?«
Simth war zugute zu halten, dass er nicht wie seine Freunde sein Lächeln verlor und sich nicht durch Dragiths Herausforderung beleidigt fühlte. Das hatte Esi eigentlich immer an ihm gemocht.
»Es ist zu gefährlich, hier zu reiten«, wandte die junge Wache ein und suchte Bestätigung bei seinen Kameraden. Die beiden hinter ihm waren etwa in ihrem Alter, noch kaum zwanzig Jahre. Beide waren hager, so wie beinahe die gesamte Bevölkerung, der linke war flachsblond, der rechte hatte rötliches Haar, das wie gerostetes Eisen aussah; und beiden stand die Dummheit regelrecht in den leeren Gesichtern. Sie waren dafür bekannt, selbst Löcher in den Wänden nachzustellen. Obwohl die Welt unterging und alle um sie herum starben, hatten sie nichts als Saufen und Ficken in den Köpfen, sowie hirnlose Witze.
Dragith nickte, konterte aber: »Oder traut Ihr Euch nicht, auf Euer eigenes Pferd zu steigen, da er Euch eben fast abgeworfen hätte?«
Allmählich hatte Simth Mühe, seine Züge unter Kontrolle zu halten. »Er ist kein einfaches Pferd und heute ist er besonders unruhig. Er muss noch einiges lernen. Und wenn wir uns jetzt auf ihn setzen, würde er nur losrennen. Das macht er immer, er rennt, als wären die Monster hinter ihm her.«
»Dann kehren wir besser um«, sagte Esi laut. Es klang wie ein Vorschlag, doch ihre Stimme hatte einen befehlsgewohnten Tonfall.
»Nein, Esi, bitte!«, setzte Simth flehend an und griff erneut nach ihrer Hand. »Komm schon! Es ist nicht mehr weit und es wird dir gefallen! Wir setzen uns einfach in die Blumen und… und reden!«
»Hast du gehört? Reden!«, flüsterte der Rothaarige dem Blonden zu. »Was für ein Mädchen. Reden!«
Der Blonde grinste dämlich.
»Ich weiß nicht…«, begann Esi unsicher zu werden, zog ihre Hand erneut zurück und blickte Simth in die Augen. Er bettelte mit einem stummen Blick.
»Habt Ihr etwa Angst, Prinzessin?«, fragte der Blonde und lachte dreckig. »Wir reiten beinahe täglich aus, hier passiert nichts! Nie! Und bisher hatte auch noch keine der Dienstmägde so ein Gezeter veranstaltet.«
Der Rothaarige kicherte: »Nein, die haben sich wohl genug gefühlt, um alle Hüllen fallen zu lassen.«
Esi hätte gern im Strahl gekotzt. Götter, sie wollte nicht mit diesen Mädchen in einen Topf geworfen werden. Und doch war sie hier, oder etwa nicht? Zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch war sie froh, dass Dragith sie begleitet hatte. Wer weiß, was diese Schwachköpfe vorhatten oder was für Gerüchte sie verbreitet hätten.
»Es ist gefährlich in den Wäldern, selbst hier«, wandte sie stattdessen ein. »Onkel Marks sagte, dass Rebellen und Barbaren in der Gegend gesichtet worden sind.«
Der Blonde verdrehte die Augen und wandte sich an Simth. »Hättest du nicht einem mutigeren Mädchen schöne Augen machen können? Das Gewimmer nervt!«
»Komm, lass sie in Ruhe…«, bat Simth, doch er war sichtlich hin und her gerissen, da er zwischen die Fronten geraten war.
»Ich wimmere nicht, ich habe nur Vernunft«, wandte Esi trocken ein.
Die beiden belächelten sie, wie Jungs Mädchen immer belächelten. Auf diese herablassende und verletzende Art, als wäre sie zu bedauern. Andere Mädchen in ihrem Alter hätten nun aufbegehrt und den Herren das Gegenteil beweisen wollen. Auf diese Art rauben sie Mädchen die Unschuld. Das hatte ihre Mutter ihr beigebracht. So manipulierten sie sie.
Esi sah die beiden nur gelangweilt an. Simth seufze und schien zu resignieren, mit stummem Blick bat er wegen der beiden um Vergebung.
Sie war nicht einmal böse auf ihn, es war schwer Freunde zu finden, es gab nicht genug Lebende, um wählerisch zu sein.
»Und was ist mit Euch, Prinz? Habt Ihr auch Angst?«, fragte der Blonde ihren Bruder plötzlich.
»Ich bin öfter hier draußen als ihr«, entgegnete Dragith ruhig.
Es war die Wahrheit, er bekam deshalb ständig Schwierigkeiten mit Onkel Marks und Esis Mutter Ilsa, ihren Aufsehern. Dragith war jung und Jungs waren dumm. So dumm. Sie würde nie verstehen, warum sie immer das Bedürfnis verspürten, sich gegenseitig zu übertrumpfen.
Die beiden Wachleute schmunzelten darüber, als glaubten sie ihm nicht. »Warum schlottern Euch dann die Knie so sehr?«
»Mir schlottern nicht die Knie, ich beschütze nur meine Schwester vor Dummheiten.«
Esi verdrehte innerlich die Augen, denn er übertrieb. Ihr Bruder hätte gar nicht hier sein sollen, aber er klebte ihr regelrecht am Arsch, weil sie seine einzige Freundin war. Und er hatte gesehen, wie sie versuchte, sich mit den Jungs rauszuschleichen. Natürlich hatte er sich nicht abwimmeln lassen und darauf bestanden, mitzukommen.
»Da habt Ihr aber eine schöne Ausrede, Prinz«, provozierte der Blonde ihren Bruder. »Dann bringt sie doch zurück und kommt wieder.«
Dragith zeigte sein berühmtes Grinsen. »Klingt für mich, als bräuchtet Ihr mich, damit Ihr den Weg zurückfindet.«
»Das Letzte, was wir wollten, wäre den Rückweg anzutreten, wir haben noch eine Wette am Laufen, welches der Pferde höher springt.« Sie waren reizbarer als Dragith, und das machte Esi Sorgen, es knisterte zwischen ihnen plötzlich, als würde es gleich zu einer Schlägerei kommen. »Wenn wir umkehren, dann erst, wenn es sich für uns lohnt.«
Auch Simth schien zu spüren, dass seine Freunde keine Hemmungen hätten eine Grenze zu überschreiten. »Gehen wir einfach zur Lichtung weiter.«
Sie ignorierten ihn und der Blonde feixte ihren Bruder an. »Reitet Ihr doch Simths verrückten Gaul über die Lichtung, wenn Ihr so furchtlos seid, Prinz. Wir haben ein paar Hindernisse aufgestellt, dort könnt Ihr mal Euer Können demonstrieren. Ach nein!« Er schlug sich pathetisch gegen die Stirn und schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich habe vergessen, dass Ihr ja gar nicht reiten könnt, nicht wahr? Wie oft seid Ihr vom Pferd gefallen? Wie oft habt Ihr Euch das Bein gebrochen, sodass Euer Vater es Euch letztendlich verboten hat?«
»Was hat das eine mit dem anderen zu tun?«, fragte Esi mit einem Hauch aufkommenden Ärger.
Es war zu spät, sie spürte Dragiths Wut regelrecht wie warme Atemwolken in ihrem Nacken, die pulsierend gegen sie stießen, als ob er sich jeden Augenblick verwandeln würde. Und Dragith war nicht leicht zu erzürnen. »Die Pferde spüren den Drachen in mir, das macht sie nervös«, verteidigte er sich.
Aber junge Männer hatten zu viel Stolz…
»Und wieder hat er eine hübsche Ausrede«, sagte der Blonde zum Rothaarigen. Dieser grinste blasiert.
»Wenn Ihr wollt, kann ich Euch auf der Lichtung gern demonstrieren, was die Pferde so nervös macht.«
»Dragi, nicht…«
»Oho!« Der Blonde hob die Hände und lehnte sich zurück, als wollte er vor Dragith zurückschrecken. Natürlich in einer absolut überheblichen Geste, die voller Spott war. »Haben wir den Babydrachen geweckt? Ich hörte, Ihr hättet eine hübsche rosa Blütenfarbe und seid so groß wie ein Pony mit Flügeln. Vielleicht könnten wir ja auch auf Euch eine Runde über den Wald fliegen, wie wär´s? Ihr passt bestimmt in den Sattel meiner Stute.«
Der Rothaarige prustete los.
Keiner sonst lachte. Simth rieb sich verlegen den Hinterkopf, er hatte sich diesen Ausflug sicherlich anders vorgestellt. Esi ebenso.
Dragith sagte nichts, er schaute scheinbar unbeeindruckt zurück. Der Wind strich durch sein strohblondes Haar, das er seit einigen Wochen kurzgeschnitten trug, sodass es nur seine Ohrenspitzen bedeckte. Er hatte die Augen ihres Vaters. Das sagten zumindest immer alle. Ihre Farbe, seinen durchdringend, erhabenen Blick, gepaart mit etwas, dass sie immer als einen Hauch Unbeschwertheit verband. Jetzt wirkte er vor allem beneidenswert ruhig, doch da er ihrem Vater so ähnelte, besaß diese Ruhe etwas durch und durch Beängstigendes. Aber so feinfühlig waren diese beiden Idioten nicht.
»Was?«, blaffte der Blonde. »Dann kommt und zeigt uns doch, was für ein großer, pinker Drache Ihr seid!«
»Er ist immer noch euer Prinz«, warnte Esi sie.
»Aber nicht unser König, wenn ich mich recht entsinne. Er wird Malahnest erben, nicht Nohva. Und selbst wenn…? Wer soll uns zur Rechenschaft ziehen? Euer alter Herr schläft seit Jahren oder ist schon mausetot, und die Herrin interessiert sich einen Scheiß für euch beide. Lang lebe die Rabenkönig!«
Sie waren keine treuen Anhänger der Königin, sie dienten ihr lediglich aus dem Grund, um unter dem Deckmantel ihrer Herrschaft zu tun und zu lassen, was immer sie wollten. Es gab keine Regeln, solange sie sie anpriesen, und ihre Bosheit war willkommen. Die beiden waren dumm genug, die Leibeigenschaft anzustreben und sich zu wünschen, Getreue zu werden, um Unsterblichkeit zu erlangen. Sie waren schlicht und ergreifend –
»Schwachköpfe«, beendete Dragith ihren Gedanken unbeabsichtigt und drehte sich um. »Lass uns einfach gehen, Schwester.«
Er zog sich immer zurück, wenn ihr Vater zur Sprache kam. Sie konnte es ihm nicht verübeln, es ging ihr ähnlich wie ihm, sie wusste nicht, ob sie ihn verteidigen sollte oder nicht. Einerseits vermissten sie ihn, andererseits waren sie froh, dass er nicht anwesend war.
»Ihr seid ein Feigling, genau wie Euer feiger Vater, der sich in den Gewölben versteckt!«
Dragith fuhr doch wieder herum. »Hütet endlich eure Zungen!«
»Sonst was?«, forderte der Blonde ihn heraus.
»Wenn er jemals erfährt, wie ihr mit uns sprecht, häutet er euch«, sagte Esi, bevor Dragith antworten konnte. Sie spürte den verblüfften Blick ihres Bruders im Nacken, drehte sich aber nicht zu ihm um. Smith wirkte ebenso überrascht, seine beiden Kameraden blickten sie einen Moment verwundert an.
Dann grinsten sie. »Er ist tot. Toter als tot. Mach dir keine falschen Hoffnungen, kleines Mädchen, du bist nur der Einfachhalber und des Titels wegen Prinzessin, genau wie dein Bruder nur der Prinz ist, weil es der Rabenkönigin in den Kram passt, damit sie Malahnest ausnehmen kann. Aber das bedeutet nichts.«
»Sagt wer?«, fragte Dragith noch immer beneidenswert ruhig.
»Sag ich, kleiner Prinz.« Der Blonde schlenderte näher heran, dabei ließ er die Zügel seiner weißen Stute los und fixierte ihren Bruder mit einem Funkeln in den Augen, das er sonst den Mägden zuwarf. »Schon bald werdet auch ihr erkennen, dass die Armee die wahre Macht ist. Wir Krieger tragen vielleicht keine Kronen, aber Schwerter, die in dieser sterbenden Welt mehr wert sind als zwei feige Königskinder, die sich hinter Mauern verstecken. Und apropos sterben, Ihr und Eure Schwester wollt doch sicher nicht unberührt von dieser Welt scheiden, oder? Wie wäre es, wenn wir uns ein wenig um Euch kümmern, während Simth sich um Eure Schwester kümmert?«
»Äh… mach das mal ohne mich…«, warf der Rothaarige von hinten ein.
Simth blieb zu Esis Bedauern noch immer stumm und scharrte nur ungeduldig mit den Füßen.
Der Blonde grinste jedoch Dragith ungerührt an. »Dann eben nur Ihr und ich. Mal sehen, wie groß Eure Klappe dann noch ist. Oder habt Ihr auch vor Schwänzen so viel Angst wie vor den Schatten hinter den Baumstämmen?«
Er kam so nah und baute sich vor Dragith auf, dass er Esi gegen ihren Bruder trieb. Sie trat jedoch nicht zur Seite, sondern blieb wie ein Schild vor Dragith stehen, während die beiden sich anstierten wie zwei Bullen, die man auf einer Weide zusammengepfercht hatte.
Bis ihr Bruder plötzlich wieder dieses entwaffnende Lächeln aufsetzte und den Kopf schieflegte, als könnte ihn kein Wässerchen trüben. »Wieso eigentlich nicht. Es würde mich wahrlich interessieren, ob du genauso sabberst und bettelst wie deine beiden Schwestern, die für einen Kanten Brot schon seit Monaten meinen königlichen Schwanz reiten.«
Esi hasste die Art und Weise wie er sprach, sie hasste alle Männer dafür, wie sie sprachen, aber sie konnte sehen, dass seine Worte den Blonden unvermittelt trafen. Die Genugtuung prickelte unter ihrer Haut, während sie ein wenig stolz auf Dragith war.
Die Stille daraufhin fühlte sich lebendig an, wie ein eigenständiges Wesen, das sich um die Anwesenden schmiegte und die Luft mit knisternder Spannung auflud.
Esi krallte sich in Dragiths Umhang, weil sie befürchtete, dass er eine Dummheit begehen könnte. Sie würde den Drang zur Gewalt nie verstehen, sie hatte auch zur großen Enttäuschung ihrer kriegerischen Mutter niemals ein Schwert in die Hand nehmen wollen. Oder einen Bogen. Schärfer als Stahl waren Worte, das sah sie in dem zuckenden Gesicht des Blonden, der zu Stein geworden war und Dragith anstarrte, als wollte er ihn mit bloßen Händen erwürgen.
Plötzlich lachte der Rothaarige.
Dann Simth.
Das Gelächerter zerschnitt nicht bloß die Stille, es schien auch gleichsam die Spannung aus dem Moment zu nehmen. Der Blonde war noch immer versteinert vor Zorn, doch er wirkte kleiner und angreifbarer, während seine Freunde lachten. Simth klopfte ihm auf die Schulter.
Esi wagte einen Blick zurück zu Dragith und bemerkte, dass ihr Bruder noch immer sein charmantes Lächeln trug.
»Lass gut sein«, sagte Simth weiterhin lachend zu seinem Kameraden und massierte ihm die Schulter durch den Umhang. »Darauf gibt’s keinen guten Konter mehr, der Prinz hat die Schlacht gewonnen.«
Der Blonde entspannte sich nur langsam und auch nur widerwillig. »Die Schlacht, aber nicht den Krieg.«
»Kein vernünftiger General würde mehr als eine Schlacht an einem einzigen Tag schlagen.« Dragith grinste auf seine unbeschwerte Sonnenscheinchen-Art.
Der Blond schnaubte über ihn und trat zurück. »Was wissen Prinzen schon über das Militär? Ihr benutzt es nur, aber Ihr habt keine Ahnung wie man einen Krieg führt und gewinnt.«
»Wüssten wir, wie man einen Krieg gewinnt, wären die Rebellen schon geschlagen«, meinte Simth dazu, um die Stimmung weiterhin aufzulockern.
»Früher oder später werden sie fallen, das hat mein Vater gesagt«, wandte der Blonde sich an Simth. »Sie können das nicht gewinnen, sie verhungern jetzt schon. Wir haben längst gewon-« Er zog scharf die Luft ein und zuckte zurück, im nächsten Moment schlug etwas krachend in den Baumstamm neben ihnen.
In dem Atemzug danach starrten sie bloß verwirrt auf den zitternden Griff des Dolches, dessen Klinge die Rinde gespalten hatte. Esi verengte die Augen und erkannte in der Maserung des dunklen Holzgriffes einige Vertiefungen, die ein Bildnis ergaben. Eine Schnitzerei, ein Wappen…
»Rebellen!«, stieß der Rothaarige aus, der das Wappen ebenfalls erkannt hatte. Er wurde bleich, ließ die Zügel seiner Stute los und stolperte rückwärts in den Wald, um davonzulaufen.
Der Blonde fluchte ausgiebig und langte mit der Schwerthand nach seiner Waffe, die an seiner Hüfte baumelte, um sich dorthin zu drehen, woher der Dolch aus dem Wald gekommen war.
Simth ließ sein Pferd ebenfalls los, das sich, nervös wie es war, sofort auf die Hinterbeine stellte und aufbäumte. Der junge Wachmann zog seine Klinge und stellte sich schützend vor Esi.
Dragith hatte die Hände bereits auf ihre Schultern gelegt und zog sie vom Geschehen fort. »Magie«, flüsterte er ihr ins rechte Ohr. »Fühlst du das Knistern?«
Erst als er es sagte, überwand sie ihre Überraschung genug, um mehr wahrzunehmen als das, was sie sehen konnte. Zuvor war sie so überrumpelt gewesen, dass sie sogar das Atmen eingestellt und sich nur auf ihre Sehkraft verlassen hatte. Nun spürte sie das leichte Kitzeln auf ihrer Haut, das von der gerade gewirkten Magie um sie herum herrührte.
Da hörte sie auch schon ein lautes Summen im Nebel, der sich verdunkelte und sich regelrecht in einen Schwarm wütender Hornissen verwandelte. Im nächsten Augenblick hüllte die Wolke aus Insekten die Wachen ein. Der Rothaarige schrie zuerst, ließ sich im vollen Lauf fallen und wälzte sich, als würde er brennen. Der Blonde und Simth hoben schützend ihre Arme vor die Gesichter und schlugen blind mit den Schwertern um sich. Als das nichts nützte, stießen sie aus ihren Händen kurze Flammenstöße, denn sie waren der Magie ein wenig kundig, wenn auch noch keine ausgebildeten Kampfzauberer. Doch selbst das Feuer konnte den Schwarm nicht lichten, der sich lautsummend immer mehr um sie verdichtete.
Dragith zog Esi an den Schultern noch weiter zurück zwischen zwei eng stehende Baumstämme, ihr Atem kam in Form von wallenden Wolken aus ihren offenen Mündern, doch der Schwarm erreichte sie gar nicht.
»Was…?«, stammelte Esi.
Die Pferde rannten nicht davon, obwohl sie ein wenig tänzelten, schienen die Insekten sie nicht zu stören, eher scheuten sie vor den wildfuchtelnden und brüllenden Männern und ihren Klingen und Zaubern zurück.
Durch das Dröhnen der Hornissen konnte sich ein schmaler Schatten regelrecht lautlos an die Gruppe heranschleichen. Esi sah ihn erst, als Dragith in seine Richtung nickte und flüsterte: »Dort!« Dabei klang die Stimme ihres Bruders eher aufgeregt und begeistert als besorgt.
Ein in den Farben der Rebellen – schwarzer Stoff mit roten Nähten – gekleideter Attentäter sprang durch den Schwarm auf den Rothaarigen zu und trat ihm vollen Lauf so hart gegen das Kinn, dass er im Schrei abbrach und bewusstlos in sich zusammensackte. Esis Herz setzte aus, doch bevor sie den anderen beiden eine Warnung zurufen konnte, hatte der Rebell bereits seinen Dolch erreicht, ihn blitzschnell aus dem Baum gerissen – sie hatte die Bewegung kaum erkennen können – und den Blonden von der Seite attackiert.
»Vorsicht!«, rief Esi, als es längst zu spät war.
Der Rebell duckte sich unter der Klinge durch, die der Blonde gegen den Schwarm schwang, und rammte ihn mit der Schulter auf Rippenhöhe, sodass er zu Boden stürzte. Mit einem gezielten Tritt entwaffnete der Rebell ihn, packte ihn an seinem Reverse und riss ihn hoch, um ihm eine Kopfnuss zu verpassen, die ihn ohnmächtig auf den Boden sinken ließ.
Simth hatte jedoch Esis Aufschrei gehört und stellte sich dem Rebellen in den Weg, noch bevor dieser seinen Freund losgelassen hatte. Aber der Schwarm versperrte ihm die Sicht.
Der Rebell rollte an Simth vorbei, kam neben ihm auf die Füße und entwand ihm mit dem Dolch geschickt die Klinge, um sie ihm gegen die Kehle zu halten.
Plötzlich fielen die Hornissen zu Boden und lösten sich in weißen Dampf auf.
Nein, nicht in Dampf – in Nebel!
»Eine Illusion«, flüsterte Dragith beinahe ehrfürchtig.
»Wenn du auch nur blinzelst, schneide ich dir und dann deinen Freunden die Kehlen auf und lasse euch hier ausbluten, kapiert?«, sagte der Rebell ruhig zu Simth, der den Kopf soweit er konnte in den Nacken gelegt hatte, um der Klinge zu entkommen. Seine Nasenflügel bebten, er fühlte sich gedemütigt, aber er war klug genug, sich nicht zu rühren.
Ohne den alles verdunkelnden Schwarm aus Hornissen erkannte Esi nun auch das schwarze Haar, die hageren Gesichtszüge und die grünen Augen des Angreifers. Er war nicht so groß wie Simth und lange nicht so muskulös, außerdem waren seine Kleider schmutzig und zerrissen und überall leuchteten rötliche Wunden hervor. Sie erkannte, dass er einen Fuß nicht belastete und quasi auf einem Bein balancierte. Und trotzdem hatte er sie überrumpelt, schnell und unberechenbar.
Sie war keine Närrin, sie würde diesen Mann nicht unterschätzen. Niemals.
Auch wenn sie ihn kannte.
Simth schielte zu ihnen herüber, doch es war schwer zu erkennen, ob er sich um sie beide sorgte oder von ihnen Hilfe erwartete.
»Töte ihn nicht, bitte«, hörte Esi sich sagen. Es lag nicht in ihrem Wesen, sich einfach auf und davon zu machen.
Der Rebell sah nicht in ihre und Dragiths Richtung, aber er hatte sie gehört und er wusste offensichtlich, dass sie da waren. Allerdings machte er keine Anstalten, sie ebenfalls unschädlich machen zu wollen. »Sind noch mehr von euch hier?«
»Du wirst sterben, Rebell«, presste Simth durch die Zähne. »Du bist umzingelt.«
»Ich hab nicht mit dir gesprochen, Kind, sondern mit der Prinzessin.« Der Rebell sah sie immer noch nicht an, doch sie glaubte nicht, dass er sie deshalb weniger bewachte als Simth. Sie glaubte sogar zu spüren, wie er jeden ihrer Atemzüge verfolgte. Und Dragiths. »Sind noch mehr Soldaten des Dunklen Reiches in der Nähe? Erwachsene? Kommandanten? Getreue?«
Esi schüttelte den Kopf. Die Angst lähmte sie, denn sie sah sich schon in Ketten zu den Barbaren geschleift, wo sie ihr und Dragith Unaussprechliches antun würden, um ihrem Vater zu schaden. Jedoch war sie überzeugt, dass eine Lüge ihre Lage nicht verbessert hätte. Er war allein, vielleicht konnten sie ihn überwältigen und wegrennen, wenn er sich in Sicherheit wähnte.
»Seid ihr euch sicher?«
»Niemand ist hier.« Dragith löste sich von ihr und trat einen Schritt auf den Rebellen zu, bevor sie ihn aufhalten konnte. »Nur wir. Wir haben uns rausgeschlichen, niemand weiß, wohin wir gegangen sind. Weit und breit ist niemand.«
»Dragi!«, zischte Esi und griff nach seinem Arm, während sie nervös den Rebellen im Auge behielt.
Ihr Bruder löste sich mit einem Schütteln aus ihrem Griff und ging noch weiter auf den Angreifer zu. »Du bist der Illusionist, nicht wahr?«
»Mein Prinz, seid vor-«, wollte Simth ihn warnen, doch seine Worte gingen in einem Zischen unter, als der Rebell die Klinge ruckartig zurückzog.
Esi versteinerte, bis sie erkannte, dass es Simth gut ging. Er hatte nur einen leichten Kratzer. Wütend fasste er sich an den Hals und fuhr dann zu dem Rebellen herum, der ihn mit einem schnellen Schlag den Schwertknauf über den Hinterkopf zog und ihn zu Boden schickte.
Esi sah auf die junge Wache mit Bedauern herab, doch er schien noch zu atmen.
Dragith jedoch interessierte sich nicht für Simth, er starrte nur den Rebellen mit der Begeisterung eines Kindes an. »Bist du hier, um uns auszuspähen? Hast du noch mehr gezaubert? Ich habe genau gespürt, wie du deine Magie benutzt hast, überall hat es geprickelt!«
Der Rebell wirbelte den Dolch in der einen und Simths Schwert in der anderen Hand um seine Gelenke, um sie in einer fließenden Bewegung in zwei Scheiden an seiner Hüfte zu versenken. Das Schwert war zu klein für das Futteral, es wackelte ein wenig herum.
»Ihr solltet nicht hier draußen sein«, sagte der Rebell zu ihnen beiden. »Es ist gefährlich hier.« Er drehte sich zu Simths nervösen Pferd um und hinkte auf es zu. »Geht zurück.«
Dragith grinste breit und folgte ihm.
»Nicht!«, zischte Esi wieder, bekam ihren Bruder aber nicht mehr zu fassen. Dieser Dummkopf!
»Du bist Eri!« Es war keine Frage. »Du hast dich früher um mich gekümmert!«
Esi wusste, dass Dragith sich nicht wirklich daran erinnern konnte, doch er liebte die Geschichten, die Onkel Marks ihm darüber erzählte, wie Dragith als Neugeborener entführt worden war. Ihr Bruder hatte nie verstanden, dass das etwas Schlechtes war, er wirkte immer zufrieden und glücklich, wenn Marks davon erzählte. Als ob etwas in ihm sich doch irgendwie daran erinnerte, wenn auch nicht bewusst.
Esi erinnerte sich hingegen noch an Siderius. An den schlaksigen Jungen, der ihrem Onkel Xaith wie ein Schatten gefolgt war. Damals, als sie und ihre Mutter noch auf der Festung gefangen gewesen waren. Die Erinnerungen waren schwach, aber präsent. Siderius war älter geworden, erwachsen geworden, doch dieses Gesicht erkannte sie dennoch. Und seine Illusionen.
Der Rebell legte kurz seine Hand auf die Nüstern des Schwarzbraunen, dann nahm er die Zügel. »Geht zurück, bevor euch die Barbaren erwischen«, trug er ihnen auf.
»Nimm lieber eines der anderen Pferde«, sagte Dragith. »Der ist nervös.«
»Dragi, hör auf, ihm zu helfen, er ist unser Feind!«, flüsterte Esi schockiert. Am Ende würde ihr Bruder noch wegen Hochverrats hängen.
»Ich brauche ein schnelles Pferd.« Der Rebell schwang sich in den Sattel und blickte sie noch einmal nacheinander an. »Lasst die Wachen liegen und rennt zurück in die Stadt.«
»Warte!« Dragith wollte nach ihm greifen.
Doch der Rebell trieb das Pferd bereits an und preschte durch die Bäume. Esi sprang gerade noch zur Seite und trat dabei auf den Saum ihres schwarzen Kleides, sodass sie hinstürzte. Schmerz zog durch ihren Ellenbogen.
Äste knackten und splitterten, als der Rebell auf Simths Pferd durch den Wald davonstürmte. Dragith rannte ihm nach und an Esi vorbei.
»Nein, keine Sorge, mir geht es gut, vielen Dank auch!«, murrte sie und rappelte sich umständlich auf.
Sie strich energisch das Laub und den Schmutz von ihren Röcken, während sie ihrem Bruder nachfolgte.
Dragith stand mit der Hand an einem Baum am Waldrand und starrte in die Senke und in die sumpfige Weite hinab, die sich im Morgengrauen vor ihnen ausbreitete. Esi stellte sich neben ihn, zu ihrer Rechten sah sie im dunstigen Nebel die Stadtmauern von Dargard nur, wenn sie die Augen sehr stark anstrengte.
»Sieh nur!«, sagte ihr Bruder begeistert und zeigte auf den einsamen Reiter, der sich auf die weite Fläche und die nassen Felder hinauswagte. Dragith grinste. »Er kann ihn reiten!«
Esi blickte dem Rebellen nach, der auf dem schwarzbraunen Hengst wie ein Pfeil in die Ferne schoss. Sie hörte das Donnern der Hufe, Wasser spritzte unter ihnen auf, während das Pferd schnaubend galoppierte, als wäre es endlich frei.
Dragith ließ den Arm sinken. »Es heißt, er ist der beste Reiter Nohvas. Siehst du, was er macht? Er lässt ihn einfach rennen, ohne Angst, dass er abgeworfen wird.«
»Na ja, es wäre sein Tod, anzuhalten.« Esi blickte in den Himmel, die Schatten der Whyrms versammelten sich bereits im undurchdringlichen Nebel. Sie und Dragith hatten vor den Haustieren ihres Vaters nichts zu befürchten, doch sie stürzten sich auf jeden Rebellen, den sie sichteten.
Das Pferd war jedoch flinker.
»Er wird entkommen«, war Dragith sich sicher und grinste von einem bis zum anderen Ohr.
»Er ist dein Feind.« Esi schlug ihm gegen den Arm. »Nicht dein Held!«
Aber das kümmerte ihn nicht, er grinste sie nur breit an, bevor er Siderius wieder nachblickte, der mehr und mehr zu einem kleinen schwarzen Punkt im Nebel wurde.
Nachdenklich lehnte Esi sich an ihren Bruder. »Was er wohl hier wollte? Und warum er uns nicht gefangen genommen hat?«
Ein Horn wurde in der Nähe der Stadt geblasen, gefolgt vom hellen Klang der Glocken der Wachtürme. Doch die Getreuen konnten in dem Nebel unmöglich die einzelne Gestalt im Sumpf entdeckt haben. Nein, dieser Alarm galt nicht dem Eindringling.
Esi und Dragith blickten sich wie aufgescheuchte Kaninchen an.
»War das Onkel Marks` Horn?«, fragte Esi, obwohl sie es beide als jenes erkannt hatten. »Sie suchen uns!«
»Wir sind geliefert«, stellte Dragith fest.
*
Die Ebenen und die Fruchtbaren Hügel waren Feindgebiet. Ganz Nohva war ein Feindgebiet, wenn man das Dunkle Reich bekämpfte, doch bis auf ein paar geplünderte und am Hungertuch nagende Dörfer war kaum noch Zivilisation übrig, die es wert wäre genannt zu werden. Die meisten Menschen versteckten sich in den großen Städten, doch die Burgen auf den Hügeln waren größtenteils unbewohnt, Mahnmale ausgelöschter Familienstämme. In manchen hausten nur noch alte Lords und Ladys, die sich weigerten, hinter die dicken und schützenden Mauern der Stadt zu ziehen.
Dennoch hielt Siderius sich weitestgehend von den Blicken der Burgen fern, damit keine Pfeile auf ihn hagelten. Das kleine Handgemenge gegen die Kinderkrieger des Dunklen Reiches hatte ihn beinahe seine letzte Kraft gekostet. Er sammelte die restlichen Vorräte seiner Magie und spürte, wie seine Finger und Zehen taub wurden und seine Kopfhaut zu prickeln begann, um sich in die Illusion einer Nebelwolke zu hüllen, die ihn vor den Biestern am Himmel verbarg.
Sie folgten ihm, er hörte ihr Kreischen und bald darauf das Rauschen ihrer Flügel. Sie stürzten tiefer, schrien frustriert, er spürte ihren Luftzug.
Das Pferd unter ihm steigerte seine Geschwindigkeit, als er sich dicht über seinen Hals lehnte. Es war schnell und es rannte, als ob in seinem Herzen ein Feuer entfacht wäre. Beinahe spürte Siderius das Glück, das von dem Tier ausging. Es frohlockte, es hätte geschrien und gelacht, wenn es gekonnt hätte, während es die Freiheit genoss, über die feuchten Felder zu fliegen. Hätten ihnen nicht blutrünstige Monster im Nacken gesessen, hätte Eri das hier sehr genossen.
Endlich sah und spürte er die Schutzzauber des Rebellenlagers. Selbstverständlich war es als solches nicht zu erkennen, wenn man nicht wusste, worauf man achten musste. Augenscheinlich war es nicht mehr als ein einfaches Dorf auf der Grenze zwischen den Fruchtbaren Hügeln und der Ebenen, das inmitten der gegabelten Rinnsale eines Nebenarms des Östlichen Flusses lag. Eingerahmt von vielen kleinen Brücken und winzigen Behausungen, sodass es wie jedes Dorf in den Ebenen aussah. Nur dass die Bewohner als gewöhnliche Bauern verkleidete Rebellenkrieger waren. Alte und Kinder inbegriffen.
Sei deinen Feinden so nah wie möglich.
Sie gaben der Rabenkönigin sogar Steuern ab, um nicht aufzufallen, doch das kam ihnen auch zugute. Denn so konnten sie ohne Angst vor Zerstörung, Pflanzen anbauen und ernten. Auf diese Weise kamen die Vorräte, den Rebellen zugute, was immerhin noch mehr war als Nichts. Und das Dunkle Reich hatte das Dorf für seine Treue mit Zaubern geschützt, die die Whymrs davon abhielten, es dem Erdboden gleich zu machen.
Dieser riskante Schachzug verdankten sie natürlich wieder seinem Vater. Xaith.
Sobald der schwarzbraune Renner die ersten Schutzzauber passiert hatte, drehten die Biester mit einem frustrierten Kreischen ab und erhoben sich wieder in die Lüfte.
»Prinz Siderius!« Die erste als Bauer gekleidete Wache – eine Frau mittleren Alters – warf beinahe ihre Schale mitsamt dampfendem Inhalt über die Schulter, als sie ihn ins Dorf reiten sah.
Auch andere sprangen auf oder eilten herbei und riefen »Mein Prinz!« oder »Euer Gnaden!«.
Alle wirkten überrascht, ihn von draußen kommen zu sehen, also war seine Abwesenheit noch gar nicht bemerkt worden.
Das hoffte er zumindest.
Mit einem unfreiwilligen Gefolge aus verwunderten Knechten lenkte er das trabende Pferd zwischen den Gebäuden vorbei in Richtung Stall. Das Tier musste dringend mit Stroh abgerieben und versorgt werden. Er hatte es viel zu lange viel zu schnell rennen lassen, es war klatschnass vom Schweiß.
Genau wie er.
»Mein Prinz! Was ist geschehen?« Der hiesige Stallmeister der Zelle kam ihm aus dem Stall entgegen und griff nach den Zügeln. »Wo… wo ist Euer Pferd, Eure Hoheit?«
Ein Stich erfasste Siderius´ Brust, er ließ sich erschöpft aus dem Sattel fallen und wimmelte die Burschen ab, die erschrocken ob seiner Verletzungen nach ihm greifen und ihn stützen wollten.
»Gefallen«, sagte Eri zu dem Stallmeister und wich seinem Blick aus. Er ertrug die Betroffenheit in den alten Augen nicht. »Kümmert euch um den hier, er hat mir das Leben gerettet«, trug er dem Mann auf und klopfte dabei wohlwollend den Hals des Pferdes ab. »Passt auf, dass ihn niemand tötet und isst.«
Der Stallmeister nickte, obwohl noch immer Trauer in seinen Augen stand. »Natürlich, Prinz Siderius«, flüsterte er bedächtig. Er war der Beweis dafür, dass nicht jeder Bauer ein grausamer Verräter war, der in seinen eigenen Tieren nur Nahrung sah. Er war gebrochen und verstört zur Rebellion übergelaufen, nachdem Plünderer seinen Hof überrannt und all seine Tiere ermordet hatten. Ein guter Mann, dessen Traurigkeit ihn allgegenwärtig umgab wie eine dunkle Wolke aus purer Melancholie.
Eri wandte sich ab und bahnte sich einen Weg durch das halbe Dutzend gaffender Knechte, die mit stummen Blicken tausend Fragen an ihn sandten.
»Wie lautet sein Name?«, rief der Stallmeister ihm nach.
Siderius drehte sich noch einmal um, er war für so etwas zu müde und zu gereizt. An diesem Morgen – nein, eigentlich schon in der Nacht davor – war alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Aber als er das Tier betrachtete, wusste er, dass es am allerwenigsten etwas dafürkonnte, dass er schlecht gelaunt war. Und er schuldete ihm sein Leben. »Windschnitt«, entschied er. »Sein Name ist Windschnitt.«
Der Stallmeister nickte wieder und führte das schnaubende und bebende Pferd in den fast leeren Stall, wo nur drei weitere Pferde untergebracht waren und auf ihrem Frühstück kauten. Viele schwerbewaffnete Wachen waren innerhalb des Stalles nötig, um die Tiere vor der Gier der Menschen zu beschützen.
Der Meister bellte etwas und die Knechte schreckten auf und verteilten sich. Siderius sah dem gewöhnlichen und geschäftigen Treiben noch einen kurzen Augenblick zu und erinnerte sich an sein eigenes einfaches Leben, bevor er Xaith begegnet war.
Es kam ihm vor, als wäre es Jahrtausende her. Oder so, als wäre es nie ihm selbst passiert, sondern wie ein Märchen über jemand anderen.
Er vermisste es nicht. Das war nicht das, was er fühlte. Nein, er beneidete diese Knechte aus einem ganz anderen Grund. Denn sie waren als das geboren, was sie sein wollten, während er unter einer Illusion leben musste.
Er seufzte, drehte sich um und sah den König auf der Straße vor ihm stehen.
Sein Vater blickte ihn mit einer Miene an, in der wie immer nichts herauszulesen war. Weder Zorn noch Freude noch sonst irgendetwas. War er belustigt? Juckte es ihn irgendwo? Steckte ihm was im Schuh, oder genoss er gerade den stinkenden Geruch des Dorfes? Keine Ahnung, es war, als würde man versuchen, einem Granitblock eine Empfindung anzudichten.
Siderius ließ die Schultern hängen und hinkte auf ihn zu. Er versuchte gar nicht erst, die Verletzungen vor ihm zu verstecken. Es wäre sinnlos.
Xaith trug schwarze Kleider aus gefärbten Leinen, der schneidende Wind zerzauste sein kurzes Haar und drückte den Umhang gegen seine drahtige Gestalt. Die Hände hatte er wartend hinter dem Rücken verschränkt.
»Vater«, begrüßte Siderius ihn knapp und ging an ihm vorbei.
Xaith drehte sich nicht um, fragte aber: »Was ist passiert?«
Seufzend blieb er stehen und wandte sich an seinen Vater, als sei er in Eile. »Ein verseuchter Whyrm in den Wäldern hat mich erwischt, ich brauche einen Trank.«
Er hoffte, dass er damit der drohenden Befragung entkommen würde und machte sich wieder auf den Weg zur Mühle, wo der Schacht nach unten lag, der zu ihrem eigentlichen Versteck führte.
»Das erklärt deine Wunden und was mit deinem Pferd geschehen ist, aber nicht, woher das andere Tier kommt.«
Siderius stockte. Er hatte keine Lust darauf, seinem Vater die Begegnung mit den Kindern zu erzählen. Sicherlich wäre Xaith stolz auf ihn, dass er sie gehen gelassen hatte, er predigte ihm schließlich immer wieder, dass er sie nicht für Riaths Taten verantwortlich machen sollte. Doch ein Teil von ihm selbst verdrängte die Tatsache, dass er die beiden nicht mitgenommen hatte. Er wäre bei dem Versuch gestorben, denn sie hätten ihn aufgehalten, redete er sich ein. Doch das war nicht der wahre Grund. Sie waren eben nur Kinder, das wusste er tief in sich drinnen, aber sie waren eben auch die Kinder des Mannes, den er sich geschworen hatte, zu töten…
Als würde Xaith seine innere Zerrissenheit riechen, drehte sein Vater sich zu ihm um und maß ihn mit einem langen und intensiven Blick.
»Ich hab es gestohlen«, log Siderius schnell. »Von ein paar dummen Kriegern.«
Er sah sofort, wie sein Vater kritisch die Brauen zusammenzog, und hob abwehrend die Hände. »Niemand hat mich gesehen, ich habe den Reiter niedergeschlagen.«
»Wir dürfen keine Aufmerksamkeit auf uns lenken.«
»Es war weit weg von hier in den Wäldern! Außerdem würde jeder Bauer heutzutage bei erster Gelegenheit ein Pferd stehlen. Die Menschen hungern!«
Der Blick seines Vaters sprach Bände, er glaubte ihm zwar, aber nicht die ganze Geschichte. Er wusste, dass mehr dahintersteckte.
Zeit, zu gehen.
»Eri…«
»Siderius!« Wie oft musste er das noch sagen? Vielleicht sollte anfangen, sich selbst bei seinem vollen Namen zu nennen, auch in Gedanken, dann würde sein Vater es vielleicht auch endlich tun.
Er drehte sich wieder um. »Was ist?«
Xaith atmete tief ein und aus. »Entschuldige. Siderius.« Er trat einen Schritt auf ihn zu. »Warum warst du in den Wäldern?«
»Ist das wichtig?«
»Es ist gefährlich da draußen.«
»Ich bin kein Kind mehr.«
»Ich auch nicht, trotzdem reite ich nicht allein hinaus.«
Ach verdammt, warum musste er immer so neumalklug sein!
Siderius zuckte mit den Achseln. »Gestern berichteten die Späher von Bewegungen auf den Straßen zwischen Dargard und dem Toten Wald. Ein ganzer Trupp wäre zu auffällig gewesen, ohne Gefolge konnte ich mich näher heranwagen. Ich wollte mir ein genaueres Bild machen.«
»Nachts? Ohne Begleitung? So überstürzt, als wärest du auf der Flucht vor etwas oder jemanden?«
Natürlich…, sein Vater wusste mal wieder alles. Zähneknirschend wich er Xaiths Blick aus und suchte nach einer Ausrede. »Mir fiel die Decke auf den Kopf. Ich war ungeduldig…«
»Eri…«
»Siderius!«
Xaith schloss kurz die Augen, nickte dann aber und sah ihn wieder durchdringend und auf ärgerliche Weise allwissend an. »Ich habe dein Mädchen mit einem der Wachen gesehen. Ging es darum?«
Ein Schwall Hitze stieg Siderius ins Gesicht, sein Kopf lief vor Scham vermutlich hochrot an, er wandte den Blick ab und wünschte, die Whyrms hätten ihn erwischt.
»E- Siderius.« Xaith trat noch näher auf ihn zu und löste die hinter dem Rücken verschränkten Hände. »Du weißt, dass du mit mir über alles reden kannst.«
Nun schloss er selbst für einen Moment die Augen. »Können wir das einfach vergessen? Bitte?«
»Nicht, wenn ich mich um dich sorgen muss.«
»Ich bin kein Kind mehr.«
»Und wenn du ein alter Mann bist, bleibst du mein Sohn, und ich darf mir Sorgen um dich machen.«
»Es ist nichts. Es war nichts! Mir geht es gut.«
»Deshalb fliehst du aus dem Dorf und riskierst dein Leben? Weil es dir gut geht.«
»Ich will wirklich nicht darüber reden…«
»Und im Grunde heißt das, du willst über alles reden, ich soll es dir nur aus der Nase ziehen.«
»Nein.«
»Siderius.«
»Fein!« Er fuhr zu seinem Vater herum und stieß frustriert den Atem aus. »Ich wollte Heza gestern Abend noch in ihrer Nische überraschen, weil ich sie etwas vernachlässigt hatte. Aber sie war nicht allein, ein anderer war bei dir, der bis zu den Eiern in ihrer Möse steckte. Als ich sie zur Rede stellte, erklärte sie, dass sie nicht gewusst habe, wie sie es mir sagen sollte. Sie wollte mich nicht verletzen, also hat sie einfach ihre Taten sprechen lassen.« Er breitete die Arme aus. »Irgendwann hätte ich es dann schon erfahren, meinte sie. Und das habe ich ja jetzt, oder? Alles gut, ich weiß, woran ich bin.«
Xaith schlug die Augen für einen Moment nieder, seine Stimme klang leise und mitfühlend. »Tut mir leid, das muss hart gewesen sein.«
»Nein, weißt du, was hart war, abgesehen von dem Schwanz dieses Kerls?« Jetzt brach es aus ihm heraus, so peinlich es auch war, er war wütend und er ließ es an seinem Vater aus. »Dass sie mir ins Gesicht sagte, dass sie nicht schuld ist, ich könnte ihr keinen Vorwurf machen, denn sie braucht eben einen richtigen Mann. Ich wäre nett und süß, aber ihr fehlt ein echter Kerl.«
Sein Vater zog die Brauen zusammen.
»Ja.« Siderius schnaubte. »Einen richtigen Mann, mit Schwanz und so, verstehst du? Bist du jetzt zufrieden? War das genug Demütigung oder willst du jedes einzelne Wort wissen, mit dem sie mein verficktes Selbstwertgefühl zerrissen hat?«
Xaiths Mimik wurde einen Hauch mitfühlender, aber nicht zu viel. Das hätte auch nicht zu ihm gepasst. »Sie hat dich nicht verdient.«
Siderius schüttelte wütend den Kopf. »Das hilft mir nicht.«
»Nein, aber es ist die Wahrheit. Irgendwann wird jemand kommen, dem es egal ist-«
»Dass ich keinen echten Schwanz zu bieten habe, sondern nur eine Illusion?«, unterbrach Siderius ihn. »Oder ich unterhalb dieser Illusion nicht halb so gut aussehe wie die anderen? Weder als Mann noch als Frau?« In jedem Wort war seine Frustration herauszuhören. »Das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Und mit Frauen bin ich sowas von durch, scheiß drauf. Es gibt wichtigeres als Weiber.«
»Warum kamst du nicht zu mir? Warum redest du nicht mit mir? Ich kann dich besser verstehen, als du mir zutraust.«
»Nein, kannst du nicht.« Siderius sah ihn versöhnlicher an, er war nicht wütend auf ihn, sondern nur auf die Welt. Aber er hatte auch keine Lust, mit ihm darüber zu reden. »Nicht für alle geht es irgendwann so gut aus wie für dich. Ehrlich, ich beneide dich, um Jin, um Vaaks, die dich nehmen wie du bist, weil du bist, wie du bist. Aber ich habe nichts zu bieten, im Gegensatz zu dir. Heza hat sich nur eine Weile für mich interessiert, weil ich dein Sohn bin. Weil ich ihr Prinz bin. Aber selbst das reicht nicht aus.«
Xaith war klug genug, dazu nichts mehr zu sagen. Sein standhafter und verständnisvoller Blick war tröstlich, aber er änderte leider nichts. Und dieser Trost machte auch nichts besser für ihn.
Siderius wandte sich ab, fragte aber noch: »Kann ich jetzt gehen?«
»Geh. Aber wir werden noch darüber reden, dass du nicht allein ausreiten wirst. Ganz gleich wie sehr du flüchten willst.«
»Wenn du das tun musst…«, murmelte Siderius und ging endlich weiter. Er brauchte dringend einen verdammten Trank und einen feuchten Lappen, um sich zu säubern. Außerdem viel Zeit, um trauern zu können. Verdammt, er würde es sich nie verzeihen, dass dieses Monster sein treues Ross getötet hatte. Seinen einzigen, wahren Freund. Und das alles nur, weil ihn eine dumme Göre verletzt hatte.
Er war mit allem fertig. Mit den Frauen, mit der Liebe, mit allem, was auch nur einen Hauch Hoffnung und Glück in dieser bescheidenen Welt gebracht hatte. Zu dieser Erkenntnis war er dort draußen in den Wäldern gekommen. Er war ein einsamer Krieger, der hoffte, den Tod eines Freundes rächen zu können. Mehr nicht. Alles, was zählte, war das Dunkle Reich aufzuhalten. Wenigstens dafür brauchte es keinen funktionstüchtigen Schwanz…
*
»Siehst du, ich sage doch, ich bringe uns ungesehen rein.«
»Freu dich nicht zu früh, noch sind wir nicht in unseren Zimmern«, flüsterte Esi zurück und drängte ihren kleinen Halbbruder weiter vorwärts. »Und mein Kleid sieht aus, als wäre ich unter der Mauer durchgekrochen, wenn ich mich nicht hurtig umziehe, wird Mutter sofort durchschauen, dass wir fortwaren!«
»Genau genommen, bist du unter der Mauer durchgekrochen.«
»Das sollen sie aber doch nicht wissen!« Sie gab ihrem Bruder einen kleinen Stoß in den Rücken.
»Ich höre unter all dem Gejammer noch immer kein Dankeschön. Danke, Bruder, dass du mir hilfst, obwohl ich dich heute Morgen noch eine Nervensäge nannte und ich es verdient hätte, dass du mich im Stich lässt. Ach, keine Ursache, ich bin selbstlos und verzeihe schnell.«
Sie verzog hinter seinem Rücken missmutig den schmalen Mund. Dragith grinste sie über die Schulter an, während sie sich an die verzierte Wand des Flures drängten.
Zu ihrem Leidwesen war ihr Bruder absolut im Recht. Dieses eine Mal zumindest.
»Danke.« Es fiel ihr nicht schwer, es zu sagen, sie liebte den kleinen Sonnenschein. Wohlwollend blickte sie ihn an. »Mutter und Onkel Marks würden mich umbringen, du rettest mir den Hals.«
»Na ja, ich war ja auch da draußen, also…«
»Aber meinetwegen.«
»Ich habe mich aufgedrängt.«
»Aber nur, weil ich etwas Unbedachtes tun wollte. Du bist meinetwegen mit mir in Schwierigkeiten.«
»Das wissen sie ja nicht«, wollte er sie beruhigen. »Und wenn wir schnell sind, werden sie es auch nie erfahren.«
»Wenn doch, werde ich die Schuld auf mich nehmen, glaub mir. Das war so dumm von mir, ich weiß nicht, warum ich mich dazu überreden ließ…«
»Er war süß.«
Sie seufzte. »Ich muss klüger sein…«
»Es war nur ein einziger Fehler«, beschwichtige er sie und griff nach ihrer Hand, seine grünen Augen sahen sie vertraut an. »Auch du darfst dir mal erlauben, etwas Dummes zu tun. Onkel Marks sagt doch stetst-«
»Aus Fehlern lernt man«, vollendeten sie den Satz wie aus einem Munde.
Dankbar lächelte sie ihren Bruder an.
Doch Schritte ließen sie erschrocken verstummen. Dragith drehte sich wieder nach vorn und streckte gleichzeitig einen Arm vor Esi, um sie gegen die Wand zu drücken. Er war jünger, aber geübter darin, verbotene Dinge zu tun, beispielweise den Palast unerlaubt zu verlassen und sich wieder hineinzuschleichen.
Es war dunkel in dem fensterlosen Flur, sodass sie sich in den Schatten der Nischen verstecken konnten. Sie wartete, bis die Schritte verhallten, dann erst atmeten sie auf.
»Sie sind alle damit beschäftigt, uns draußen zu suchen.« Dragith schmunzelte sie wieder an. »Hab ich doch gesagt, es wird ein Kinderspiel. Komm!«
Er zog sie an der Hand weiter, um mehre Biegungen herum. Die Dienstboten waren aufgeschreckt und liefen umher, weshalb sie deren Gänge und Treppen mieden. Sie mussten zur Halle und von dort ungesehen nach oben gelangen, das gelang ihnen am besten auf den verlassenen Fluren der Hohen Herren.
Glücklicherweise war die Halle verwaist und lag größtenteils im Dunkeln, ganz anders als befürchtet. Sie verstanden zwar nicht warum, aber Dragith schob es auf die Aufregung, die ihr Verschwinden und die Suche nach ihnen verursacht hatte. Die Wachen rannten durch den gesamten Palast und verstärkten die Sicherheit rund um die Zugänge.
Dragith zog sie aus dem Flur hinter die Marmorstatue eines steigenden Pferdes, um sich dahinter zu verstecken. Es war die Nachbildung eines Hengstes namens Lord. Dem ersten Ross ihres Vaters. Gegenüber, eingerahmt von den Treppen, standen die Statuen von zwei Goldschakalen, die ihr Vater einst großgezogen hatte. Esi erinnerte sich noch an Mak, er starb vor einigen Jahren eines natürlichen Todes im Schlaf, während er an der Seite ihres Vaters gewacht hatte.
»Woher kennst du eigentlich all diese Schleichwege?«, fragte sie ihren Bruder, der kurz innehielt, um zu lauschen.
»Ich habe Citrine verfolgt.«
»Er hat es nicht bemerkt?«, stutzte sie.
Dragith zuckte mit den Schultern, dann grinste er sie wieder an. »Doch, natürlich. Aber mit jedem Mal, wenn ich ihm erneut folgte, kam ich ein Stück weiter, bevor er mich aufhalten konnte. Ich weiß nicht, ob er es irgendwann aufgab, oder ich mir sein Schleichen so gut abgeschaut habe, dass ich ihn wirklich irgendwann täuschen konnte und er mich nicht bemerkte.«
Sie war beeindruckt von seiner Geduld und Hartnäckigkeit. Citrine war der Meisterspion ihres Vaters, kaum jemand – abgesehen von Schatten selbst – konnten sich so lautlos und schnell bewegen wie er. Er führte selbst die Königin an der Nase herum. Es muss Jahre gedauert haben, ihn so gut nachzuahmen, dass Dragith ihn hatte überlisten können.
»Seit wann machst du das schon?«, fragte sie überrascht.
Er grinste bloß, dann fuhr er zu einem Geräusch hinter den Türen herum. Schwere Schritte und das leise Klimpern gepanzerter Wachen näherten sich der Halle.
»Sie kommen zurück auf ihre Posten«, befürchtete Esi und krallte sich in den Arm ihres Bruders.
»Schnell«, flüsterte Dragith und löste sich von der Statue. Mit je einem Auge auf die schwarzen Flügel der Tür huschten sie durch die Halle zum linken Treppenaufgang. Esi drohte das Herz zu zerspringen, sie wollte nicht erwischt werden und ihrer Mutter erklären müssen, warum sie sich so hatte hinreißen lassen. Oder noch schlimmer, sie wollte nicht Onkel Marks und Eury erklären müssen, dass sie sich von einer jungen Wache dazu hatte überreden lassen, sie wären bitter von ihr enttäuscht.
Das würde sie nicht ertragen.
Mit der einen Hand in Dragiths Rücken verkrallt, um ihn nicht zu verlieren, und mit der anderen auf dem Geländer, eilte sie die Treppe hinauf und überlegte, wie sie das schmutzige Kleid verstecken konnte. In Gedanken war sie schon in ihrem Zimmer und überlegte sich Ausreden, wo sie gewesen sein könnte. In der Bibliothek oder flanieren im Garten, wo sie dann den Tumult bemerkte und zurückgekehrt war.
Die Schritte näherten sich der Tür, dunkles Gemurmel drang in die Halle. Die beiden Geschwister hatten die oberste Stufe noch nicht erreicht, im Lauf schielten sie bange zurück auf die schwarzen Flügel, als sich ihnen oben an der Treppe ein Schatten in den Weg stellte.
Esi bemerkte es erst, als sie gegen Dragiths Rücken rannte und ihren Bruder umwarf. Mit den Nasen voran fielen sie keuchend auf die Stufen, nur dank Dragiths schnellen Händen, die sich an die Treppe klammerten, rutschten sie nicht wieder in die Halle hinab.
Sie blickten mit bleichen Gesichtern zu dem großen Schatten auf. »V-Vater?«, stammelte Dragith entsetzt.
Auch Esi gefror beim Anblick des Königs das Blut in den Adern zu Eis. Sie konnte nicht einmal atmen, während er mit granitharter Miene auf sie herabblickte.
Er sollte doch schlafen, ging es ihr durch den Kopf. Seit Monaten hatte er geschlafen!
Ihr Vater trug eine schwarze Schuppenrüstung mit imposanten glänzenden Schulterstücken und einem langen Umhang. Die einzige leuchtende Farbe an ihm war das Purpurn des Innenfutters seiner Kleidung. Sein langes blondes Haar war glanzlos und stumpf, als wäre er gerade erst erwacht, seine Haut war blass und kränklich. Er hatte keine Augen mehr unter der schwarzen Binde, aber sein Starren war nicht weniger durchdringend. Trotz seiner ungepflegten Erscheinung war er nicht weniger imposant. Sie spürte seinen kalten magischen Blick, er hatte noch immer die gleiche Schärfe wie vor einem Jahr, als sie ihn zuletzt wach gesehen hatte. Um ihn herum schien die Luft dem Raum die Wärme zu stehlen, es wurde kalt, je näher man ihm kam.
Esi richtete sich langsam auf, sie lag noch immer auf dem warmen Körper ihres schmalen Bruders, ihr Mund war trocken vor Schreck. »Vater, wir haben-«
»Nicht mit mir gerechnet?« Der König nickte ihnen befehlend zu. »Steht auf.«
Und sie standen auf, mit vor Anspannung steifen und ungelenken Bewegungen. Dragith hatte es komplett die Sprache verschlagen, er starrte ihren Vater an wie einen Geist, und Esi hatte den Drang, ihn zu beschützen.
Also stieg sie eine Stufe hoch und versuchte, sich vor ihren Bruder zu stellen. »Vergebung, Vater, wir wollten Euch nicht wecken, wir-«
»Ihr habt lange gebraucht«, unterbrach der König sie unbeeindruckt. »Aber ich nehme an, es dauert seine Weile, sich hereinzuschleichen, nicht wahr?«
Sie verstummte, da sie nicht mehr wusste, was sie sagen konnte, ohne sich noch mehr reinzureiten. Es war klüger, erst einmal zu schweigen und abzuwarten, wie viel er wusste und wie viel er nur vermutete.
Der König musterte sie beide nacheinander mit einem langen, intensiven Blick, den er auch gänzlich ohne Augen bewerkstelligte, eher er sich in Bewegung setzte und die erste Stufe nach unten stieg. Dabei wirkte es, als wäre eine unheimliche Rüstung plötzlich zum Leben erwacht, die Gelenke knackten und knirschten.
»Zu dumm für euch beide, dass eure Begleiter bereits gefunden wurden.«
Sie versteiften sich und warfen sich besorgte Blicke zu.
»Mitkommen«, trug er ihnen auf, als er sich zwischen sie drängte und an ihnen vorbei die Treppe nach unten ging. »Meine allzu enttäuschende Brut.«
Esi spürte, wie ihr Herz in der Brust sank und blickte entschuldigend zu ihrem Bruder hinüber, dem der Schock noch immer ins kreideweiße Gesicht geschrieben stand.
*
Die Fackeln warfen lange und unheildrohende Schatten auf den glänzenden Boden des düsteren Thronsaales. Es drang kaum Licht durch das purpurne Glas der hohen Fenster, die wie spitze Türme bis zur gewölbten Decke reichten und düstere Geschichten über blutige Schlachten erzählten.
Es war kalt und jeder Atemzug schien von den nackten Wänden widerzuhallen, ebenso das schnelle Pochen der ängstlichen Herzen, die hier zusammengetrieben waren.
Der König hing auf seinem kalten Gesteinsthron auf der Empore, ihn umgab eine ehrfürchtige und gleichsam grausame Aura. Der einstige Marmor der Stufen war durch schwarzen Schiefer ersetzt worden, er schimmerte purpurn im Schein der zischelnden Flammen des Geistfeuers, das an den Wänden tanzte.
Im Saal kniete Simth vor dem König, getrocknetes Blut klebte in seinem Nacken, während er den Kopf so tief gesenkt hielt, wie es ihm möglich war, ohne den Boden zu küssen. Er war schmutzig und wirkte noch immer benommen, als hätten ihn die Wachen vom Wald direkt in den Saal geschleift, während er noch ohne Bewusstsein gewesen war.