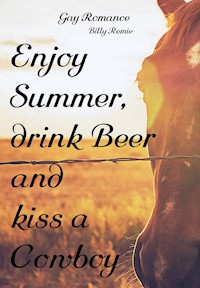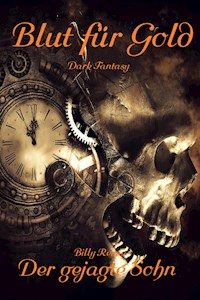Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Bruderschaft 5
- Sprache: Deutsch
Der Kaiser von Elkanasai wurde ermordet, der Großkönig von Carapuhr übernimmt nach und nach sein Reich, während Wexmell unter Beweis stellen muss, dass er der wahre König von Nohva ist – und Desith auf Rache sind, als er vom Tod seines Vaters erfährt. Riath ist sowohl vor Melecay auf der Flucht als auch auf der Jagd nach Xaith, um ihn für seine Sache zu gewinnen. Er ahnt nichts davon, dass sein geliebter Kacey von seinen Feinden verschleppt wurde und gefoltert wird. Kacey versucht derweil mit allen Mitteln, das göttliche Licht in seiner Aura vor seinem Peiniger zu beschützen, doch seine Kräfte schwinden schnell. Die Welt versinkt im Chaos und selbst Xaith beginnt sich zu sorgen. Nicht zuletzt, weil Jin alles daransetzt, auf sein Herz einzuwirken, damit er endlich begreift, dass er – und nicht sein Vater – gebraucht wird. Xaith hat jedoch nur ein Ziel im Leben, und nichts wird ihn aufhalten. Er will seinen Vater wiedererwecken, dafür will er sogar sein eigenes Leben beenden – Doch was, wenn das Ritual ein Opfer von ihm fordert, mit dem er nicht gerechnet hat? Was ist er bereit für das Leben seines Vaters zu geben? *Das eBook hat ca. 800-900 Seiten, je nach Geräteeinstellung, plus Mini-Bonus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1214
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Billy Remie
Geliebtes Gestern
Bei der Liebe unserer Väter
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Was bisher geschah…
Prolog
Teil 1: Sturmesruh
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Teil 2: Zornesbrand
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Teil 3: Racheglut
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Epilog
Nachwort
Bonus
Impressum neobooks
Was bisher geschah…
(Für diejenigen, die eine komplette oder teilweise Auffrischung möchten. Ich habe den Rückblick in Bände unterteilt, sodass ihr nach Belieben alles oder nur die Geschehnisse aus dem vorherigen Band noch einmal zusammengefasst lesen könnt – oder ihr springt gleich zum Prolog.)
Band 1-2:
Vor knapp acht Jahren geriet ein Götterportal in den Tiefen des Dschungels von Zadest außer Kontrolle und drohte, das Leben der gesamten sterblichen Welt auszusaugen. König Desiderius gab sein Leben im Kampf gegen eine fremde Göttin, die durch das Portal gekommen war, um alles Leben zu versklaven. Er starb nicht umsonst, denn nur so erlangte sein Sohn Sarsar die nötige Macht, um die freigesetzte Magie des Portals zu bannen.
Sarsar verteilte diese fremde Macht auf zehn Männer, um sie wegzuschließen. Sarsar, Derrick, Place, Korah, Doragon, Vaaks, Xaith, Riath, Kacey und Desith tragen seitdem ein Stück Göttlichkeit in sich, verschlossen in ihren Seelen und mit magischen Siegeln versehen, damit sie niemals ausbrechen kann. Doch allein der Hauch dieser Macht verändert sie.
Diese zehn Männer sind die Hüter eines Geheimnisses, das niemals in falsche Hände geraten darf, denn die göttliche Macht ist weiterhin am Leben und versucht, ihrem Gefängnis zu entkommen.
Doch von diesen zehn sind scheinbar nur neun übrig. Niemand glaubt, dass Sarsar den Dschungel überlebte, als der Turm über diesem einstürzte, nur sein Bruder Riath war allein mit ihm – und dieser ließ ihn dort zurück. Niemand weiß, dass Riath ihn dem Tod überließ, bis auf dessen Gefährte Kacey, der ihn deckt.
Wexmell Airynn, Desiderius` Gefährte, erbte die Krone Nohvas.
All dies ist nun knapp acht Jahre her.
Band 3:
Sarsar taucht aus dem Nichts wieder auf, in das er sich gerettet hatte, doch er strandete in Zadest und geriet in die Versklavung der Frauenstämme, niemand weiß, dass er noch lebt und gefangen gehalten wird. Gleichzeitig mit seinem Auftauchen entflammte in Carapuhr ein Bürgerkrieg. Desiths Zwillingsschwester, die mit Vynsu – dem Erben Carapuhrs – vermählt war und ihm zwei Erben geschenkt hat, wird scheinbar Opfer eines Kutschüberfalls. Ihre Leiche besaß kein Gesicht. Um das Bündnis zwischen Desiths Vater – Eagle, Kaiser von Elkanasai – und dem Großkönig von Carapuhr – Vynsus Onkel Melecay – zu wahren, verloben sich Desith und Vynsu. Doch was als Zweckehe gedacht, wurde schnell zu Respekt und schließlich zu Liebe. Gemeinsam decken sie in Carapuhr eine Verschwörung auf, dabei hatten sie unerwartet fremdländische Hilfe von Riath und seinem Freund Marks, die nach Riaths Bruder Xaith suchten. Es schien zunächst so, als ob Xaith mit dem Krieg in Carapuhr in Verbindung stünde.
Doch schließlich entdeckte Desith, dass der Bürgerkrieg und das Verschwinden seiner Schwester mit Riaths Anwesenheit zusammenhing, denn er war es, der das gesamte Volk infiltrierte und gegeneinanderhetzte, und Riath war es auch, der Desiths Zwillingsschwester verführt und ihren Tod inszeniert hatte, bevor ihr bewusstwurde, dass es Riath nicht um sie, sondern nur darum gegangen war, Melecay zu schaden.
Desith findet schließlich seine doch noch lebende Schwester in einem Geburtenhaus, wo sie von Xaith vor Riath versteckt wurde. Sie gebar Drillinge, zwei der Kinder überlebten, sie selbst starb bei der Geburt. Eines der Kinder wurde von Xaith entführt, das andere versteckten Vynsu und Desith bei sich. Es gelang Desith und Vynsu schließlich, den Aufstand in Carapuhr zu zerschlagen, allerdings entwischte ihnen Riath, der mit einem Schiff in Richtung Elkanasai floh.
Band 4:
In Elkanasai will Riath nur eines: Die Magier des Kaiserreichs für sich gewinnen. Dafür suchte er seine Jugendliebe Kacey auf und ließ sein Herzblut fließen, um dessen Vertrauen und auch sein Herz zurückzugewinnen.
Im Zuge vieler politischer Verwicklungen und Machenschaften, brandete im Kaiserreich ein Krieg zwischen Magiern und Normalsterblichen auf, und Kacey stand vor der Entscheidung, für seines Gleichen – Die Magier – einzustehen, oder seiner Familie – den Herrschern Elkanasais – einzustehen. Sein Herz stand der Vernunft im Wege, denn er liebte Riath irrwitziger Weiser trotz all seiner Taten. Zumal er endlich Riaths Geheimnisse aufdeckte und erkennen musste, dass der Großkönig von Carapuhr hinter dem Hass auf die Magier stand, um Riath von seinem Thron fernzuhalten. Als Kacey zudem auch noch erfuhr, dass der Großkönig Riaths neugeborene Tochter und deren Mutter ermorden hatte lassen, stand seine Entscheidung bereits so gut wie fest.
In der Zwischenzeit eilte Xaith durch den Regenwald Elkanasais, um zu dem magischen Ort auf der Insel Malahnest zu gelangen, wo er seinen Vater wiedererwecken will. Etwas, das Riath unbedingt verhindern will, denn das Ritual fordert einen zu hohen Preis: Den Untergang Nohvas und Dunkelheit über viele Zeitalter. Xaith ist sich sicher, diese Katastrophe zu umgehen, indem er sein Leben für das seines Vaters opfert, dennoch trägt er Riaths Bastard mit sich, um seinen Bruder von Carapuhr wegzulocken. Er sieht keinen Sinn in einem Krieg. Riath will ihn aufhalten, damit Xaith durch das Ritual kein schlechtes Licht auf alle Magier wirft, also ließ er ihn von Bestien und Geistern jagen, um ihn daran zu hindern. Doch dann bekommt Xaith unerwartete Hilfe. Jin, den er für Vaaks` – die Liebe seines Lebens und Ziehbruder – Gefährten gehalten hatte, tauchte wie aus dem Nichts auf und rettet ihn unentwegt – auf mehr als eine Weise. Jin will ihn nach Hause holen, aus eigenen, persönlichen Gründen. Doch statt nach Hause zu gehen, müssen sie zunächst notgedrungen – und später freiwillig – zusammenbleiben. Was Xaith nicht ahnt: Jin bleibt bei ihm, weil er in ihn verliebt ist. Er will ihn davon abhalten, sich für seinen Vater zu opfern.
Die Ereignisse spitzten sich langsam zu, auch in der Hauptstadt des Kaiserreichs, wo Riath gefangen genommen wird, als der Kaiser von seiner Reise aus Carapuhr zurückkehrte. Auch der Großkönig und sein Prinzgemahl Dainty sind anwesend, um den »Dunklen Hexenprinzen« hinzurichten.
Kacey erfährt nach einem Anschlag auf sein Leben, dass während der vor Wochen kurzweilig entbrannten Affäre mit Xaith in seiner Aura ein göttliches Licht entstanden war. Es schien andere in den Wahn zu treiben, so vor allem auch Dainty, der sich plötzlich seltsam und wie besessen verhielt.
Kacey konnte niemandem mehr vertrauen und beschloss, Riath zu befreien, da er von der Besessenheit unangetastet schien – er konnte beweisen, dass seine Liebe echt war.
So verriet Kacey seinen Vater zu Riaths Gunsten und hoffend, die Zukunft der Magier des Reichs zu sichern.
Als Kacey und Riath dann unerwartet von Wexmell Hilfe bekamen und das Kaiserreich vom Einfluss Carapuhrs befreien können, unterband Melecay mit einer letzten und konsequenten Tat ihre Macht im Kaiserreich. Mit Riaths Dolch tötete er den Kaiser und hing es diesem an. Kacey rannte vom Tatort davon, damit er vor dem Rat der Fünf Riaths Unschuld bezeugen konnte, Riath floh unterdessen vor Melecay und vorerst aus dem Kaiserreich, bis seine Unschuld bewiesen werden konnte.
Er setzte alle Hoffnung in Kacey, den er von Wexmell und dem Rat beschützt sah.
Aber Kacey schaffte es nicht wie erhofft, den Palast zu verlassen, er lief Dainty in die Arme, der ihn entführte. Und während Riath seinem Bruder Xaith nachjagen musste, da dieser bereits auf einem Schiff in Richtung Malahnest unterwegs war, wurde Kacey nach Carapuhr gebracht – ohne, dass Riath auch nur etwas davon ahnte.
Prolog
Der Winter an der Küste hatte alles mit einer dicken Schicht Eis überzogen. Es schimmerte wie Glas in der Morgensonne, nachdem der kreischende Sturm in der Nacht es über das Land gebracht hatte. Die Häuser, Straßen und die Gerüste der Schiffe, die am Hafen in den Werften gebaut wurden, wirkten gläsern und mystisch.
Es war bitterkalt, sodass nicht nur Straßenhunde und Obdachlose in der Nacht zu makabren Statuen eingefroren waren, sondern auch das Vieh in den Ställen dezimiert worden war.
Winter war an den Küsten Carapuhrs genauso verheerend wie Kriege.
Trotz der offenen Tore des Langhauses, hatten nicht alle unterkunftslosen Herumtreiber die Warnungen ernst genommen und am warmen Feuer ihrer Könige Unterschlupf gesucht. Mit scheinbar ungerührter Miene stand Desith vor dem Langhaus und besah die Küste und das Eis, das alle Gebäude und alles Leben überzogen hatte. Narren, dachte er sich, als er zusah, wie Krieger die steifen Leichen aus den Straßen zerrten.
Er empfand keine Schuld für diese Toten, er konnte nicht mehr tun, als ihnen warme Feuer anzubieten, ihr eigener Stolz und ihre eigene Blindheit vor der Gefahr der Kälte hatten ihnen den Tod gebracht. Sturheit wurde eben manchmal auch mit Grausamkeit bezahlt.
Verschwendung von Leben, dachte er mürrisch, Leben, das er noch gebraucht hätte. Der Winter würde ihm bald keine Männer mehr übriglassen, mit denen er seine Schiffe bemannen konnte.
Und der Großkönig saß ihnen bereits im Nacken.
In diesem Moment, als Desith dort vor dem Langhaus stand, hielt er eine Nachricht von Melecay in der Faust und knüllte sie, während er den Schaden besah, den die letzte Nacht und ihre Kälte in seinem kleinen, aber feinen Königreich angerichtet hatte. Und was verlangte der Großkönig? Dass er bereits auf dem Weg nach Nohva war, um es einzunehmen.
Glaubte Melecay denn wirklich, dass sich Schiffe über Nacht bauen ließen? Und damit war es nicht getan, Desith war nicht so haltlos von Rache getrieben, wie Melecay es sich wünschte. Natürlich wäre er am liebsten vorgestern losgesegelt, doch sie hatten nur winzige Fischerboote, der Winter fraß ihre Vorräte. Desith würde nicht einfach ein paar Tausend Soldaten in den sicheren Tod schicken! Nein, er plante. Und Pläne zu schmieden dauerte lange. Dafür würden sie von Erfolg gekrönt sein. Er würde Melecay nicht noch einmal antworten, sollte er ihm doch den Kopf abschlagen wollen, Desith wusste, dass er als Sohn des Kaisers unantastbar war.
Nun, was für ein Pech für Melecay.
Desith hatte genug andere Sorgen. Das Holz für den Bau der Schiffe wurde knapp, bei dem Wetter konnten sie jedoch keine neuen Stämme aus dem Wald zur Küste transportieren, das Korn schwand rapide, und der Versorgungsweg von Carapuhr nach Nohva war eine Katastrophe, sie würden auf dem fremden Land wie die Fliegen fallen, wenn es ihnen nicht gelang, eine Lösung zu finden. Der Weg über die See würde zu lange dauern, um die Soldaten zu versorgen, doch es gab keine andere Route, auf der die Vorräte sicher wären. Am Ende würden sie alles daransetzen müssen, so schnell wie möglich Land und eine Festung einzunehmen, die sich gut verteidigen ließen. Doch das Problem mit gut zu verteidigten Festungen war nun mal, dass sie nicht leicht einzunehmen waren.
Und natürlich würden sie ein ungeschütztes Königreich zurücklassen, wenn sie jeden Krieger und jede Kriegerin mitnahmen. Nur die Alten und Kranken würden zurückbleiben. Wer würde ihre Kinder schützen?
Ein Feldzug ließ sich nicht über Nacht durchfuhren, nicht einmal über Nacht planen. Desith war kein einfacher Barbar, dem die Verluste gleich gewesen wären. Melecay würde tausende Krieger in den Tod schicken, wenn er einen Sieg roch. Desith war auch kein ausgesprochen mitfühlender Mensch, aber ohne Krieger, gab es auch kein Königreich. Nein, er hatte die Verantwortung für diese Männer und Frauen – und er wollte, dass sein Vorhaben mit Erfolg gekrönt war.
Desith stopfte die Nachricht wieder unter seinen Mantel und zog den Pelzkragen eng zusammen, über den der eisige Wind strich. Die flachen Stufen waren vereist, etwas Schnee hatte sich darauf gesammelt und knirschte, als seine leichten Stiefel darauf traten.
Die Menschen, die ihm entgegenkamen, blickten ihn immer noch mit gewissem Argwohn und Befremdung an, dennoch besaßen sie mittlerweile genug Respekt, um sich vor ihm zu verneigen und ihm aus dem Weg zu huschen. Er war ihr König, aber es war nicht leicht gewesen, sie alle davon zu überzeugen, dass er stark und würdig war. Viele Barbaren hatten ihn wegen seiner hageren und kleinen Statur für ein Nichts gehalten und ihn nicht ernst genommen. Viel Blut war geflossen, viele Zähne ausgeschlagen worden und viele Köpfe gerollt, bis sie endlich verstanden hatten, dass er einer von ihnen war, ganz gleich hinter welcher Grenze er geboren worden war.
Desith trug keine Krone in seinen langen, roten Haaren, nur sein dunkelrotes Haarband bändigte den wirren Zopf und die abgefressenen Strähnen. In dem riesigen Wolfspelzumhang hätte er untergehen müssen, doch das tat er nicht, das Kleidungsstück passte wie angegossen, auch wenn es auf dem Boden hinter ihm her schleifte wie ein Schleier – denn er trug den Pelz mit genügend Stolz.
Gefrorene Leichen wurden an ihm vorübergetragen, Hunde und obdachlose Veteranen auf Karren geworfen und weggebracht, um gemeinsam verbrannt zu werden, Knechte trugen schwere Krüge mit Öl hinterher.
Über ihrem kleinen Küstenkönigreich brach die dichte Wolkendecke auf und ließ noch mehr Sonnenstrahlen hinab, die das Eis zum Funkeln brachten. Dort, wo die meisten Leichen bereits verschwunden waren, trat Leben in die Straßen. Mütter fütterten die Hühner und Ziegen, nachdem sie sie aus dem Haus gelassen hatten – bei dem Wetter schlief man lieber mit dem Vieh in einer Stube, als es draußen erfrieren zu lassen – und Kinder schlitterten unter fröhlichem Gelächter über den gefrorenen Marktplatz. Eisfischer gingen mit Äxten und Eimern hinaus und wanderten auf das dicke Eis vor der Küste, nur in der Ferne konnte man schwarze Wellen erkennen, die an hohen Eisbergen brachen.
Nein, dachte Desith wieder, im Winter konnten sie unmöglich lossegeln.
Heda und Aegir spielten auch auf dem Marktplatz. Bei ihnen saß auch Vishalyrr – der gruselige Feenkönig mit dem pelzigem Kopf und messerscharfen Zähnen – und bewachte dasandereKind. Doch ausnahmsweise galt Desiths Aufmerksamkeit einmal nicht Riaths verdammten Bastard, sondern dem anderen Neffen.
Desith blieb stehen und rief mit kräftiger Stimme durch die enge Straße zum Platz hinüber: »Aegir!«
Vynsus Junge warf den roten, kurzen Schopf herum und starrte Desith aus riesigen, frostblauen Augen ertappt an.
»Lass die Leichen in Ruhe, bevor du dir die Pest holst«, warnte er mit unnachgiebig strengem Blick.
Der Junge verzog missmutig das Gesicht und wich vor dem gefrorenen Einarmigen zurück, der den verbliebenen Arm hochgestreckt hielt, als hätte sein Herr und Erlöser wahrhaftig vor ihm gestanden, während der Sturm ihn zu Eis hatte erstarren lassen.
Allein die Vorstellung fröstelte Desith, das Einfrieren war für ihn nicht halb so gruselig wie der Gedanke, der Obdachlose hätte bei Eintritt des Todes tatsächlich so etwas wie eine Erleuchtung gehabt. Jemand musste ihn wegschaffen.
»Und leg den Finger zurück!«, befahl Desith streng, als Aegir sich schon in Sicherheit wähnte und davonschlich.
Der Junge ließ die Schultern hängen, als hätte man ihm sein Haustier weggenommen. Er maulte etwas, das Desith nicht verstand, und warf dann den gefrorenen und abgebrochenen Finger in den eisigen Schoß des Obdachlosen. Dann ging Aegir mit hängendem Kopf zurück zu seiner Schwester, auf die er eigentlich achtgeben sollte!
Dieser Junge! Desith schüttelte den Kopf. Aegir kam auf die irrwitzigsten Ideen, manche davon wahrlich gefährlich, und das nicht nur für ihn selbst. Aegir hatte Riaths Bastard in einem Topf baden wollen. In einem Topf, der wohlbemerkt über einem Feuer gehangen und Wasser erhitzt hatte!
Entweder, so sagte Desith immer, war Aegir ein besonders neugieriger und gerissener Junge – denn ihm erschloss sich sehr wohl der Sinn dahinter, das Kind doch gleich in den Topf zu stecken, statt den schweren Topf zur Holzwanne zu tragen – oder Aegir war schlicht strohdoof und konnte Gefahren für sich und andere einfach nicht erkennen. Es blieb abzuwarten, ob er mit Genialität oder Naivität gesegnet war, auf jeden Fall würde er gewiss noch so einiges anstellen, dass ihnen den Atem verschlagen würde, davon war Desith überzeugt. Er selbst ließ den Jungen nur ungern aus den Augen, Vynsu war da schon nachsichtiger, er war dumm genug, seinen Kindern zu vertrauen.
Heda war gänzlich anders als ihr Bruder. Sie war eine ruhige kleine Spionin, die die Machenschaften ihres Bruders stets aus unheimlich klugen Augen verfolgte, als wollte sie sich ein ums andere Mal genervt an die Stirn greifen. Wenn sie etwas älter war, würde sie gewiss ein Auge auf ihn haben, zumindest hoffte es Desith für Aegir, er würde jemanden brauchen, der ihn am Leben hielt – und alle um ihn herum.
In den Schmieden flammten Feuer auf, heißer Stahl zischte im Eiswasser und helles Hämmern drang auf die Straßen. Das Eis hatte alles überzogen, aber es war nicht stark genug, alles Leben auszulöschen. Es musste weiter gehen, immer weiter.
Das ist der Lauf der Dinge.
Doch manchmal geschahen Dinge, die einen zurückwarfen oder nicht losließen. Dinge, Ereignisse, die sich so tief in die Seele gebrannt hatten, dass das Vorankommen unmöglich schien. Wie der Tod der Schwester, den man nicht überwinden konnte, weil man vielleicht eine Teilschuld daran trug. Weil man sie allein gelassen hatte. Es war leichter, einen anderen Schuldigen zu finden und ihm ewig zu grollen, als das Schicksal dafür verantwortlich zu machen – oder es den Lauf der Dinge zu nennen.
Manchmal konnte man nicht nur nach vorne sehen, manchmal hielt etwas aus der Vergangenheit einen Mann an Ort und Stelle.
Das Ganze wurde schwieriger, wenn die Zeit verstrich und man spürte, wie die Welt weiter ihrem Wandel nachging und die Menschen um einen herum aufgehört hatten, jemanden die Schuld zu geben. Vielleicht sogar vergaben. Und man selbst stand mitten unter ihnen und spürte, dass sich alles und jeder weiterentwickelte, doch man selbst blieb stehen und hatte das Gefühl, in der Vergangenheit zu leben.
Dabei ging es für Desith immer nur vorwärts, es hatte für ihn kein Weg zu Derrick zurückgegeben, nur ein Vorwärts mit Vynsu. Warum konnte er in Bezug auf seine Familie nicht loslassen, so wie seine neue Sippe es von ihm erwartete?
Lohna war tot, Riath war über alle Berge. Was kümmerte ihn Nohva?
Ach ja, Melecay war sein Großkönig und würde ihm den Kopf abschlagen, wenn er es sich nun anders überlegte.
Natürlich hatte Desith seine Rache nicht vergessen, doch er wollte nicht brutal über Nohva herfallen, wie Melecay es von ihm erwartete. Immerhin war König Wexmell Airynn von Nohva Desiths Großvater. Und Desith war überdies kein Mann, der sich darauf freute, wilde Barbaren auf wehrlose Bauern zu hetzen und dabei zuzusehen, wie ihre bescheidenen Häuser abbrannten und sie alle geschändet wurden. Er machte sich nichts vor, er kannte das Gemüt seines neuen Volkes.
Nein, er würde es anders angehen, mit weniger Wut und mehr Verstand. Es ging ihm nur darum, Riath etwas zu stehlen, nicht darum, Unschuldige für Riaths Taten büßen zu lassen.
Ein schmaler Grat auf dem Desith balancierte und der monatelange Vorbereitungen benötigte, um sich die richtigen Züge zurechtzulegen. Denn wenn er gen Nohva segelte, würde er zwar Riath etwas wegnehmen, sein Gegner war jedoch Wexmell. Und Wexmell war ein Mann, den Desith nicht unterschätzte, denn er war klug, umsichtig und obendrein um einige Jahre erfahrener als er.
Er war nicht so dumm, auf die Gerüchte zu hören und ihn als schwachen König abzustempeln.
Desith fand seinen Gemahl auf den Reitplätzen. Er hatte auch gar nichts anderes erwartet und war seinem Ziel auf direktem Weg dorthin gefolgt. Als er allein unter den Fellen in ihrem Bett erwacht war und die Seite neben ihm verwaist und ausgekühlt vorgefunden hatte, hatte er sofort gewusst, dass Vynsu beim ersten Licht des Tages nach seiner geliebten Herde sah.
Und dort war er, sein großer Barbar, imposant wie immer unter seinen vielen Wolfspelzen, die er um seine malerischen Muskeln gewickelt und gespannt hatte. Das braune Haar schimmerte im Sonnenlicht so violett wie die winzigen Splitter in seinen warmen Iriden. Vynsu. König von Gren. Groß und gewaltig wie der Eisbär, den er als Haustier hielt – der jedoch aus naheliegenden Gründen nicht in die Nähe der Jungpferde durfte – doch sanft und ruhig wie ein leiser Schneefall ohne Sturm.
Desith trat an das Seil, das von Holzpfosten zu Holzposten reichte und den Reitplatz einzäunte. Er beobachtete Vynsu, wie er einen mausgrauen Falben daran gewöhnte, dicht neben einem anderen Hengst zu laufen. Ja, auch das musste man Pferden erst beibringen, die Tiere gingen nicht von Anfang an in Reih und Glied, wie Desith es von der Reiterstaffel seines Vaters kannte, alles musste ihnen mühsam und durch eine geduldige Hand beigebracht werden.
Vynsu ritt auf seinem großen, langbeinigen Fuchshengst Hekkilston und führte den viel kleineren und stämmigen Falben am Strick neben sich her. Immer wieder ritt er nah an ihn heran, Hekkli stieß hin und wieder mit dem Schenkel gegen ihn, doch der Falbe blieb entspannt, obwohl er die Ohren warnend anlegte. Er beruhigte sich jedoch, sobald der große Hengst ihm wenigstens zwei fingerbreit Raum ließ.
Vynsu war der geduldigste Mann, den Desith kannte. Und immer wieder war er fasziniert davon, wie er mit den Pferden umging und wie es ihm gelang, sie innerhalb kürzester Zeit von stürmischen Giftzwergen in besonnene Gefährten zu verwandeln.
Zur Hochzeit hatte Vynsu Desith ein Fohlen versprochen, er wollte ihm das beste und treuste Pferd züchten. Doch bis dieses Fohlen geboren und beritten werden konnte, würden noch Jahre vergehen, also hatte Vynsu aus seiner Herde ein passendes Pferd für Desith herausgesucht.
Es war dieser Falbe, mit dem Vynsu seit Wochen jeden Tag auf dem Platz war. Desith hatte ihn wegen seiner Farbe Kiesel genannt. Er war ein stämmiges Pony mit klugen, dunklen Augen und zweifarbiger Mähne und Schweif – schwarzgrau. Wobei Vynsu die Mähne so weit abgeschnitten hatte, dass nur noch bolzenartige Stoppeln übrig waren, die wie ein schmucker Fächer den Hals zierten und ihn noch muskulöser erscheinen ließen.
Desith sah den dreien einen Moment zu. Er wünschte, er könnte Vynsu hierlassen, sobald sie lossegelten. Er wollte diesen schönen Mann nicht mit in den Krieg nehmen, auch wenn er wusste, dass er ohne Vynsus Stärke vermutlich gleich zuhause bleiben konnte. Er brauchte seine Erfahrung als Krieger und seine Geduld im Umgang mit Desith selbst. Er brauchte Vyn als Kämpfer und auch als Anker. Dennoch, er hätte ihn gern in Ketten gelegt und hier in Sicherheit gewusst, denn anders als Desith, trug Vynsu keine eingesperrte, gruselige Magie von fremden Göttern in seiner Seele, die tödliche Wunden heilte.
Aber der Barbar war diesbezüglich genauso stur wie Desith. Sie würden immer zusammen gehen, wohin ihr Weg sie auch führte. Desith müsste ihn schon verraten und sich heimlich davonschleichen, sollte er ihn zu seiner eigenen Sicherheit zurücklassen wollen. Und selbst dann würde Vynsu die ganze Welt nach ihm absuchen. Und sei es nur, um ihm den Arsch zu versohlen und ihn an seinen roten Haaren nach Hause zu schleifen.
Als Vynsu langsam um die vereiste Kurve ritt, wobei Hekkli und Kiesel beneidenswert trittsicher waren, bemerkte er Desith mit aufleuchtendem Blick, der sich in einem Zucken seiner Mundwinkel widerspiegelte.
Es war noch vor dem Morgengrauen gewesen, als die wärmende Esse im Raum beinahe gänzlich verglüht war und außerhalb der Felle der Atem in weißen Nebel hervorkam, als sie sich im Halbschlaf aufeinander gerollt und geliebt hatten wie zwei junge Löwen. Desith hatte es beinahe für einen Traum gehalten, bis er in Vynsus funkelnden Augen die Begierde und den Triumph sah.
Als Vynsu langsam herangeritten kam und in Erinnerung an ihre stille Leidenschaft schmunzelte, sagte Desith trocken: »Es ist so spielend leicht, euch Barbaren zufriedenzustellen, es genügt, wenn man ordentlich für euch abspritzt.«
Vynsu lachte rau auf, er hielt jedoch nicht an und ritt an Desith vorbei, um der Bahn zu folgen. Der Schneematsch hatte sich mit dem Grund vermischt und schmatzte, das Eis zersplitterte unter den Hufen der beiden schnaubenden Hengste.
»Du hast es nicht kommen sehen, das war das erste Mal.« Vynsu strahlte wie ein Junge, der seine erste Schlacht geschlagen und gewonnen hatte.
Desith legte ungerührt den Kopf zur Seite. »Woher willst du wissen, dass ich nicht die ganze Zeit vor dir wach war und meinen warmen Hintern an deinem wachsenden Stamm gerieben habe, bis du mich endlich genommen hast?«
Vynsu schüttelte belustigt den Kopf, nichts konnte ihm die gute Laune verderben. Er war sich sicher, dass er Desith einmal zuvorgekommen war.
Nun, sollte er es glauben.
»Du weißt schon«, wechselte Desith nahtlos das Thema, »dass dein Sohn Leichen verstümmelt, während du hier deine morgendlichen Bahnen reitest und in Erinnerung an meinen göttlichen Körper schwelgst?«
Vynsu runzelte die Stirn, während er in die Mitte des Platztes einscherte und im gemächlichen Schritt über das Eis ritt. »Aegir?«
»Wer sonst?« Desith hasste unnötige Fragen. »Er hat einen Gefrorenen um einen Finger erleichtert.«
Vynsu schnaubte und winkte ab. »Ach, der ist doch nur neugierig. Wir haben doch alle unsere erste, gefrorene Leiche mit dem Fuß angestoßen und geschaut, ob die Finger abbrechen.«
»Kann ich nicht beurteilen«, gab Desith zurück und beobachtete, wie sein Barbar aus dem dunkelbraunen Ledersattel glitt und schwer auf dem Platz aufkam. »Bei uns war es zu heiß, da fingen die Leichen sofort an zu stinken. Die wollte ich mir gar nicht so genau ansehen.«
Vynsu fummelte an irgendetwas an Hekkilstons Trense herum. »Ich werde mit ihm reden«, doch er wirkte eher belustig, als schockiert. »Er war nur neugierig, sicherlich hat er nicht einmal eine Vorstellung davon, was er da eigentlich gemacht hat. Ich erklär`s ihm später.«
»Hmmmh. Aegir hat die Intelligenz wohl von der Seite des Vaters geerbt, ein Airynn würde wohl kaum solchen Hirngespinsten nachgehen.«
Vynsu lehnte sich um den Kopf seines Hengstes herum und verengte warnend die Augen.
Desith grinste in sich hinein. »Oh ja«, er zog die Luft durch die Zähne, »das werde ich noch büßen müssen.«
»Mhm«, brummte Vynsu zustimmend.
Desith lächelte in sich hinein, doch die Heiterkeit auf seinem Gesicht erstarb genauso schnell, wie sie Einzug gehalten hatte, fortgewischt mit dem nächsten eisigen Windzug. Er verfiel in sein übliches Brüten.
»Nachricht von meinem Onkel?«, fragte Vynsu, als er mit den Pferden im Schlepptau zum Pfosten kam.
Desith nickte und beobachtete den geschickten Knoten, mit dem Vynsu die Hengste festband. Obwohl Kiesel gifteten, verhielt Hekkilston sich neben ihm ganz souverän, dabei waren beide vollausgewachsene Pferde mit instinktivem Paarungsverhalten, einschließlich der tiefen Abneigung allen anderen männlichen Artgenossen gegenüber. Doch Vynsus Pferd war es gewohnt, neben anderen Hengsten zu stehen und sich vorbildlich zu verhalten. Es war allerdings auch keine Stute mit ihnen hier draußen, vielleicht hätte die Sache dann weniger entspannt ausgesehen.
Vynsu seufzte, als er sich Desith zuwandte und mit den Händen das Seil packte, das sie trennte. »Der Schiffsbau wird sich noch eine Weile hinziehen.«
»Melecay würde uns auf einem wackligen Floß nach Nohva schicken, wenn er hier wäre.« Desith knirschte mit den Zähnen. »Wie sehr ich es doch hasse, sein verdammter Hund zu sein.«
Vyn lächelte besonnen zu ihm auf, selten brachte ihn echte Wut zur Raserei. »Aber er ist nicht hier, Desith.«
»Das beruhigt mich nur geringfügig.« Desith verschränkte unter dem Umhang die Arme vor der Brust und legte düster die Stirn in Falten. »Ich glaube, er weiß selbst ganz genau, wie viel Arbeit und Zeit unser Vorhaben benötigt, er hat nur Freude daran, uns zu zeigen, dass er uns tyrannisieren kann, wie es ihm beliebt!«
»Ja, das denke ich auch«, seufzte Vyn. Er streckte den muskulösen Arm nach Desiths aus und legte ihm die Hand in den Nacken, um ihn sanft zu massieren, wie er es immer tat, um ihn zu besänftigen.
Seine magischen Finger fanden und lösten jede Verspannung, und auch wenn Desith sehr wohl bemerkte, dass es Vynsus Art war, ihn liebevoll zu manipulieren, ließ er es zu und genoss es.
Ohne seinen Barbaren wäre Desith vor Anspannung durchgehend hart wie ein Fels. Und kalt, innen wie außen. Manchmal, wenn er Vynsu in die braunen Augen mit ihren violetten Splittern blickte, ängstigte ihn die tiefe Liebe, die er für ihn empfand. Wenn es eine Schwachstelle in seinem Leben gab, dann war es eindeutig sein Barbar. Nur gut, dass dieser Muskelberg kein leicht zu tötendes Opfer war.
»Es wird schon alles gut.« Vynsu hob auch den anderen Arm und nahm Desiths langes Gesicht zwischen die Hände, um ihn sanft an sich heranzuziehen. Desith ließ es zu, auch wenn er unwillig dreinblickte. Das Seil störte sie nicht, als es sich in ihre Kleidung drückte, nichts konnte sie trennen. »Melecay wird genauso wie wir anderen den Winter abwarten müssen, er lässt nur den Großkönig raushängen, damit niemand hier vergisst, wem sie zur Treue verpflichtet sind.«
»Als könnten wir das bei seinen hohen Steuern je vergessen, unser Korn ist so gut wie leer. Wie sollen wir unsere Soldaten versorgen, sobald wir in Nohva sind, Vyn?«
Vynsu seufzte, seine breiten Fingerkuppen gruben sich in Desiths feuerrotes Haar und massierten seine Kopfhaut, sodass er eine Gänsehaut bekam. »Wie wir es besprochen haben, Desith.«
Desith hielt seinen Blick mit seinen frostblauen Augen fest. »Und wenn wir scheitern, sterben unsere Brüder wie die Fliegen.«
»Nein, nicht mit dir als Anführer.« Vynsu zeigte eine Zuversicht und ein Vertrauen in Desith, die er nicht teilen konnte.
Mit noch immer finsterem Blick wandte Desith das Gesicht ab und starrte an Vynsu vorbei ins Leere. Er sah den Strand von Nohva bereits vor sich, übersät von den Leichnamen seiner Männer. »Ich bin kein Anführer, Vyn«, sagte er dann und blickte wieder zu seinem Gemahl auf, der ihm aufmerksam lauschte. »Ich bin kein General, ich habe immer nur für mich gekämpft.«
»Das stimmt nicht.« Stolz sah Vynsu auf ihn herab. »Du hast mit mir gemeinsam um das Land und die Burg meines Vaters gekämpft. Wir haben ein Heer zusammen zurückgeschlagen, Desith. Sag nicht, du wärest kein Anführer, du bist mein König und der König von Gren, und niemandem sonst würde ich mehr eine Krone anvertrauen als dir. Vor niemanden sonst würde ich knien.«
»Da wo ich herkomme, planen jedoch die Generale die Schlachten.« Desith machte sich von Vynsu los. »Der Kaiser gibt nur sein Einverständnis und schiebt die Schuld auf seine Berater, wenn der Plan schieflief. Ich traue Melecay zu, dir den Kopf abzuschlagen, wenn ich Mist baue!«
Vynsu schmunzelte über ihn. »Wir sind hier nicht im Westen, hier obliegt die Verantwortung dem König – oder eben den Königen, also ist es auch Melecays Verantwortung. Desith!« Ein heiteres Lachen drang aus Vynsus Kehle, als er Desiths Blick suchte. »Ich bin sein einziger Erbe, Derrick ist fort, es gibt nur noch uns. Und erzähl mir nichts! Als ob du ernstlich einen Ratschlag von einem anderen annehmen würdest, selbst Melecays Befehle bringen dich zur Weißglut! Du allein wirst diesen Angriff planen, denn du allein hast die Macht dazu. An nichts anderes will ich glauben. Jeder dieser Männer hier vertraut dir, weil du ihnen bewiesen hast, dass du würdig bist. Ob du willst oder nicht, du bist ein Anführer!«
Desith spürte, wie das Lächeln in seinen Mundwinkeln zuckte. Vielleicht hatte er das Gespräch gesucht, weil er genau das hatte hören wollen. Er gab nur selten Unsicherheiten zu, aber wenn er sie eingestand, dann nur vor Vynsu. Er war der einzige, den Desith in seinen Kopf und sein Herz sehen ließ, wenn ihn Zweifel quälten.
Schweigend sahen sie sich an, in diesem Moment brauchte es keine Worte. Vynsu lächelte wissend, Desith kämpfte mit einem Schmunzeln.
Oh ja, wenn jemand Nohva einnehmen konnte, dann waren sie es. Denn sie wollten es, sie brauchten ihre Rache, vor allem Desith. Und genau aus diesem Grund würde er keinen Fehler begehen. Er würde sich mehr als einen Notfallplan überlegen, damit auf Feindesboden nichts schiefgehen konnte. Melecay hin oder her, er machte es einfach auf seine Weise.
Sie hielten sich noch mit Blicken fest, sprachen eine ganz eigene, stumme Sprache, als ein schriller Schrei sie aus ihrer abgeschirmten Welt zurück in die Gegenwart riss.
Verwundert drehten sie die Köpfe, das Schreien brach nicht ab, es wurde nur kurz von japsenden Atemzügen unterbrochen.
»Was ist da los?«, fragte Vynsu.
Desith bevorzugte es, nachzusehen, bevor er unnötige Fragen stellte. Wortlos lief er die Straße zurück und drängte sich an den Gaffern vorbei, die aus ihren Behausungen drängten und zum Langhaus hinaufstarrten. Vynsu duckte sich unter dem Seil hindurch und folgte ihm auf dem Fuße.
Die Straße rauf blickten Krieger und Knechten verwirrt um sich, das Schreien drang aus der Halle der Könige nach draußen, niemand schien nachsehen zu wollen, was der jungen Frau zugestoßen war, die den Lärm verursachte. Die helle Stimme klang nach großer körperlicher Qual, als hätte sie eine Verabredung mit dem Folterer.
Stirnrunzelnd marschierten Desith und Vynsu zu ihrer Halle, als auch schon der rechte Flügel der Tür aufgestoßen wurde und eine junge Frau in braunen Wollkleidern hervor stolperte. Sie trug ein weißes Häubchen auf ihrem brünetten Schopf, ihr Gesicht war kalkweiß, die Augen waren weit aufgerissen. Sie hielt ihr einfaches Bauernkleid an der Kehle zusammen, doch die Schnürung stand offen und blasse Haut blitzte weich und samten hervor, besudelt mit Blut.
Irritiert sah Desith ihr nach, als sie an ihm vorbeischlitterte und panisch das Weite suchte. Ihre freie Hand hatte auf ihrem linken Busen gelegen, wo sich ein blutiger Fleck ausgebreitet hatte. Sie hinterließ rote Tropfen auf dem Eis.
Die Umstehenden blickten ihr entsetzt nach, dann sahen sie sich nach dem Langhaus und Desith um, die Bauern und Krieger fingen an zu flüstern.
Grimmig drehte Desith sich wieder zu den Türen der Halle um und stieg die Stufen hinauf, gefolgt von einem besorgten und sprachlosen Vynsu. Ihre Untergebenen wichen tuschelnd aus.
Prompt flog ihnen aus dem warmen Inneren des Gebäudes ein katzengroßes, pelziges Wesen mit schimmernden Flügeln und Reißzähnen entgegen. Die funkelnden Augen blickten Desith kritisch an.
»Du solltest doch aufpassen!«, schalt Desith den Feenkönig nur und ging an ihm vorbei.
Der Fee schwirrte surrend hinterher und verschränkte empört die Arme. »Das habe ich. Jawohl, das habe ich. Obwohl ich es nicht müsste, Eure Durchlaucht. Darf ich erinnern, dass ich selbst ein König bin, keine Amme. Zum Glück, möchte ich meinen. Das Biest hatte eben Hunger, was hätte ich tun sollen? Dafür ist die Amme doch da, nicht wahr? Jawohl, genau dafür, mein feiner Herr König. Deshalb-«
Desith brummte nur, Vishalyrr konnte reden, ohne Luft zu holen, vor allem wenn er pikiert war und sich rechtfertigte. Manchmal war er Desith zu anstrengend und er versuchte, das Geschwafel konsequent zu ignorieren.
Der König der Feen plapperte empört weiter: »…kann ich ja wohl nicht hungern lassen, wenn es plärrt! Dann müssen die Herrn Könige eben selbst aufpassen, jawohl…«
»Wir danken für deine Hilfe«, schlichtete Vynsu eine Spur zu freundlich für Desiths Geschmack.
In der Halle glühten die Essen vor sich hin, Frauen und Männer saßen um die Glut herum bei Speis und Trank, um sich aufzuwärmen. Einige webten, andere spielten Laute, es war stets gesellig unter Vynsus Dach. Oben zwischen den Thronen lag Eisbär Snjór mit Junghund Juna und schnarchte. Dahinter wehte noch der dicke Vorhang, der zu ihren privaten Räumlichkeiten führte.
Desith eilte schnurstracks dorthin, gefolgt von den stummen Blicken der Anwesenden, doch niemand würde ihm folgen, dafür war der Argwohn zu groß.
Und da saß er im Zimmer, das hinter einem von Vynsus Mutter gewebten Teppichen lag, und blickte mit großen Augen verständnislos zu Desith auf.
»Hunger!«, blubberte er mit einem rot verschmierten Mund. Er streckte Desith die blutverschmierten, winzigen Hände entgegen, als wäre er stolz darauf, lachte und leckte sich über die messerscharfen Fänge. Andere Zähne besaß er noch nicht.
Hinter ihm surrte Vishalyrr mit den Flügeln, Vynsu bückte sich durch den Vorhang und schluckte, als er das Schlamassel sah.
»Das war nun schon die dritte Amme, die er gebissen hat«, stellte Desith fest, »bald gibt es keine Frau mehr, die noch Milch gibt.«
Vynsu zog schwer und zweifelnd den Atem ein. »Ich befürchte, Milch ist nicht das, was er will.«
Sie sahen sich an, beide unglücklich darüber.
»Schlachtet doch einfach eine Ziege«, schlug Vishalyrr gelassen vor. »Wenn es Blut will, soll es Blut haben.«
Er sagte immer Es zu Riaths Bastard, als ob er ihn nicht als intelligentes, heranwachsendes Wesen anerkennen wollte, sondern mehr ein Monster in ihm sah. Da war er jedoch nicht der Einzige, die Feen im Dorf wurden weniger schief angesehen und mit Vorsicht behandelt als Desiths Neffe.
Der Kleine bemerkte die angespannte Stimmung und blickte mit zitternder Lippe zu Desith auf, die Augen füllten sich mit dicken Kullertränen. »Böse?«, stammelte er.
Desith schüttelte den Kopf, jedoch nur aus Bedauern. Seufzend beugte er sich hinab und hob den Kleinen auf den Arm. Mit dem behandschuhten Daumen säuberte er ihm das Mäulchen. »Oh Eyvind, Eyvind, Eyvind. Was machen wir nur mit dir?«
Kaum jemand wusste, wessen Sohn dieses kleine Monster überhaupt war. Desith war nicht so dumm gewesen, herumzuerzählen, dass er Riaths und Lohnas Bastard aufgenommen hatte. Nein, denn Riaths Spione waren überall, die Gefahr, dass er erfuhr, dass er zwei Söhne hatte und einer davon bei Desith lebte, war einfach zu groß. Vynsu und er hatten behauptet, das Kind aus Nächstenliebe aufgenommen zu haben, weil er ein Waise war, ein Fremdländer einer unbekannten Reisenden, die zusammen mit Lohna im Geburtenhaus gewesen und bei der Niederkunft gestorben war.
Es war auch zur eigenen Sicherheit des Kindes besser, wenn niemand seine wahre Abstammung kannte.
»Du willst also Blut, ja?« Desith trug ihn zurück zu seiner Wiege, die Bissspuren eines Raubtieres aufwies.
Eyvinds grünes und blaues Auge leuchteten plötzlich auf, als hätte er ihn verstanden. »Blut! Blut!«
»Heute hattest du genug.« Desith setzte ihn auf die Felle und drückte ihn sanft auf die Seite. »Jetzt wird geschlafen.«
Der Kleine brummte unwillig, doch als Desith ihm zweimal über den blonden Schopf streichelte, grummelte er zufrieden und schob den Daumen in den Mund. Langsam schlossen sich seine Augen.
Nachdenklich blickte Desith noch auf ihn herab und fuhr mit den Knöcheln über die rosige Wange. »Schlaf, kleines Monster, schon jetzt bist du der gefürchtetste Mann der Welt«, flüsterte er ihm zu.
Was sollte nur aus diesem Wesen werden? Es wirkte so fehl am Platz, es war so gefürchtet, dass Desith keine rosige Zukunft für es voraussah. Eyvind würde viel allein sein, abgesehen von seinen Geschwistern. Man würde ihn ausschließen, weil er gänzlich anders war. Er musste stark genug werden, es zu verkraften.
Vynsu trat hinter Desith, seine Präsenz war wohltuend und besänftigend.
»Er ist schon wieder gewachsen.« Desith richtete sich auf und atmete tief durch. »Liegt es an mir oder altert er schneller als es sein sollte?«
Vynsu kratzte sich am Ohr. »Nun ja, in die Kinder Carapuhrs wachsen schneller als die im Westen.«
»Ja, schon.« Desith sah ihn über die Schulter ernst an. »Aber Eyvind ist das Kind von Riath und Lohna, Vyn. Wenn ich dich daran erinnern darf, war keiner der beiden ein Barbar. Riath ist Luzianer, meine Schwester war ein Mensch und nur zu einem geringen Teil Luzianer. Eyvind ist nicht wie du oder Aegir. Warum zum Teufel wächst er so schnell?«
Doch wie so oft machte sein Gemahl sich darüber kaum Gedanken, er zuckte gelassen mit den Achseln. »Vielleicht hat er sich angepasst.«
»Er ist kein Chamäleon!«
Vynsu legte den Kopf schräg. »Was ist ein Chamäleon?«
Manchmal vergaß er, dass sie aus verschiedenen Welten stammten. Ungeduldig winkte er ab und drehte sich gänzlich zu Vynsu um. »Etwas stimmt nicht, will ich damit sagen, ich spüre förmlich etwas… Ich kann es nur nicht… begreifen. Es prickelt und kribbelt in seiner Nähe…« Er sah wieder über die schmale Schulter hinab in die Wiege. »Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, es ist Magie, die ihn wachsen lässt. Doch sie geht nicht von ihm aus.«
»Hm«, brummte sein Gemahl und blickte nun auch nachdenklich drein. Er hatte gelernt, Desiths Bauchgefühl zu vertrauen.
»Vyn!« Jori schlug den Vorhang zurück und steckte den Kopf herein, seine dunklen und langen Haare hatten sich durch die Feuchtigkeit gekräuselt. »Desith. Ihr solltet das sehen«, sagte er kryptisch und verschwand wieder.
Vynsu drehte sich stumm zu Desith um.
Dieser hob eine geschwungene, rote Augenbraue. »Wie viel kann an einem Morgen schiefgehen, der so vielversprechend begonnen hat?«
»Nenn mich abergläubig, aber vielleicht sollten wir uns die Leidenschaft für das Ende des Tages aufheben, um den Allvater nicht zu verärgern.«
»Als ob dein alter, vertrockneter Gott keine Freude dabeihätte, uns zuzusehen.« Desith ging an ihm vorbei, um Jori zu folgen. Der König der Feen blieb zurück, um auf Eyvind aufzupassen. »Ich sage dir, deshalb hat er den Schneesturm von uns genommen, er war beeindruckt von unserer Leistung.«
Hinter ihm lachte Vynsu zufrieden in sich hinein. »Selten schmeichelst du mir so wie gerade.«
Jori stand wartend unterhalb der beiden mit Fell belegten Throne und drehte sich mit ernster Miene – er besaß keine andere – zu ihnen herum.
»Was gibt´s, Bruder?«, fragte Vynsu gut gelaunt seinen alten Freund.
Jori nickte zur Tür. »Die Patrouille fand ihn in einer Hütte, halb erfroren und am Ende aller Kräfte.«
»Wen?«, fragte Desith.
»Einen Jungen, sagten sie«, erklärte Jori. »Er verlangte wohl, dich zu sehen.«
Desith blieb ungerührt, doch Vynsus Augenbrauen schossen in Richtung Haaransatz. »Desith? Wieso will er Desith sehen?« Er klang wie ein knurrender Wolf.
»Weiß ich nicht.« Jori hob die Schultern in absoluter Gleichgültigkeit. »Er verlangte wütend, zu Desith gelassen zu werden, sonst würden Köpfe rollen.« Er verzog missmutig das Gesicht. »Ihr wisst ja, wie das bei den Männern ankommt.«
Desith ahnte es. Er nickte Jori zu und ihr alter Gefährte ging voraus, dabei klimperte und knirschte sein Lederharnisch, auf dem ein Eisbär unter silbernen Sternen prangte.
Jori führte sie aus der Halle und brachte sie in Richtung eines der drei größeren Wirtshäuser, das sich in der Nähe der Händlerstraße am Rande des Dorfes befand. Der Schornstein qualmte ordentlich und Pferde standen vor dem Gebäude angebunden auf dem Eis.
Sie hörten den Tumult schon, bevor sie überhaupt um die Ecke gebogen waren. Eine Schar Barbaren hatte sich grölend vor Schadenfreude um etwas versammelt, das auf dem Boden zu liegen schien und lauthals schrie: »Fickt euch, ihr widerlichen Bastarde! Fasst mich ja nicht an!« Ein Barbar zuckte lachend zurück.
»Bissig, der Kleine«, amüsierte er sich.
Seine Brüder lachten.
»Dem stopfen wir schon das Maul.«
»Wohl kaum«, sagte Desith trocken.
Die Schar drehte sich mit offenen Mündern zu ihm und Vynsu um. Das Gelächter verstummte sofort.
»Eure Hoheit«, sagte der Sprecher der Gruppe kleinlaut. »Wir haben den da im Wald gefunden, er behauptete doch tatsächlich, er wäre Euer Bruder-«
»Er ist mein Bruder.«
Der Barbar verstummte, seine Augen weiteren sich. Sofort trat er beiseite, sichtlich irritiert, genauso wie seine bärtigen Kameraden.
Desith starrte auf die Gestalt herab, die in der Mitte der Schar auf dem Eis kniete und den blassen Handrücken unter die blutende Nase presste. Sein Hemd war zerrissen und er sah aus wie ein Bettler, vermutlich hatte man ihn überfallen, aber er wirkte bis auf seine Nase unverletzt, wenn auch ein wenig durchgefroren.
»Lexi.« Desith konnte nicht behauptet, erfreut über den unerwarteten Besuch zu sein.
»Desith«, gab sein Bruder mit zorniger, unnahbarer Miene zurück und sah aus, als wollte er ihn am liebsten bespuckten.
Desith trat noch weiter auf ihn zu und spürte eine kalte Vorahnung seinen Nacken hinaufkriechen. »Was ist passiert?«
Teil 1: Sturmesruh
Dort droben in der Fern
am weit entfernten Horizont
zieht sich bereits der Himmel zu
bedrohend und warnend zugleich
Dunkle Wolkengebilde lauern
der Wind kreischt noch nur aus weiter Fern
ich flehe nach euch Brüder
doch hört mich keiner rufen
Ihr seht den Sturm zwischen uns
was dahinterliegt bleibt blind für euch
ihr geht eures Weges stur
eurem eigenen Schmerz folgend
Noch seht ihr nur die Wolken
still und warm scheints um euch
doch innen ist euch kalt
Ruhe um euch und Sturm im Herz
Furcht und Leid tragt ihr in euch
und weint allein tief im Innern
bis der Sturm zu euch kommt
und ausspricht was ihr fühlt
Kapitel 1
Die dunklen Wellen brachen sich an den scharfen Klippen unterhalb der gewaltigen Festung, die genau an der Kante des Gebirges lag und vom Weiten aussah, als drohte sie jeden Augenblick wegzubrechen und im dunklen Gewässer des Tobenden Meeres für immer zu verschwinden.
Die Gischt spritzte bis zu den schwarzen Eisengeländern der Treppen, die sich wie eine Serpentine an der Klippenwand entlang schlängelten und von der Burg hinab in eine unruhige, verborgene Bucht führten, wo stets drei winzige Boote vertäut waren, falls die königliche Familie fliehen musste.
Auf dieser Seite der Anlage hatte die Öffentlichkeit keinen Zutritt, die Gärten und die Rückwand waren für das einfache Volk der Unteren Stadt nicht zugänglich, auch keine Bediensteten kamen hierher, es war ein einsames Fleckchen, denn an den Klippen wehte stets ein rauer Wind und die Luft schmeckte nach dem Salz der See. Bis auf ein paar wenige Blumen gab es keine Pflanzen und somit auch kein Grün. Die Aussicht erstreckte sich über eine unruhige See, und die Treppen waren direkt ins karge Gestein gehauen, mehr als schwarze Wellen und grauer Felsen gab es hier nicht zu sehen. Und doch war es der Ort, an dem er ihn immer und immer wieder gefunden hatte, wenn ihm selbst der verschlungene und blühende Obstgarten mit seinen wilden Kaninchen zu überlaufen gewesen war.
Der Wind riss an schwarzem Haar und einem schwarzen Umhang, als Wexmell die Stufen hinabstieg und sich neben ihn stellte, den Blick über das Meer zum nördlichen Horizont gerichtet. Sie sahen beide dorthin, die Gesichter kritisch und angespannt.
»Der Nebel verdichtet sich«, sagte Wexmell in den kreischenden Wind hinein und besah die weißen und dichten Schwaden, die über der See hingen und wie Geister langsam dem Land entgegenkrochen. »Ein Sturm zieht auf.«
»Wir haben schon viele Stürme überdauert«, erwiderte der Mann neben ihm mit verschränkten Armen und entschlossener Miene, »wir überdauern auch diesen, Wex.«
»Ich werde unsere Heimat – unsere Krone! – niemals aufgeben«, sagte Wexmell mit Grimm und Stärke in der Stimme. »Ich werde ihnen nichts je einfach so überlassen. Sie werden mir unsere Krone aus den kalten und toten Händen reißen müssen, wenn sie sie haben wollen.« Er spürte Derius´ Blick auf seinem Profil und wandte ihm das Gesicht zu, er musste zu ihm aufsehen. Erregt atmete aus. »Wir haben so lange hierfür gekämpft und so viel dafür geopfert und verloren, ich werde ihnen unsere Krone und unsere Freiheit nicht verkaufen, ganz gleich wie viel Druck sie auf mich ausüben.«
Ein milder Ausdruck machte Derius´ sonst so granitharten Züge weich, er wirkte auf einmal so jung wie damals, als sie sich das erste Mal begegnet waren. »Nein, wir werden ihnen nichts schenken, Wex. Was sie auch für einen Sturm auf uns loslassen, Nohva wird standhalten. Das haben wir doch immer. Vor allem mit dir als König.«
»Ich habe keine Furcht vor ihnen.« Wexmell musste den Blick abwenden, sein Herz zog sich schmerzlich zusammen. Tastend wanderten seine eisblauen Augen über die schwarzen Wellen und ihre weißen Schaumkronen. »Obgleich ich eingestehe, angespannt zu sein und mich darüber zu sorgen, ob das Gerede über mich vielleicht wahr ist. Möglicherweise bin ich zu naiv und darüber hinaus zu eigensinnig, mich weiterzuentwickeln.«
»Ich würde gar nicht wollen, dass du dich veränderst, dann wärest du nicht mehr du«, flüsterte Derius liebevoll. Er hob eine Hand und legte sie zärtlich in Wexmells Nacken, wo sich goldene Locken um seine Fingerspitzen schlängelten. »Warum solltest du dich weiterentwickeln, wenn du so, wie du immer warst, das Beste für alle bietest? Wex, ich wählte dich zum König, weil ich niemanden sonst mehr vertraue als dir. Als der, der du immer warst, nicht der, den andere gerne sehen würden.«
Wexmell sank in sich zusammen und seufzte dankbar. Mit geschlossenen Augen drehte er das Gesicht, sodass Derius` große Hand an seine Wange rutschte und er sich sehnsüchtig hineinschmiegen konnte. Er konnte sogar den Hauch von Wärme und Stärke fühlen, die seinen Geliebten immer umgeben hatten. »Du fehlst mir so«, raunte er schmerzlich.
Derius wandte sich ihm gänzlich zu und zog ihn sanft in seine Arme, eine Hand auf Wexmells Hinterkopf und eine auf seinem Rücken, hielt ihn fest und gab ihm den Halt, den er brauchte.
Tief inhalierte Wexmell den vertrauten Duft nach Mann, Leder und herber Würzigkeit, schmiegte die Wange an den schwarzen Brustharnisch und verlor sich in seinen Armen.
»Ich bin da.« Derius` Atem strich heiß über Wexmells Haar, dann spürte er die Lippen seines Geliebten an der Schläfe und kämpfte mit Tränen der Trauer und der Erleichterung. »Ich werde dich nie verlassen, Wex. Vor allem nicht in dunklen Stunden.«
»Ich weiß«, gab er mit erstickter Stimme zurück und legte die Hände auf Derius` Rücken, um sich festzukrallen. »Ich wünschte nur so sehr, du wärest es wirklich.«
Er spürte Derius` Lächeln an der Schläfe, liebevoll strich er ihm über den Hinterkopf. »Wer sagt, dass ich es nicht wirklich bin, Geliebter?«
Wexmell schmunzelte und hielt ihn noch fester, Geborgenheit umhüllte ihn wie ein warmer Sonnenschein, doch er wusste leider zu gut, dass der Abschied nahte.
Ein Rabe krächzte, und als er deshalb die Augen öffnete, sah er sein auf die Seite gekipptes Schlafgemach, statt der unruhigen See.
Blinzelnd ließ er den Traum los. Am Anfang war es ihm noch schwergefallen, Derius` zurückzulassen, und er hatte krampfhaft versucht, erneut einzuschlafen, da er nicht mit Sicherheit wusste, wann er ihn wieder im Traum sehen würde. Doch mittlerweile wusste er, dass das wahre Leben wartete, und er hatte genug Pflichten, die ihn aus den Laken trieben.
Es waren Jahre vergangen und die leere Seite des Bettes machte ihn noch immer so traurig wie am ersten Tag, doch er hatte mit dem Schmerz zu leben gelernt. Derius fehlte ihm so sehr wie sein eigenes Herz in der Brust, mit ihm war vieles auch in Wexmell gestorben, aber die Erinnerung an ihn schenkte ihm nach all der Zeit Mut und Kraft, statt bittere Verzweiflung.
Er konnte es sich nicht leisten, im Bett zu liegen und zu trauern, das hatte Melecay ihm klar gemacht.
Einmal, dachte Wexmell grimmig, nur ein einziges Mal hatte er den Fehler begangen, in Trauer versunken zu wehklagen und auf Melecays Anwesenheit zu vertrauen. Ein fataler und schwacher Fehler, wie sich später herausstellte. Natürlich hatte Melecay nur sein Spiel gespielt und Wexmells dumme Schwäche ausgenutzt.
Trotzdem blieb Wexmell nach jedem Traum von Derius, noch einen Augenblick länger in den Kissen liegen und drehte sich zur leeren Seite um, streckte den Arm aus und legte ihn auf die flache Decke, wie früher auf Derius` Brust. Mit den Fingerspitzen fuhr er die goldenen Stickereien nach, streichelte die filigranen Blätter der Lilien, die alles zierten und ihn daran erinnerten, dass er quasi der letzte Überlebende so vieler legendärer Männer war.
Ausgerechnet er, der von allen – seiner Ansicht nach – am wenigsten geleistet und geopfert hatte. Derius, Cohen, Zasch, Niegal, Luro und Allahad… sie fehlten ihm so, sie hätten es seiner Meinung nach so viel mehr verdient, jetzt hier zu sein und zu atmen. Er hoffte nur, sie warteten an einem leuchtenden Lagerfeuer auf ihn, mit einem Schluck Wein aus einem alten Reisetrinkbeutel. Denn er hätte alles Gold und Samt und Seide eingetauscht, um wieder mit ihnen durch die Welt zu streifen, nur damit er sie noch einmal lebend sehen konnte.
Wieder ertönte das Ächzen eines Raben und erinnerte Wexmell daran, warum er aufgewacht war. Er runzelte die Stirn, denn aus einem ihm unerfindlichen Grund, trieb das laute Krächzen seinen Herzschlag höher. Und als es erneut erklang, wie ein panischer Ruf in der Ferne, fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und er warf sich im Bett herum, um zum Fenster zu blicken.
Er kannte diesen Ruf!
Nach all den Jahren hätte er nicht vermutet, dass er aus all den ähnlichen Krächzen ein bestimmtes wiedererkennen würde, er hatte ja nicht einmal gewusst, dass es sich von anderen unterschied. Doch als der Ruf ihn an diesem Morgen weckte, wusste er es einfach. Woher und warum er es wusste, konnte er nicht erklären. Er spürte es mit einer Klarheit, die ihn sofort jede Müdigkeit und Melancholie aus dem Leibe trieb.
Vor den Fenstern flog ein heller Schatten vorbei. Wexmell verfolgte ihn mit den Augen, während er die schwere Decke aus vielen Lagen Samt zurückschlug und die Füße auf den Boden stellte. Sein Nachtgewand bestand aus einem schwarzen Hemd, das ihm bis zu den Schenkeln reichte. Das Feuer war verglüht, es war kühl im Schlafgemach, doch das kümmerte ihn nicht, während er auf nackten Sohlen über gewebte Teppiche und nacktes Gestein eilte und den Schatten verfolgte, der auf der Klippenseite der Festung an einem der Fenster, draußen auf der steinernen Bank, mit lautem Flügelschlag landete und mit seinem gewaltigen Schnabel gegen die rotgefärbte Scheibe klopfte.
Wexmell schlug das Herz vor Erleichterung und Freude bis zum Hals, er riss das Fenster auf und wollte bei dem Anblick des weißen Raben in Tränen ausbrechen.
Es war Winter und vom Meer her wehte ein eiskalter Wind in Wexmells Gesicht, der Frost würde nicht mehr lange auf sich warten lassen.
»Xaith«, flüsterte Wexmell. Natürlich nicht zu dem Vogel, der ihn aus Augen ansah, die alles zu wissen schienen. Nein, er flüsterte es, weil er so erleichtert war, endlich ein Lebenszeichen seines Sohnes zu erhalten, der seit so vielen Jahren verschwunden, geächtet und verfolgt worden war, aufgrund völlig falscher Gerüchte.
Am Bein des Raben hing eine eingerollte Nachricht, die der Vogel Wexmell auffordernd entgegenstreckte. »Dringend! Dringend!«, ächzte er. »Meister sagt wichtig, wichtig. Ernst nehmen! Ernst nehmen.«
Wexmell nahm den Raben von der Fensterbank und drückte ihn an seine Brust. Der Vogel protestierte erst, hielt dann aber still, als Wexmell die Nachricht an sich nahm und umständlich mit einer Hand entrollte. Zwischen zwei Fingern hielt er den kleinen Zettel und las die geschwungene Handschrift. Wexmell musste grinsen, denn erstaunlicherweise war sie seiner ähnlicher als Derius`. Nein, er hatte diese Kinder nicht gezeugt, sie trugen nicht sein Blut in sich, und doch entdeckte er unter all ihren Eigenarten nicht nur einen Hauch von ihrem leiblichen Vater, auch er hatte seine Spuren in ihnen hinterlassen. Und es erfüllte ihn mit einer übermütigen Liebe, zu wissen, dass sie auch etwas von ihm in sich trugen, denn so bewies er trotz aller Gegenargumente, dass sie auch seine Söhne und seine Erben waren.
Auf dem Papier befanden sich jedoch enge und winzige Zeilen, die beinahe ein Vergrößerungsglas benötigten, damit er sie entziffern konnte. Lesend wandte er dem offenen Fenster den Rücken zu, noch immer mit dem weißen Raben unter dem Arm, und ihm zog der kalte Wind in den Nacken. Doch was ihn letztlich frösteln ließ, war die Botschaft in seiner Hand.
Wexmell, Vater,
frag nicht, woher ich es weiß, aber vertrau mir, wenn ich dir mitteile, dass etwas Dunkles auf uns zukommt. Ich sah den Schleier, er ist verseucht, Fäule und Tot haben diesen Ort übernommen und machen ihn schwach. Ich weiß nicht, wie sich das auf unsere Welt auswirkt, aber ich sehe eine Katastrophe voraus, nenn es Bauchgefühl. Du musst die Hexen darauf aufmerksam machen, haltet die Augen offen, haltet euch bereit für… was auch immer. Ich sah auch einen Sturm, gewaltig und magisch, voll dunkler Magie. Es scheint, als ob die Zeit unserer Welten abgelaufen ist. Du musst die Magier vereint halten, du brauchst ihre Kräfte, falls der Schleier stirbt oder gar zerbricht, denn dann steht nichts mehr zwischen dir und der Fäule, die dort gefangen ist.
In Liebe,
Xa Dein Sohn.
Ein lautes Klopfen an der Tür riss ihn aus seiner Schockstarre, sein Verstand hatte schon immer eine schnelle Auffassungsgabe besessen, doch Xaiths Zeilen musste er mehrfach lesen, und konnte dann immer noch nicht richtig begreifen, was er ihm damit sagen wollte. Als es dann klopfte, zuckte er so heftig zusammen, als wäre ein göttlicher Richthammer auf ihre Welt gefallen.
Er schluckte und schüttelte daraufhin den Kopf, um sich zu sammeln. »Ja, bitte?«
Anhand der Art des Klopfens – Härte und Dringlichkeit – konnte er bereits vorausahnen, wer es war. Und schon drang die raue Stimme seines schweigsamen, aber loyalen Leibwächters durch die Tür. »Eure Hoheit, General Hierraf mit einer Botschaft.«
Wexmell setzte den weißen Raben auf eine Stuhllehne, wo der Vogel sich schüttelte, und umhüllte die Botschaft mit der anderen Faust, während er nach seinem schweren, weinroten Morgenmantel griff. »Er kann eintreten.«
Knarrend öffnete sich die Tür, mit grimmiger Miene ließ Haahreel – sein Leibwächter, der ursprünglich aus der Wüste stammte und einen entsprechenden Teint besaß – den General vor.
Wexmell schloss gerade den Mantel und stopfte die Botschaft in die Taschen. »Hierraf, wie gut, dass Ihr hier seid! Lasst die Hexen rufen, wir müssen beunruhigende Neuigkei– Was ist passiert?« Mitten im Satz brach er ab und spürte eine eiskalte Faust nach seinem Herzen greifen.
Der General blickte ihm nicht in die Augen, er trat ein und hielt eine Botschaft in der rechten Hand, die ein gebrochenes, goldgelbes Siegel mit einer Taube darauf zeigte. Eine Nachricht ihrer Spione.
Wexmell sank das Herz. »Riath…?«, fragte er dünn. Seit Riath die sichere Festung verlassen hatte, wartete Wexmell auf den Tag, wenn er Meldung über seinen Tod erhielt.
Doch der General schüttelte den blonden Kopf. Endlich hob er den Blick, seine Lippen waren nur ein dünner Strich, doch seine zusammengezogenen Augenbrauen wirkten entschuldigend, nicht wütend. »Mein König…«, er schluckte und hob die Botschaft vor seinen schwarzen Brustharnisch mit dem Wappen des Königs darauf – einem Drachen, der sich um eine Lilie schlängelte – als müsste er die Nachricht ablesen.
Wexmell trat näher. »Sag es, ich komme damit zurecht«, forderte er und wappnete sich innerlich gegen alles.
»Es tut mir so leid«, begann der General vorsichtig, »wir haben Meldung aus Elkanasai.«
Ihm blieb der Atem weg, doch das ließ er sich nicht anmerken, ernst wartete er ab.
»Es heißt, Euer Sohn… Eagle«, voller bedauernd seufzte Hierraf, »es heißt, Prinz Riath habe ihn erdolcht. Er ist tot, mein König! Und Großkönig Melecay … übernahm die führungslose Stadt.«
*~*~*
»Das ist unerhört!«, donnerte die erstaunlich kräftige Stimme des alten Mannes durch den Thronsaal.
»Dem stimme ich vollkommen zu, Ratsherr.« Der Großkönig stieg die Stufen zum Sitz des Kaisers hinauf und warf sich hinein. Er war ein Bulle von einem Mann, der zu groß für das zarte Möbelstück auf der Empore war. »Die Dinge, wie sie gerade liegen, sind unerhörter Naivität geschuldet.«
Der Ratsherr ließ sich davon nicht beeindrucken, er machte einige Schritte auf den Großkönig zu, der nur mit einem müden Lächeln den Kopf schieflegte und gemütlich die Beine übereinanderschlug.
»Ihr habt kein Recht, uns wie Vieh oder Sklaven von Euren verdammten Barbaren hierher eskortieren zu lassen, als müssten wir Euch Rede und Antwort stehen! Ebenso besitzt Ihr nicht die Befugnis, über die Stadt zu bestimmen, als gehörte sie Euch. Und schon gar nicht dürft Ihr im Thron des Kaisers Platz nehmen! Ich erwarte, dass Ihr umgehend aufsteht und Euch für Eure Arroganz entschuldigt! Dies ist Elkanasai, Ihr seid nur Gast in diesem Land!«
Gut gesprochen, dachte Ashen und blickte mit stolzer Miene zum Thron hinauf. Er stand hinter dem Rat der Fünf, die vor dem Thron aufgereiht und von den ranghöchsten Generälen und Hauptmännern der Stadt umgeben waren. Barbaren-Krieger waren überall im Raum positioniert, in der Stadt sah es seit Tagen – Wochen! – nicht anders aus. Der Kaiser war noch nicht kalt gewesen, als die Carapuhrianer aus jeder Ecke des Urwaldes in die Stadt gestürmt und alles unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Der Rat war so geschockt über die Gerüchte, wer den Kaiser ermordet hatte, dass er die Bevölkerung um Ruhe und Fügsamkeit gebeten hatte, damit sie Leben schützten, während sie den Mord an Kaiser Eagle untersuchten.
Melecay belächelte die fünf Ratsherren – darunter Ashens Onkel – und besah sie nacheinander von oben herab. Er legte die großen Hände auf die Stuhllehnen, sein geflochtener Barbarenzopf hing wie eine Schlange über seiner Schulter, während seine rasierten Schädelseiten mit roter Farbe – oder war es gar Blut? – bemalt waren. Er sah durch und durch barbarisch aus.
»Der Kaiser ist tot«, betonte der Großkönig, als hätten sie es alle vergessen. »Ermordet von einem jungen Hexenmeister, dem Ihr naiven alten Säcke Vertrauen entgegengebracht habt. Der Junge, den ihr als des Kaisers Nachfolger benannt habt, ist mit dem Mörder eures Kaisers geflüchtet. So wie ich das also sehe, ist euer Land führungslos!«
Ashen konnte die Wut, die er auf diesen Mann besaß, nicht beschreiben. »Wexmell Airynn ist Kaiser von Elkanasai«, platzte es aus ihm heraus, er ballte an den Seiten seiner weißen Toga die Hände zu eisenharten Fäusten. »Er führt das Land.«