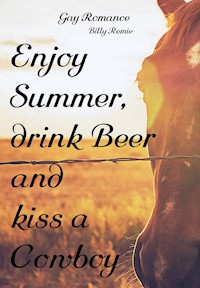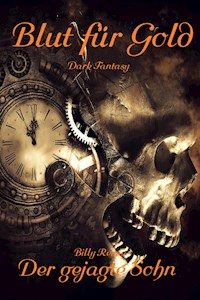4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zane & I
- Sprache: Deutsch
Es war ein Jahrzehnt her, wir waren erwachsen geworden, trotzdem erkannte ich ihn sofort. Die grünen Augen, das wie aus Marmor gemeißelte Gesicht, seine schiere Größe und das fast pechschwarze Haar. Mir war, als träumte ich. Mein Verstand konnte seine Anwesenheit nicht begreifen, es war zu surreal. Und doch war er wahrhaftig da, er stand direkt vor mir. Das wusste ich, als ich seinen unverkennbaren Duft wahrnahm, der mir die Knie weich werden ließ und mich gleichzeitig stärker als jede Droge beruhigen konnte. Sein Duft, den mein Verstand und mein Herz noch immer erkannten, nach einem verdammten Jahrzehnt. Doch konnte er mir verzeihen, dass ich ihn ohne eine Erklärung vor all diesen Jahren verlassen hatte? (Gay-Romance/ Contemporary Romance)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Billy Remie
how I found him again
Gay Romance
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
How I found him again
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Epilog
Nachwort
Impressum neobooks
How I found him again
Liebe Leseri:nnen,
dies ist die Liebesgeschichte von Doe und Zane, Band 2, und Vorkenntnisse aus Band 1 sind dringend notwendig, sonst macht das Buch keinerlei Sinn. Auch in Band 2 handelt es sich weiterhin um eine ausgedachte und rein fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit echten oder fiktiven Personen und Handlungen wären rein zufällig und unbeabsichtigt.
Auch wenn die Thematik nicht jeden anspricht, hoffe ich die Beiden bekommen ein paar Leser, die sich durch ihre Geschichte unterhalten fühlen und wünsche viel Spaß mit dem abschließendem Band.
Prolog
Fische beruhigen mich. Früher hatte ich die Faszination für Aquarien nicht nachvollziehen können. Wer hält sich schon Fische, dachte ich, voll langweilig. So wie vieles in meinem Leben, änderte sich auch diese Ansicht urplötzlich von einem auf den anderen Moment. Es geschah, als ich mit meiner Mutter in einem hierzulande bekannten Gartencenter einkaufen war. Sie ist im Alter zur leidenschaftlichen Gärtnerin mutiert und sie schleppte mich gern in die Öffentlichkeit, damit ich das Rausgehen »trainierte«. Immer, wenn mich beim Einkaufen eine Panikattacke ereilt, versuche ich, mein Gehirn abzulenken, indem ich mir die Produkte ansehe. Aber das hilft nicht immer und es dauert eine Weile, bis die Ablenkung fruchtet. Am liebsten laufe ich, weil mich die Angst dazu drängt. Angst löst unseren Fluchtreflex aus, dazu ist sie da, auch wenn man sich vor dem eigenen Körper fürchtet, vor dem man nicht weglaufen kann. Also trieb mich die Attacke durch den Laden, während meine Mutter sonst wo zurückblieb. Ihr war es immer peinlich, wenn ich auf- und ablief. Ich tat so, als suchte ich etwas, und irgendwann stand ich in der Zooabteilung vor einem Aquarium. Ich kann nicht sagen, was es genau war, aber die Fische fesselten und beruhigten mich, je länger ich ihnen zusah.
Es war fast hypnotisch.
Der Effekt ist am stärksten, wenn ich direkt vor einem Aquarium stehe und viele bunte Fische gemütlich an der Scheibe vorbei schwimmen, aber es hilft auch, mir Videos davon anzusehen. Dem Internet sei Dank, gibt es mittlerweile ja alles, unter anderem auch zahlreiche, mit sanften Klängen untermalte Videoaufnahmen von Aquarien. Nur mit diesen Videos und einer erheblichen Dosis Beruhigungsmittel schaffte ich den Flug. Georgia. Ich war noch nie dort gewesen, meine alte Heimat war West Virginia, meine »neue Heimat« seit knapp zehn Jahren war ein Kuhkaff, einige Stunden von Frankfurt entfernt.
In den Flieger zu steigen war nicht so schlimm, wie das ewige Warten am Flughafen. Ich hasse Warten, es ist wie Kerosin auf dem Feuer der Angstzustände. Es half, vor der Fensterfront auf- und abzulaufen und die Flugzeuge zu beobachten. Das Fliegen an sich machte mir keine Angst, nur in dem Kasten eingesperrt zu sein. Was, wenn ich einen Herzinfarkt erlitt?
Nicht, dass ich mittlerweile eine echte Herzerkrankung besaß, nur ein verkrüppeltes Zwerchfell.
Ich war nicht allein. Es gab nur einen einzigen Menschen in meinem Leben, mit dem ich mir diese Reise zutraute. Meine Schwester. Sie kannte sich mit Fliegen aus und anders als meine Mutter, wurde sie nicht schnell hysterisch. Außerdem hatte sie selbst schon Bekanntschaft mit Angstzuständen gemacht. Irgendwie lag es uns im Blut. Oder besser gesagt, in der Seele. Aber bei ihr tauchte es viel später auf als bei mir und sie konnte viel besser damit umgehen. Sie war zu stur, sich von ihrer Angst einschließen zu lassen.
Sollte ich also Panik davor bekommen, dass es mir nicht gut gehen könnte, sagte sie immer lapidar, dann könnte ich mich einfach hinlegen. Egal wann und egal wo. Unsere Mutter würde sich Sorgen machen, was die Leute denken könnten, aber sie nicht. Meiner Schwester war das egal. Mit ihr konnte ich darüber reden, sie verstand es mittlerweile.
Sie war der einzige Mensch, bei dem ich mich ein wenig wohlfühlte. Außerdem konnte ich ihr alle Dinge überlassen, die mit dem Fliegen zu tun hatten. Sie kannte sich mit einchecken und auschecken aus, oder wie man das nennt. Sie wusste, wohin wir gehen mussten, was uns erwartete.
Mein letzter Flug lag Jahre zurück, aber damals war der Flughafen deutlich voller gewesen. Durch Corona war weniger los und auch das machte es mir leichter. Ich weiß, dass mich jetzt alle verfluchen, aber seit der Maskenpflicht fällt es mir deutlich einfacher, nach draußen zu gehen. Leben ist so viel angenehmer. Ich kann meine hässliche Fratze endlich richtig verstecken, und ich hätte nie erwartet, wie viel Druck mir das nahm. Sich zu verschleiern ist schön, Menschen können einen dadurch nicht mehr allein über das Gesicht verurteilen.
Aber die Menschen sind noch aggressiver als sonst, genervter. Sie rempeln einen gerne an und dann motzen sie. So sind die Deutschen. Ich erinnere mich, wie mich diese ätzende Eigenschaft am Anfang irritierte. Je nachdem, wo man in den Staaten ist, pöbelt man auf der Straße lieber nicht jemanden an, Amerikaner sind nicht nur voller heißer Luft, sie drehen sich um und gehen auf Konfrontation. Deutsche sind anders, sie meckern den ganzen Tag passivaggressiv vor sich hin und am liebsten nörgeln sie über andere, aber sie prügeln sich nur, wenn sie auf dem Dorffest zu viel gesoffen haben. Oder sie in der Gruppe sind.
Ein Teil von mir freute sich, in die Staaten zu fliegen, doch der Anlass könnte schöner sein.
Als wir endlich im Flieger saßen und ich ein Aquarium-Video ansah und auf die Wirkung des Schlafmittels wartete, erinnerte ich mich an den Tag, als ich Joshs Mail erhalten hatte.
Ich wusste nicht, was mir mehr zusetzte. Dass Josh mir nach zehn Jahren schrieb, oder dass die erste Nachricht, die ich von ihm erhielt, die von Ramirez´ Tod war.
Warum hatte ich es nicht gewusst?
Ich hatte mit Ramirez E-Mail-Kontakt gehalten, aber er hatte davon wohl niemandem erzählt. Jedenfalls erfuhr ich nur durch Josh davon. Herzinfarkt, Urlaub in Mexico. Vermutlich bei einem Besuch einer Prostituierten. Es wäre ein Tod, der ihm ebenbürtig gewesen wäre.
Ich hatte Ramirez nur ein Jahr lang persönlich gekannt und ihn ein Jahrzehnt nicht mehr gesehen, trotzdem schockte mich sein Tod. Es war, als ob ich einen Onkel verlor, der mir mehr Vater gewesen war als mein eigener. Was verrückt war, niemand hatte mich je seelisch und körperlich so gedemütigt wie Ramirez, aber er war auch der einzige erwachsene Mann in meiner Jugend gewesen, der wenigstens hin und wieder meinem Hinterkopf einen stolzen Klaps gegeben hatte. Es macht etwas mit Jungen, wenn es ihnen gelingt, bei dem Mann etwas richtig zu machen, der einem sonst das Fürchten lehrt. Er hatte mich zum ersten Mal fühlen lassen, wie es sich anfühlte, wenn jemand stolz auf etwas war, das ich tat. Das war ein Gefühl, das ich damals nicht kannte. Wie so vieles andere auch.
Meine Gefühle für diesen Mann sind schwer zu erklären, aber eines ist sicher, ich wäre vermutlich für keinen anderen in einen Flieger gestiegen.
Auch nicht für… Zane. Wäre es seine Beerdigung, wäre ich allein deshalb nicht hingegangen, weil ich gewusst hätte, dass seine Schwester Zoey da sein würde. Außerdem wäre es zu schmerzhaft geworden und daran wollte ich nicht einmal denken.
Ich hatte Joshs Mail dreimal gelesen. Georgia. Ein Flugticket. Ich hatte noch Meilen, du solltest es nutzen, du bist vermutlich der Einzige, der keine Tanzschuhe anhaben wird. Um auf Ramirez` Grab zu tanzen, schon klar, haha. Noch ganz der Alte, unser Josh.
Nostalgie und Melancholie vermischt mit dem Schock über Ramirez´ Tod, dem Unglauben, dem Bedauern, hatten mich erstarren lassen. So saß ich eine Weile im Dunkeln und starrte auf den Bildschirm meines Laptops, ohne etwas zu sehen.
Es war tiefste Nacht und ich konnte mal wieder nicht schlafen, wie immer. Ich hatte kein Licht gemacht, den Laptop aufgeklappt und wollte an meinem Buch weiterschreiben, als ich die Mail entdeckte. Weder an Schreiben noch an Schlaf war danach zu denken.
…du solltest es nutzen…
Allein der Gedanke zog mir den Magen zusammen. Fliegen. Die Staaten. Eine lange Reise, soweit entfernt von meiner sicheren Höhle, ich ging normalerweise nie weit von meinem Haus weg.
Nein, dachte ich mir, das würde ich nicht durchstehen. Beerdigungen waren ohnehin die Hölle. Ich war auf zweien gewesen, von einem Onkel und von meinem Großvater, dem das Haus gehörte, in dem ich und meine Eltern nun wohnten. Ich hasste das, den Zwang, Abschied nehmen zu müssen, mit einem Haufen Menschen, die mich nervös machten.
…du bist vermutlich der Einzige, der keine Tanzschuhe anhaben wird…
Ein Geräusch riss mich aus meinen Gedanken. Ich hielt den Atem an und betete, es würde verebben.
Doch dann wurde es lauter, drängender, fordernder.
Seufzend stand ich auf und schlich eilig in den winzigen Raum neben dem Schlafzimmer der Einliegerwohnung. Das Nachlicht tauchte das Zimmerchen in ein Meer aus funkelnden Sternen, als ich die angelehnte Tür aufdrückte und sie hinter mir offenließ.
»Shhh.« Ich trat an das Bettchen, das ich zusammengeschraubt hatte, und schaute auf dieses winzige Wesen hinab, das seinen Po in die Höhe streckte. »Ist ja gut, alles ist gut.« Zärtlich streichelte ich ihm über die Wange. Sie war so samten, so zart, so warm, dass es mich immer wieder überwältigte und vor Ehrfurcht erstarren ließ.
Nein, dachte ich in diesem Moment wieder, ich konnte nicht einfach überstürzt in die Staaten fliegen. Das wäre nicht fair, ich hatte versprochen, zu helfen, wo ich konnte.
Der Kleine greinte immer mehr und meine leisen Bemühungen schienen ihn nur noch mehr aufzubringen. Ich griff ins Bett, etwas, das ich nicht oft tat. Aus Angst, ihm wehzutun, er war so klein und so kostbar, ich traute mich selten, ihn anzufassen. Und er spürte meine Angst und Unsicherheit, fast wie ein Tier. Er fing richtig an zu schreien, als ich ihn hochhob und zu beruhigen versuchte. Sanfte Laute von mir gebend, wippte ich im Stehen, wie ich es bei seiner Mom gesehen hatte, streichelte seinen kleinen Rücken. »Alles ist gut«, sagte ich. Glaubte mir ja selbst nicht.
Schon wurde es Licht im Wohnzimmer und eilige Schritte tapsten in mein ehemaliges Schreibzimmer mit Blick auf den Apfelbaum in Großvaters stolzem Garten.
»Was ist los?«, fragte Laura, das kastanienbraune Haar offen, sodass es in sanften Wellen auf ihre fast nackten Schultern fiel, nur in ihrem seidenen Nachthemd.
»Ich mach schon«, sagte ich und winkte sie weg. »Geh schlafen, er beruhigt sich gleich wieder.« Ich wollte, dass sie wenigstens einmal durchschlief.
Aber sie ließ sich nicht aufhalten, nahm mir den Kleinen aus dem Arm, bevor ich protestieren konnte. »Nicht so, du bist zu verkrampft, das überträgst du auf ihn!«, sagte sie. »Und ich hab gesagt, das Licht ist nicht gut für ihn, mach das andere an, die Sterne machen ihm Angst! Shhh, ist ja gut, shhh.«
»Ist alles in Ordnung?« Auch Nick tauchte im Türrahmen auf, eine dunkle Silhouette mit zerzaustem, blondem Haar.
Laura ging zu ihm. Nick strich dem Kleinen über den Kopf. Sie gingen ins Wohnzimmer, während sie den Schreihals beruhigten. Ich schaltete das Nachtlicht aus, das ich angemacht hatte, als ich den Kleinen vor Stunden zu Bett gebracht hatte, und machte das andere an. Das, was Lauras Mutter gekauft hatte. Was Lauras Familie kaufte, war immer gut. Was ich kaufte, lag unbenutzt herum.
Aber das war nicht fair. So zu denken war nie fair. Eine andere Familie würde sich schon darüber freuen, ich wollte die Sachen spenden. Die Kissen, die Poster, die Plüschtiere und Nachtlichter, ebenso die viele Strampler, die die falsche Farbe hatten. Aber Laura wollte nichts davon hergeben, es war ja von mir. Sie mochte das Zeug nicht, aber sie wollte sich auch nicht schlecht fühlen, also log sie.
Ich ging ihnen leise nach. Wenn der Kleine schrie, wollte Laura ihn nie jemand anderem geben, sie allein durfte ihn dann halten. Wippend stand sie im Raum, Nick bei ihr, den Kleinen streichelnd und beruhigend, eine Hand vertraut auf ihrem Arm. Er durfte ihr helfen, bei ihm schrie der Kleine nicht wie bei mir.
Ich besah sie, die kleine Familie, und da war wieder dieses dunkle und kalte Gefühl in mir. Die Einsamkeit. Die tiefe Resignation.
Es waren Momente wie dieser, die wie kleine Nadelstiche ins Herz stachen und es bluten ließen. Momente, die mich zu irgendwelchen Fremden trieben, nur um mich für ein paar Augenblicke nicht wie Ballast zu fühlen. Nur, um etwas zu fühlen, ein kurzes, sexuelles Hoch. Besser als nichts. Besser, als sich immer anstrengen zu müssen, um nicht unterzugehen.
»Hey, Leute…« Ich stützte mich in den Türrahmen und nagte an der Lippe, sie drehten sich zu mir um, als wunderten sie sich, dass ich noch da war. »Ich hab eine E-Mail bekommen, ein alter Bekannter ist … verstorben«, fuhr ich fort, bevor ich wusste, dass ich es wollte, »ich flieg für ein paar Tage in die Staaten.«
Es war der Trotz gewesen, der mich diese Entscheidung treffen und am nächsten Tag bereuen ließ. Nick glaubte mir kein Wort, ich würde ja nicht mal zum Bäcker gehen, warf er mir vor, als er dann bemerkte, dass ich es ernst meinte, war er wie immer wütend und vorwurfsvoll, weil ich allein gehen und ich mit ihm nicht einmal auswärts essen gehen wollte. Nicht konnte. Doch den Unterschied kannte er nicht, er dachte immer, die Angst sei nur eine Ausrede. Laura sorgte sich, wie sie es immer tat, aber ich glaubte, sie war auch froh. Ich war kein besonders einfacher oder netter Geselle in den letzten Monaten gewesen. Sonst hörte ich ihr immer zu, war immer für sie da, doch in letzter Zeit verschloss ich mich, das spürte sie. Weibliche Intuition und weibliches Feingefühl. Ich sagte, alles sei Bestens, aber das war es nicht. Das war es nie, aber das war mein Problem.
Letztlich hatte ich Glück, meine Schwester wollte ohnehin schon lange eine alte College Freundin besuchen und war spontan dabei. Es gab keine Ausreden mehr und wenn ich eines noch besser kann, als mich abzuschotten, dann ist es wegzulaufen. Nicht einmal meine Angstzustände konnten mich dann aufhalten, und ich hatte ja schon lange das Gefühl, so weit und so schnell ich kann weglaufen zu müssen. Zuerst durch Sex mit Fremden, und zuletzt mit dem Flug in die Staaten.
Genau wie damals. Genau wie bei Zane. Nur lief ich damals nicht vor ihm, sondern vor der Angst vor der Liebe zu ihm davon. Dieses Mal lief ich davon, weil ich einfach nicht mehr konnte. Weil ich ausgelaugt, ermüdet, irgendwie von allem übersättigt und gleichzeitig leer war.
Ich weiß nicht mehr, wie sich Liebe mal angefühlt hat, aber es war bestimmt mehr als Bedauern und ein tiefes, seelisches Seufzen.
Kapitel 1
Zwischenlandung in Alabama und Georgia - Atlanta, dann weiter nach Savannah. Ich hatte das Gefühl, wir würden Zickzack durch die Staaten fliegen, was den günstigen Preis der Tickets wohl erklärte, aber zum Glück stand ich noch voll unter Drogen. Meine Schwester war weniger begeistert, sie musste auf mich aufpassen, wie auf ein Kind. Menschen auf Schlaftabletten machen seltsame Dinge – an die ich mich zum Glück nicht erinnere.
Es gab unzählige Wartezeiten wegen Corona und wir kamen in Savannah völlig fertig an.
Es war dunkel, aber heiß. Warum war es immer heiß? Ich hasste Hitze, Sommer war mein persönlicher Horror. Viel Licht, lange Tage, viele fröhlichen Menschen, die wie Affen auf Paarungssuche durch die Straßen streiften. Echt zum Kotzen, ich hasse Menschen, die ständig unterwegs sein, Party machen und rumvögeln müssen. Sie sind mir suspekt. Was muss das für ein Leben sein, wenn man sich nur durch Sex definiert? Wenn sich alles im Leben nur ums Ficken dreht? Ums Aussehen und Ausgehen und Aufreißen.
Aber vielleicht können hässliche Menschen wie ich das einfach nicht verstehen, ich ernähre mich nicht von der Bewunderung anderer, sie ist mir egal geworden, ich beschäftige mich lieber mit mir allein, in allen Lebenslagen. Alles ist mir im Laufe des letzten Jahrzehnts egal geworden. Unter anderem meine aschblonden Haare, die ich zu einem lockeren Knoten auf dem Kopf zusammengewurschtelt und mit einem Haargummi fixiert hatte. Nein, das sieht nicht lässig aus, es sieht einfach nur heruntergekommen aus. Ich trug Jogginghosen und ein weites, verblichenes T-Shirt, das nach Zuhause roch und mir Sicherheit vermittelte. Aber mein Aussehen war mir egal, ich kämpfte täglich mit einer riesigen Angst vor dem Aufstehen und sich dem Leben stellen, und das Letzte, das mich interessierte, war mein Äußeres und ob die Leute mich geil fanden und ob ich gut fickte. Denn nein, das tat ich natürlich nicht, ich habe keine besonderen Talente und im Bett bin ich der Oberlangweiler, wie mir oft genug gesagt wurde. Danke, Nick.
Ich war einfach zu müde von der ständigen Panik, um mich um mich selbst zu scheren. Ich war wie ein Haus, das vom Eigentümer nicht mehr instandgehalten wurde und langsam, aber sicher vermoderte.
Doch in den Staaten fühlte ich mich sofort anders, weniger bedrückt und eingeengt. Trotz der Dichte an Menschen, der riesigen Städte, der vielen Autos, wirkte alles so viel freier. Größer, aber nicht erstickend. In Deutschland ist alles dicht besiedelt, in Amerika gibt es viel größere Flächen freies Land außerhalb der Bevölkerung. Auch wenn ich diese Freiheit nicht sah, spürte ich sie, sobald das erste Mal den Flughafen betrat. Es ist wie ein Aufatmen. Man fühlt sich klein, unbedeutend, aber gerade deswegen freier. Es ist ein schwer zu beschreibendes Gefühl, vielleicht waren auch die Drogen daran schuld. Die nächsten beiden Flüge schaffte ich im wachen Zustand, aber Kopfschmerzen bahnten sich an und wir waren froh, als wir endlich keine Flughäfen mehr sehen mussten.
Der Plan war, ein Motel zu suchen, zwei Zimmer zu nehmen, damit ich allein sein und runterkommen konnte, meine Schwester würde am nächsten Tag mit dem Leihwagen und in aller Frühe zu ihrer Freundin aufbrechen. Wenn es mir nicht gut gehen würde, würde sie zurückkommen, ansonsten blieb sie ein paar Tage fort.
Einerseits war mir flau im Magen, auf mich gestellt zu sein, andererseits beruhigte es mich auch. Wenn ich Panikattacken bekomme, will ich allein sein und mich einschließen. So entging ich der Pflicht, mich zusammenreißen zu müssen und konnte im Notfall auch einfach im Motel bleiben.
Letztlich zwang mich niemand, zu der Beerdigung zu gehen. Es war meine Entscheidung.
Meine Schwester besorgte sich einen Leihwagen, wir kauften ein paar Lebensmittel in einem Drugstore, besorgten Burger und Milchshakes an einem Drive In und verspeisten sie noch im Auto, so hungrig waren wir. Dann checkten wir in ein Motel in Flughafennähe ein, das fast leer war.
Ich schlief augenblicklich ein und erinnere mich nur schemenhaft, dass meine Schwester am nächsten Morgen an meine Tür klopfte und sich verabschiedete, dann fiel ich wieder ins Bett auf das leicht modrig riechende Kissen und pennte weitere zwölf Stunden. Was ungewöhnlich für mich war, frühstens um halb Neun wache ich immer auf, denn auf meine Blase ist Verlass, aber ich hatte den Jetlag unterschätzt. Obwohl es für mich so nahe an der Straße und am Flughafen ungewohnt laut war, schlief ich wie ein Stein bis tief in den Tag.
Als ich aufwachte und mir gewahr wurde, wo ich war, dachte ich mir sofort: Scheiße, was habe ich getan? Ich muss nach Hause, ich muss sofort nach Hause! Und prompt war die Panik da, samt Herzrasen, Übelkeit, Schweißausbruch und Zittern. Ich quälte mich aus dem Bett und konnte mich ein wenig mit dem Gedanken beruhigen, dass ich allein war und ich nirgendwo erwartet wurde.
Alles cool, du kannst dich einfach wieder hinlegen oder den ganzen Tag schreiben und in aller Ruhe die Attacke durchstehen.
Aber sie war heftig, ich glaubte, mich übergeben zu müssen. Ich nahm nicht gerne Pillen, denke oft genug, dass das nicht gut für mein Herz war. Ein Teufelskreis, die Pillen könnten helfen, aber ich hatte Angst davor, sie zu nehmen.
Also hieß es, nüchtern durch die Angst.
Es war stickig im Raum, durch die Hitze und meinen langen Schlaf roch es muffig und der Sauerstoff war verbraucht. Ich öffnete das Fenster, um zu lüften. Es roch nach Abgasen und Benzin, nach Straße und Stadt. Ich holte zittrig meinen Laptop aus der Tasche und stellte ihn auf den kleinen Tisch neben der Tür, um ihn aufzuklappen und anzuschalten.
Dann trieb mich die Angst wieder aufs Klo. Ich nahm mein Handy zur Ablenkung mit. Meine Schwester hatte einige Male geschrieben, dass es ihr gut ginge und sie gut vorankäme, sie wäre bald bei ihrer Freundin. Nick hatte geschrieben, ob ich gut gelandet sei, dass ich ihm fehlen würde und einige Stunden später, ob alles okay sei, da ich nicht antwortete. Ich schrieb zurück, dass alles gut gegangen sei, ich lange geschlafen habe und er mir auch fehlen würde. Ich hatte gelernt, zu antworten, was andere hören wollten. Laura war penetranter, alle fünf Minuten eine besorgte Nachricht, wo ich sei, was ich tue, ob ich schliefe, ob es mir gut geht, und dass sie hoffte, dass alles okay sei. Auch ihr antwortete ich, dass ich geschlafen hatte und nach kurzem Zögern schrieb ich, dass es mir nicht so gut ginge. Panikattacke.
Bei Nick ersparte ich mir die Erwähnung, er würde es ohnehin nicht begreifen, oder sich wieder schlecht fühlen, weil er nicht wusste, wie er mir helfen konnte. Laura verstand meine Angsterkrankung besser, sie war sehr einfühlsam und immer verständnisvoll. Zumindest versuchte sie es. Sie wollte sofort anrufen, aber ich drückte sie weg, saß noch auf der Toilette und hatte auch nicht den Wunsch, einen von beiden zu hören.
Als ich mir gewahr wurde, wie weit weg sie waren, legte sich die Panik seltsamerweise. Ich war allein in einem Motel, niemand würde mich belästigten. Ich. War. Allein. Und wenn ich wollte, könnte ich eine oder zwei Wochen bleiben, so war es abgesprochen, damit mich der Rückflug nicht stresste, würde ich das Ticket spontan kaufen. Ich konnte drei Tage oder zwei Wochen bleiben. Oder länger, je nachdem, wie viel mein Notgroschen hergab.
Wegzulaufen fühlte sich so gut an.
Es geht schon, schrieb ich Laura, ich komme klar, muss erst mal an- und runterkommen.
Sie antwortete: Okay, mach langsam, leg dich hin oder lenk dich ab. Du packst das, ich glaub an dich.
Süße, aber nutzlose Worte. Was, wenn ich es nicht packte, wäre sie dann enttäuscht? Ich beschloss, es darauf ankommen zu lassen und mir keinen Stress zu machen. Es war okay, wenn die Angst mal wieder stärker war als ich, dann verbrachte ich eben die nächsten drei Tage in diesem Zimmer. Was soll´s.
Das Motel bot mir abgesehen von einem Tisch, Bett und einem angrenzenden Badezimmer mit Duschwanne, einen Minikühlschrank, den ich am Abend bei meiner Ankunft noch eingesteckt und mein Essen darin verstaut hatte. Ein paar Dosen Ginger Ale, abgepackte Sandwiches, die Reste meines Burgers, abgepackter Salat, ausreichend für die nächsten drei Tage, falls ich das Zimmer wirklich nicht verlassen konnte. Außerdem hatte ich Unmengen an Snacks, immerhin war es zehn Jahre her, als ich zuletzt in den Genuss amerikanischer Süßigkeiten, Chips und Popcorn gekommen war.
Ich blieb auch erst einmal dort, zog die Vorhänge zu und verkroch mich in der sicheren Dunkelheit, während der Lärm der Straße zu mir drang. Es gab eine Tankstelle nebenan, nur einen Katzensprung entfernt, und am Ende der Straße befand sich eine Burgerbude. Ich würde es schon schaffen, sagte ich mir, erstmal konnte ich aber drinnen bleiben.
Die nächsten Stunden setzte ich mich an den Laptop, telefonierte gelegentlich mit meiner Schwester, meiner Mutter und Nick. »Geh doch mal raus, zeig uns Fotos, nutz die Chance.« Er war so neidisch auf mich und nahm es mir auch übel, dass ich ihn nicht mitgenommen hatte. Doch das hätte ich nicht verkraftet, Nick war ein liebevoller Mensch, der die Welt verdient hätte, aber manchmal konnte er schwierig werden. Nein, eigentlich war ich der Schwierige von uns, aber Nick konnte damit nicht immer gut umgehen. Das war aber auch nicht sein Problem. Manchmal war er wirklich verständnis- und auch rücksichtsvoll, doch er konnte auch geradezu herablassend werden. Etwa dann, wenn mich in der Öffentlichkeit eine Panikattacke ereilte, dann wurde er genervt und hinterher wütend auf mich, weil ich ihm ein Essen oder einen Kinobesuch versaut hatte. Er hätte den Aufenthalt in den Staaten vollgepackt mit Touristentouren, keine Sekunde im Hotelzimmer, meine Zwänge ignorierend, dass ich immer zu gewissen Zeiten essen musste. Das hätte ich nicht durchgehalten. Bei ihm konnte ich nicht sagen »Es geht jetzt nicht«, denn er wollte einen triftigen Grund dafür. »Ich habe Angst« oder »Mir geht es nicht gut«, akzeptierte er nicht mehr, weil es mein Dauerzustand war.
Und Laura wollte ich auch nicht dabeihaben, obwohl sie mich verstand, aber ihr wurde im Flieger selbst immer übel und sie reagiert nicht gut auf Stress, was mich dann auch gestresst hätte…
Ich durfte gar nicht daran denken, es wäre eine Katastrophe geworden. Doch ich stellte fest, dass ich allein ganz gut zurechtkam. Na ja, halbwegs allein, ich konnte mich immer noch im Notfall auf meine Schwester verlassen, sie regelte alles bezüglich Tickets.
Ich schrieb den ganzen Tag an meinem Buch, aß meine Sandwiches, trank mein Ginger Ale und traute mich sogar, am Wasserspender an der Rezeption eine Flasche Wasser aufzufüllen. Dann ging ich zurück, schrieb weiter, um mich abzulenken, ging zwischendurch duschen und checkte immer wieder meine Nachrichten auf dem Handy.
Laura: Wie geht es dir?
Ich: Gut, es legt sich langsam.
Laura: Das freut mich, du packst das.
Darauf antwortete ich nicht mehr. Und sie schrieb nach einer Weile, es ginge ihr nicht gut. Der Stress, mal wieder. Sie schlief zu wenig, sie kümmerte sich quasi allein um das Baby, sie studierte nebenher, arbeitete zweimal die Woche in einem Büro als Aushilfe. Es war zu viel für sie. Ich antwortete, sie solle sich hinlegen. Das ging nicht, wegen dem Kleinen. Ich fragte, ob Nick ihr nicht helfen könnte. Ja, schon, aber das wollte sie nicht.
Ich bin ein Monster, denn ich war froh, dass uns plötzlich so viele Flugmeilen trennten. Wenn ich wollte, könnte ich das Handy ausstellen und das Drama vergessen. Das immer wiederkehrende Drama. Aber dann würde ich mich schlecht fühlen, weil ich erschöpft davon war.
Ich hatte das erstickende Gefühl, immer für alle da sein zu müssen. Immer. Nicht mit Taten, sondern wenigstens mit Worten, wenn ich schon nicht tatkräftig mitanpacken konnte. Aber zuzuhören kann so anstrengend sein, immer die richtigen Worte suchen zu müssen, eine moralische Stütze zu sein, war auslaugend. Trotzdem hörte ich ihr zu, wie ich immer jedem zuhörte.
Wenigstens Nick war an diesem Tag unkompliziert, ein Paar Fotos aus dem Fenster des Motels genügten, um ihn fröhlicher zu stimmen. »Nächstes Mal fliegen wir zusammen«, beschloss er.
Allein bei dem Gedanken an den Stress und den vielen Streit und der grausigen Panik, die dadurch entstehen würde, wurde mir übel, trotzdem schrieb ich: »Unbedingt.«
Wie gesagt, ich hatte gelernt, zu antworten, was sie hören wollten. Nicht, weil es mir egal gewesen wäre, sondern schlicht, um Streit aus dem Weg zu gehen. Schlicht, um sie nicht immer wieder zu enttäuschen. Sie sollten träumen dürfen, meine Angst sollte ihrem Leben nicht im Weg stehen, denn ich wusste, dass tat sie schon zu oft. Und deshalb fühlte ich mich schuldig.
Deshalb wollte ich weglaufen.
Am Ende des Tages waren die Kopfschmerzen unerträglich. Der Flug, die Panik, das viele Schreiben an meinem Buch, die langen Gespräche per Nachrichten forderten ihren Tribut.
Ich legte mich ins Bett, um einfach nur zu atmen, als mein Handy mir eine neue E-Mail anzeigte. Ich wurde aus dem Absender nicht schlau. BearMonkey91.
Ich weiß nicht, ob du tatsächlich gekommen bist, das Ticket wurde jedenfalls genutzt. Also, wenn du da bist, die Beerdigung ist morgen um 02:00pm. Blöde Zeit für dich, ich weiß, aber besser als vor dem Mittagessen. In welchem Motel bist du? Ich könnte dich abholen, wenn du nicht mit dem Bus fahren willst.
Der Absender war nicht Josh und mein Herz setzte aus, nur um sofort wie wild zu schlagen. Ich saß kerzengerade im Bett, als hätte mir jemand Eiswasser ins Gesicht geschüttet, und ich verlor jegliche Farbe. Er beschrieb noch, wo der Friedhof lag, Ramirez` Adresse hatte ich bereits. Aber die Mail ging noch weiter.
Lauf nicht sofort wieder weg, ich bin nur hier, um es dir leichter zu machen. Wenn ich nicht kommen soll, dann bleibe ich im Motel. Du hast mehr Berechtigung, dort zu sein, als ich. Aber ich will helfen, wenn du allein bist und Hilfe brauchst. Sei nicht zu stolz, nimm´s an.
Und vergiss nicht, zu atmen. Das hilft.
Zane
Josh musste ihm meine Mail-Adresse gegeben haben. Oder er hatte sie wie Josh herausgefunden, was nicht schwer war, immerhin war sie freizugänglich für alle, die auf der Plattform, über die ich meine Bücher verlegte, mein Profil ansahen. Meine Autoren-E-Mail.
Ich starrte auf seine Nachricht und mein Mund wurde staubtrocken, meine Finger begannen zu zittern und mir fiel das Handy aus der Hand.
Mir war irgendwie klar gewesen, dass er auch kommen würde, oder zumindest die sehr hohe Chance bestand. Vielleicht hatte ein Teil von mir darauf gehofft, vielleicht war ich nur deshalb gekommen.
Und wieder dachte ich mir: Was hab ich getan. Fuck, fuck, fuck…
Es kam mir hoch, bevor ich begriff, dass mir übel war. Ich sprang auf und stürzte zum Klo. Halbverdaute Sandwiches kamen wieder hervor und brannten sich mit ätzender Galle meine Speiseröhre hinauf. Mir floss der Schweiß von der Stirn in die Augen. Es dauerte eine Weile, aber als alles draußen war, ging es mir etwas besser.
Erschöpft lehnte ich den Hinterkopf an die gekachelte Wand und erwischte mich dabei, wie ich Zanes Stimme im Ohr hatte. Vergiss nicht, zu atmen.
Atme, Doe, atme!
Ist es verrückt, dass ich nach mehr als einem Jahrzehnt in meinem Kopf mich selbst immer noch Doe nannte? Dass ich mich in Selbstgesprächen Doe nannte?
Vielleicht. Aber es fühlte sich richtiger an, als wenn Nick mich Kadir nannte.
Ich fuhr mir mit dem Handrücken über den Mund, als mich ein seltsames Gefühl überkam. So, als fiele mir etwas wie Schuppen von den Augen, ohne zu begreifen, was es war. Stirnrunzelnd zog ich mich am matschgrünen Waschbecken hoch, wankte zurück zum Bett, ignorierte Lauras und Nicks Nachrichten und las Zanes Zeilen noch einmal.
Das Ticket wurde jedenfalls genutzt.
Ich dachte, Josh hätte es gebucht. War es Zane gewesen? Hatte er es bezahlt?
Es sähe ihm ähnlich.
Bedeutete das, er wollte mich sehen? Oder war er bloß auf seine Zane-Art freundlich?
Oder bedeutete es, dass er mir beweisen wollte, dass er mit mir und unserer Geschichte abgeschlossen hatte?
Ich analysierte mal wieder, konnte es nicht lassen, aber mir war ebenso bewusst, dass ich keine Antwort auf meine Fragen erhalten würde. Ganz gleich, wie lange ich darüber grübelte, was Zane damit bezweckte.
Sollte ich mich nicht fragen, ob ich ihn sehen wollte?
Wollte ich?
Ja. Nein. Mein Magen zog sich zusammen, aber mein Herz jagte wild in meiner Brust.
Wieder las ich seine Mail und ließ mich dabei auf die Bettkante nieder. Bei Vergiss nicht, zu atmen, atmete ich, wie er es mir beigebracht hatte. Und brach fast in Tränen aus.
All die Jahre, so viel vergangene Zeit, und er wusste es immer noch. Er ging nicht einfach davon aus, dass ich ein Jahrzehnt später geheilt wäre. Nein, das würde er nicht, er kannte mich besser.
Ich rutschte vom Bett auf den Boden und lehnte mich gegen die Matratze, bevor ich wusste, was ich tat. Erst später sollte mir bewusstwerden, dass ich genauso dort kauerte, wie früher in den Duschen im Institut, wenn er sich neben mich gesetzt und die Angst mit mir gemeinsam durchgestanden hatte.
Mein Daumen schwebte über dem Touchscreen meines Smartphones. Ich wollte antworten, aber ich wollte auch nicht. Ich wollte ihn sehen, aber ich wollte auch wegrennen.
Was würde passieren, würden wir uns gegenüberstehen? Wäre er noch wütend? Wäre er darüber hinweg? Ich wusste gar nicht, was mir mehr Angst machte.
Bevor ich mich davon abhalten konnte, hatte ich getippt. Es gab nur eine würdige Erwiderung auf seine Nachricht.
BearMonkey91? Dein Ernst?
Mehr schrieb ich nicht und als ich begriff, dass ich die Nachricht gesendet hatte, drehte ich fast durch. Wieder wurde mir übel und ich verfluchte denjenigen, der sich ausgedacht hatte, dass man eine abgesendete Mail nicht zurückholen konnte.
Oder konnte man doch?
Ich wollte es gerade recherchieren, als ich eine neue Nachricht erhielt.
Bist du in Savannah?
Meine Brust zog sich eng zusammen, als ob ich zwischen zwei Autos geraten wäre, die mit Vollgas frontal aufeinanderprallten. Ich biss mir auf die Lippe. Es war zu viel auf einmal. Viel zu viel.
Ja.
Mein Herz raste und ich glaubte plötzlich nicht, dass ich diese Begegnung überleben würde. Nein, dachte ich, ich konnte das alles nicht, ich musste zurück. Was hatte ich mir dabei gedacht? Ich war nicht bereit für solche Reisen, würde es nie sein. Ich musste in meine sichere Wohnung.
Aber das war sie nicht mehr. Nur meine Wohnung. Dort gingen jetzt mehr Menschen ein und aus, als mir lieb war. Sie wollten immer bei mir sein, immer, und meine Zuflucht war zu einem Ort geworden, den ich teilen musste, ohne Rückzugsmöglichkeit.
Es gab keinen Ort mehr, an den ich gehen konnte, der mir allein gehörte. Keine sicherere Festung mehr.
Eine weitere Mail. Ein einziges Wort, eine einzige Frage.
Geht’s?
Und ich heulte los. Ich war ja so eine Memme, es brach aus mir heraus. Geht’s? Ich hörte seine trockene Stimme, seine dunkle, raue Tonlage, als stünde er wieder neben mir. »Nein«, schluchzte ich und schlug die Hände vor das Gesicht. Es war, als ob ich zehn Jahre lang die Luft angehalten hätte und plötzlich alles aus mir herausbrach. Und das nur weil er mich das fragte.
Ich kann schwer beschreiben, was dieses Wort in mir auslöste. Viele fragten mich seither, ob es »geht«. Aber wenn er das tat, war es etwas anderes. Er verstand, er wusste sogar, wenn ich log. Bei ihm musste ich nichts erklären, ich konnte einfach … loslassen. Zumindest war es immer so gewesen.
Doch was ich mir in Erinnerungen rufen musste, war, dass ich nicht mehr mit dem achtzehn-, neunzehnjährigen Zane schrieb, sondern mit dem erwachsenem Zane. Dem… Fuck, er musste dreißig sein.
Nein.
Das antwortete ich. Schlicht und wahrheitsgemäß, wohlwissend, was folgen würde. Und dann spürte ich dieses Nein so sehr, dass es mich erschütterte. Ich sprang wieder auf, rannte ins Bad, denn die Angst brach sich mit aller Macht bahn und stülpte meine Organe um. Doch es war mehr als die Panik vor dem Reisen, die Panik davor, so weit weg zu sein, die Panik davor, eines plötzlichen Todes zu sterben, obwohl ich nicht krank war. In mir wuchs ein Druck, den ich unmöglich erklären kann. Wie ein Luftballon, der sich in meiner Brust immer weiter ausgedehnt hatte. Über Jahre hinweg. Als ob ich in mir drinnen eingesperrt war und aus Leibeskräften brüllte, doch äußerlich bekam ich nicht einmal ein Seufzen zustande. Ich lebte hinter einer Maske.
Welches Motel?
Woher wollte er wissen, dass ich nicht in einem schicken Vier-Sterne-Hotel residierte? Ach, ich machte mir etwas vor, er kannte mich besser als jeder andere, er wusste, dass ich es zu nichts gebracht hatte.
Mich durchfuhr die Angst eiskalt und heiß zugleich, während ich mit der Antwort haderte.
Nein, das konnte ich nicht tun. Ich konnte ihn nicht kommen lassen. Das war zu viel, mein Herz hielt so viel Stress nicht mehr aus.
Er schrieb noch einmal, bevor ich antwortete.
Gib mir deine Handynummer.
Ich konnte fast seinen Befehlston hören.
Nein, dachte ich. Das geht nicht. Ich hatte es bisher immer geschafft, niemandem meine Nummer zu geben, der sie nicht wirklich brauchte. Ein befreundeter Autoren-Kollege, mit dem ich mich austauschte, meine Geschwister, eine Tante, die ich mochte, meine Eltern, Laura und Nick. Niemand sonst, damit mich niemand belästigte. Damit ich keine Angst vor unangenehmen Einladungen haben musste.
Aber es ist Zane. Was machte es schon? Ich könnte seine Nummer blockieren, ich musste sie nicht speichern, wenn er ein Bild von sich und einem anderen Kerl als Profilbild haben sollte. Wenn es zu schmerzhaft wurde.
Ich belog mich nicht selbst, ich war immer noch verliebt in ihn, das war nie das Problem gewesen.
Doch ich bezweifelte stark, dass nach all der Zeit seine Gefühle noch vorhanden sein würden. Er musste längst erkannt haben, dass er bessere Männer haben konnte als mich. Zumal ich nicht mehr der war, der ich einmal war.
Ich gab ihm meine Handynummer, damit ich auf seine Frage, in welchem Motel ich war, nicht antworten musste.
Während ich darauf wartete, dass er mir eine weitere Nachricht schrieb, tigerte ich nervös im Zimmer auf und ab. Die Panik war endgültig ausgebrochen und was ich den ganzen Tag über mühsam unterdrückt hatte, wollte sich nun nicht mehr einsperren lassen. Wie eine Ratte, die sich durch meinen Magen fraß. Genauso scheußlich fühlte es sich an. Und sie wühlte sich wildgeworden von meinem Bauch in meine Brust hinauf und raubte mir den Atem.
Er schrieb nicht mehr und ich fühlte mich dumm. So naiv war ich doch sonst nicht, nur bei ihm. Hatte ich wirklich geglaubt, er würde weiter mit mir schreiben? Mir die Angst nehmen? Mich eventuell anrufen und mir mit seiner rauen, ruhigen Stimme vorsagen, wie ich atmen sollte? Er hatte die Nummer vermutlich nur gewollt, um vor der Beerdigung nachzufragen, ob ich kommen würde.
Fuck, plötzlich gaben meine Knie nach, weil ich begriff, dass ich die Beerdigung nicht allein durchstehen würde. Nein, ich könnte da nicht hingehen, nicht so, nicht ohne jemanden, der mich verstand. Wieso musste sie schon am nächsten Tag sein?
Komm runter, Doe, komm runter, sprach ich auf mich selbst ein. Ein letzter Blick auf mein Handy, keine Nachricht von Zane, nur Laura und Nick, denen ich antwortete. Sie gingen nun ins Bett. Gemeinsam, vermutlich. Natürlich gemeinsam. Ich kannte keine Menschen, die so sexuell aktiv waren wie die beiden.
Ein Stich ins Herz, obwohl ich es nicht wollte. Sie verdienten das nicht, trotzdem gefiel es mir nicht. Sie wussten, wie es mir ging, vor allem Laura wusste es. Nicht nur wegen der Angst, ich hatte ihr vor Monaten auf ihr Drängen hin versucht zu erklären, dass ich mich irgendwie depressiv fühlte, leer. Dass ich deshalb so ungeheuer lustlos war, keinen Sex wollte, dass ich ständig das Gefühl hatte, heulen zu müssen, aber nicht konnte, und nicht wusste, warum ich überhaupt heulen wollte.
Noch an dem Tag, als ich ihr durch Aufbringen all meinen Mutes von meinem Seelenleben erzählte, vögelte sie Nick, blies ihm einen, obwohl sie meine Gefühle kannte. Für sie war die Sache einfach, wenn ich keinen Bock hatte, galt das noch lange nicht für sie, und Nick sagte nicht Nein. Natürlich nicht, Nick war ausgehungert wegen mir. Mich hatte es fertig macht, weil ich keine Lust hatte, mich gedrängt und von Sex gestört fühlte, und dann lutschte sie ihm einfach den Schwanz, während ich Essen kochte, das sie beide nicht mochten, weil es immer anbrannte. Sie war nicht böswillig, so war sie nicht, nur ungewollt rücksichtslos. Laura dachte immer zuerst an ihr eigenes Seelenheil. Die beiden hatten gewollt, dass ich mitmachte, aber sie wusste doch, dass es mich stresste. Dass ich nicht in Stimmung war.
Sie hatte nicht zugehört.
Danach war es das erste Mal, dass ich mit einem Fremden gevögelt hatte. Jemand, der einsam und dankbar war, der sich nur um meine Bedürfnisse kümmerte. Bei dem ich keine Show abziehen musste, bei dem ich nicht mithalten musste, weil es mir egal sein konnte.
Und es hatte sich so gut angefühlt, dass ich es immer wieder getan hatte, mit Kerlen aus dem Internet, die mir einen blasen durften. So wie sie ihm.
Und ich gebe zu, dass ein Hauch kindischer Rache dahintersteckte, für die ich mich mittlerweile schämte.
Ich drückte den Knopf für die Bildschirmsperre und warf mein Handy auf das Bett. Sollten sie doch ficken, wenn es sie glücklich machte, ich hatte meinen Spaß am Sex vor Jahren Stück für Stück verloren, als mir klar wurde, dass es nicht um Genuss ging, sondern nur darum, einem anderen Menschen zu gefallen. Dass die gesamte sexuelle Zufriedenheit meines Partners immer nur von mir abhing, egal, ob ich mich damit wohlfühlte oder nicht. Dass ich immer spontane, neue, aufregende Ideen liefern musste, wenn ich nicht betrogen werden wollte. Dass Sex, genau wie Beziehungen, immer nur ein Kampf darum war, jemand anderem zu genügen.
Mein Ärger über die beiden und mein Neid auf ihre offensichtlich glückliche Sexualität und ihren Hunger aufeinander, hatte mich erfolgreich davon abgelenkt, auf eine Nachricht von Zane zu hoffen.
Was für ein Bullshit. Alles. Ich hasste mich selbst.
Zane. Verdammt, ich musste aufhören, immer wieder an ihn zu denken.
Die nächste Panikattacke ließ mein Herz stolpern. Ich rieb mir die Brust, während ich krampfhaft aufstieß, um die Luft aus dem Magen loszuwerden. Ein Zwang, den ich mir angewöhnt hatte, kein sehr schmeichelhafter Tick, aber oft half es wirklich.
Es wurde Zeit, einfach ins Bett zu gehen und versuchen, zu schlafen, dachte ich, als es plötzlich an der Tür klopfte. Drei kurze, dumpfe Töne, die das dünne Türblatt erbeben ließen.
Mir sank das Herz. Wer könnte das sein? Niemand. Vermutlich irrte sich jemand an der Tür. Oder vielleicht stimmte etwas mit der Bezahlung nicht. Würden sie mich rauswerfen? Was sollte ich dann tun? Meine Gedanken überschlugen sich und gossen Öl auf das Feuer der Panikattacke, um es lichterloh in mir brennen zu lassen.
Ich überlegte ernsthaft, mich totzustellen. Mich einfach nicht zu rühren. Genau wie Zuhause, wenn es unerwartet klingelte oder das Haustelefon schrillte. Ich bekam dann auch immer Angstzustände, weil jemand etwas von mir wollen könnte, worauf ich nicht vorbereitet war. Mittlerweile fürchtete ich vermutlich wirklich meinen eigenen Schatten. Ich kann auch keine Briefe ohne Herzrasen öffnen.
Nach einem Moment klopfte es wieder.
Ich atmete tief durch. Komm schon, Doe, sei keine Memme. Ich würde keinen Schlaf finden, wenn ich Angst davor haben musste, dass man die Tür aufbrechen und mich rauswerfen könnte. Weshalb auch immer. Meine Angst fragte nicht nach Logik, sie war einfach nur immer hysterisch.
Ich gab mir einen Ruck, ging zur Tür und zog sie auf.
Und da stand er.
Es war ein Jahrzehnt her, wir waren erwachsen geworden, trotzdem erkannte ich ihn sofort. Die grünen Augen, das wie aus Marmor gemeißelte Gesicht, seine schiere Größe und das fast pechschwarze Haar.
Ich wusste nichts zu sagen, konnte nicht denken, aber mein Mund stand offen.
»Dein Standort ist an.« Er hielt sein Handy hoch und wackelte damit. »Alle lassen immer ihren Standort an. Ich konnte dich orten.« Es klang beinahe wie eine Entschuldigung. Beinahe. »Ich muss bei dir ja immer ausgefuchster werden.«
Mir war, als träumte ich. Mein Verstand konnte seine Anwesenheit nicht begreifen, es war zu surreal. Und doch war er wahrhaftig da, er stand direkt vor mir. Das wusste ich, als ich seinen unverkennbaren Duft wahrnahm, der mir die Knie weich werden ließ und mich gleichzeitig stärker als jede Droge beruhigen konnte. Sein Duft, den mein Verstand und mein Herz noch immer erkannten, nach einem verdammten Jahrzehnt.
Kapitel 2
Zehn Jahre konnten eine verdammt lange Zeit für jemanden wie mich sein. Ich meine, natürlich kamen einer Mutter zehn Jahre vor, als vergingen sie wie im Flug, denn sie sah ihre Kinder heranwachsen, schneller, als ihr lieb war. Was sind schon zehn Jahre für Eltern, die ihr Kind aufwachsen sahen? Oder zehn Jahre Ehe, die man mit demjenigen verbringt, den man liebt. Aber zehn Jahre, in denen ich Zane weder gesehen noch gehört hatte, kamen mir wie ein ganzes Leben vor. Eine Ewigkeit. Zeit vergeht für jeden anders, Zeit ist mehr ein Gefühl, denn eine Angabe.
Zehn Jahre ohne den Menschen, den man so tief geliebt hatte, dass kein anderer je das Loch füllen konnte, das er hinterlassen hatte, waren ein ganzes, weggeworfenes Leben.
Der ganze Scheiß ging mir im Kopf herum, während ich ihn anstarrte. Das Verrückte daran war, ich sah ihn, wie er damals war. Der blutjunge Zane stand vor mir, der Teenager, ich erkannte die Unterschiede zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht. Es war mein Zane.
Und auch ich fühlte mich, als wäre ich wieder siebzehn.
Zane ließ den Arm fallen, mit dem er das Handy erklärend hochgehalten hatte. »Sag was.«
Ich blinzelte, war wie paralysiert. »Ich… ähm… woher wusstest du, welche… Tür?«
So vieles, das gesagt werden müsste, aber das war alles, was ich zustande brachte. Keine Entschuldigungen, kein Flehen um Vergebung, nichts.
»Ich habe an der Rezeption gefragt«, erklärte er und steckte sein Handy in seine Jeans, zog die Hose zurecht. »Außer dir sind nur zwei weitere Zimmer belegt und das schon seit einer Woche, die Inhaberin erinnerte sich daran, dass du gestern eingecheckt hast und welche Nummer.«
Seine monotone, sachliche Art zu sprechen und die Belanglosigkeit des Gesprächs wirkten hypnotisierend auf mich.
»Ähm…« Er holte Atem und rieb sich unsicher den Hinterkopf. »Sie sagte auch, eine Frau wäre bei dir, aber sie sei heute Morgen abgereist, also…« Seine Augen zuckten an mir vorbei ins Zimmer, fast besorgt. »Ich… wusste nicht, ob ich vielleicht störe…«
Ich begriff erst nicht, war noch zu sehr damit beschäftigt, dass er wahrhaftig vor mir stand. Es dauerte einen langen Moment, bis ich verstand, was er sagte. »Ach so… ja, ich… ich bin mit meiner Schwester gekommen.«
Seine dunklen Augenbrauen hoben sich unter den schwarzen Haarspitzen, die verwegen in seiner breiten Stirn hingen. »Ah. Okay.«
»Sie ist nicht da, sie…« Ich stockte, mein Hirn war leer. »Ich bin allein.«
Allein. Das Wort schwebte einen Moment zwischen uns. Ich sah ihm in die Augen und er mir in meine, und es fühlte sich irgendwie noch immer surreal an.
Er nickte, ich konnte nicht erkennen, ob er erleichtert war. »Lass mich rein.« Keine Frage, keine Bitte, seine Mimik wirkte auf mich entschlossener als vor einer Sekunde.
Ich starrte ihn an und schluckte. So mussten sich Menschen fühlen, denen man eine Pistole auf die Brust setzte. »Ich glaub, ich muss kotzen«, sagte ich, ließ die Tür aber los und drehte mich um. Überließ es ihm, ob er eintrat und folgte.
Das tat er und er schloss die Tür hinter sich. Hinter uns. Sperrte die Welt aus, nachdem er in meine eingedrungen war.
Verdammt, ich hätte ihn wegschicken sollen, ich brauchte die Einsamkeit.
Mitten im Raum stützte ich die Hände auf die Schenkel, Schwindel überkam mich urplötzlich und heftig, ich sah schwarze Punkte. »Ich glaub, ich… ich leg mich einfach… hier so hin…«
Es war ihm hoch anzurechnen, dass er weder lachte noch genervt stöhnte. Aber er macht dieses Drama ja auch noch nicht seit Jahren mit.
Dass er bei mir war, wurde mir zu viel. Ich zitterte stark und mein Gesicht begann taub zu prickeln. Seine Präsenz war zu übermächtig, zu… bedrohlich. Ich schuldete ihm eine Erklärung, mehr als das, eine Entschuldigung, die nicht genügen würde.
Eine Berührung ließ mich zusammenzucken. »Wie wäre es mit dem Bett, sieht bequemer aus«, brummte er lässig.
Zanes Hände lagen auf meinen Seiten, warm und seltsam vertraut und doch fremd. Er stand hinter mir, und ich wurde mir gewahr, dass er wirklich – also so richtig wahrhaftig – bei mir war.
Die Berührung lähmte mich und ich ergab mich kampflos seiner Bemühung, mich die zwei letzten Schritte zum Bett zu schieben. Er brauchte nichts zu sagen, von selbst kletterte ich hinein.
Ich hasse es, wenn jemand bei mir auch, während ich Panikattacken durchlitt, das war auch bei Zane nicht anders. Vor allem nach zehn Jahren Funkstille. »Du solltest gehen«, schnaufte ich und ließ mich ins Kissen fallen, um es zu umklammern. »Geh einfach. Bitte, geh wieder.«
Die Angst zog jedes Organ in mir zusammen.
Im Augenwinkel, und trotz durch Angst ausgelöstem Tunnelblick, konnte ich seine harte Miene über mir erkennen, als er mir die Hose von den Beinen zerrte. »Zieh das aus, ist bequemer«, sagte er nur. Ich wehrte mich nicht, er zog das dünne Laken über mich, unter dem ich mich halb versteckte.
»Zane…«, knurrte ich ins Kissen, »verschwinde.« Ich halt das nicht aus, du musst gehen, es ist mir zu viel. Du bist mir zu viel.
Sein Gesicht tauchte vor meinem auf, als er sich am Bett hinabbeugte, um mir in die Augen zu sehen. In diesem Moment fiel mir auf, dass er älter geworden war, irgendwie noch riesiger, ein paar Fältchen in den Augenwinkeln, Grübchen um seinen Mund, die Haut wettergekerbter, ein dunkler Bartschafften auf den breiten Wangen. Die Schultern, die Brust, die Arme, der Bauch, alles an ihm war eine Spur breiter geworden. Noch immer stark, groß, gewaltig, aber weicher. Mit einem kleinen Bäuchlein, das sich ein wenig über den Hosenbund wölbte. Echt, dachte ich, er war echt, nicht nur eine Erinnerung oder Vorstellung, wie er jetzt aussehen könnte. Er war echt und ich vermisste, was ich sah, mehr denn je.
Fuck, warum sah er so gut aus, so nahbar, so … vertraut und neu zugleich. So anziehend, so … als ob ihn nichts erschütterte, aber gleichzeitig samten, zart und weich.
»Ich geh nicht«, sagte er ruhig, mit einem Hauch von Trotz, während ich ihn noch anstarrte, »weil du bei mir nicht stark sein musst, Doe. Halt die Fresse und versuch, zu schlafen.«
Doe. So lange hatte mich niemand mehr so genannt. Doe. Es war, als ob ich endlich wieder richtig gesehen wurde. Als ob ich wieder jemand war.
Er stand auf und meine Augen folgten ihm. Er trug ein offenes, weißes Hemd über einem schwarzen Tanktop, das im Bund seiner dunklen Jeans steckte, dazu schweres Schuhwerk. All das saugte ich in mir auf, seine Erscheinung, wie er jetzt aussah, was er für Sachen trug, und ich scannte seine Finger, seinen Hals. Kein Schmuck, kein Ring, keine Ketten, keine Uhr.
Aber nur weil er nicht verheiratet war, hieß das nicht, er hätte niemanden.
Er ging zum Lichtschalter und schlug darauf, dann lief er im Dunkeln zum Fenster, zog die Vorhänge auf und lüftete.
Kein Wort kam über seine Lippen, kein Vorwurf, kein Drängen nach Erklärungen. Vielleicht war es ihm egal.
Das wollte ich nicht. Ich bin ein egoistisches Arschloch, denn ich wollte nicht, dass er mit mir abgeschlossen hatte, wollte nicht einmal, dass es ihm gut ging. Er sollte ohne mich nicht glücklich gewesen sein. Ich wünschte ihm nicht das Glück der Welt. Na ja, doch, das tat ich schon, aber nicht in diesem Moment. Er sollte mir nachweinen, mich vermissen, die Jahre ohne mich bedauern, mich hassen. Denn wenn er mich hasste, dann weil ich ihm etwas bedeutete.
»Sag was«, bat ich und schluckte gegen die Trockenheit in meinem Mund. Ich ertrug seine starre, beherrschte Miene nicht.
Thanksgiving im Institut. Meine ersten Monate dort, mein erster Versuch, auf ihn zuzugehen. Damals hatte er auch so dreingesehen, so verbissen, brodelnd. Verschlossen. Und wir hatten uns geprügelt, er hatte mich geküsst, ich hatte ihm eine reingehauen, er hatte mich zu Brei geschlagen.
Ich wünschte fast, er würde auf mich losgehen, Leben zeigen, Leidenschaft.
Sein steinernes Gesicht jagte mir noch mehr Furcht ein, ich ertrug kein Schweigen, ertrug es nicht, wenn andere wütend auf mich waren und ich praktisch spürte, wie die Luft brannte.
Ich wartete auf die Vorwürfe, wappnete mich, zitterte und kämpfte mit Übelkeit…
»Was möchtest du, was ich sage?« Zanes Stimme klang, anders als seine Miene vermuten ließ, sanft und warm. Er holte eine Dose Ginger Ale aus dem Minikühlschrank und zog einen Stuhl an das offene Fenster. Von dort aus konnte er mich ansehen, es sei denn, ich drehte mich um.
Was ich nicht tat.
Nur das Licht von draußen fiel herein, milder Wind strömte über die Wände und lüftete die angespannte Luft, der seit Stunden im Raum gefangenen, angsterfüllten Atmosphäre. Er brach sie auf, wie er sie immer aufbrach, als wäre er allein der Schlüssel.
Zane drehte die Dose zwischen seinen Fingern, Feuchtigkeit perlte über seine Knöchel, er hatte die Ellenbogen auf seine Schenkel gestützt und wartete schweigend auf meine Erwiderung.
»Ich weiß nicht«, gab ich schließlich zu, schluckte.
Durch das halbdunkle Zimmer begegnete mir sein Blick und er strömte solch eine Ruhe aus, die sich zumindest einen Hauch auf mich übertrug.
Es war nie so, dass er mich heilen konnte, niemand konnte einen anderen Menschen heilen, das ist Schwachsinn. Aber er war eine Stütze, ein Ruhepol. So wie wenn man sich einen Gegenstand ins Auto legte, der eine Farbe trug, die einen beruhigte. Es vertrieb die Angst nicht, aber es half dagegen. Ein sachtes Pusten der Mutter auf der Schürfwunde des Kindes.
Das war Zane für mich.
Er verstand mich nicht nur, er war auch noch stark. Ich wusste, wenn ich nicht mehr konnte, konnte ich mich auf ihn zweierlei verlassen. Er hatte Verständnis und er war ein Fels in der Brandung.
»Ich bin nicht hier, um dir Vorwürfe zu machen, während du dir vor Angst in die Hosen pisst, Kadir«, sagte er und öffnete seine Dose, sie zischte. »Du solltest mich besser kennen. Darum geht´s nicht, okay? Ich will dich nicht stressen, ich will nichts von dir hören. Ich will einfach nur … da sein.«
Ich drehte mich auf den Rücken, ein Zittern durchlief mich, ich fühlte mich steif. »Sag das nicht.«
Mit der Dose vor dem Mund hielt er inne. »Was?«
Ich starrte an die Decke, blinzelte. »Kadir. Sag nicht Kadir.«
Beinahe spürte ich körperlich, dass er die dunklen Augenbrauen zusammenzog. Doch dann hörte ich sein geflüstertes »Okay«. Er fragte nicht, er wusste es. »Doe.«
Ich atmete ein und schloss die Augen. »Willst du da die ganze Nacht sitzen?«
»Zerbrich dir nicht meinen Kopf.« Er trank und sah dabei aus dem Fenster, aber er schien nichts zu sehen. Zumindest nicht das, was vor ihm lag, die vielen Lichter der Stadt, die Leuchtreklamen der Tankstelle. Ich wünschte beinahe, er sähe in die Vergangenheit, sähe zurück zu… uns.
Ich stieß einen halblauten Laut aus, der fast wie ein Lachen klang. »Jedes Mal, wenn ich daran denke, wo ich bin, will ich mich übergeben.«
»Dann denk nicht dran.« Noch immer sah er nach draußen.
Sprechen kostete mich Anstrengung, aber es lenkte mich auch ab. Ich schmatzte, schluckte, mein Magen krampfte. »Ich hab keine Ahnung, wie ich es zurückschaffen soll…«
»Wie gesagt, dann denk nicht dran.« Zane starrte auf die Dose in seiner Hand, seine Schultern hoben und senkten sich unter langsamen Atemzügen. »Theoretisch musst du gar nichts, Doe. Gar nichts. Nicht zur Beerdigung, nicht zum Flughafen, nicht mal auf´s Klo. Und nicht zurück. Du kannst einfach so lange da liegen bleiben, wie es nötig ist.«
»Aber-«
»Nichts aber, bleib einfach liegen, denk an nichts, atmete und warte, bis es sich legt.« Er unterbrach sich, trank und sah wieder aus dem Fenster. Wie abwesend fuhr er fort: »Es legt sich, das weißt du, irgendwann verfliegt die Anspannung. Es ist nur der Stress und der vergeht. Er vergeht immer.«
Ich weiß nicht, ob er noch mehr sagte, seine Worte schläferten mich ein. Denn er hatte Recht, ich würde einfach liegen bleiben, bis es vorbei war. Einfach… liegen bleiben.
Niemand außer ihm war hier. Kein Nick, der mich sehen wollte, keine Laura, die mich brauchte. Keine sozialen Pflichten. Ich… konnte einfach loslassen.
Er war ja jetzt da. Zane. Ich musste nicht aufstehen, er würde alles von mir fernhalten, ohne irgendetwas von mir zu verlangen. So wie früher. Ich konnte einfach liegen bleiben. Liegen, liegen, liegen. Ein wunderschöner, befreiender Gedanke.
Ich musste eingeschlafen sein, denn ich erwachte immer wieder kurz, wenn er sich bewegte. Zuerst schreckte ich auf, dann erinnerte ich mich und beruhigte mich. Wie in jeder Nacht, wollte ich gar nicht, dass es Morgen wurde. Fürchtete das Licht, das mir die Realität mit aller Härte ins Gesicht schleuderte. Ich hasste Licht, lebte lieber im geborgenen Mantel der Dunkelheit. Bei Tag wirkt die Angst so viel realer. Keine Ahnung, warum das so ist.
Zane verhielt sich leise. Ich weiß, dass er an meinem Laptop saß, als wäre es ganz natürlich, doch es störte mich nicht. Im Gegenteil, wenn ich aufwachte und sah, dass er noch wach war, schien der Morgen noch so fern. Die Angst fiel von mir ab, zurückblieb nur das Gefühl, einmal durch den Fleischwolf gedreht worden zu sein – und Erleichterung darüber, es wieder einmal geschafft zu haben. Die Angst verzog sich.
Zumindest vorerst.
*~*~*
Die Sonne weckte mich. Sie musste schon eine Weile durch das Fenster auf das Bett gefallen sein, als mich ihre Wärme sanft aus dem Tiefschlaf kitzelte. Es war heiß und trocken und ich hatte das Laken um meine nackten Beine gewickelt. Angenehm prickelten die Sonnenstrahlen auf meiner Haut, das erste Mal seit langsam genoss ich das Gefühl sogar.
Immerhin könnte ich ja liegen bleiben, redete ich mir ein.
Der Lärm der Stadt rauschte überlaut, aber das war egal. Ich fühlte mich nicht erholt, auch das war egal. Ich drehte das Gesicht über die Schulter und sah zum Fenster.
Er war noch da. Er war kein Traum gewesen.
Tief in den Stuhl gesunken und mit dem Kinn auf der Brust schlief er noch. Zane sah ein wenig so aus, als wäre er in der Morgensonne zerlaufen wie ein nackter Schokoladennikolaus. Ich musste schmunzeln, traurig, das Herz blutete mir.
Ich war enttäuscht, dass er dort im Stuhl geschlafen hatte und nicht neben mir, das gebe ich ehrlich zu.
Alles in mir schrie danach, ihn zu berühren, aber das ging nicht. Die Jahre bildeten eine Mauer zwischen uns. Und andere Dinge auch.
Ich setzte mich auf und bemerkte, dass nicht die Sonne mich geweckt hatte, sondern ein Geräusch, das erneut erklang und nun auch dafür sorgte, dass Zane sich regte. Aus kleinen und müden Augen sah er mich an, blinzelte, als bräuchte auch er einen Moment, um sich zu erinnern.
Wir sagten nichts, das Licht brachte die Realität in die surreale Situation.
Ich drehte mich zum Nachtisch und streckte mich nach meinem Handy, das dringlich vibrierte. Laura. Scheiße. Ich ging ran und ächzte ein raues: »Ja?« Räusperte mich, um die Müdigkeit von den Stimmbändern zu kratzen.
Sie fragte, wie es mir ginge, doch ich hörte ihrer Stimme bereits an, dass sie nicht wegen mir anrief. Nein, es ging um sie, um den Kleinen. Ich versuchte, zuzuhören, das versuchte ich wirklich. Sie war gestresst, das Baby habe die ganze Nacht geweint. Streit mit Nick, weil er arbeiten und schlafen musste und er nicht verstand, warum der Kleine nicht durchschlief.
»Ich schaffe das nicht!« Sie weinte. »Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Er schläft nie durch und Nick tut so, als wäre es meine Schuld! Ich bin eine schlechte Mutter, warum weiß ich nicht, was ihm fehlt? Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich pack das nicht, ich pack das einfach nicht!«
»Nick war bestimmt nur schlecht gelaunt, weil er müde war«, versuchte ich, zu schlichten. »Und du bist keine schlechte Mutter, du bist einfach nur erschöpft.«
Ich spürte Zanes nachdenklichen Blick auf mir, der sich im Sessel nicht rührte.
Irgendwie war es mir unangenehm, dass ich mit Laura sprach und er zuhörte. Ich wollte nicht, dass sich meine Gegenwart mit meiner Vergangenheit vermischte. Ich hatte nie richtig von Zane erzählt, sondern ihn nur erwähnt, wie man eben denjenigen erwähnte, der der erste gewesen war, mit dem man eine Beziehung geführt hatte. Nebenbei, nicht ins Detail, wie Schuhe, die man mal besessen hatte. Aber man erzählte ja nicht, dass man seinen Ex noch liebte.
»Ich meine es ernst, ich versau ihn!« Sie schluchzte leise und ich hörte den Kleinen greinen. »Ich bin keine Mutter, ich bin eine Katastrophe! Alle haben es mir gesagt, es wäre dumm, aber nein, ich musste ja stur sein. Was mach ich denn jetzt? Ich pack das nicht, ich will nicht mehr, ich kann das nicht mehr...«
Ich atmete tief ein und rieb mir die Nasenwurzel. Kopfschmerzen pochten in meinem Schädel. Das alles hörte ich nicht zum ersten Mal. Mir war das Drama zu früh, mir waren über die Wochen hinweg die Argumente ausgegangen. Ich konnte selbst nicht mehr.
Zane erhob sich leise aus dem Sessel und knackte mit einer Schulter, er tapste ins Badezimmer, dessen Tür sich neben dem Bett befand. Das Schloss klickte leise.
»Hör mal«, sagte ich zu Laura, nachdem ich sie einen Moment weinen gelassen hatte, weil ich wusste, dass es ihr guttat, es rauszulassen, »denkst du, es geht nur dir so? Ich glaube nicht, dass keine Mutter Angst hat, etwas falsch zu machen-«