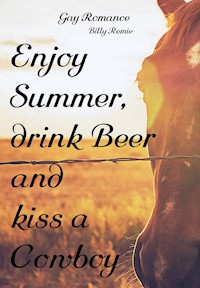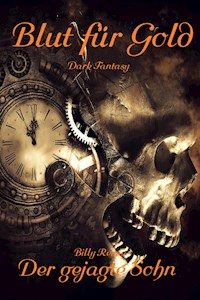6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mythen aus Nohva
- Sprache: Deutsch
Sie sind die Erben des Erlösers. Sie sind die Nachfahren des großen Drachen. Sie sind die Betrogenen – und die vermeintlichen Verräter. Cybras M`Shier, Erstgeborener des legendären Schlächters, wuchs im Königreich Nohva während des Dämonenkrieges auf und wurde zur perfekten Waffe geformt. Ein eiskalter Krieger, von Monstern gezeichnet, und ein Relikt aus einer blutrünstigen und dunklen Zeit, die längst einem anhaltenden Frieden gewichen ist. Und ausgerechnet mit diesem düsteren Genossen hat Maerveth, Zweitgeborener des neuen Königs, eine unglückliche Begegnung im nächtlichen Wald. Von allen Personen, die ihn hätten finden können, stolperte er genau vor Cybras` Füße – dem Sohn des Verräters. Der düstere Genosse ist jedoch nicht Maerveths einziges Problem, denn er hütet seine eigenen Geheimnisse und er muss so schnell wie möglich fliehen, bevor seine Brüder ihn einholen und zum König zurückbringen können. Cybras hat jedoch bereits Pläne mit Maerveth… Gleichzeitig erobert Cybras` Vater – wahrer Erbe Nohvas – den weit entfernten Norden und sucht einen Weg, dem Einfluss der Götter zu entkommen, während er selbst immer mehr zum Gott wird. Doch sein racheerfüllter Blick fällt immer wieder auf Nohva zurück. Und es benötigt nur ein Zeichen von ihm, um Cybras als Waffe einzusetzen. __________________ Erlebt das 1. Zeitalter Nohvas, keine Vorkenntnisse von Nöten. Neue Charaktere, neue Abenteuer, neue Liebschaften.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 923
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Billy Remie
Mythen aus Nohva 1
Juwel der Krone
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Band 1: Vorherbestimmt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Impressum neobooks
Prolog
1. Zeitalter nach Aufzeichnungen der Kirche
nach dem ersten Dämonenkrieg
Balthasar M´Shier, Sohn des Blutdrachen, wurde des Hochverrates angeklagt und für schuldig befunden. Im Name der Krone Nohvas, erklärte ihn König Lugrain Airynn, Erbe des Blutdrachen, zum Feind von Nohva.
Er zog eine pechschwarze Augenbraue hoch, las die Zeilen noch einmal, als das Pergament sich plötzlich zusammenknüllte. Ach schau an, er hatte die Faust um das Schreiben geballt. Passend zu dem heißglühenden Ball, der einmal sein Magen gewesen war. Dabei hatte er sich so sehr auf ein Fässchen Met nach dem Scharmützel gefreut, jetzt war ihm vor Zorn nur noch übel.
»Er nennt sich jetzt einen Airynn, aber seinen Rufnamen behielt er.« Balthasar spuckte einen Klumpen Spucke versetzt mit metallisch schmeckendem Blut in den Schnee und knüllte die Nachricht in seiner Hand. »Verdammter Sohn einer dreckigen Hexenhure, er verdient den Namen meines Vaters nicht, er ist ja nicht einmal sein Sohn! Und jetzt verunreinigt er der Namen mit dem Familiennamen seiner verdammten Hure von Mutter!«
Seine schwer bewaffneten Männer teilten sich, als hätte er eine Schneise in sie geschlagen, als er losstampfte und über die Leichen stieg, die er hinterlassen hatte. Der Schnee knirschte unter seinen schwarzen Stiefeln.
»Die Götter haben uns verlassen«, jammerte einer der Männer aus den hinteren Reihen und sank auf die Knie. »Sie werden kommen und uns alle töten! Und als Verräter hinrichten!«
Balthasar verdrehte die Augen. »Bringt ihn zum Schweigen, bevor ich es tue!«, bellte er wütend über die Schulter.
Ein erschreckter Laut erfüllte die windgepeitschte Anhöhe, ein dumpfer Schlag erklang gefolgt von einem Stöhnen, dann das wunderbare Geräusch, wenn ein Lebloser über den Schnee geschliffen wurde.
Balthasar ließ seine Söldner zurück und trat aus den Reihen durch die Tannenbäume, duckte sich unter den Schneemassen, die die Äste niederdrückten, hindurch und trat an den Rand der Anhöhe, mit Blick über ein Land, das so frei und unberührt war, dass er vor Ehrfurcht auf die Knie sinken wollte.
Schnee, unangetastet lag er über der unbesiedelten Landschaft wie ein welliger Teppich vor den Schatten riesiger, dunkler Berge.
Vor ein paar Monaten hätte er bei Eintreffen der Nachricht die Schultern gezuckt. Was soll´s, hätte er sich gesagt. Er hatte den Thron zurückgelassen, um zu reisen. Er hatte Frau – die er nicht liebte, die ihm aber Kinder geschenkt hatte – und Kinder zurückgelassen, um die Welt zu erkunden. Er hatte seine Burg zurückgelassen, um… zu vergessen.
Wenn die eigene Mutter versuchte, einen umzubringen, wem konnte man im eigenem Land dann noch über den Weg trauen? Also hatte er ein paar abenteuerlustige Männer versammelt und war mit ihnen auf ein Boot gestiegen, um zu sehen, was es jenseits des Meeres gab. Und als die See ihn an diese vereisten Küsten gespült hatte, hätte er nichts dagegen gehabt, für immer hier zu bleiben.
Unbehelligt, als König der Söldner, des Eises und der Schatten. Was brauchte ein Mann mehr? Genug Huren hatten sie dabei. Genug von ihnen trugen seine Früchte aus.
Was verband ihn noch mit der Heimat? Mit Nohva?
Und doch spürte er eine Wut, die er kaum bändigen konnte. Seine Oberlippe zuckte gefährlich, sein Blut kochte.
Die Wahrheit war, er hatte bloß nicht ertragen, wie sie alle diesen Inzestbastard verehrten, als der Erbe, der er nicht war. Lugrain. Der Name hätte ihm, Balthasar, zugestanden, er hatte den harten Winter überlebt, als sie noch in Zelten hausten und all seine Halbgeschwister gestorben waren. Er war der Erstgeborene, der wahre Sohn des Blutdrachen. Er und seine Kinder waren die wahren Erben! Aber seine verdammte Mutter, die ihn hatte umbringen wollen, musste ja mit ihrem verdammten Bruder einen Sohn zeugen. Seinen Halbbruder, den vermeintlichen König.
Die Landschaft vor ihm verschwamm, statt einer weißen Schneedecke sah er plötzlich ein rotes Land. Als ob ein Meer aus Blut durch die Ebene floss, seine Fänge wurden länger, je wütender er wurde.
Er hätte nicht Lust, nach Nohva zu reisen und diesem Airynn Abschaum die Kehle zu durchtrennen.
Erst so kurz auf dem Thron und schon erklärte er Balthasar zum Erzfeind. Was für ein ambitionierter kleiner Hurensohn.
Es war unnötig, darüber zu grübeln, warum er das tat. Es lag auf der Hand. Balthasar könnte Anspruch auf seine Krone erheben. Seine Kinder könnten Anspruch erheben.
Aber nicht, wenn er zum Verräter ernannt wurde. Er müsste den Frieden brechen, um den Thron zu besteigen, und für einen Krieg fehlten ihm Männer. Und er konnte nicht gerade behaupten, dass sie sich über Nacht verdoppelten, eher im absoluten Gegenteil, ihre Zahl schwand geschwind.
Er sah über die Schulter, besah die sechs Leichen auf dem Boden, der Schnee war hellrot von ihrem Lebenssaft, drei mit aufgerissenen Kehlen, deren Blut noch an seiner Zunge klebte. Sie hatten gespürt, was es bedeutete, einen M`Shier stürzen zu wollen.
Sechs Männer weniger. Sechs, die nach Hause zurückkehren wollten. Sechs, die ihn als Anführer hatten stürzen wollen. Die eine Revolte hatten anführen wollen.
Menschen, vielleicht sollte er diesen kurzlebigen Bastarden nicht vertrauen. Andererseits war kein Luzianer bereit gewesen, ihm zu folgen. Sein eigenes Volk hatte sich den Airynns zugewandt, als wären sie Erlöser, obwohl er das Fleisch und Blut des Mannes war, der sein Leben geopfert hatte, um alles Leben zu retten. Statt mit dem eigenen Leuten, hatte Balthasar sich mit den Männern aus dem Süden Nohvas zusammengeschlossen. Das Volk aus dem Schwarzfelsgebirge hatte wenigstens Mumm.
Er verzog den Mund zu einem kalten, schiefen, blutigen Lächeln und wandte sich wieder der Landschaft zu. Der Wind, der über den Schnee wehte und ihn in Nebel verwandelte, als ob Geister über die Ebne schwebten, schien mit ihm zu flüstern.
Die Wölfe, die das Blut rochen, heulten in der Nähe.
Es schien, als wollte das Land nach ihm greifen und ihn dortbehalten. Er gehörte hierher, sein Herz gehörte hierhin. Seine Bastarde würden das Licht der Welt an diesem Ort erblicken, die Bastarde seiner Männer.
Brüder, auf Ewig, sie und alle Nachkommen, die folgten. Es war sein Land, all das gehörte ihm. Würde ihm gehören. Auch, wenn die Elkanasai noch immer danach gierten.
Und doch gab es da diese Stimmen in seinem Kopf, die ihm sagten, dass ihm Unrecht angetan wurde. Dass er es nicht vergeben konnte. Er war kein Verräter an Nohva, sie hatten ihn bloß dazu gemacht.
»Wenn ich wollte, dass du stirbst«, flüsterte er in den eisigen Wind, der nach Westen wehte, »hätte ich dich eigenhändig zerrissen, Bruder.« Und keinen Meuchler gesandt, wie sie es behaupteten.
Er schnaubte mit gebleckten Fängen, das Leder seiner Handschuhe knirschte, als er die Finger zu stahlharten Fäusten ballte und sich der Fantasie hingab, wie er Lugrain auf seinem verdammten Thron an die Kehle sprang. Er sah schon den roten Blutteppich über die Stufen fließen…
»Balt?«
Diese Stimme. Dieses Rauchige, Dunkle, in dieser vertrauten Stimme. Er schloss die Augen und obwohl er es nicht wollte, war ein Großteil seiner Wut wie fortgewischt. Statt Mordlust verspürte er nur noch einen gesunden Ärger.
Wirklich ungeheuerlich.
»Balt.« Die schweren Schritte hinter ihm drückten tiefe Stiefelabdrücke in den gefrosteten Schnee, es knirschte laut.
Balthasar mahlte mit den Kiefern. »Verflucht, ich hasse es, wenn du so vernünftig klingst…«
Er konnte das leichte Lächeln beinahe im Nacken spüren. »Was willst du jetzt tun?«
Eine wirklich verdammt gute Frage.
Balthasar drehte sich zu Skraemd um und musterte den Riesen, der doppelt so muskulös war wie der Baum hinter ihm. Eine Statur, mit der man ohne große Anstrengung eine Kutsche heben könnte. Oder einen Felsbrocken so groß wie eine Kutsche. Das Erbgut der Giganten, die das Gebirge Nohvas bewohnten. Ein Bastard der Youris, die mit dem Blutdrachen gegen die Dämonen gekämpft und sie vertrieben hatten. Ein Mann, der allein aufgrund seiner Abstammung Respekt verdient hätte. Aber Bastard blieb nun Mal Bastard in den Augen der Kirche Nohvas.
Tragisch, aber sein Glück.
»Saufen«, antwortete Balthasar und ging an ihm vorbei. »Ficken.«
Sein Vertrauter schmunzelte kaum merklich, nur die Grübchen, die sich in seine Wangen gruben, auf denen ein dunkler Bartschatten lag, verrieten ihn. Gewelltes, braunes Haar fiel auf die breiten Schulterstücke der Lederrüstung, hellbraune Augen verfolgten ihn, eher sich die muskulösen Beine ebenfalls in Bewegung setzten.
»Ich vermute, du lässt ihm das nicht so einfach durchgehen…«, mutmaßte Skrae.
»Er will einen Verräter?« Balthasars Augen wurden dunkel. »Ich gebe ihm einen Verräter.«
Band 1: Vorherbestimmt
Es gab uns schon einmal, vor all der Zeit.
Meine Seele erkennt die deine.
Nach all der Zeit.
All das Gutes, was wir teilten, und all das Schlechte.
Sie erinnert sich. An alles.
Und das war unsere Geschichte.
Kapitel 1
1.Zeitalter, nach Aufzeichnung der Kirche, nach dem ersten Dämonenkrieg
– Königreich Nohva
Sie verfolgten ihn.
Er verfluchte sich, weil er seine Spuren nicht besser verwischt hatte. Er hätte durch den Fluss reiten sollen, auch wenn sein Pferd hätte ausrutschen können. Mit einem verletzten Bein wäre der weiße Hengst bei dem ersten Schnattern der Nachtschattenkatzen auch nicht gleich davongerauscht und hätte nicht nur einen nutzlosen, gerissenen Zügel am Baum hinterlassen.
Maerveth spürte mehr, als dass er den Verfolger hörte, wie dieser sich durch das Unterholz auf das schwache Feuer zu bewegte.
Sein zweiter dummer Fehler: bei Nacht ein Feuer zu entzünden, wenn er nicht gefunden werden wollte.
Er sah sich nach allen Seiten nach einem geeigneten Versteck oder Fluchtweg um, doch er hatte sich ein geschütztes Fleckchen ausgesucht, umgeben von totem Geäst, das dicht genug war, dass es fast wie eine blühende Hecke jede Sicht versperrte. Nur eben nicht das warme Glühen der Esse.
Als ein Ast knackte, ging ein Ruck durch ihn durch und die Furcht, entdeckt zu werden und die Strafe erdulden zu müssen, übernahm sein Handeln. Eilig sprang er auf und trat staubigen Grund auf die Glut, damit sie erlosch, um sich anschließend in der Dunkelheit der Nacht auf den Baum zu retten, an dem der abgerissene Zügel baumelte.
Maerveth zog sich daran hinauf, zum ersten Mal war er wirklich froh über seine fehlende Körpergröße und Masse, obwohl ihm ein paar Armmuskeln sicher das Erglimmen des Astes erleichtert hätten. Er zog sich auf den ersten, dann mühsam auf den zweiten Ast und spähte hinab in sein Lager, das nur aus einem zurückgebliebenen Sattel, einer Decke und einem Feuer im Boden bestand. Nach all den Nächten allein in den Tiefen Wäldern hatte er den Dreh mit dem Feuermachen allmählich raus. Und ausgerechnet jetzt mussten sie ihn finden!
Seine Gedanken erlagen einem sofortigen Stillstand, als er den Schatten unter sich bemerkte. Sein Hengst hatte ein riesiges Loch in die toten Hecken geschlagen, als er davongerannt war, durch jenes sah er nun von oben ein beeindruckendes Paar breite Schultern und einen dunklen Schopf das Lager betreten. Das Haar glänzte schwärzer als die Nacht selbst, obwohl nur ein paar strähnen aus der Kapuze hervorlugten sie Stroh aus einem ärmlichen Bett.
Es war kein Soldat, den er kannte, von oben und wegen des schwarzen Umhangs, konnte er weder Rüstung noch Wappen erkennen.
Der Fremde bewegte sich im Dunkeln so souverän wie am Tage, er musste ein Luzianer sein, wenn er bei Nacht so gut sah wie Maerveth selbst. Suchend sah er sich im Lager um, ging in die Hocke und hielt die Hand über die Glut. Sie musste noch heiß sein. Das ließ ihn alarmiert aufstehen und eine Hand an sein Schwert legen. Mit einem riesigen Schritt stieg er über die Glut, doch er bewegte sich nicht so klobig und ungelenk wie die Soldaten, die Maerveth kannte.
Neugierig reckte er den Hals, als der Fremde näher an den Baum trat.
Was tat er? Wo ging er hin? Maerveth duckte sich unter dem Ast hindurch, an dem er mit beiden Händen hing, und suchte die Dunkelheit ab.
Kein weiterer Soldat erschien, kein Hufgetrampel und keine Fackeln in der Nähe. War der Mann allein?
Zum ersten Mal kam ihm in den Sinn, dass kein Soldat ihn suchte, sondern dass ein Räuber auf ihn aufmerksam geworden war.
Der Fremde stand direkt unter dem Baum, in dessen Ästen Maerveth kauerte, und befühlte den abgerissenen Zügel. Dann sah er sich wieder zum verlassenen Lager um.
Es war zum Verrücktwerden, dass Maerveth sein Gesicht nicht sehen konnte, dann hätte er vielleicht gewusst, was der Fremde wollte, ob er nur Wertsachen suchte – oder ein Mörder war.
Es kam ihm vor, als stünde der Kerl ewig dort unter ihm und rieb die Zügel nachdenklich zwischen zwei Fingern, während er den Sattel anstarrte, der als Kopfkissen gedient hatte.
Dann endlich ließ er den Lederfetzen los und ging um das Feuer herum. Gemächlich, mit einer Hand am silbernen Knauf seines ungeheuer langen Schwertes, während der Umhang hinter ihm her schleifte wie ein Schatten.
Noch immer sah er sich im Lager suchend um, doch er rührte weder die Satteltaschen noch den Beutel an, den Maerveth sonst immer um sich schlang.
Als ob ihn jemand verfolgen könnte, drehte er sich noch einmal um und verschwand rückwärts in dem Loch, durch das er gekommen war. Ein Pfeifen ertönte in der Nacht und versetzte Maerveth so einen Schrecken, dass er innerlich zusammenzuckte.
Dann hörte er einsames, schweres Huftraben auf dem Waldboden, ein Schnauben, es kam näher.
Er versuchte, durch das Gestrüpp etwas zu entdecken, doch er konnte rein gar nichts sehen, nur hören.
Etwas knarzte, etwas raschelte, der Fremde zog sich in den Sattel. Dann entfernten sich die Hufe im gemächlichen Galopp und verstummten nach und nach, wie ein Echo.
Eine ganze Weile wagte Maerveth nicht, sich zu bewegen. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals, als wollte es herausgewürgt werden. Und siehe da, vor lauter Aufregung wurde ihm übel.
Ganz großartig, aber leider nichts Neues. Was war er doch für ein Bild von einem Mann.
Der Fremde hatte seine Sachen nicht nach Wertgegenständen durchsucht, er hatte sich für nichts im Lager interessierte, außer der warmen Glut. Gut möglich, dass er auf andere Dinge aus gewesen war. Es gab das Böse auch ohne Dämonen, es wuchs in jedem sterblichen Herzen. Mörder, Sadisten, die verbannt worden waren, weil sie Spaß am Elend anderer hatten. Weil sie gerne Leid und Schmerz zufügten.
Vielleicht sollte er zur Sicherheit auf dem Baum ausharren, bis es Morgen wurde und-
»Wie lange willst du dich noch wie eine Katze auf dem Ast verstecken?«
Die dunkle Stimme erschrak ihn so sehr, dass er einen leisen Schrei ausstieß und beinahe vom Baum gefallen wäre, hätten sich seine Arme nicht instinktiv um den Stamm gelegt, als könnte er so mit der Rinde verschmelzen.
Der Fremde. Er stand nun hinter ihm im Gestrüpp.
»Ich kann dich atmen hören«, sagte die dunkle Stimme gelangweilt. »Und ich hab deine Fußspuren gesehen, sie führten vom Schlafplatz zum Baum, an der Rinde sieht man ebenfalls deine Spuren.«
Verdammt!
Er schloss die Augen, als könnte der andere ihn nicht sehen, wenn er ihn nicht sah.
Ein ungeduldiges Seufzen ertönte von unten. »Na gut…« Kurz darauf erklang ein hölzernes Klicken, wie wenn ein Stock gegen etwas Hartes stieß. Das leise Flüstern und Knarzen, wenn eine Bogensehne gespannt wurde.
»Halt!«, rief Maerveth erschrocken, jedoch zu spät. Der Pfeil krachte dicht neben seinem rechten Auge in den Stamm. Panisch ließ er los und wich instinktiv zurück, sodass er das Gleichgewicht verlor. Einen Moment ruderte er noch mit den Armen und hing schräg in der Luft, doch der Sturz war unvermeidlich. Er konnte nur noch die Augen schließen und hoffen, dass-
Ruums.
Der Aufprall kam viel schneller als erwartet. Und schmerzhafter. Für einen Moment raubte ihm ein heißes Ziehen im Rücken den Atem, er schrie stumm. Seine Augen nahmen nur noch Schwärze wahr.
Halt, nein, er hatte nur die Lider immer noch geschlossen.
Als er sie blinzelnd öffnete, blickte er auf die schimmernde Schneide einer scharfen Klinge, die direkt auf seine Kehle gerichtet war. Er folgte dem Schwert zum schlichten Parierstück, zum Griff, zum Knauf – und dem harten Gesicht, das unbarmherzig auf ihn herabsah.
»Wer bist du und was machst du in meinem Wald?«, fragte die kalte, dunkle Stimme und schien keine Ausflüchte zu dulden.
Er war jung, höchstens ein oder zwei Jahre älter als Maerveth selbst, aber er hatte einen Blick so hart wie Granit.
»Dein Wald?« Maerveth schlug das Herz wieder so wild, als wollte es ihn von innen heraus die Rippen zertrümmern, trotzdem konnte er die Klappe nicht halten. »Hast du kein richtiges Zuhause…?«
Das Gesicht über ihm wurde, wenn überhaupt möglich, noch härter. Maerveth hob die Hände, denn er spürte, dass der Mann keinen Funken Selbstironie in sich trug.
Mit einem gereizten Schnauben riss der andere das Schwert zurück, sodass Maerveth abermals zusammenzuckte, weil er befürchtete, gleich das heiße Brennen einer Klinge zu spüren, die ihn durchstieß. Doch stattdessen rammte der Fremde seine Waffe zurück in die Scheide und bückte sich nach ihm.
Maerveth konnte nur noch nach Luft schnappen, doch bevor er dazu kam, seinen Schock zu überwinden und sich zu wehren, landete sein Rücken an der rauen Rinde des Baumes.
Mit großen Augen und panisch rauschendem Puls starrte er seinen Angreifer an, der seine Faust in Maerveths Kragen gegraben hatte und ihn an den Baum nagelte.
Sie sahen sich an, der Fremde kam ihm nahe und betrachtete sein Gesicht. Beinahe augenblicklich kräuselte er die Nase, als hätte er etwas ungeheuer Ekelhaftes vor Augen.
Autsch…
Mit einem Brummen ließ er Maerveth wieder los, als würde er stinken.
»Welcher von ihnen bist du?«, fragte der Grobian monoton und trat zurück, sodass er in einem Streifen silbrigen Mondlichts stand, das den Wald wie eine Klinge spaltete. Sein Haar lugte unter der Kapuze hervor, wie ein Wasserfall floss es über sie Stirn, und es war wirklich so schwarz wie nichts anderes, selbst Kohle, selbst Pech hätten zu hell dagegen gewirkt, und seine Augen leuchteten so grün wie Zauber.
Maerveth blinzelte irritiert. »W…wie bitte?«
»Der Große, Mittlere oder Kleine?«, wollte er wissen. Und als er Maerveths verwirrten Blick bemerkte, ließ er ungeduldig die breiten Schultern hängen. »Du bist ein Airynn«, half er ihm auf die Sprünge und hob mit fordernder Geste die Augenbrauen. »Welcher der Prinzen bist du?«
Maerveth versuchte, sich unwissend zu stellen. »Äh… ich… also… Woher … Wieso erdreistest du dich-« Er verstummte, als eine schwarze Augenbraue in Richtung Haaransatz wanderte.
Der Blick des Grünäugigen schüchterte noch mehr ein als seine rauchige Stimme.
»Gib dir keine Mühe«, sagte er gelangweilt und wedelte vor Maerveths Gesicht herum, als wollte er eine lästige Fliege vertreiben. »Die eisigen Augen, das goldene Haar. Als ob die Götter nur noch Ebenbilder von deinem Vater erschaffen wollten. Also« - Er neigte fordernd den Kopf - »welcher seiner Söhne bist du?«
Maerveth wollte verärgert sein, doch er konnte in seinem Herzen nur Wut auf sich selbst finden. Wieder ein Fehler, er hätte sich die Haare mit Lehm rot färben sollen. »Ich bin Maerveth.« Und als der Grünäugige ihn noch immer fragend anstarrte, fügte er kleinlaut hinzu: »Der Zweitgeborene.«
Es trat ein Wissen in das Gesicht seines Peinigers, das er ihm zu gern aus dem Gesicht geschlagen hätte.
Nicht, dass er je irgendjemanden geschlagen hätte.
»Der nächste Hohepriester also, ja?« Belustigung machte die scharfkantigen Züge seines Gegenübers plötzlich weicher.
»Leck mich!« Maerveth stieß sich vom Baum ab und schlug sich in die Hecke.
Hinter ihm hörte er ein Glucksen, das seine Wut noch mehr anfachte. »Falsche Richtung. Nach Hause geht’s da lang, Prinzchen.«
Es war ihm gleich, wohin der andere deutete, er kannte die verdammte Richtung. »Ich will ja gar nicht nach Hause.«
»Gut, dann geh nicht nach Hause, aber da lang kannst du auch nicht gehen.«
»Wieso?« Er kam nicht schnell voran und schlug ärgerlich um sich, um sich von den Dornen zu befreien. Ungeachtet der Kratzer, die er sich an Armen und Händen zuzog. Er würde lieber stecken bleiben und verbluten, als zurückzugehen und sich in eine verdammte Novizenrobe stecken zu lassen, um den Göttern zu dienen.
Sollten sie sich doch selbst dienen!
»Der Wald gehört meiner Familie«, wurde ihm nachgerufen.
»Genau genommen, ist es mein Wald«, wandte er ein, »oder der, meines Vaters, dem König. Die Tiefen Wälder gehören dir nicht, also kann ich hingehen, wo ich will!«
Es war ihm egal, dass er klang wie ein trotziges Kind. Er wollte doch bloß in Ruhe von zuhause weglaufen, war das denn zu viel verlangt?
Völlig ruhig antwortete der Grünäugige. »Du bist nicht mehr in den Tiefen Wäldern.«
Maerveth stockte irritiert mitten in der Bewegung.
»Das hier ist der Tote Wald«, sagte die Stimme hinter ihm dunkler als zuvor.
Da fiel es ihm auf. Das tote Geäst, die kargen Bäume, der saure Waldboden und die Stille, die ihn seit einem Tag begleitete. Wie konnte es ihm nicht aufgefallen sein?
»Wer bist du?«, hörte er sich fragen, seine eigene Stimme kam ihm leise und tonlos vor. Warum wurde es ihm plötzlich kalt, obwohl doch Sommer war?
Hinter ihm kamen die Schritte näher und mit einem mal hatten sie etwas Bedrohliches.
Maerveth drehte sich um und sah den anderen an, er wirkte plötzlich größer, stärker, unheimlicher, wie er so auf ihn herabsah und die Augen leicht verengte. Er antwortete nicht.
Die grünen Augen, das schwarze Haar, dieses scharfkantige Gesicht, wie ein Raubvogel.
»Du bist ein M`Shier«, erkannte er geflüstert.
Ein schmales, kaltes Lächeln traf ihn.
»Ich bin Cybras«, stellte der Grünäugige sich vor, »Sohn des Balthasar« - er machte eine kurze Pause - »dem Verräter.«
*
Er kannte diesen Blick. Schon bevor sein Vater als Verräter gebrandmarkt worden war, hatte man ihn mit dieser Mischung aus Unglaube und Schrecken angesehen. Als wäre er ein Dämon, den der Blutdrache vergessen hatte, zu verbannen. Dabei fand er sich selbst gar nicht so abstoßend, es konnte also nichts mit seinem Äußeren zu tun haben, viel mehr mit Gerüchten über seine Taten.
»Du bist sein Bastard«, raunte sein Gegenüber unbehaglich.
Cybras trat auf den Schmächtigen zu und beobachtete, wie sich das Porzellanpuppengesicht verschloss, wie er die Angst verbannte und ihm stolz das schmale Kinn entgegen hob. Die milde Sommernachtsbrise traf den Prinzen von hinten und wehte Cybras den Geruch des frischen Blutes ins Gesicht. Blut und ein starker süßer Geruch nach… nach… Er bemerkte nicht, wie er die Nasenflügel blähte und wie ein Drache den Duft des anderen tief inhalierte, als hätte er Beute gewittert. Erst als der Prinz einen Schritt zurückwich und ihn musterten angespannt, als wäre er ein gefährliches Raubtier, wurde ihm gewahr, wie er sich benahm.
Er riss sich zusammen und fasste nach dem Arm des Blonden, der zur Abwehr halberhoben gewesen war.
Er zuckte nicht zurück, als Cybras sein Gelenk umfasst und es langsam zu sich zog. Noch ein Schritt, dann standen sie ganz nahe beisammen und das seltsam süße Blut kitzelte noch mehr in seiner Nase. Aber vor allem in seinem Schädel.
Augen so blau und so kalt wie ewiges Eis starrten zu ihm auf, und er konnte hören, wie das junge Herz in der flachen Brust hüpfte.
Ohne ein Wort zog er mit der freien Hand ein Tuch aus seiner Tasche und wickelte es um die blutige Hand, auf deren Rücken ein Dorn eine tiefe Wunde hinterlassen hatte. »Du lockst Raubtiere an.«
Der Prinz ließ zu, dass er verarztet wurde, starrte ihm forschend ins Gesicht. »Ich befürchte, das habe ich bereits.«
Cybras blickte ihm wieder in die hellblauen Augen, verzog jedoch keine Miene, obwohl er offensichtlich von ihm sprach. Blind zog er einen Knoten mit zwei Ecken des seidenen Taschentuchs und ließ die Hand los.
Auch die andere Hand hatte Kratzer, ebenso war das weiße Hemd an den Armen aufgerissen und wies dunkelrote Spuren auf, jedoch bluteten die Wunden nicht so stark.
Die hellen Augen zuckten hinab zu dem Verband und wieder zurück zu Cybras` Gesicht. »Du hattest hoffentlich in letzter Zeit keinen Schnupfen.«
Cybras runzelte die Stirn.
»Wegen des Taschentuchs«, plapperte der Blonde weiter. »Schnupfen? Taschentuch? Zeug aus deiner Nase in meiner offenen Wunde?«
Ungerührt blickte er zurück.
Der Prinz ließ die Hand fallen und seufzte. »Vergiss es.« Er musterte ihn flüchtig. »Du machst mich nervös.«
»Das kann ich hören.«
Etwas Röte schlich sich auf die zarten Jochbeine, die ihm etwas Kindliches einhauchten, er wich seinem Blick zur Seite aus. Räusperte sich und rieb sich mit der unverbundenen Hand das Gelenk des anderen Arms. »Und jetzt?« Seine Nervosität stieg, was seinen körpereigenen Duft verstärkte.
Was war das bloß für ein Geruch? So süß, dass er ihm den Speichel auf die Zunge trieb. Süß, klebrig, heiß… Wie der Duft aus der Küche, wenn die Köchin in der Erntezeit Fruchtgelee kochte.
Weil er nicht antwortete und ihn nur durchdringend ansah, lehnte der Blonde sich ein Stück zurück und betrachtete ihn wieder argwöhnisch. »…ich werde es dir nicht leichtmachen.«
Cybras zog die Augenbrauen über der von vielen Brüchen gezeichneten Nase zusammen. »Was?«
»Ich sagte, wenn du mich zu meinem Vater zurückbringen willst«, er schien sich tatsächlich zu wiederholen, »werde ich es dir nicht leicht machen!«
Angriffslustig funkelten die eisblauen Augen zu ihm auf, aber in dem aristokratischen Gesicht lag eine deutliche Unsicherheit, die seiner Entschlossenheit Lügen strafte.
Ungerührt konterte Cybras: »Warum sollte ich dich zurückbringen wollen?«
Das irritierte den Prinzen, seine Mimik entglitt ihm und er ließ die zur Gegenwehr hochgezogenen Schultern sinken. »Um seine Gunst zu erlangen?«
Er tat so, als würde er darüber nachdenken, dabei beobachtete der Blonde jede Linie in seinem Gesicht, als wäre er ein exotisches Tier.
Als Cybras den Kopf schrägte, wich er wieder ein wenig zurück, sein voller Mund öffnete sich ein wenig, als hätte er sich erschrocken.
»Ich glaube nicht«, entschied Cybras dann. »Aber so ungern ich deine hochgesteckten Ziele auch zunichtemachen möchte, ohne ein Pferd kommst du ohnehin nicht weit.«
Beinahe taten ihm seine realitätsnahen Worte leid, als Mutlosigkeit in dieses junge Gesicht trat. »Ähm… Danke?«
Beinahe hätte er geschmunzelt. Beinahe. Er trat wieder auf ihn zu, und statt zurückzuweichen, hob der Prinz sein Kinn und streckte den Rücken durch, aber er war immer noch kleiner. Einen guten Kopf kleiner, um genau zu sein. »Und du glaubst, wegzulaufen ist die einzige Möglichkeit, deinem Schicksal zu entgehen?«
»Wenn es um die Zukunft seiner Söhne geht, kennt mein Vater ironischerweise keinen freien Willen. Wäre er mit uns doch so gütig und nachsichtig, wie er es mit seinen Völkern ist.«
Cybras sah ihm in die Augen. »Väter sehen nur Werkzeuge in ihren Söhnen, keine Lebewesen.«
Er sprach aus Erfahrung.
Der Prinz hob an, um zu widersprechen, doch irgendetwas in Cybras` Blick ließ ihn innehalten. Seine Augen flogen zwischen Cybras` Augen hin und her, und für einen Moment, einen winzigen Augenblick nur, verstanden sie sich ohne Worte.
Ein hämisches Lachen durchschnitt die Nacht und das aufgekommene Verständnis. Mehr Geschnatter erhob sich hinter den Hecken, Äste knackten.
Cybras drehte das Gesicht über die Schulter und sah zu dem spärlichen Lager zurück.
»Was war das?«, fragte der Prinz überlaut geflüstert und in einem Tonfall, als kannte er die Antwort bereits.
»Das«, betonte Cybras und zog sein Schwert, »sind dann wohl die Nachtschattenkatzen, die dich verfolgt haben und vor denen dein viel klügeres Pferd geflohen ist.«
Der Blick des Blonden flog zu ihm herum. »Hast du gerade impliziert, ich sei dümmer als ein Pferd?«
»Alle Pferde sind klüger als ihre Reiter«, wandte er ungerührt ein. »Sag mir, dass du eine Waffe führen kannst.«
»Natürlich!« Er hatte etwas von einem Welpen, wenn er beleidigt klang.
Cybras` Augen zuckten zu der Schlafstätte, dem Sattel und dem Gepäck des Prinzen, das zehn Schritte entfernt im Lager deponiert lag. »Sag mir, dass du sie am Leib trägst.«
Das Schweigen gefiel ihm gar nicht.
Er wollte fluchen und auf das Gepäck zuspringen, als er schon beim Ansetzen versteinerte, weil ein Schatten elegant und lautlos durch die Hecke ins Mondlicht sprang und ihm den Weg versperrte.
Sie war schneeweiß, das Fell bewegte sich so leicht wie ein Federkleid, buschig wie eine Löwenmähne, der Kopf und die langen Beine erinnerten mehr an einen Mähnenwolf, denn an eine Katze, doch ihr geschmeidiger Leib war der eines Panthers nicht unähnlich. Er blickte direkt in ihre gelben mordlustigen Augen, die in der Nacht leuchteten wie zwei Lagerfeuer. Sie duckte sich zum nächsten Sprung und bewegte sich seitlich vor ihm im Halbkreis, Gift troff von den langen Fängen, die aus ihrem Maul steil nach unten ragten.
»Nicht rennen«, presste er durch die eigenen Fänge und hob ganz langsam die Klinge zur Abwehr, während er betete, dass der Prinz keinen dummen Fehler machte.
Eine zweite Nachtschattenkatze landete im Mondlicht, links von ihnen, eine dritte rechts, hinter den Hecken knackten noch mehr Äste. Das Rudel war groß und es war hungrig. Sie lachten schnatternd und voller Hohn, leckten sich die Fangzähne provozierend.
»Gib mir deinen Bogen«, verlangte der Blonde konzentriert.
Cybras zögerte. »Damit du mir einen Pfeil in den Rücken jagen kannst?«
Er spürte den verständnislosen Blick im Nacken wie einen Stein, der ihn traf. »Und was hätte ich davon?«
»Ich würde fallen und sie würden sich auf mich stürzen, du könntest fliehen und hättest einen Verräter weniger.«
Kurzes, sprachloses Schweigen. »Mir behagt deine Denkweise ganz und gar nicht.«
»Was hast du von einem Sohn Balthasars erwartet?«
»Dass er sein Sohn und nicht sein Vater ist.«
Eine merkwürdig logische Einstellung in Anbetracht der Tatsache, dass vor ihm offensichtlich noch nie jemand zu dieser Erkenntnis gelangt war.
Die Katzen unterbrachen ihre nicht sehr erbauliche Unterhaltung, indem sie sich leichtfüßig auf sie stürzten. Mit lautem Geschnatter und Gefauche.
Cybras handelte instinktiv, er riss die Schulter herum, sodass die schneeweiße Bestie dicht an ihm vorbeisprang, und schlug sie gleichzeitig mit seiner Klinge in zwei. Sein Rücken schirmte dabei genauso instinktiv den Prinzen ab, und er wirbelte sofort herum, als die Katze jaulend zu Boden ging und der Geruch ihres Blutes die Nacht erfüllte.
Der Prinz riss ihm den Bogen vom Rücken und einen Pfeil aus dem Köcher, wirbelte herum und schoss den Pfeil so schnell ab, dass er unmöglich gezielt haben konnte.
Doch er traf eine Katze im Sprung, woraufhin sie fiel und sich auf dem Boden überschlug.
»Sauberer Schuss«, staunte Cybras.
»Danke.« Der Prinz zog ungefragt noch einen Pfeil aus dem Köcher, der auf Cybras` Rücken hing, und spannte die Bogensehne erneut.
Keine Zeit für Verwunderung, weitere Schatten stürzten auf sie zu, und die Biester waren wütend, sobald sie das Blut ihrer Artgenossen rochen. Mit vereinten Kräften schossen sie aus der Dunkelheit, ein gutes halbes Dutzend lautlose, tödliche Schemen mit giftigen Bissen und einem unstillbaren Blutdurst.
Cybras schlug eine Nachtschattenkatze mit der Klinge zur Seite und verwundete sie tödlich, ihre Gedärme hingen heraus, sie schrie. Der Prinz schoss blitzschnell zwei Pfeile und traf zwei Bestien, doch für die dritte Fehlte ihm schlicht die Zeit, und sie zielte mit aufgesperrtem Maul und Krallen auf seine Kehle. Erschrocken drehte er seinen Körper, sodass das Biest an ihm vorbeiflog und gegen Cybras stieß, ihn umriss, während er die anderen zwei Bestien mit drohendem Schwenken seiner Klinge auf Abstand gehalten hatte.
Der Aufprall überraschte ihn, die Katzen mochte leichtfüßig sein, aber als sie ihn mit vollem Körpereinsatz traf, war es, als ob ein Pferd im vollem Galopp gegen ihn prallte.
Er verlor sofort den Halt und krachte auf die Schulter. Schmerz durchzuckte seinen Arm und einen Teil seines Rückens, kroch durch seinen Nacken hinauf in seinen Schädel, der ungesund dröhnte.
Das Miststück lag auf ihm, Gift und Geifer tropfte von den Reißzähnen und Lefzen auf seine schwarze Rüstung, als sie die Sprunggelenke durchdrückte, um sich aufzurichten.
Er knurrte mit gebleckten Fängen zurück – da schnappte sie zu, schneller als eine Viper.
Cybras riss einen der beiden Dolche aus der Scheide, die auf seine Brust geschnallt waren, und blockte ihren Biss ab, indem er die Klinge in ihr zuschnappendes Maul stieß.
Seinen schnellen luzianischen Reflexen war es zu verdanken, dass sein Gesicht unversehrt blieb. Aber er hatte ihren Atem schon auf der Haut gespürt, heiß und sauer.
Gift und Geifer tropften vermischt mit Blut in seine Augen, während das Biest sich in deinen Dolch verbiss, ungeachtet der Verletzungen, die sie sich zuzog. Sie war wie tollwütig, aber das waren Nachtschattenkatzen immer. Als wären sie zum Töten geboren, als kannten sie keinen Hunger, nur Mordlust.
Sie riss wild den Kopf hin und her und wollte sich durch die Klinge beißen. Sein Arm schmerzte, er brauchte den anderen, um den Dolch nicht zu verlieren. Verzweifelt versuchte er, sie von sich zu treten, doch er hatte nicht genug Freiraum, um Schwung zu holen, sie kam immer wieder zurück. Und er befürchtete, sie könnte vom Dolch abrutschen und ihm an die Kehle gehen, bevor es ihm gelang, sich herumzurollen und sie von sich zu stoßen, um auf die Beine zu kommen.
»Aaaarght!«, knurrte er verbissen, während er in die aufgerissenen tollwütigen Augen der Nachtschattenkatze starrte.
Ihr Gift konnte ihm nichts anhaben, aber ihre verdammten Zähne wollte ihm die Kehle aufreißen und sein sprudelndes Blut trinken.
Nicht gerade das, was er sich für den Abend vorgestellt hatte, aber er musste ja nachsehen, wer da Feuer gemacht hatte, statt einfach weiter zu reiten, um einen Kelch Wein am heimischen Kamin zu schlürfen. Warum musste er sich auch überall einmischen?
Die Wut auf sich selbst verlieh ihm einen Moment genug Kraft, um die Ellenbogen durchzudrücken und die Katze anzuheben.
Tolle Idee, jetzt hieb sie mit den in der Luft baumelnden Tatzen nach seinem Gesicht, mit ausgefahrenen Krallen, um ein paar Verschönerungen zu verpassen.
Plötzlich wurde sie schlaff. Von dem einen, auf dem anderen Moment fiel sie ihm entgegen, doch ihre Wut war verraucht. Langsam wich das Licht aus ihren Augen.
Cybras stieß sie von sich, seine Armmuskeln schmerzten und in seinem Nacken pochte es beunruhigend bis in seinen Kopf.
Das gefiederte Ende ragte aus dem Hals der Bestie.
Er richtete sich auf und fuhr mit den Ledermanschetten, die seinen Unterarm schützten, das Blut-Gift-Geifer-Gemisch aus dem Gesicht.
Der Prinz trat in sein Blickfeld, seine feinen Reitstiefel hatten keinen noch so winzigen Fleck Schmutz an sich.
Warum fiel ihm das auf? In so einem Moment?
»Geht es dir gut?«, wurde er gefragt, er Prinz klang ein wenig außer Atem.
Cybras blickte in diese eisblauen Augen hinauf, die heller als Mond schienen, der über der rechten Schulter des Prinzen durch die knochigen Äste der toten Bäume leuchtete. »Du hast dir ja Zeit gelassen.« Es sollte ein Scherz sein.
Der Prinz zuckte mit den Schultern, als Cybras sich aufrappelte und sich Laub und Erde von der Kleidung klopfte. »Du sahst aus, als hättest du es ihm Griff, ich hab mich erst mal um die gekümmert.« Er nickte an ihm vorbei.
Cybras stockte mitten in der Bewegung und sah ihn an, doch sein Gegenüber schien das ernst zu meinen. Er folgte dem Nicken, sah die beiden übrigen Nachtschattenkatzen gespickt mit Pfeilen sterbend im Lager liegen, und fuhr wieder zu dem Prinzen herum.
Dieser verstand sein Entsetzten nicht, zuckte erneut die Schultern. »Was?«
Bevor er etwas bezüglich Prioritäten erwidern konnte, wurden sie von weiterem Geschnatter unterbrochen. Es klang nun bedrohlicher, wütender und näher, als ihnen lieb war.
Sofort fuhren sie herum, Rücken an Rücken, überall knackten Äste. Cybras bückte sich nach seiner Klinge, der Prinz hielt den Bogen bereit, ihre Augen zuckten über das dunkle Gestrüpp.
Es war ein Dutzend, angelockt durch das sterbende Winseln ihrer Artgenossen. Eine nach der anderen schlichen sie aus der Dunkelheit, mit geduckten Körpern und leuchtenden Augen.
Cybras zog die Lippen über die Fänge und knurrte tief und dunkel zurück, doch das beeindruckte die Bestien nicht. Natürlich nicht. Im Rudel gingen sie sogar auf Bären- und Drachenjungtierjagd. Es gab fast nichts, was diese Kreaturen fürchteten.
Eigentlich waren sie so gut wie tot, aber sein Stolz wollte das Unausweichliche nicht wahrhaben. Sie duckten sich, bereit, den Angriff abzuwehren.
Die Katzen zogen ihren Kreis enger um sie, fauchten sie an. In ihren Augen lag eine solche Intelligenz, eine solche emotionale Lebendigkeit, dass es unheimlich war.
Seine Hände kneteten den mit Leder umwickelten Griff seiner Klinge, sein ganzer Körper war angespannt und bereit, zuzuschlagen. Genauso wie die Bestien.
Die drei vor ihm duckten sich noch tiefer, zogen die Lefzen hoch und setzten zum Sprung an – als sie plötzlich versteinerten.
Cybras, dessen Blut schon in Wallung war, weil er den unausweichlichen Angriff schon kommen gesehen hatte, hätte beinahe in die Luft geschlagen.
»Was ist jetzt?«, flüsterte der Prinz irritiert.
Die Mordlust in den Augen der Bestien verwandelte sich in etwas Tierisches. Sie waren alarmiert. Sie richteten sich auf und ihre fuchsspitzen Ohren richteten sich auf, um zu lauschen.
Cybras versuchte, im Wald etwas zu hören.
Wie auf ein Stichwort kam plötzlich Bewegung in das Rudel und die Bestien sprangen lautlos mit eingezogenen Schwänzen allesamt in eine Richtung in den Wald und verschwanden so schnell und leise, wie sie aufgetaucht waren.
Argwöhnend richtete Cybras sich auf und senkte die Klinge.
Auch der Prinz entspannte sich, drehte sich zu ihm um, und fragte irritiert: »Was war das?«
Cybras verengte die Augen und spähte in den dunkeln Wald. In die Richtung, die die Katzen gemieden hatten. »Sie sind geflüchtet.«
»Aber wovor?«
»Vor etwas, das ihnen Angst macht.«
Der Prinz stutzte. »Ich dachte, ein Rudel von dieser Größte fürchtet höchstens einen-«
»Drache«, stieß Cybras aus.
»Ja, genau, einem ausgewachsenen-«
Cybras packte den Prinzen am Arm und riss ihn mit sich. »Drache!«, zischte er erneut und rammte das Schwert in die Scheide, während er bereits vorwärtspreschte.
Die eisblauen Augen weiteten sich verstehend, als der Prinz ihm nachstolperte. »Du meinst, da ist ein-«
»Drache!«
Was musste er noch tun, damit er verstand? Ihm ein Bild malen? Eine Ballade schreiben?
»Lauf!«, rief er ihm ins Gesicht.
Genau in dem Moment hörten sie das Rauschen am Himmel und das Knacken der Äste, das das Ungetüm irgendwo hinter ihnen in der Nacht im Wald landete. Das Beben konnten sie unter ihren Füßen vibrieren fühlen. Das Blut musste ihn angelockt haben.
Sie blieben stehen, ungewollt, ihre Körper hielten an und sie drehten sich um. Hinter dem Lager erhob sich seine riesige Silhouette. Na toll, es war auch noch einer von den ganzen großen, und wenn er auf dieser Seite der Landkarte unterwegs war, war er vermutlich ein vertriebener Bulle auf der Durchreise, halb ausgehungert und aggressiv.
Und sobald er Cybras wittern würde…
»Lauf«, knurrte er leise dem Prinzen zu. »Und bete.«
Der Prinz war schon herumgewirbelt und rannte. Vom Beten hielt er wirklich nichts, der zukünftige Hohepriester. Cybras nahm die Beine in die Hand und eilte ihm nach, quer durch den Wald.
Der Boden wäre schon bei Tageslicht tückisch gewesen, bei Nacht war es beinahe unmöglich, nicht zu stolpern. Doch wie durch ein Wunder schienen Cybras` Füße zu erahnen, wo eine Wurzel, ein Stein, eine Kuhle lauerten. Er rannte wie ein junges Reh durch den Wald, holte den Prinzen ein, der drei, vier Schritte neben ihm durch den Wald hetzte und dessen weißes Hemd in der Nacht leuchtete wie ein Signalfeuer auf einem verdammten Berggipfel.
»Verfolgt er uns?«, rief er viel zu laut.
Gute Idee, wollte Cybras zurückbrüllen, schrei doch noch ein bisschen lauter, vielleicht hat er uns noch nicht bemerkt.
Da er nicht antwortete, riss der Prinz den Kopf herum und blickte sich nach hinten um.
»Pass auf!«, brüllte Cybras, ungeachtet der Gefahr, den Drachen auf sich aufmerksam zu machen.
Zu spät, der Prinz konnte nur noch den Kopf drehen und erschrocken die Augen weiten, als er auch schon im vollen Lauf mit dem Gesicht gegen einen Ast knallte.
Die Wucht riss seinen Kopf zurück, aber seine Beine rannten noch ein Stück weiter, bis sie vom Boden abhoben. Er vollführte beinahe einen halben Rückwärtssalto. In einem Wanderzirkus wäre er vielleicht besser aufgehoben als in der Kirche…
Fluchend schlug Cybras einen Haken und stürzte zu der Stelle, wo er den Prinzen fallen gesehen hatte. Er ließ sich auf die Knie krachen und blickte auf das weiße Gesicht herab, das im Mondschein plötzlich blass wie Milch war.
Er lag zwischen zwei Wurzeln, die wie Wellen aus dem Waldboden ragten. Der Prinz stöhnte und blinzelte irritiert, seine Nase sah aus, als wäre sie explodiert, umrundet von Blutspritzern. Der rote Lebenssaft floss ihm auch wie kleine Bäche aus den dunklen Löchern seiner kleinen Schweinsnase über die vollen Lippen.
»Alles in Ordnung?«, flüsterte Cybras.
Die Augen des Prinzen verdrehten sich und er kämpfte damit, sie wieder richtig auszurichten, während er sich an den Kopf griff. »Ich… denke schon.«
»Regel Nummer ein, schau immer nach vorne, wenn du nachts durch den Wald gehetzt wirst.«
Der Prinz schien die Worte nicht zu begreifen. »Was?«
Es war beinahe süß, wie er benommen zu ihm aufsah, als … Na ja, als bräuchte er von nun an jemanden, der ihm das Essen kleinschnitt. Beinahe.
Cybras spürte mehr, als dass er es hörte, wie sich der Drache in Bewegung setzte. Wie er den Kopf hob und in der Luft witterte, weil er sie gehört hatte.
Fluchend warf er sich neben den Prinzen auf den Waldboden, zwischen die beiden Wurzeln, die sie zusammendrückten und warf den schwarzen Umhang über sie.
Das überdeckte zwar nicht Geruch, aber mehr blieb ihm gerade nicht übrig.
Doch, hörte er die Stimme seines Vaters, lass den Kleinen liegen und lauf.
Aber er tat es nicht.
»Was machst du da?« Die Stimme des Prinzen strich gemeinsam mit seinem heißen Atem über seine Kehle.
Cybras blickte hinab, selbst unter dem Umhang leuchteten diese Augen. Die Benommenheit ließen sie plötzlich verletzlich wirken.
»Dein weißes Hemd leuchtet heller als der Mond«, entgegnete er und wusste selbst nicht, was seine Stimme plötzlich so abweisend und gereizt gemacht hatte.
Vielleicht die Tatsache, dass er wegen diesem Prinzen gleich gefressen wurde…
Er spürte, dass der Drache seine Aufmerksamkeit auf sie richtete, Äste knackten wieder und Bäume stöhnten, als sie von mächtigen Krallen halb aus den Wurzeln gedrückt wurden.
Cybras legte seine Hand über den Mund des Prinzen. »Sh…«
Die eisblauen Augen wurde riesig, starrten ihn an. Er hielt dem Blick stand, wollte ihn durch seine Ruhe beruhigen. Obwohl ihm das eigene Herz bis zum Hals schlug.
Apropos Herz, Cybras` Arm lag auf der Brust des Blonden und er konnte deutlich das wilde Pochen darin spüren, es mitverfolgen. Und warum wurde ihm davon so heiß?
Er hielt die Luft an, aber nicht, weil der Drache auf jedes Geräusch lauschte, sondern weil ihm der Geruch des Prinzen wieder in die Nase stieg. Und unter dem Umhang wurde er unerträglich stark.
Birnen. Jetzt erkannte er den Duft. Birnenkompott, noch heiß, mit Zucker gekocht…
Er schloss die Augen, Zeit spielte keine Rolle mehr. Er musste die Luft anhalten.
Die Lippen unter seiner Hand vibrierten. Er runzelte die Stirn und blickte auf den Prinzen hinab.
Oh, er zerrte an Cybras` Hand, hatte aber keine Chance. Bittend tippte er ihm mit dem Finger auf seine Knöchel.
Cybras ließ ihn los. »Was?«, flüsterte er scharf.
»Ich glaube, er ist weg«, gab der Prinz leise zurück.
Irritiert lauschte Cybras, konnte nichts mehr hören, schüttelte aber zögernd den Kopf. »So schnell gibt er nicht auf…«
Sie lauschten beide, doch sie konnten nichts mehr hören. Cybras lüftete eine Ecke seines Umhangs und linste in die Nacht. Es war nichts mehr zu sehen.
»Wieso haben wir ihn nicht gehen gehört?«
»Ich habe es gehört«, wandte der Prinz ein.
Cybras spürte seinen forschenden Blick auf seinem Profil.
»Dein überlauter Herzschlag muss mich taub gemacht haben«, behauptete er, lüftete den Umhang und sog die frische Nachtluft in seine Nase. Aber auch das trockene Holz und die Erde konnten den Duft des Prinzen nicht aus seiner Erinnerung vertreiben.
Er stand auf und abermals klopfte er Laub von seinem schwarzen Umhang.
Der Prinz taumelte, als er aufstand. Taumelte sogar sehr gefährlich, wie ein besoffener Seemann, der auf einem Floß stand, das auf riesigen Wellen ritt.
»Geht es dir wirklich gut?«, fragte Cybras skeptisch.
»Was? Oh, ja!« Er torkelte rückwärts, schafftes es, sich umzudrehen. »Bestens. Alles… bestens…«, sagte er, prallte mit der Schulter gegen einen, übergab sich und fiel mit einem dumpfen Plumpsen in Ohnmacht.
Es geschah zu schnell, um ihn aufzufangen.
Cybras seufzte, ließ die Schultern hängen und ging auf ihn zu, starrte auf ihn hinab. »He!« Er trat ihn sanft, doch der Prinz rührte sich nicht. Cybras ging in die Hocke, rüttelte ihn leicht. »Aufwachen, komm schon!«
Nichts. Kein Flattern der Lidern, kein Stöhnen.
Cybras nahm das hübsche Gesicht zwischen die Hände und tätschelte sanft die Wangen, doch der Prinz wachte nicht mehr auf.
Ausatmend blickte Cybras auf ihn herab, legte den Kopf schief und verengte die Augen, während er ihn einen Moment lang einfach nur betrachtete.
Und dann eine Entscheidung traf.
Seufzend warf er sich den bewusstlosen Prinzen über die Schulter wie ein erlegtes Reh, stand geschmeidig auf und ging.
Kapitel 2
Eisland
Eine Fontäne aus blutfeuchter Erde erfasste ihn gemeinsam mit dem unsichtbaren Schlag, der ihn aus dem Stand von den Beinen riss und zurückschleuderte. Wie ein Ast, der von einem Sturmwind erfasst wurde, wirbelte er durch die Luft, als wöge er nicht mehr als ein Stück Laub. Hart kam er auf, der Schmerz presste den Atem aus seinem Leib und brannte sich durch seine Schulter in die Rippen. Wie eine Klinge, die ihm die Seite aufgeschlitzt hatte. Er überschlug sich, fraß Matsch und spürte ein ekelerregendes Knacken in den Halswirbeln.
Schmutz rieselte auf ihn nieder, als er endlich zum Erliegen gekommen war, und für einen Moment spürte er nichts. Rein gar nichts, keinen Schmerz, nur einen Übelkeit erregenden Druck im Kopf und Nacken, und für einen furchtbaren Moment glaubte er, gelähmt zu sein. Vielleicht hatte er sich das Genick gebrochen.
In Balthasars Ohren klingelte es, die Welt verschwamm vor seinen Augen. Plötzlich war er taub und so gut wie blind. Die Szenerie war zu einer graubraunen Masse verschmolzen, nicht mehr als eine verschwommene Leinwand. Dann spürte er es, das heiße Ziehen des Schmerzes, das sich langsam von seinem Nacken in den Rücken und in jede Extremitäten ausbreitete. Wie Gift.
Doch der Schmerz beruhigte ihn. Beflügelte ihn. Trotzdem kostete es ihn eine beinahe nicht aufzubietende körperliche und willentliche Kraft, sich auch nur halbwegs aufzurichten.
Balthasar blinzelte, er presste sich seinen vom Matsch und Blut verschmutzten Handballen an die Schläfe. Sein Gesicht war von Erde und blutroten Spritzern besprenkelt. Nicht, dass es ihn gekümmert hätte, wie er aussah.
Blinzelnd drehte er sich herum, versuchte benommen, auf die Knie zu kommen. Durch das Klingeln in seinen Ohren vernahm er das Brüllen seiner Männer. Warme Leuchtpunkte durchzogen den Himmel wie fallende Sterne. Pfeilhagel. Er ging auf seine Leute nieder. Mehr Schreie, mehr Gebrüll.
Balthasar schüttelte den Kopf, versuchte, zu sich zu kommen.
Rauch kitzelte in seiner feinen Nase, dunkle Schwaden stiegen hier und dort vom Schlachtfeld auf. Um ihn herum zogen sich seine Männer plötzlich immer weiter zurück. Balthasar lag zwischen Leichen, die meisten davon zerfetzt. Dort ein Arm, hier ein Fuß, neben ihm eine abgerissene Hand, die noch eine Klinge umklammerte. Überall Stöhnen, Wimmern, ehrloses Weinen.
Er zuckte zusammen, als dicht an seinem Ohr ein Pfeil vorbeizischte, und rollte sich durch den Schmutz, das Blut, die Leichenteile.
Es stank. Es stank so finster, wie nur Kriege stinken konnten. Nach Tod, nach Verzweiflung. Doch es lag noch ein anderer Gestank in der Luft. Magie. Sie knisterte ihnen von den gegnerischen Linien entgegen, erhellte den grauen Himmel und sprengte die Erde, sodass mehr Männer wie er zurückgeschleudert wurden, als wären sie bloß Puppen ohne großes Gewicht oder Körperspannung.
Das Schlachtfeld war eine offene Ebene, von Stiefeln und Nässe zertretener, aufgeweichter Boden, blutgetränkter Matsch, mehr Sumpf als Feld.
Und im Dreck starben seine Leute. Seine verdammten Leute.
Wut erfasste ihn wie ein Leuchtfeuer in der Dunkelheit, rot, glühend, heiß, gab ihm Kraft, sich zu fokussieren. Er entdeckte neben sich sein Schwert Nachtauge, als wäre es ihm gefolgt, als flüsterte es ihm zu. Die schwarze Klinge steckte halb im Boden, das dämonische Auge, das ins Heft eingearbeitet war, blinzelte ihm entgegen, als fragte es, ob es frei wäre.
»Noch nicht, alter Freund«, knurrte er, packte Nachtauge und riss es aus dem schlammigen Boden.
Der schwarze Stahl saugte das Blut in sich auf, das die Erde getränkt hatte. Es war dem Schwert gleich, ob es das Blut der eigenen Leute war. Seine Stärke floss über Balthasars Arm in sein Herz und gab ihm die Kraft, aufzustehen.
Er taumelte auf die Füße, doch alles drehte sich. Der Schmerz in der Seite ließ ihn kaum Atem schöpfen, und die Schulter, an jener seine Schwerthand hing, ließ kaum eine Bewegung zu, ohne dass der Schmerz so stark wurde, dass er sich fast übergeben musste.
Ein Hagel aus flammenden Pfeilen erhellte über ihm den Himmel. Er bleckte die Fänge und torkelte knurrend rückwärts. Mehr als das blieb ihm nicht übrig, er konnte nicht rennen, er … konnte einfach nicht. Trotz der Wut, trotz der Kraft aus der Klinge – er war eben trotz allem nur ein Sterblicher.
Das würden seine Feinde an jenem Tag, in jenem verfluchten Moment beweisen.
Neben ihm schlug ein Feuerball ein, beschworen von einer der verdammten Hexen auf der Gegenseite. Er riss den Kopf herum, sah die Erde aufwallen als wäre ein Geysir neben ihm explodiert, als ihn plötzlich ein freilaufender Hengst im vollem Lauf von hinten rammte und zu Boden stieß.
Hart schlug er mit dem Kinn in den eiskalten Matsch, sodass die Zähne aufeinander krachten und seine Halswirbel erneut protestierten. Abermals verlor er Nachtauge, abermals war er für einen Moment taub und blind.
Ein Gewicht so unüberwindlich wie ein Stier drückte ihn zu Boden, verdunkelte den Himmel. Dumpf schlugen die Pfeile in Holz.
Das Geräusch kannte er. Zu gut.
Balthasar blinzelte, doch er konnte nur das Feld vor sich sehen. Wo Rauch von den angezündetem Laub, das in den Löchern brannte, die sie gegraben hatten, die Sicht versperrte.
»Bogenschützen!«, brüllte jemand über ihm. »Haltet sie uns vom Leib.«
»Die Hexen«, hörte Balthasar sich sagen, »tötet die verdammten Hexen.«
Er wollte es brüllen, aber er war nicht einmal sicher, ob die Worte überhaupt über seine Lippen kamen. Wenn er zu sprechen versuchte, überkam ihn plötzlich eine unüberwindbare Schwäche, als ob sein sterblicher Körper endgültig aufgeben wollte.
Er kämpfte mühsam gegen den Sog der Ohnmacht.
Wind fegte sanft über das dampfende Schlachtfeld und lichtete einen Moment für beide Seiten die Sicht. Balthasar entdeckte den Kopf der verdammten Schlange, den Kommandanten des Feindes, auf seinem feinen weißen Ross, mit einem federbesetzten Helm und in glänzender Blechrüstung, wie er das Schwert schwenkte und Befehle gab. Wie sich hinter ihm fünf Magiebegabte aufreihten und magische Schilde beschworen, die die Pfeile seiner Männer abwehrten.
In seinem ganzen Leben hatte er niemals so einen Hass verspürt. Solch einen kalten, unberechenbaren Hass, solch eine Mordlust. Das hier war sein Land, er hatte es entdeckt, er hatte es bezwungen. Er würde es nicht diesen Spitzohren überlassen. Niemals! Sollten sie doch in ihrem verdammten Regenwald bleiben, der Norden gehörte ihm! Ihm allein! Sie kamen einfach hierher und glaubten, sie könnten sich nehmen, was er und seine Männer entdeckt und zu ihrem Zuhause gemacht hatten, nur weil sie eine Übermacht hatten.
Balthasar hatte nicht einmal die Dämonen so sehr gehasst wie diese verdammten Elkanasai mit ihren verdammten spitzen Ohren und ihrer Arroganz, seit sie es gewagt hatten, einen Fuß in dieses Land zu setzen.
Etwas riss ihn auf die Beine, als er sich noch in seinen Zorn steigerte. Der vermeintliche Hengst war ein Mann. Sein Mann. Skraemd. Er brüllte ihm etwas ins Gesicht. Sein welliges braunes Haar klebte an den ausgeprägten Wangen und Stirn, die vor Blut und Dreck bedeckt waren, wie der Rest von ihm. Wie der Rest von ihnen allen. Er schüttelte Balthasar. »Balt! Du musst hier weg!«
Balthasar überhörte die Worte, als wären sie nicht mehr als ein Vorschlag gewesen.
»Meine Klinge!«, verlangte er, stieß den Mann von sich, verlor das Gleichgewicht und taumelte über die Leichenteile. Pfeile und Zauber schlugen neben ihm in den Boden, er knickte um und landete im Dreck. Wie durch Zufall direkt neben seinem Schwert. Doch es war kein Zufall, das wusste er, Nachtauge fand immer zu ihm zurück. Immer. Sein Fluch, sein Segen.
Er packte die Klinge gerade wieder, als eine kräftige Hand seinen Arm umfasste und ihn auf die Füße riss. Es war der verletzte Arm, er schrie auf, als der Schmerz durch ihn hindurchzuckte, als hätte ihn ein verdammter Blitz erfasst.
»Rückzug«, schrie Skrae den Männern zu, als er Balthasar an seine Brust riss. »Zieht euch zurück! Zum Wald!«
Balthasar spürte einen Widerwillen gegen diesen Befehl, als ob sein Getreuer ihnen befohlen hätte, dem Feind den Arsch anzubieten. »Nein!«, brüllte er dazwischen und wollte sich losreißen. »Ich töte ihn! Ich töte diesen Hurensohn! Ich töte sie alle.«
Skrae war stark, Balthasar war verletzt, was letztlich vielleicht ihr beider Glück war. Er riss ihn zurück, hatte aber nicht damit gerechnet, dass Balthasar so schwach war, dass er quasi keinen Widerstand bieten konnte, und sie prallten zusammen wie Hammer und Amboss. Ungewollt riss Balthasar den Hünen zu Boden. Zwei Arme so dick wie Baumstämme schlossen sich um seinen Leib, und ehe er sich versah, lag er unter Skrae, der sich schützend über ihn gerollt hatte. Sein Schild, sein lebendiger und riesiger Schild. Bereit, für ihn zu sterben, sein Leben für ihn zu geben.
Neben ihnen schlugen die Pfeile in den Boden, mit schmatzenden Lauten, als ob die Erde seines Landes hungrig wäre. Das Feuer erstickte, es roch nach Pech.
Er wartete darauf, dass Skrae zusammenzuckte, dass er vor Schmerz versteifte, dass sein massiver Körper über ihm erschlaffte und ihn noch tiefer in den Matsch drückte.
Der Schmerz in seinem Arm wurde unerträglich, weil Skare die Arme zu fest um ihn zog. Weil die Schulter verdreht war. Weil sie verfickt noch mal im Dreck lagen und sterben würden.
Eine kaum überwindbare Übelkeit erfasste ihn, schwarze Punkte tanzten vor seinen Augen.
Plötzlich hob Skrae den Kopf, sein schulterlanges Haar hüllte sie wie ein gewellter, schmutziger Vorhang ein. Erst da begriff Balthasar, dass er nicht tot war. Zwei sehr lebendige braune Augen blickten auf ihn herab. Die hatte der Mistkerl von seinem Vater geerbt, aber in seinem kantigen und charakteristischer Gesicht machten sie viel mehr her.
Neben ihm stampften Stiefel durch den Match, dem Feind ein Stück entgegen, um ihnen den Rückzug zu ermöglichen.
»Du musst hier raus«, sagte Skrae angesichts der Situation unangebracht ruhig. »Wir müssen dich in Sicherheit bringen.«
Balthasar presste die Lippen aufeinander. Aufgeben lag nicht in seiner Natur. Er war nur dreimal vor einer Schlacht geflohen, und das auch nur, weil sein Vater es befohlen hatte. Damals, gegen die Dämonen.
»Ich flüchte nicht vor Sterblichen!«
»Hier endet es nicht, Balt! Wir werden ihnen diesen kleinen Sieg wieder abnehmen!« Skrae ließ keine Widerrede zu, er erhob sich und riss Balthasar auf die Beine. Drei, zwei Herzschläge stand er, ging zwei Schritte, bis ihm einfach die Beine wegknickten. Sofort war Skrae da, fing ihn auf und legte sich seinen Arm um die Schultern, während er seine Taille umfasste und mit sich durch die Leichen zog, hinter das Schlachtfeld. »Nur nicht heute.«
Verdammt, dachte Balthasar, er musste irgendwo bluten. Irgendwo. Seine Kräfte schwanden, seine Sicht verschwamm. Er spürte nur noch ein taubes Prickeln in Armen und Beinen, alles wirkte wie ein Traum.
Schweres Hufgetrampel näherte sich, schmatzte auf der feuchten Erde. Hinter ihren Linien wartete ein schneeweißer Wald, die Tannen weiß gepudert. Beinahe ein friedlicher Anblick.
»Zu den Höhlen«, Skrae bugsierte Balthasar zu dem schwarzen Hengst, der vor ihnen hielt und den Kopf hoch und runter warf, als wollte er sich beschweren. »Du musst leben, ohne dich ist alles verloren!«
Balthasar löste sich von seinem Krieger und zog sich auf den starken Rücken seines Schlachtrosses. Eine Art Prozession aus in Wolfsfälle gewickelter, bis an die Zähne bewaffneter Krieger eilte in Richtung Bäume wie ein Vogelschwarm.
Balthasar konnte kaum aufrecht sitzen, nahm die Zügel auf und nickte Skrae zu.
Dieser erwiderte die Geste. »Rückzug!«, brüllte er dann und schlug nebenbei die flachte Seite der Klinge auf den Hintern von Balthasars Pferd, das mit einem Satz nach vorne Sprang und ihn forttrug, auf dass Erde unter den gewaltigen Hufen aufspritzte.
Balthasar biss die Zähne grimmig zusammen, schluckte die Niederlage und krallte sich an den Sattel.
»Pfeilhagel«, brüllte jemand seiner Männer plötzlich hinter ihm. »Und Reiter! Sie kommen uns nach!«
Er fuhr herum, während der Hengst sich nicht mehr anhalten ließ.
Skrae war bereits losgerannt, zurück aufs Schlachtfeld, um ihren Männern den Rücken zu decken. »Schildwall! Schildwall!«, brüllte er und sprang ihnen bei, klaubte einen Schild vom Boden auf und fing damit die Pfeile ab, schlug den Schild nach dem Kopf eines Pferdes, das ihn beinahe über den Haufen rannte, schlitzte ihm die Seite und dem Reiter das Bein auf. Dann wirbelte er herum, zuckte vor einem anderen Pferd zurück, stach nach diesem. Duckte sich unter einem Hieb hindurch, gewandt für jemanden seiner Masse.
Balthasar riss an den Zügeln, aber der Hengst rannte weiter, legte die Ohren zurück und rannte mit geblähten Nüstern. Sturer als jeder Esel. Der Hengst kannte seine Pflicht. Ihn, den Erben, zu beschützen.
Balthasar brüllte seinen ganzen Frust heraus, er wollte abspringen, doch er wusste, er hätte sich damit noch mehr verletzt. Seine Männer rannten ihm nach, Skrae stand allein in einer Flutwelle aus Reitern, die ihn bald verschluckte. Ein Pferd rammte ihn, er wirbelte herum, der Schild flog ihm aus der Hand, ein Pfeil traf seinen Rücken und Balthasar sah ihn zwischen die Leichen stürzen. Dann erreichte er selbst den Wald und Bäume versperrten ihm die Sicht.
Vielleicht lag es an den Schmerzen, an der Schwäche in seinem Leib, aber plötzlich hatte er ein ganz seltsames Gefühl im Herzen. Fast so, als ob es sich zusammenzog und blutete.
*
Er wusste nicht, wie er den harten und schnellen Ritt in seinem Zustand überhaupt überlebte. Immer wieder wurde ihm schwarz vor Augen und er drohte, runterzufallen. Nur das Bild, wie Skrae mit dem Gesicht voran zu Boden ging und die Reiter des Feindes über ihn hinweggaloppierten, hielten ihn wach. Die Wut, der Unglaube.
Man hatte ihm Nohva geraubt, jetzt wollte man ihm den Norden rauben – und die letzten Männer, die ihm treu gewesen waren.
Es war eine Art Verzweiflung, tief und dunkel, die seinen Schmerz betäubte und ihn nicht aus dem Sattel stürzen ließ. Er erbrach sich vom Pferd aus, klammerte sich aber eisern an die pechschwarze Mähne.
Seine Männer konnten nicht so schnell rennen wie der Hengst, sie waren irgendwo hinter ihm im Wald zurückgeblieben, auf Bäume gestiegen, und würden den Feind abwehren.
Die Höhlen, die ihnen in den letzten Jahren ein Zuhause geworden waren, tauchten in einer Schlucht mitten im Wald auf. Der Hengst ging geübt den gewundenen Steinpfad hinab. Zelte befanden sich vor den drei großen Eingängen, die in den grauen Felsen führten. Von Feuern stieg Rauch auf. Die Frauen und Günstlinge der Männer erhoben sich, kaum, dass sie ihn sahen. Sie eilten ihm entgegen und löcherten ihn mit Fragen, halfen ihm aus dem Sattel. Ihm, ihrem Anführer, den sie nie hatten verletzt gesehen. Der nie gefallen war.
Er spürte und er sah wie entsetzt sie ob seines Anblicks waren, so blass und schwächlich, so schwankend und benommen. Er konnte ihre Angst beinahe in der Luft schmecken, wie Säure.
Genervt machte er sich von den vielen Händen los, die ihn zu einem warmen Lager bringen wollten, die Schamanen zu sich riefen, Knechte umhertrieben, damit sie Tücher kochten.
Es gab nur eines, was er seit Stunden tun wollte. Wütend packte er die Zügel des Hengstes, sodass der Bursche, der das Tier wegbringen und versorgen wollte, zurückzuckte.
Balthasar zog den schwarzen Kopf grob zu sich herum, hakte sich in die Trense. Der Hengst versuchte, sich zu befreien, blähte die Nüstern und legte wie jedes Mal, wenn Balthasar ihm direkt in die Augen starrte, die Ohren warnend zurück.