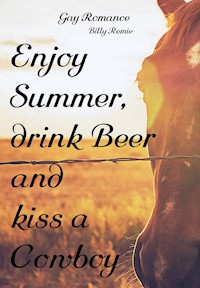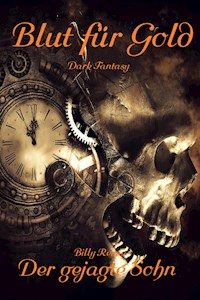4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Bruderschaft (6)
- Sprache: Deutsch
Die sterbliche Welt droht in Blut zu ertrinken, während der magische Schleier von Fäule zerfressen wird. Alle stehen vor Wendepunkten. Melecay muss entscheiden, ob er auf seinen blutigen Pfaden weiter wandelt – oder ob nach all der Zeit unter seiner Wut doch noch so etwas wie ein Herz schlägt. Wexmell steht zwischen Moral und Pflicht. Xaiths Herz wird von den Göttern geprüft: Alte oder neue Liebe? Derrick wird vor die Wahl gestellt, zu kämpfen oder Gefangener zu sein. Sarsar weiß nicht, ob er den Weg der Vergebung oder Rache gehen soll – und sucht sein wahres Ich. Riath tut sich schwer damit, der eigenen Familie zu trauen, während Kacey zwischen Hass und Angst gefangen bleibt. Die Dunkelheit breitet sich in allen Herzen aus – und erhebt sich in jedem Reich. Doch der Schöpfer selbst besitzt eine Karte, die er noch nicht ausgespielt hat. Sie hat allerdings zwei ungleiche Seiten, und es gibt nur einen, der entscheiden kann, welche davon oben liegt. Sterblichkeit – oder doch Göttlichkeit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1193
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Billy Remie
Geliebte Brüder
Die Bande des Blutes
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Was bisher geschah…
Prolog
Teil 1: Blutsbande
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Teil 2: Kampf der Brüder
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Teil 3: Riss der Blutsbande
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Epilog
Impressum neobooks
Was bisher geschah…
(Zur Auffrischung der Leser, aber es macht trotzdem nur Sinn, wenn man die Reihe gelesen hat.)
Acht Jahre sind vergangen, seit Desiderius sich in Zadest geopfert hat, damit sein Sohn Sarsar genug magische Kraft bekam, um die fremde Magie aus einer anderen Welt zu bannen und in den damals Anwesenden einzuschließen. Seit dem sind Sarsar und neun weitere Männer wie Gefäße, die je ein Teil dieser gefährlichen Macht in sich eingeschlossen haben. Dazu zählen Sarsar selbst, Korah (göttliches Licht, vom Gott der Meere Levi und Fürst der Unterwelt Bellzazar erschaffen), Place (ein Wächter und Spion aus der fremden Welt, der in ihrer Welt zurückblieb), Doragon (Blutdrache und leiblicher Sohn von Desiderius` und Rahff, dem Älteren; von einem Vogelzwitter geboren, niemand weiß von seiner Abstammung), Xaith (leiblicher Sohn von Desiderius, Prinz von Nohva), Riath (leiblicher Sohn von Desiderius, Prinz von Nohva), Vaaks (Leiblicher Sohn von Cohen Youri und Halbbruder von Marks Youri, Riaths rechter Hand, aufgewachsen bei Desiderius als Sohn und (Zieh-)Bruder von Xaith, Riath und Sarsar), Kacey (Kareth Airynn, Enkel von Wexmell, Bastard von Eagle Airynn, Kaiser von Elkanasai), Desith (ehelicher Sohn von Eagle Airynn, nun König von Grent, Vasall von Großkönig Melecay, verheiratet mit Vynsu, Bruder von Kacey, Enkel von Wexmell), Derrick (Halbdämon, Ziehsohn von Melecay, Blutdrache seit Sarsar ihm das Leben rettete, indem er ihm eine Drachenseele einpflanzte).
Zehn Männer, durch ein Schicksal geeint, aber jeder kämpft für sich.
-Riath zettelte einen Bürgerkrieg in Carapuhr an, verführte dabei Desiths Zwillingsschwester Lohna, die mit Vynsu verheiratet war, und bekam Kinder mit ihr. Sie starb bei der Geburt, was Desith Riath nicht verzieh, weshalb er ihn hasst.
-Als Riath in Elkanasai auftauchte, stachelte er die Magier gegen den Kaiser auf. Doch er geriet in Gefangenschaft und sollte hingerichtet werden. Das ließ Wexmell jedoch nicht zu, immerhin ist Riath Desiderius` Sohn, also half er Riath und Kacey und setzte Kacey als Kaiser ein. Was Melecay mit seinem inszenierten Anschlag auf Eagle jedoch verhinderte. Melecay übernahm kurz die Macht und vernichtete auch den Rat. Sodass das Kaiserreich allein dem Kaiser unterstellt ist.
-Doch Eagle war mit einem Zauber belegt und wachte wieder auf, sodass sie den angeblichen Anschlag gemeinsam Riath anhingen. (Um den Hass des Volkes auf Riath zu schüren)
-Melecay versucht Riath von Nohvas Krone fernzuhalten, deshalb setzt er Wexmell mit Krieg unter Druck. Entweder Wexmell stellt sich gegen Riath und liefert ihn ans Messer – oder Melecay reist Nohva gewaltsam an sich, damit Riath niemals an Macht gewinnt.
-Riath hat endlich seinen Kacey für sich gewonnen – und mit ihm die Loyalität beinahe aller Magier, die mit ihnen zu den freien Inselstaaten flüchteten.
-Xaith hat den Versuch aufgegeben, Desiderius zum Leben zu erwecken, als er vor die Wahl gestellt wurde, Jin oder seinen Vater zu retten. Er ist zurück nach Nohva gegangen, wo Wexmell ihn freudig empfangen hat. Und wo er Jin seine Liebe gestand.
-Sarsar wurde vor acht Jahren von Riath in den Tod gestoßen, tauchte vor einigen Monaten in Zadest wieder auf und ist seitdem bei den Frauenstämmen in Gefangenschaft.
-Xaith entdeckte eine seltsame Fäule im Schleier, kurz darauf taten sich in Nohva Risse auf und das Volk erkrankte an einer Seuche, die nur durch das Schließen der Risse einzudämmen ist.
-Kacey wurde von Dainty gefangen genommen und gefoltert, weil dieser von einem Licht besessen war, das Kacey mit Xaith im Liebesakt erschuf. Riath konnte ihn befreien, doch als sie in Malahnest gegen Xaith und Desiths kämpften, stahl Xaith das Licht und nahm es mit.
-Wexmell war derweil nicht untätig, er enttarnte einen Spion im eigenem Bett, nutzte Vaaks´, um Dainty in seine Gefangenschaft zu bringen, womit er nun Eagles Familie und Melecays Prinzgemahl gegen die beiden einsetzen kann.
-Auf der Insel Malahnest versuchte Xaith zuletzt mit einem uralten Zauber und vier versteinerten Dracheneiern seinen Vater wieder zu erwecken, Desith verbündete sich kurzzeitig mit ihm, weil er Riath abfangen wollte, der hinter Xaith her war, um ihn von dem Zauber abzuhalten. Bei dem Kampf starb Desith fast, Xaith rettete ihm das Leben und zerschnitt Riaths Augen, durch ein Feenportal gelangten sie nach Carapuhr, wo Desith die Eier für den Zauber zur Sicherheit aufbewahren wollte. Doch sie verschwanden gemeinsam mit Vynsus Mutter Karrah (Ziehtochter von Desiderius, Schwägerin von Melecay).
-Desith ließ Xaith im Guten ziehen, doch Melecays Befehl lautet, dass Desith und Vynsu gemeinsam mit ihm gegen Nohva in den Krieg ziehen.
-In Nohva angekommen, weiht Wexmell Xaith dann in ein folgenschweres Geheimnis ein, das Wexmell all die Monate allein getragen hat: Riaths erstgeborene Tochter (Prinzessin Desiderius „Esi“) ist bei Melecays Angriff nicht getötet worden, sie lebt und Wexmell hält sie versteckt…
(Ich hoffe, ich konnte alle wichtigen Fäden noch einmal auffrischen, doch wie immer habe ich versucht, notwendiges Hintergrundwissen hier und dort kurz und knapp in die Geschichte einzufügen und an den gegebenen Stellen aufzufrischen.)
Nun viel Spaß beim Lesen ;)
Ps.: Ich habe derzeit immer noch Probleme mit Amazon. Eine vollständige Auflistung all meiner Bücher gibt es deshalb leider nur bei Weltbild.
Es tut mir sehr leid.
Prolog
Das Feuer knackte im offenem Kamin, das Zimmer roch nach Rauch und Pelzen. Tierhäute und Felle bedeckten die Wände zum Schutz vor der Kälte, draußen tobte erneut ein eisiger Sturm und heulte in der Nacht wie ein einsamer Wolf.
Sie schwiegen, schwelgten, liebten.
Ihre Münder im Kuss vereint. Zärtlich, hungrig, verzweifelt. Bittersüße Erleichterung wogte durch ihre Körper, jede Berührung eine Absolution.
Schweiß bedeckte sie hinterher, der Akt so lautlos geendet wie begonnen, nur tiefer und zufriedener Atem erfüllte die Stille danach.
Sanft strichen die Fingerspitzen über seine Wirbelsäule, die granitharte Brust unter ihm hob und senkte sich, drückte ihn hoch und ließ ihn sanft wieder nieder. Für nichts würde er in diesem Moment aufstehen wollen. Ihre muskulösen Beine rieben sich aneinander, Felldecken umschlagen sie halb. Der Wind kreischte durch den Kamin und ein glühender Holzscheit brach knisternd auseinander, Funken vergingen wie Glühwürmchen, sie spiegelten sich in seinen Augen.
»Tu mir das nie wieder an«, flüsterte Jori ihm zu. In seiner dunklen Barbarenstimme klang kein Tadel, nur der Schock.
Bragi hob das lädierte Gesicht, es schillerte noch in allen Farben und zeugte von dem Kampf, der Meilen entfernt von ihrem sicheren Zuhause stattgefunden hatte. Er lächelte schief, frech, so wie es ihm eigen war, seine herabhängenden Spitzohren zuckten erregt. »Du sorgst dich«, hauchte er und legte die Fingerspitzen über Joris warmen Mund, spürte seinen Atem. »Das heißt, du liebst mich!«
Jori atmete tief ein und legte behutsam seine großen Hände um Bragis langes, schmales Gesicht, das er dem Elkanasaiblut in seinen Venen zu verdanken hatte. »Das war dumm!«
»Es war Desiths´ Befehl«, er nahm die Fingerspitzen von den Lippen seines Geliebten und zog versöhnlich Kreise auf seiner nackten, behaarten Brust. »Ich habe nur getan, was unser König mir befohlen hat.«
Mit ernster Miene strich Jori ihm das Haar hinter das lange Ohr. »Du hättest es mir sagen müssen!«
»Auch das war ein Befehl.« Bragi grinste schief. »Du bist Vyns bester Freund, du hättest ihm von Desiths Plan erzählt und er hätte Desith aufgehalten.«
Jori brummte nur. Ein Schuldeingeständnis. Grübelnd streichelte er durch Bragis Haar und betrachtete sein Gesicht, als würde er jede einzelne Schwellung bedauern. Als wäre all das sein Fehler, sein Verschulden.
Bragi schob sich über Joris Brust nach oben, bis ihre Münder verheißungsvoll übereinander schwebten. »Ich werde dich die ganze Nacht lieben, bis du endlich aufhörst so zu schauen, als läge ich in einem kalten Loch, denn das tue ich noch nicht, und du auch nicht. Nicht, bevor wir Ruhm und Ehre im Kampf erlangten und unsere Namen unsterblich werden, so wie Vyns und Desiths!«
Er hatte poetisch sein wollen, war im wilden Carapuhr geboren und aufgewachsen und kannte die Herzen der Männer, der Krieger. Doch auf Joris Gesicht trat nur Sorge.
Bragi verzog den Mund zu einem warmen Ausdruck. »Du bist eine harte Nuss, mein Ernster.«
Das brachte doch tatsächlich so etwas wie ein heiteres Funkeln in Joris dunkle Augen.
Sie küssten sich, verloren jedes Gefühl bis auf die Zuneigung füreinander. Jede Verfehlung, jedes Geheimnis, jeder Schmerz längst vergessen, verziehen.
Ob Jori auch nur ansatzweise ahnte, wie sehr er ihn liebte? Dass er für ihn sterben würde, dass er sich das Leben nehmen würde, sollte ihm je etwas zustoßen, nur um bei ihm zu sein? Dass sein verdammtes Diebesherz nur für ihn schlug und er der einzige Grund war, hier zu sein?
Es war Junas Bellen, das sie auseinanderfahren ließ. Sie war plötzlich von ihrem Platz neben dem Kamin aufgesprungen und bellte die Tür an.
Jori und Bragi sprangen auseinander. Der Barbar griff zum Schwert, Bragi zur Armbrust, beide noch immer nackt. Sie hatten gelernt, niemals – auch im eigenen Bett – unvorsichtig zu werden.
Er rannte ihnen die Tür ein, sie war nicht verriegelt. Schnee wirbelte in ihre bescheidene Behausung neben den Ställen, der Mond schien herein und eisiger Wind heulte durch das Zimmer. Im Rahmen hing ein riesiger Schatten, der es seinem starken Schwanken verdankte, dass Bragis Bolzen knapp an seinem Augen vorbeiflog und im Schneesturm verloren ging.
Sie senkten sprachlos die Waffen. Juna verstummte und ging geduckt und schwanzwedelnd auf den nächtlichen Eindringling zu.
Er stolperte herein, Schnee bedeckte seinen Bärenpelz und sein dunkles Haar. Die Lederrüstung starrte vor Blut und Schmutz, tiefe Kratzer zierten seine Brust, sein Gesicht war verkrustet. Es musste mindestens ein Eisbär gewesen sein, der ihn angegriffen hatte. Vor Tagen, vor Wochen schon…
»Scheiße, Bruder!« Jori ließ das Schwert fallen und fing ihn auf. Beinahe gaben seine Beine unter dem Gewicht des Riesen nach. Er bugsierte ihn zum Bett, sie fielen beide darauf.
Rurik schluckte, stammelte: »Ein Monster… Brüder… ein Monster… Sie haben ein Monster geschickt.«
Bragi senkte die Armbrust, er hatte nur einen Gedanken: »Wo ist Prinzgemahl Dainty?«
Doch der Riese schüttelte nur den Kopf, hielt sich die klaffende Seite. »Ein Monster«, stammelte er weiter, »eine Bestie… sie… sie haben ihn… mitgenommen… meine Brüder… eine Bestie… aus Nohva… hat ihn geholt… Eine Bestie… Brüder…«
Bragi legte die Armbrust über die Schulter und tauschte einen Blick mit Jori.
»Ein wildes Biest«, brabbelte der Riese weiter und sank mit dem Gesicht erschöpft in ihre Kissen. »Es hat… es hat mich… fast gehabt… Eine Bestie, Brüder, eine Bestie…aus Nohva. Sie haben eine Bestie.«
Teil 1: Blutsbande
Die Söhne, die mich riefen.
Der Geliebte, der mich nicht losließ.
Die Welt, die durch mich atmet.
Ich öffnete die Augen – und alles war verändert.
Kapitel 1
Der silberne Mond hing groß und leuchtend am Nachthimmel, schimmerte silbern durch die hohen und dichten Tannen und ließ die dicke Schneedecke leuchten, die das gesamte Gebirge wie einen Teppich bedeckte und alles unter sich begraben hatte.
Zwischen den vom Frost befallenen Stämme der Bäume schlängelte sich die halb verwischte Spur einer Hirschkuh. Vaaks verfolgte sie seit dem frühen Abend, er konnte sie im sachten Wind wittern, der ihm entgegenwehte und seine dunklen Locken aus seinem Gesicht strich. Geduckt und mit Pfeil und Bogen in den Händen folgte er der Hirschkuh in den dichten Wald, immer tiefer, bis selbst das silberne Schimmern des Mondes kaum noch gegen die Dunkelheit ankam.
Lange hatte er sie beobachtet, um sicher zu gehen, dass sie nicht noch ein Kitz zu versorgen hatte. Im Winter rechnete er nicht damit, aber es war nicht unmöglich und er wollte nicht für zwei Tode verantwortlich sein. Doch er musste auch essen.
Sie schien gänzlich allein, hinkte ein wenig mit dem rechten Hinterlauf, er konnte es an den leichten Schleifspuren im Schnee erkennen.
Die Wölfe waren hinter ihr her, ein Rudel hatte von ihr abgelassen, als sie ihn gewittert hatten, doch ein anderes Rudel tauchte im Süden auf dem Berghang auf wie lautlose Naturgeister. Ihre Höhle musste in der Nähe sein. Junge Rüden waren neugierig, sie ließen sich nicht allein durch seine Anwesenheit abschrecken, eher wurden sie davon sogar angelockt.
Vaaks begegnete ihnen am Rande einer winzigen Lichtung. Ihre Augen leuchteten wie von mystischen Wächtern aus dem Dunkel zwischen den Bäumen heraus, als sie ihn begutachteten.
Ihre Geister zerrten an seinem Geist, seine Familiengabe schlug aus, die jungen Rüden waren offen für die Jägerbindung. Doch er durchschnitt sie eisern. Es schmerzte, als ob dicht unter der Haut eine Sehne riss, gefolgt von dem Gefühl tiefer Einsamkeit. Doch daran hatte er sich gewöhnt.
Die jungen Wölfe heulten, als riefen sie nach ihm, als protestierten sie. Es kratzte in seiner Brust, ein Brennen erfasste seine Venen. Er kämpfte dagegen an, doch er war machtlos. Bogen und Pfeil fielen in den Schnee, und als sein Brüllen erklang, übertönte es den Gesang des jungen Rudels, dunkel und kraftvoll, aber ebenso düster und unkontrolliert. Die Wölfe zogen die Schwänze ein und verschwanden anstandslos. Die Hirschkuh fiel den Klauen zum Opfer. Es blieb nur wenig von ihr übrig.
*~*~*
Ich bestehe aus Erinnerung. Das ist jetzt mein Dasein. Ich bin nur noch ein Gedanke nach dem anderen, ein Bild, ein Geruch. Mehr nehme ich nicht wahr. Wenn ich mich konzentriere, kann ich Erinnerungen aufleben lassen, als wäre ich wieder dort, doch meistens bevorzuge ich es, nicht mehr zu sein.
Es ist friedlich, dieses Dasein als Erinnerung. Ich treibe mal hierhin und dorthin. Ich bin nicht allein, ich spüre die anderen, sie waren und sie sind Familie. Die Familie, für die ich mich einst entschied. Aber wir spüren uns jetzt anders, wenn wir uns streifen, uns berühren, dann ist es wie ein verhallendes Lachen, ein Glücksgefühl aus vergangener Zeit. So existieren wir. Wenn wir wollen, erschaffen wir einen Ort aus einer Erinnerung, erinnern uns an unsere Gesichter und Formen und sitzen wie einst zusammen am knackenden Lagerfeuer, wir singen, wir spielen, wir frönen dem Zusammensein.
Meistens bleibe ich für mich, döse und schwelge im Vergangenen. Ich bin nicht wie die anderen, ich habe immer gespürt, dass ein Teil von mir fehlt, eine Erinnerung, ein anderes Leben. Es ist auch hier, irgendwo hinter dem Nebel, es ist ruhelos, manchmal spüre ich seine Verzweiflung – meine Verzweiflung.
Ich erinnere mich an Gesichter, an Gerüche, an Stimmen. Ich weiß, ich habe viele geliebt, ich sehe sie vor mir, ich erinnere mich an ihr Lachen, ihre Berührungen, ihren Geschmack. Viele von ihnen sind hier bei mir, ich spüre sein Echo, seinen Gesang in meiner Nähe, spüre die lebendige Erinnerung der anderen zwei, dem, dem Frieden verwehrt bleibt, dem, der mich verließ für ihn. Doch er kommt, er ruft manchmal, zusammen mit dem, der uns beschützt.
Ich erinnere mich, dass ich sie liebe, doch ein Teil von mir bleibt schwer.
Meistens trifte ich ab und träume von goldenen Haar und eisblauen Augen. Und ich frage mich, wie etwas, das so eine frostige Farbe besitzt, so voller Wärme, voller Liebe und voller Mitgefühl sein kann, dass es mir selbst hier an diesem Ort das Herz zerreißt.
Ja, ich liebte viele, aber ihn besonders. Vielleicht, weil er nicht hier ist, vielleicht suchen ich und die Erinnerung hinter dem Nebel nach ihm. Wir warten, wir harren aus, wir werden erst den wahren Frieden spüren, wenn er wieder bei uns ist.
Ich weiß, warum ich mich schwerer fühle als die anderen, ich weiß, was mich von ihnen fernhält. Er ist es, denn er kann mich nicht loslassen. Ich höre ihn nach mir rufen, seine Liebe an mir zerren. Ich spüre seine Angst, seine Zweifel, ebenso seine Wut. Es zerreißt mich. Ich will ihm vieles sagen, aber er kann es nicht hören.
Ich vermisse ihn, so sehr. Seine Haut schimmert, ich sehe es vor mir, als beugte er sich über mich. Sein Haar ist so weich, es funkelt wie poliertes Gold, seine Augen strahlen, sie sind riesig, tief, wässrig. Ich lebe nicht mehr, aber mein Herz stockt, zieht sich zusammen. Seine Lippen sind voll und weich, ich würde noch zehnmal einen grauenhaften Tod sterben, um seinen Atem davon zu trinken. Nur noch ein einziges Mal.
Es ist ungerecht, dass ich jetzt hier bin und er allein dort. Ich weiß, er hat auch Freude, ich gönne sie ihm so sehr, aber ich habe ihn im Stich gelassen.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber ich spüre, dass es nicht genug ist. Nein, wir müssen uns loslassen, für den Moment, er gehört noch nicht hier her.
Ich habe ihn im Stich gelassen, für den Heldentod. Ich starb, wie ich es immer wollte, doch ich erkenne mehr und mehr den Preis, den andere dafür bezahlten.
Es sind noch andere, die mich festhalten, ihre Tränen fallen auf mich. Aber bei ihnen ist es anders, ich liebe sie nicht wie ihn, ich bedaure etwas. Fleisch und Blut binden mich an sie, ich will ihnen die Hand reichen und ihnen aufhelfen. Vergesst den Schmerz, will ich ihnen sagen, euer Leben geht weiter. Ihre Herzen sind nicht wie seines, ihre sind nicht gebrochen, sie heilen, sie vergessen mich langsam. Doch nicht er. Er niemals. Was er auch tut oder sagt, er krallt sich an mir fest. An die Erinnerung an mich. So wie ich mich an ihn.
Es ist nicht gerecht, dass ich Frieden finde.
Etwas Dunkles breitet sich um uns herum aus und treibt uns zusammen, jemand ruft mich und zerreißt meine Erinnerungen, zerreißt mich. Ich will nicht, nein, ich will bei ihm sein, bei der Erinnerung an ihn, bis wir wahrhaftig wieder zusammen sind. Wir sind eins, unsere Herzen sind es.
Ich bin egoistisch, wenn es um ihn geht.
Nein, ich bin immer egoistisch.
Der Nebel schwindet, ich spüre, wie er löchrig wird wie ein Blattpapier, das über züngelnde Flammen gehalten wird und sich langsam auflöst. Mehr Erinnerungen kommen durch die Lücken in unsere Welt.
Ich spüre den Tritt, als wäre ich wieder manifest, er geht mir durch und durch. Meine Lider klappen auf, ich liege an einem dichtbewachsenen Ufer, ein Bach plätschert an meinen Füßen entlang durch die Senke. Ich kenne diesen Ort, ich liebe Wasser, ich liebe Bäche, Flüsse, Seen. Bäume umringen uns, alles wirkt wilder als ich es kenne und doch weiß ich, dass ich einmal hier war. In einem anderen Leben. Dem ersten Leben, dem allerersten, als ich noch auf einen anderen Namen hörte.
Ich blicke jedoch nicht zum Wasser, ich sehe hinauf in ein Gesicht, das zu mir herabsieht. Es ist mir vertraut, es hat die Züge meines Vaters – meine eigenen Züge. Es sind meine grünen Augen, es ist mein schwarzes, kurzes Haar, mein Grimm um meine dünnen Lippen, doch trotzdem ist etwas anders, älter, fremder. Er ist, was war. Bevor ich geboren wurde, war er. Ein anderes Leben, ein anderer König. Der erste unseres Namens.
»Ich bin du«, sagt er. Er trägt seltsame Kleidung, wild und urzeitlich, halbnackt mit einem Schwert um die Hüfte, das das meine war.
Und ich erwidere: »Und ich bin du.«
Er nickt, er betrachtet mich mit gesundem Argwohn. Wir sind eins und doch gänzlich verschieden, er lebte ein Leben, das mir entrissen wurde, und er kennt das meine nicht. Trotzdem sind wir eins.
»Wir müssen aufstehen«, sagt er, die Hand am Schwert, und schaut sich mit steinerner Miene um.
Ich weiß nicht, wieso, doch ich spüre, dass er recht hat.
Er bietet mir seine Hand und ich weiß, dass ich einschlagen muss. Als er mich hochzieht, sind wir eins und ich spüre ihn in meinem Bewusstsein. Es lässt mich kurz taumeln, als er zu mir wird. Zwei Erinnerungen, zwei Leben – nun vereint.
Wir sind wieder eins.
Dann erkenne ich sie, die Schwärze um mich herum. Nur ein kleiner Kreis am Ufer, der mich verschont hat, leuchtet im friedlichen Schein, doch der Ort wirkt tot und trostlos, am Himmel tobt ein düsterer Sturm, Asche fällt wie Schnee vom Himmel und bedeckt den versengten Boden.
Der plätschernde Bach ist eine dicke, wogende Masse aus Fäule, die sich durch das Land frisst und alles tötet, obwohl es bereits tot war.
»Auch der Tod kann sterben«, sagt Er nun in meinem Kopf.
Mein Herz setzt aus, denn ich spüre sie nicht mehr, die anderen.
Ich bin allein.
Kapitel 2
Es war mehr als eine Witterung, die er aufgenommen hatte. Ein Gefühl, eine Verbindung, ein Echo, das lieblich und schwach vom schwülen Wind zu ihm getragen wurde. In dieser Gestalt besaß er keine echten Gedanken, nur Instinkte. Er sah die dichten Baumkronen von oben, die Schatten seiner Schwingen streichelten sie in der feuchten Hitze. Ob Tag oder Nacht, er brüllte eisern, rief ihn unermüdlich durch den ganzen Dschungel. Doch er erhielt keine Antwort und er spürte nicht mehr als eine Ahnung.
Er wusste nicht bewusst, was oder wen er suchte, aber er erinnerte sich genau daran, dass er der Verbindung nachjagen musste.
Sie endete wie ein mit Kohle gezogener Strich auf einer weißen Leinwand, der von einer ungeschickten Hand verwischt wurde. Das leise Echo erstarb immer wieder. Er blieb an Ort und Stelle, überflog den dichten Urwald und brüllte, rief. Ohne Antwort.
Irgendwann in der Unendlichkeit der Zeit – als Tier spürte er nicht, wie sie verrann – riss die Pflicht an ihm. Der Schwur.
Sein vom Tier unterdrückter Verstand war gelähmt, doch der Schwur riss auch an den Instinkten des alten Drachengeistes. Sie hatten einen Eid abgelegt – und jemand hatte das Siegel gebrochen.
Hin und hergerissen zwischen zwei Verbindungen, verharrte er einem heimatlosen Hund gleich auf einem Felsvorsprung, der aus den Baumkronen ragte, und rief weiter nach dem, der ihm diesen Eid auferlegt hatte.
Seine Anwesenheit wurde längst bemerkt, die Tierwelt hieß ihn in ihrem Reich willkommen, andere Drachen wollten sich mit ihm messen. Er hatte viele Kämpfe bestritten, er hatte sie nicht gezählt, Narben zeugten von ihnen und er trug sie seiner Abstammung gleich mit Stolz. Er war gewachsen, er gehorchte dem Instinkt und verteidigte sein Revier, solange er es in Anspruch nahm. Doch es kamen auch andere Wesen, menschliche Wesen. Weibchen. Mit Speeren und Bogen bewaffnet wollten sie ihn vertreiben. Er wehrte sie ab. Nichts würde ihn von diesem Felsen bewegen, außer die Erfüllung seiner Mission. Er wusste auch als Drache, dass er gehorsam war, er war ein guter Soldat, gehorchte dem König und Vater selbst dann, wenn es ihm das Herz brach.
Es gab keinen Grund für ihn, heimzukehren. Jetzt nicht mehr, die Liebe seines Lebens hatte ihn verlassen. Er wollte kein Mann mehr sein, er würde das Tier bleiben.
Es schmerzte selbst in dieser Gestalt, er liebte ihn noch immer, zu sehr, um ihm zu dienen. Die Einsamkeit war ein Genuss, eine Zuflucht. Die Heimkehr kam ihm nicht in den Sinn.
Kein Zuhause ohne ihn an seiner Seite. Er konnte nicht vergessen, ebenso wenig vergeben, dass er ihn auf Befehl loslassen musste.
Für die Heimat, für den Bruder.
Sie kamen, als er auf seinem Felsen schlief. Es lagen Knochenreste um ihn herum, er hatte sich an Tapiren sattgefressen und wie es einem Drachen eigen war, tief und fest geschlafen.
Sie waren anders als alle anderen Angreifer und Eindringlinge, sie waren hinterhältiger und hüllten sich in Magie, die ihre Anwesenheit vor ihm verbarg.
Vom Tier unterdrückt, schlug seine eigene magische Aura viel zu spät aus. Er hob den Kopf, als ihn bereits der Zauber traf. Es war, als hätten sie ein Netz aus Silber über ihn geworfen, mit Felsen beschwert. Doch es war schlimmer, es war Magie.
Sie waren zu sechst und ihre Auren waren tot, ihre Körper bleich und kalt. Wandler, Geister, nicht mehr als das, ihr Wille hing an Fäden.
Er bäumte sich panisch auf, doch der Zauber hielt ihn am Boden. Klagende und wütende Laute drangen aus seiner Kehle und hallten durch den nächtlichen Dschungel. Er strampelte mit den Beinen und versuchte, die Flügel auszubreiten, doch das magische Netz drückte ihn nieder und zusammen.
Ein Singsang ertönte, sie umzingelten ihn und ihre Magie bannte die seine.
Es schmerzte. Solch eine Pein hatte er noch nie gespürt, auch nicht als er vor all diesen Jahren hier im Dschungel von einem Pfeil getroffen worden und daran gestorben wäre, hätte die Drachenseele ihn nicht gerettet.
Ein Brennen sickerte langsam und quälend durch seinen Leib, als würden sie ihm flüssiges Silber einflößen. Es war wie Gift für einen Drachen – und Halbdämon – wie ihn. Er brüllte vor Schmerz, sah nur noch einen hellen Blitz vor Augen. Sie machten ihn blind, er krachte mit der Schnauze auf den Boden. Der Schmerz wurde schlimmer, er peitschte mit dem langen Schwanz, erfasste einen der Geister und zertrümmerte ihn an der Höhlenwand, doch das kümmerte die anderen nicht.
Der Zauber schwankte, aber nicht genug.
Sein Brüllen zerriss die Nacht, wandelte sich aber vom kräftigen Laut eines Drachen zu dem schmerzerfüllten Gebrüll eines Mannes, der zurück in seine Form gezwungen wurde.
Nein, ich will das nicht… Alles, nur nicht das!
Kraftlos fing er sich mit den Händen ab. Das Mondlicht gab preis, dass er vor Schmutz nur so starrte, war monatelang nur ein Drache, ein wildes Tier gewesen.
Schwer atmend blickte er auf, der Zauber floss noch brennend durch seine Adern. Bleiche Haut und milchige Augen starrten ihn aus einer Kapuze heraus an.
»Vergebung, Prinz von Carapuhr, wir haben Befehl, Euch in Gewahrsam zu nehmen.«
Derrick kam nicht einmal dazu, noch einmal Atem zu holen, schon wurde er mit einem Schwertknauf niedergeschlagen. Er hörte die eigene Schädeldecke unter dem Schlag knacken wie eine Kokosnuss und wusste, wäre er nicht unsterblich, würde er nicht mehr aufwachen.
*~*~*
Sarsar drückte das Ohr an den Felsen und hob eine Hand, um die raue Struktur zu berühren. Der schwarze Fels war so schön kühl und angenehm auf seiner bleichen und erhitzten Wange, dass er es kurz genoss. Er schloss die Augen und saugte das Flüstern des Gesteins in sich auf. Die Kälte darin nährte seine Aura, außerdem hatte es ihm etwas zu erzählen. Er konnte die feinen Schwingungen spüren, die durch Erde und Stein sickerten. Magie, nur ein paar Meilen entfernt. Sie war tot und sie war elektrisierend.
»Riath«, flüsterte er. War er gekommen, um es zu Ende zu bringen?
Sarsar würde lieber durch die Hand seines Bruders sterben, als auch noch einmal zu riskieren, wie ein verdammtes Stück Fleisch diesem Zuchthengst angeboten zu werden.
Nein! Er ballte die Hand zur Faust, sein Gesicht war im Fackelschein grimmig und ausgemerzt, zeigte kaum noch etwas von den lieblichen Zügen des Jungen, der er einst gewesen war. Die Pausbacken waren verschwunden, das Sanfte und fast Weibliche war harten Kanten gewichen. Er war seines Vaters Sohn, das sah er täglich in den Spiegelungen des Wasser, das er trank.
Ich bin meines Vaters Sohn, ich lass mich nicht töten!
Der Nachhall der Magie brach ab, gleichsam mit dem fernen Gebrüll des Drachen. In der darauffolgenden Stille holte Sarsar ein Gefühl von dumpfer Leere ein, er ließ die Hand fallen.
»Du bist nicht hier«, hauchte er wissend. Riath hatte das Siegel gebrochen – wer sonst, wenn nicht er – wäre er also hier, hätte Sarsar es deutlicher gespürt, eine stärkere Macht, gegen die seine nicht angekommen wäre, selbst wenn er in Vollbesitz seiner Kräfte gewesen wäre.
Woher sollten sie auch ahnen, dass er noch lebte, dass er hier war? Keiner seiner Brüder oder Väter konnte es wissen.
Kaum führte er den Gedanken zu ende, kam ihm etwas in den Sinn. Es war so simple und lag so sehr auf der Hand, dass er sich selbst einen Dummkopf schimpfte, weil es ihm nie früher eingefallen war.
Die Zelle war dunkel, bis auf die Fackel im Gang vor den Gitterstäben. Ein paar Sklaven schnarchten, jemand grunzte im Schlaf, neben ihm sträubte Chusei das Nackenfell und zuckte im Traum mit einem Bein, mehr wie ein Welpe denn ein halber Panther.
Sarsar sah sich im Halbdunklen um, der Boden unter ihm war hart, doch er hatte sich längst daran gewöhnt, ebenso wie alle hier. Seine Füße scharrten über den nackten Stein, als er sich aufrichtete.
Es gab nicht ansatzweise etwas Scharfes in den Zellen, aus naheliegenden Gründen. Die Wächterinnen achteten penible darauf, dass die Sklaven an nichts gelangten, das als Messer verwendet werden könnte. Auch die Wand zeigte an keiner Stelle eine scharfe Bruchkante.
Dann eben auf die altmodische Art, dachte Sarsar im Zuge seiner Verzweiflung. Er lehnte sich mit dem Rücken an die Wand, zog die Knie an und hob den Unterarm an die spröden und blutigen Lippen. Seine Fänge bohrten sich in das eigene Fleisch, es schmerzte und fühlte sich wie Zerreißen an. Er petzte die Augenlider fest aufeinander und riss die Wunde schnell auf. Das Blut strömte in feinen Linien über seine bleiche Haut, er ignorierte den metallischen Geschmack auf der Zunge. Mit der anderen Hand griff er in die Wunde, sein Blut klebte warm und samten an seinen Fingerspitzen.
Er hatte nicht viel Kraft, allein der Biss und der Blutverlust schwächten ihn wieder, ebenso seine Magie. Die Erschöpfung holte ihn ein und er schloss die Augen im Gebet.
»Ich rufe mein Blut«, flüsterte er, »vereint durch den Lebenssaft unserer Ahnen, ich rufe das irdische in uns, ich rufe euch, Brüder. Ich bin hier… hier… erhört den Blutruf, erhört unser Geschlecht!«
Mit aller Verzweiflung, die er aufbringen konnte, legte er seinen Willen in diesen Ruf. Er spürte die Ohnmacht, den Schlaf und wusste nicht, ob sie dem Zauber oder der Erschöpfung geschuldet waren.
Der Ruf war seine letzte Chance, seine Brüder mussten ihn erhören, er rief ihr Blut. Das jedes einzelnen. Riath, Xaith. Sie mussten es spüren, das Blut verband sie mehr als jede Magie.
Bitte… bitte…
Sein Kopf sank zur Seite und seine Arme fielen schlaff herab, Blut tropfte zu Boden und er verlor an Farbe, doch die Wunde heilte bereits wieder, während er nichts mehr spürte.
Es war das Fehlen von einfach allem, das ihn blinzeln ließ. Weder Schwere noch Schmerz drückten ihn nieder, er fühlte sich plötzlich leicht, wie im Traum.
Vielleicht war es nur ein Traum.
Er lag an eine Wand gelehnt, doch da war keine Wand mehr, als er sich aufrichtete, nur Schwärze. Um ihn herum befand sich ein weißer Lichtkegel, doch er konnte die Quelle des Leuchtens nicht ausmachen, denn er war sie selbst. Irgendwie.
Sarsar wusste, wo er sich befand. Es war die Schwärze, ein leerer Raum, ein Nichts, mit seinem glänzenden Boden wie aus schwarzem Glas, und seiner unendlichen Weite. Windstill, geräuschlos, einsam.
Als er aufstand, verschwand die unsichtbare Wand hinter ihm, er konnte jetzt durch sie hindurchfallen. Er ging ein paar Schritte auf nackten Sohlen, das Licht folgte ihm, aus seiner Wunde tropfte Blut und hinterließ eine Spur.
»Xaith?«, flüsterte er ins Nichts, sah sich in der Schwärze um, spähte in die Weite. »Riath?«
Sie mussten hier sein, einer von ihnen musste offen sein! Sarsars Herz raste, er begann zu laufen, die Schritte wurden schneller.
»Xaith!«, rief er wieder, die Panik machte seine Kehle eng.
Jetzt oder nie, sie mussten ihn hören!
»Xaith!«, brüllte er weiter. Er wusste, von welchen der beiden er lieber Hilfe erbat. »Xaith!« Er rannte umher, als könnte er ihn irgendwo finden, dabei sah er weit und breit nichts als Leere…
»Xaith!« Und wieder: »Xaith! Bruder… bitte…«
Er spürte, wie seine Zeit an diesem Ort ablief, wie die Schwere ihn zurück in seinen Körper ziehen wollte. Vielleicht war mehr Zeit vergangen als gedacht, vielleicht war schon Morgen, vielleicht rüttelte ihn jemand wach.
»Xaith!« Es rauschte in seinen Ohren, als wäre er wieder in seinem Körper, sein Schädel brummte, als hätte ihn jemand niedergeschlagen. Eisern klammerte er sich an diesen Ort.
»Bitte!«, flehte er die verbannten Götter an und krachte auf die Knie, er bleckte die Zähne wie ein verletzter Wolf. »Habt Gnade! Ich tue alles! Alles!« Er schüttelte flehend den Kopf. »Schickt mir meine Brüder! Schickt mir… Irgendwen… egal, wen… helft mir…«
Und dann, als ob es ihm jemand leise ins Ohr flüsterte, spürte er, dass er nicht mehr allein war.
Sarsar, schau zurück. Der Wanderer folgt dir. Schau zurück, er wandert auf deinem Pfad.
Er runzelte die Stirn, spürte eine Hand auf der Schulter. Ein Gott! Waren sie hier? Wurden sie hierher verbannt? War das alles, was sie jetzt kannten? Seine Gedanken überschlugen sich fieberhaft und der Schock ließ ihn die eigene Verzweiflung fast vergessen. Fast.
Ein Schritt hinter ihm ließ ihn auf den Knien herumfahren. Sein Herz setzte aus. »Riath?«, hauchte er, halb befürchtend, halb erleichtert, als der riesige Umriss auf ihn zukam.
Doch dann bemerkte er den schlendernden Gang und die breite Statur, die eine einschüchternde Größe und Maskulinität annahm, je näher sie kam. Sein Bruder war auch von stattlicher Gestalt, aber es gab nur einen Mann, der so groß und so mächtig war wie der, der Sarsars Blutspur durch das Nichts gefolgt war. Es waren kalte, blaue Augen, die ihn aus einem bärtigen, schmutzigen Gesicht ansahen.
Mit geweiteten Lidern starrte Sarsar zu ihm auf und die Verwirrung in seinem Kopf nahm zu, er fühlte sich benommen. »Ihr?«
»Schau an, du lebst also wirklich noch.« Der Großkönig von Carapuhr ging in die Hocke, legte locker die Arme über sein Knie und musterte ihn neugierig. »Und so wie du aussiehst, hält man dich irgendwo gefangen.«
Der Großkönig besaß das Grinsen eines Wolfes, der sich seines Sieges sicher war.
Plötzlich spürte Sarsar eine neue Art der Bedrohung, sie lag in den Augen seines Gegenübers. Sie verschlangen ihn auf eine kalte, berechnende Art.
Doch dann rettete ihn eine Hand, die ihm ins Gesicht schlug. Das Brennen, das Chuseis Krallen auf seiner Wange verursachten, ließ ihn blinzeln. Für einen Moment war ihm schwindelig und sein Verstand konnte die Szene im Nichts mit der Gegenwart nicht vereinbaren, zu schnell und zu extrem war der Ortswechsel.
Chusei packte ihn an den Schultern und rüttelte ihn sanft, bis Sarsars weiße Augen sich auf ihn richteten und sich an seinem Gesicht festhielten. Der Halbpanter fluchte in seiner Sprache. Dann schimpfte er: »Was hast du wieder gemacht, Dummkopf?« Fauchend ließ er Sarsars Arme los und griff zu seinen Sklavenlumpen, um einen Streifen Stoff herauszureißen. Er verarztete den verletzten Arm, doch die Wunde war schon verschorft.
Benommen starrte Sarsar auf den Boden vor sich und hauchte: »Wieso erhörte er meinen Ruf?«
Er hatte die Götter gebeten, ihm irgendwen zu schicken. Irgendwen. Doch wieso hatte der Großkönig ihn so angesehen? Wie ein Raubtier, das endlich seine Beute stellte.
Was geht da draußen nur vor sich?
Kapitel 3
Der süße Geruch nach goldenen Birnen lockte ihn durch die Gänge. Unter seinen nackten Fußsohlen spürte er den weichen Läufer, dessen samtige Fasern sich zwischen seine Zehen gruben. Welche Farben der Teppich besaß, wusste er nicht. Er wusste überhaupt nicht, wie es um ihn herum aussah, er folgte nur dem vertrauten Geruch, der in seine Nase stieg und mit jedem Augenblick intensiver wurde. Er war nah. So nah…
Die Wände fühlten sich kalt und glatt an, wie geschliffen. Marmor, wenn er sich nicht irrte. Seine Fingerkuppen glitten beim Vorübergehen darüber, er konnte die Welt nur noch als Schatten wahrnahmen, als hätte jemand das Licht ausgeblasen und seine Augen hätten sich noch nicht an das Dunkel gewöhnt. Doch er sah, wenn auch nur mit dem magischen Auge. Auren, Schimmer, wogende Kräfte, wie Nebelgebilde und Hitzewogen.
Alle paar Schritte spürte er die Wärme einer Fackel, er konnte das Öl riechen, das die Tücher drängte, damit sie brannten, doch er zog sich keine Verbrennungen zu, wenn er die Finger über das Holz gleiten ließ.
Riath hörte die Geräusche schon am anderen Ende des fast leeren Palastes, das Klirren, das Klingen, das Stöhnen und das Fluchen – das Fauchen und Knurren. Es war ein leichtes, ihnen zu folgen, noch leichter als dem delikaten Duft, der sein Blut zum Sieden brachte.
Seit Xaith ihm die Augen mit einer Klinge zerschnitten hatte, mit einem einzigen und absolut sauberen Hieb – er war fast stolz –, nahm Riath innerhalb kürzester Zeit mit allen anderen Sinnen die Umgebung viel deutlicher wahr. Dabei waren sein Geruchssinn und sein Gehör bereits vor der Erblindung dem eines gewöhnlichen Sterblichen über alle Maßen überlegen gewesen. Nun hatte seine Macht die Blindheit so weit ausgeglichen, dass er darin kaum eine Einschränkung wahrnahm.
Eine Tatsache, die er seinen mitleidenden Mitmenschen leider nicht begreiflich machen konnte, denn würde es nach ihnen gehen, würden sie ihren Prinzen – also ihn – an das verdammte Bett fesseln.
Im Grunde hätte er nichts dagegen, doch wenn Kaceys nackter und halbgeschuppter Knackarsch dabei nicht in seine Lenden drückte, machte das Rumliegen und Gesunden natürlich überhaupt keine Freude mehr. Vor allem, wenn man allein aufwachte – blind – und die andere Seite des Bettes nicht nur leer, sondern auch kalt war.
Bis auf seine eigenen Leute gab es keine Leibwachen, Gardisten oder auch nur Bedienstete in den Fluren. Noch nicht. Das Gebäude war instandgehalten worden, aber es hatte lange keinen Herrscher mehr in Malahnest gegeben, bis sein Sohn geboren wurde. Natürlich hatte dieser nicht genau hier das Licht der Welt erblickt, sondern auf der anderen Seite der See, aber sie hatten es Aberglauben und einer uralten Prophezeiung zu verdanken, dass die Einheimischen ausgerechnet seinen Spross als ihren rechtmäßigen Herrscher und Erlöser ansahen, ihn regelrecht anbeteten. Warum das auch ihm zugutekam? Nun, sein Sohn kackte sich noch selbst ein und lachte, wenn er sich beim Wickeln selbst ins Gesicht pieselte, er würde noch ein paar Jährchen brauchen, um dieses Königreich beherrschen zu können. Außerdem hielt Riath die wilden Stürmen ebenso erfolgreich wie sein Sohn von der Insel fern, und aufgrund seiner Fangzähne wurde er ebenso wie eine Gottheit von dem Inselvolk behandelt. Sie nannten ihn und Kacey die Ewigen und brachten ihnen Gaben wie Schmuck, Gold und Silber, edle Stoffe, edles Essen, und es standen bereits Männer und Frauen vor den schmucken Toren des Palastes Schlange, um für sie zu kämpfen oder um ihnen zu dienen.
Kurz um, sie lebten hier ein Leben als Halbgötter und Legenden. Ein Leben, das er sich für sie beide und ihre Erben immer ersehnt hatte. Nur eben nicht hier, sondern in Nohva.
Machte es einen Unterschied?
Darüber hatte er noch nicht nachgedacht, er war damit beschäftigt gewesen, nach dem Kampf gegen Desith und Xaith, wieder auf die Beine zu kommen und sich mit der Blindheit zurecht- und abzufinden. Genau genommen, hatte er in den letzten Wochen nichts weiter getan als rumzuliegen, zu schlafen, aus den Augen zu eitern, zu fiebern und wild zu träumen. Erst seit ein paar Tagen war er bei vollem Verstand und halbwegs gesunden, um selbst aufzustehen und zu urinieren. Diese Zeit hatte er natürlich erst einmal genutzt, um sich ausgiebig von seinem Liebsten bemitleiden und pflegen zu lassen. Er würde über die Zukunft nachdenken, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab. Zuallererst waren sie hier sicher. Vor allem waren sein Sohn und sein Geliebter hier sicher, alles andere zählte für den Moment nicht.
Es musste Nacht sein. Er konnte die Dunkelheit beinahe riechen. Obwohl er eine schwarze Augenbinde trug, die seine zerstörten Augäpfel verbarg, konnte er sehen. Das magische Auge nahm das Mondlicht wahr, jedoch nicht wie das silbrige Licht, das er früher gekannt hatte, sondern er sah nun ein schwarzes Schimmern, wie glänzender Onyx, der zu Pulver zerborsten war. Es roch abgesehen von Kaceys lieblicher Haut und seinem süßen Schweiß nach Kälte, Frost und Schnee. Es zog in den Fluren, wie es in jedem Flur zug.
Die Geräusche wurden lauter und er folgte ihnen durch eine Öffnung in der Wand. Er hatte sie kommen sehen, denn das laute Klirren und Fluchen war ungefiltert zu ihm auf den Gang gedrungen, keine hölzernen Türblätter hatten die Laute gedämpft.
Riath hörte ihn kämpfen, schnaufen, knurren. Dumpf prallte die Klinge gegen Holz, er hörte die Fasern splittern. Er nahm das Feuer im großen Kamin wie eine Sonne in der Finsternis wahr. Die Flammen waren rötlich bis gelblich, flackerten und blendeten, er konnte ihre Wärme spüren. Kacey hingegen war eine Mischung aus goldenem und silbrigem Schimmern, als ob Mondschein und Sonnenstrahlen zu einer glitzernden Wolke verschmolzen wären.
Ein Anblick, den er mit seiner sterblichen Sehkraft niemals hätte genießen können. Doch die Faszination darüber wurde von der Tatsache gedämpft, dass er wohl nie wieder Kaceys blasse Haut im Schein des Feuers schimmern sehen würde. Nie mehr seine smaragdgrünen Schuppen, die sich unter seiner Berührung aufstellten wie der Kamm eines Raubtieres. Nie mehr seine eisblauen Augen…
Dahingegen konnte Riath ihn nun noch deutlicher spüren als früher. Als ob Kacey sich umdrehte und die Arme nach ihm ausstreckte. Eine ungreifbare Macht legte sich um Riaths Geist und zog ihn an sich heran, lockte ihn lieblich und sanft zu sich, hüllte ihn ein. Wie eine Sehnsucht, jedoch manifester – wahrhaftiger.
Kacey hingegen war so tief konzentriert, dass er erschrocken zusammenfuhr, als Riaths große Hände seine schmalen Hüften umfassten. Doch der Schreck hielt nicht lange, nur für einen flüchtigen Herzschlag, dann entspannte sich Kaceys Leib merklich. Er atmete aus und ließ seinen Waffenarm sinken, sein süßer Schweiß hüllte ihn in eine Wolke delikaten Nebel, sein Atem ging schwer und abgehackt, fast wie bei ihrem Liebesakt.
»Es klingt, als ob du kämpfst, doch es fühlt sich an, als wärest du dabei halbnackt«, raunte Riath ihm mit dunkler Stimme ins Ohr und fuhr gleichzeitig mit den Fingern unter den kühlen, seidenen Stoff eines Gewandes, das Kaceys schlanken Leib nur sehr spärlich bekleidete. Es fühlte sich an, als wären es nicht mehr als zwei Bahnen kurzen Stoffes, die sich mit Leichtigkeit zur Seite schieben ließen.
Und – oh – da war er, der nackte und halbgeschuppte Hintern, die zwei Hälften eines blassen Mondes, an dessen weichen Rundungen er nur zu gerne seine Lenden rieb.
»Es ist ja nicht so«, entgegnete Kacey schweratmend vor Anstrengung, »als ob mein Gegner zurückschlagen könnte.« Seine Stimme klang gepresst.
Riath rieb die Nasenspitze über Kaceys Ohr durch das verschwitzte, goldene Haar. Die nassen Spitzen kringelten sich auf seiner Wange. »Du gewöhnst dir eine falsche Haltung an, wenn du nur im seidenen Gewand kämpfst. Du musst lernen, in voller Montur beweglich zu sein.« Er flüsterte, als würde er von den köstlichsten und verführerischsten Dingen ihrer bekannten Welt sprechen, während seine Hände ungehindert unter die lockere Seide wanderten und sich an der glatten und makellosen Haut ergötzten. Sie fühlte sich jetzt noch so viel verlockender an als zu der Zeit, als er sie noch mit seinen gesunden Augen hatte verschlingen können. »Du musst dich an das Gewicht einer Rüstung gewöhnen, du musst darin das Gleichgewicht halten, lernen, dich darin zu bewegen, als wärest du nackt…«
Kacey ließ sich gegen ihn fallen und lehnte sich mit dem Rücken über Riaths Arm. Sein eisblauer Blick bohrte sich fühlbar in den Stofffetzen, der um Riaths Kopf gewickelt war, als könnten sie sich noch immer in die Augen schauen. Der kalte und schwere Schmuck an Kaceys Leib klirrte leise und verlockend, zu gern hätte Riath gesehen, was er trug und welche Schätze seinen Schönling zierten. Denn er verdiente nur das Edelste. Nichts Geringeres als das Beste vom Besten verdiente es, seinen Kacey zu schmücken.
»Du solltest nicht aufstehen«, tadelte sein Geliebter ihn ernst. »Es ist zu früh, du solltest ruhen!«
Darüber konnte Riath nur schmunzeln. Angelockt von Kaceys warmen Atem, der wogend über sein Gesicht glitt, beugte er sich über dessen goldschimmerndes Antlitz, bis sich ihre Lippen fast berührten. »Und wie«, flüsterte er ihm gegen den sinnlichen Mund, »könnte ich liegen bleiben, wenn du dich aus unserem Bett stiehlst, wie eine Hure, wenn der Morgen graut?«
Kaceys bittersüßer Laut klang halb verzückt, halb empört. Statt dies einer Antwort zu würdigen, ließ er das Schwert fallen, das klirrend auf dem Boden tanzte, während Kacey Riaths Gesicht packte und ihn zu sich herunterzog. Ihr Kuss war tief und hungrig, gar verzweifelt.
Riath drückte Kacey an sich und staunte jedes verdammte Mal aufs Neue, wie schmal er in seinen Armen wirkte. Schmal, aber nicht zerbrechlich. Eine Eigenschaft, die ihm das Blut genauso zum Kochen brachte, wie Kaceys drängender, fordernder Kuss.
Manchmal wusste Riath wirklich nicht, wer wem mehr den Kopf verdrehte.
Doch, er wusste es. Er würde für Kacey knien, für ihn durch alle Gezeiten schwimmen, durch Feuer wandern, Berge versetzen, ihre götterverdammte Welt niederbrennen. Wenn Kacey ihn so küsste, mit dieser tiefen Leidenschaft, dieser brüllenden Liebe, dann gab es nichts, was er nicht von Riath hätte verlangen können, er hätte alles getan. Alles.
Und da wusste er, was als Nächstes zu tun war. Sie wussten es beide.
Als könnte er ihn noch wahrhaftig sehen, löste Riath den Kuss und hob eine Hand, um Kacey über die Stirn zu streichen. Das Gold seines neuen Haarreifs war kühl auf seiner erhitzten Haut. Eine Spitze, ähnlich einem Pfeil, bedeckte das einstige Sklavenmal aus Zadest. Zärtlich berührte Riath das Schmuckstück unter dem vom Schweiß leicht gelocktem Haar. Er brauchte keine sehenden Augen, um sich an ihren seidenen Glanz zu erinnern. Göttliche, atemberaubende Schönheit, die ihm gehörte. Ihm. Ihm allein.
»Du zerdrückst mich«, raunte Kacey mit seiner heiseren, rauen Stimme gegen Riaths vom Kuss prickelnde Lippen. Nicht gequält, nicht tadelnd, das Flüstern vibrierte vor Erregung.
»Wir können nicht länger Ruhen«, erwiderte Riath nun mit ernsten Worten, die vor Entschlossenheit nur so brodelten. »Wir haben viel zu planen.«
»Haben wir.« Kaceys Leib bebte, sein Atem ging schwerer. »Das haben wir.«
»Bereit für unseren letzten Zug, Liebster?«, fragte Riath ernsthaft.
Er spürte Kaceys kühles, schiefes Schmunzeln, die Härte in seinen Augen – und seine Fingerspitzen, die im starken Kontrast zu seinem Gesichtsausdruck zärtlich über Riaths Wange strichen. »Bereit, wenn du es bist, Geliebter.«
Kapitel 4
Mein geliebter Sohn,
wie du dir sicher denken kannst, haben wir bereits durch meine Spione lange vor deinem Brief davon erfahren, dass du wundersamerweise von den Toten zurückgekehrt bist. Ich kann dir nicht angemessen in Worte fassen, wie erleichtert deine geliebte Gattin und dein jüngster Sohn über diese Neuigkeiten waren. Erleichtert und froh genug, dass sie nur dankbar dafür sind, dass du lebst, und jede Schuld ihnen gleich ist. Du hast großes Glück, ich hoffe, das weißt du. Der beigelegte Brief ist von deiner geliebten Ari, ich bin sicher, er wird dich beruhigen, denn es geht ihr gut und es wird ihr bei mir immer gut gehen. Außerdem liebt sie dich trotz aller Vorkommnisse ohne jeden Vorbehalt.
Eine Tatsache, die ich vielleicht nicht so offen teilen kann, gleichwohl mir eine unbeschreibliche Schwere genommen wurde, als ich hörte, dass du doch am Leben bist. Oder wieder.
Wir beide wissen jedoch, dass nicht Riath dir den Todesstoß versetzt hat, und es entsetzt und betrübt mich, wozu du mittlerweile fähig bist. Lügen und Intrigen, Tod und Gewalt. Du weißt so gut wie ich, dass du ebenso an jedem Konflikt seit Derius´ Tod verantwortlich bist wie ich und Riath es sind. Und nein, bilde dir nicht ein, ich würde Riath in Schutz nehmen und dich anklagen. Ich kenne jeden einzelnen meiner Söhne und ich weiß, zu was ihr alle fähig seid.
Doch du hast mich überrascht, aber nicht auf die Art, die einen Vater stolz machen könnte. Du hast vielen die dich lieben einen schrecklichen Schmerz zugefügt. Aber schlimmer noch als deinen Tod zu inszenieren, um deinem Feind einen Mord an dir anzuhängen, ist, deinen Tod zu inszenieren und Melecay für dich die Drecksarbeit machen zu lassen, indem er den Rat der Fünf für dich auslöschte.
Ich gratuliere dir, mein Sohn, aber nicht zu deinem nun unangefochtenem Recht auf Elkanasai, sondern dafür, dass du die Demokratie, die du in deiner idealistischen Jugend doch als einzig richtige Form des Regierens ersonnen hattest, in deinem Reich zu deinen eigenen Gunsten ausgelöscht und so schändlich verraten hast. Du hast dich selbst verraten, Eagle.
Wie schwer muss deine Krone wiegen!
Trotzdem in Liebe
Dein Vater
___________________
Wexmell Ayrinn; König von Nohva
Eagle legte den Brief aus der Hand und bedeckte seine müden Augen mit den Fingerspitzen. Sein Vater hatte nicht die geringste Vorstellung, wie schwer diese Krone tatsächlich wog. Eagle wusste selbst, dass er seine gesamten Prinzipien verraten hatte. Alles, woran er immer geglaubt hatte. Und doch sah er keinen anderen Weg und noch weniger könnte er seinem einzigen Verbündeten irgendwelche Vorhaltungen machen. Sie hatten Fehler begangen, genauso wie alle anderen, aber sie standen dazu, Riath mit allen Mitteln zu vernichten.
Der Junge durfte nicht davonkommen, er würde niemals aufgeben, sie stürzen zu wollen.
Wexmell wollte die Wahrheit immer noch nicht sehen.
Und doch spürte Eagle regelrecht das Blut an seinen Händen. Und es würde mehr werden.
Seufzend ließ er die Hände fallen und griff nach seinem Kelch, doch der Wein war leer und er stellte ihn wieder zurück neben den Kerzenständer auf seinem Arbeitstisch, der gegen die nächtliche Schwärze ankämpfte. Durch die wehenden Vorhänge sah er über den Balkon aus weißen Marmor hinaus in eine dunkle Nacht, während am weit entferntem Horizont irgendwo über dem Regenwald grelle Blitze über gewaltige und tintenschwarze Wolkengebilde zuckten. Es roch nach gebackenem Stein, der feucht geworden war.
Statt nach dem Wein griff er zu den Briefbögen auf seinem Tisch, die ihn in dieser Nacht wachhielten.
Den beiliegenden und versiegelten Umschlag hatte er zuerst geöffnet. Und Wexmell hatte ganz Recht, Ari war zu erleichtert, als ihm Vorwürfe zu machen. Ihm war leicht ums Herz geworden, auch da er nun wusste, dass es ihr und Faith gut ging. Es war nicht Wexmell, den er fürchtete, es war und würde immer Riath sein. Ari und Faith durften ihm nicht in die Hände fallen, Eagle wollte sich nach allem was geschehen war nicht ausmalen, was Riath ihnen antun könnte, um es ihm heimzuzahlen.
Allein der Gedanke daran ließ Übelkeit in ihm aufsteigen.
Geräusche aus dem Hof wehten in seine Gemächer und zerrissen seine sorgenbelastenden Gedanken. Stirnrunzelnd wandte er das Gesicht zum Balkon und vernahm das Klackern von Hufen auf Backsteinen.
Eagle schob den Stuhl zurück und hinkte mit offenem Kimono hinüber, fing die wehende Seide des Vorhangs mit einer Hand und hielt ihn zur Seite, um hinabzuspähen. Fackeln erhellten den nächtlichen Stall und gaben preis, was hinter seinem Rücken vor sich ging.
Er presste die Lippen ärgerlich aufeinander, Wut brodelte in den tiefen seines vom Wein geschwängerten Magens. Das Gesöff war seinem Zorn mehr als zuträglich und machte ihn mutiger, als er ohne den Wein gewesen wäre. Eilig wandte er sich ab und hinkte auf die Tür zu, an seinem Tisch lehnte sein Gehstock und er schnappte ihm im Vorübergehen, um schneller voranzukommen.
Seine Leibwachen schreckten auf, als er die Türen aufzog, und eilten ihm dann wortlos nach. Vier riesige Männer, zwei Elkanasai, zwei Barbaren. Melecay wollte kein Risiko mehr eingehen.
Unter der weißen Seide des Kimonos schimmerte der helle Verband, der sich um Eagles magere Brust schlängelte, als er die Villa verließ und in den Innenhof trat, in dem sich immer mehr Barbaren einfanden.
»Was denkst du, wohin zu reitest?«, blaffte er, nachdem er die Männer mit einem Ellenbogen zur Seite gestoßen hatte. Er mochte vielleicht ein Holzbein haben, aber das machte ihn nicht weniger standhaft!
Gleiches konnte er leider nicht vom Wein behaupten, der seine Körperkoordination beeinträchtigte.
Melecay zuckte nicht einmal mit einer Wimper, während er die Gurte des Sattels nachzog, der auf dem Rücken seines silbernen Hengstes lag. »Ich denke nicht, ich weiß es.«
Eagles Stock klackte wütend, als er die Distanz zu ihm verringerte. »Wo bei den verdammten Göttern willst du jetzt hin?«, zischte er und spürte, wie sein Herz vor Panik flatterte. Es war schwach und schlug seit dem Stich nur sehr schwer, jede Aufregung und jede Bewegung strengten ihn an, er atmete als ob er durch halb Elkanasai gescheucht worden wäre.
»Ich reite nach Zadest.« Melecay sah Eagle unbekümmert an. »Und hole Derius´ Jungen.«
Eagle öffnete verblüfft den Mund. »Hat Derrick ihn gefunden?« Seltsam, er hatte gar keinen Boten gehört. Suchend sah er sich um, entdeckte jedoch nur grimmige Barbarengesichter, bärtig und müde, die keinerlei Lust zu empfinden schienen, ihren König in den Dschungel zu begleiten.
»Nein«, antwortete Melecay, »aber ich werde ihn finden!«
Eagles Gesicht schoss wieder zu ihm herum. »Du kannst nicht nach ihm suchen!«, warf er entsetzt ein. »Mel! Wir reiten in einem Tag gen Nohva, du musst die Armee führen, du-«
»Du wirst das tun, bis ich wieder da bin.« Entschlossen wandte Melecay sich ihm zu. »Du führst sie nach Nohva.«
Eagle rutschte das Herz in die Hose. »Was…? Nein! Das ist Wahnsinn, wir-«
»Er hat dein Weib und deinen Bengel«, fuhr Melecay ihm dazwischen und packte ihn mit einer Hand im Nacken, beugte sich zu seinem Gesicht herab, bis sich ihre Nasen beinahe berührten. Seine blauen Augen waren wild, sie wirkten wie aus dem ewigen Eis des Nordens, jedoch war dort hinter ein Feuer entbrannt. »Und er hat meinen Dainty! Er wird Forderungen stellen, Eagle! Dein Vater hat mehr gegen uns in der Hand als wir gegen ihn! Und wir müssen so viele unserer Leute zurückholen, wie wir können, bevor Riath sie sich holen kann, kapiert? Wir brauchen ein Druckmittel!«
Die Wahrheit dieser Worte sickerte nur langsam zu ihm durch, er konnte nichts sagen und fühlte sich wie gelähmt. Er konnte nicht ohne Melecay als starken und gnadenlosen Anführer gen Nohva reiten!
»Wir brauchen ein verdammt gutes Druckmittel«, betonte Melecay noch einmal leiser, aber umso bedeutsamer, und drückte Eagles Nacken, schüttelte ihn leicht wie einen Hund, der nicht verstehen wollte, dass er Sitz machten sollte. »Oder bist du bereit, dein Weib oder deinen Jungen oder sogar beide zu opfern? Nein, ich kenne dich, du würdest alles für sie hinwerfen. Und das lasse ich nicht zu!«
Eagle atmete langsam aus. »Du weißt doch gar nicht, ob er noch lebt!«
»Doch«, erwiderte Melecay, etwas Überlegenes und Triumphales erschien in seinen Augen und ließ sie in der Nacht erneut blau aufflammen. »Er lebt. Und ich weiß, wie ich ihn finde.«
Doch das überzeugte Eagle nicht, er wollte es genauer wissen. »Es könnte Jahre dauern, bis-«
»Gib mir ein paar Wochen!« Melecay ließ so unversehens los, dass Eagle beinahe umgekippt wäre, weil er sich so daran gewöhnt hatte, dass Melecay ihn festhielt.
Machtlos und noch immer gelähmt vor Unbehagen, sah er dabei zu, wie der Großkönig in den Sattel stieg. Das Leder des Sattels knarzte unter seinem Gewicht, der Hengst tänzelte.
Eagle war sich beinahe sicher, Melecay nicht wieder zu sehen. Wie eine Vision, ein Gesetz, schlug ihm diese Vorahnung mitten ins Gesicht und er wollte ihn aufhalten – konnte es aber nicht.
Melecay würde sich nie aufhalten lassen. Hatte er nie und würde er nie.
Verzweifelt sah er zu ihm auf, konnte nicht denken, nicht sprechen. Er hoffte, dass er im Bett lag und einen Alptraum hatte.
»Vertrau mir, Bruder«, knurrte Melecay mit einer dunklen Stimme, die einem Wolf gut zu Gesicht gestanden hätte.
Eagle schüttelte frustriert den Kopf. »Wir werden da draußen ohne dich sterben.« Ich werde sterben, und das weißt du! Ich werde etwas Dummes tun und sterben ohne dich. Dieses Mal wirklich.
Eagle gab es immer ungern zu, doch er fürchtete sich bis ins Mark – und Melecay war ein Mann, vor dem selbst die Angst Angst hatte. Er war Eagles götterverdammter Schutzwall!
»Ihr werdet die Grenze noch nicht erreicht haben, dann werde ich schon wieder zu euch stoßen!« Der Mistkerl grinste und riss seinen Hengst herum. »Hehya!«, rief er und seine Barbaren setzten ihm auf schweren Pferden nach, vom Hof durch das Tor in die Nacht.
Beinahe riss die Wucht der galoppierenden Pferde Eagle um, doch das bemerkte er kaum. Mit Magenschmerzen blickte er dem Gefolge von einem Dutzend Reitern nach.
Wie viele Männer mussten noch für diesen verschollenen Jungen in diesem von allen Göttern verlassenen Dschungel sterben?
Wobei es ihnen zu wünschen war, dass sie starben und nicht in die Gefangenschaft der Frauenstämme gerieten, wo sie als Sklaven wie Tiere gehalten wurden.
Ärgerlich stampfte Eagle mit dem Gehstock auf und atmete gereizt aus. »Götter… wenn es auch nur noch einen von euch gibt, dann lasst uns den Jungen endlich finden!«
Wobei er sich sicher war, wenn Melecay den Burschen in die Finger bekäme, würde der Kleine sich vermutlich wünschen, niemals gefunden worden zu sein.
*~*~*
Die Nacht verschluckte sie und die Luft des Regenwaldes war aufgeladen von dem Sturm, dem sie entgegenritten. Fackelschein glitt über die Bäume und die Straße. Melecay ritt voran und lauschte genüsslich den schweren Hufen seines Hengstes, der mit dem Donner in der Ferne Konkurrenz machte. Er hasste den Ort, an den er reiten würde, doch die Vorfreude auf den Ritt, auf die Reise, die Gefahr und das noch zu vergießende Blut prickelte bittersüß über seine verschwitzte Haut.
»Mein Großkönig!«, rief einer seiner Krieger von hinten. »Ein Botenfalke!«
Genau in diesem Moment hörte er den hellen Ruf aus dem Himmel und hob den Blick zu den Baumkronen. Er zügelte seinen Hengst nicht, das war nicht nötig.
Der Falke kreiste über den Reitern und segelte herab, setzte sich auf Melecays dargebotenen Arm und ließ sich mit einem weiteren Schrei die Botschaft aus dem Röhrchen an seinem Bein ziehen.
Mit einem Zungenschnalzen und indem er den Arm hochwarf, schickte er den Falken wieder fort.
»Licht!«, bellte Melecay und entrollte das Papier.
Zwei Reiter trieben ihre Pferde neben seinen Hengst, der drohend den Kopf hob, und erhellten sein Gesicht und die geschriebenen Zeilen zwischen seinen Fingern, die sich Wort für Wort auflösten, sobald seine Augen sie gelesen hatten.
Ich habe die Eier und ich habe den Ort fast erreicht.
Pass auf, dass er am Leben bleibt, sonst verzeiht er uns nie.
K.
Nachdem sich die Worte aufgelöst hatten, pulverisierte sich auch das verzauberte Papier, sodass Melecay die Zügel wieder richtig aufnahm.
»Du wirst mir den Kopf abschlagen, sollte das gelingen«, sagte er grimmig, »aber immerhin bist du dann wieder dazu in der Lage, nicht wahr?«
»Mein Großkönig?«, hakte einer der Barbaren irritiert nach.
Doch Melecay schüttelte nur den Kopf und trieb seinen Hengst vorwärts, als wollte er vor etwas davongaloppieren. Zu dem Gefühl der Vorfreude, gestellte sich nun auch eine Empfindung, die er nur sehr selten in seinem Leben empfand. Schuld.
Kapitel 5
Im Kamin knackten die Scheite, die ein Diener vor geraumer Zeit aufgelegt und dann das Ratszimmer verlassen hatte, bevor hinter verschlossenen Türen Berichte erstattet und Diskussionen geführt wurde. Doch obwohl die Flammen hochloderten, konnten sie den Raum kaum aufheizen. Es war in den letzten Wochen bitterkalt geworden, sodass sich kaum jemand weit von dem warmen Lichtkegeln der Feuer entfernen wollte, es zog in den Fluren und nachts heulte der Wind durch Kaminschächte und unter den Türritzen hindurch. Alle Anwesenden am Tisch trugen mit Wolle gefütterte Kleidung und schwere Umhänge aus mehreren Lagen Samt und noch mehr Wolle, teilweise mit dicken Pelzen versehen.
Nur Xaith spürte die Kälte kaum, obwohl sein jugendlicher Trieb längst erwachsener Gelassenheit gewichen und es kein Sommer war – wenn der Trieb stets am stärksten gewesen war – sorgte die innerliche Hitze dafür, dass er die Kälte in den Räumen gar als angenehm empfand. Er trug nur seinen üblichen Mantel aus schwarzem Leder, dessen neugenähter Saum bis zum Boden reichte, das Hemd darunter stand wie eh und je offen, als ob der Winter ihm nichts anhaben könnte, dabei waren die bunten Fenster der Hohen Luzianerfestung von außen bis zur oberen Hälfte verschneit, sodass es innerhalb des Gemäuers fast durchgehend dunkel blieb.
»Das Volk ist vom Krieg natürlich nicht begeistert«, berichtete Lord Seaks aus der einstmaligen Hauptstadt Dargard gerade. »Die Steuern vor dem Wintereinbruch waren enorm und unsere Bauern hungern und frieren schon jetzt, aber ihr Zorn richtet sich gegen die drohende Gefahr, nicht gegen unsereins, viele wollen in die Armee rekrutiert werden oder melden sich bei der Stadtwache und wir sind nicht wählerisch, was Gesundheit und Alter derjenigen betrifft. Bei uns bekommen sie wenigstens täglich eine warme Brühe. Hier und dort murrt ein Trunkenbold, unter Prinz Riaths Führung würde es ihnen allen besser ergehen…«
Xaith entkam ungewollt ein Grunzen.
Plötzlich sahen alle am Tisch ihn an, weshalb er sich räusperte und nach seinem Kelch griff, in dem Blut von der frisch geschlachteten Gans schwamm, die es zum Abendessen gegeben hatte.