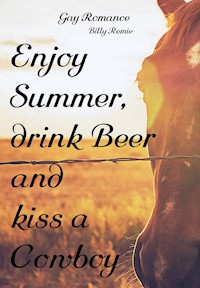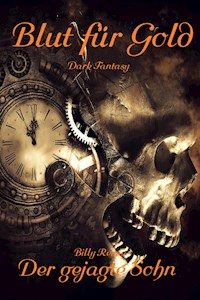Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Bruderschaft 4
- Sprache: Deutsch
Es ist acht Jahre her, seit der Blutdrache sein Leben gegeben hat, und nun wanken die Bündnisse der großen Reiche. Riath M´Shier, einer der letzten noch lebenden Söhne des Drachen, sieht es als sein gegebenes Geburtsrecht an, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Ihm gehört die Krone Nohvas, doch noch sitzt sein Ziehvater Wexmell Airynn auf seinem Thron. Riath ist ein mächtiger Zauberkundiger, wodurch sein Recht auf die Krone seines Vaters zur Spaltung der Völker führt. Je talentierter er wird, je mehr Feinde tun sich vor ihm auf. Es entflammen Hass und Angst gegenüber der Magie, um ihn vom Thron fernzuhalten, und er muss alles daransetzen, die Magier aller Reiche zusammenzuhalten. Aus diesem Grund reist er in das ihm feindlich gesinnte Kaiserreich Elkanasai, um seine Jugendliebe Kacey zu warnen und sein Herz und seine Loyalität zurückzugewinnen. Doch keiner der beiden hat mit Riaths Erzfeind gerechnet, der sowohl ihre Leben als auch ihre Liebe auf eine harte Probe stellt. Unterdessen kämpft sich sein Bruder Xaith immer weiter durch Elkanasais Wildnis und kommt dem Ziel, ihren Vater wiederzuerwecken, unaufhaltsam näher, wäre da nicht ein Mann aus Xaiths Vergangenheit, der plötzlich vor ihm steht und ihn bittet, nach Hause zu kommen, um seinem Bruder Einhalt zu gebieten… Band 4 der Chroniken der Bruderschaft - Reihentitel nicht immer komplett in sich geschlossen! -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1374
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Billy Remie
Geliebter Unhold
Erben des Blutdrachen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Was bisher geschah…
Prolog
Teil 1: Der böse Bube
~1~
~2~
~3~
~4~
~5~
~6~
~7~
~8~
~9~
~10~
~11~
~12~
~13~
~14~
~15~
~16~
~17~
~18~
~19~
~20~
~21~
~22~
~23~
~24~
~25~
~26~
~27~
~28~
Teil 2: Ein Licht aus Gold
~29~
~30~
~31~
~32~
~33~
~34~
~35~
~36~
~37~
~38~
~39~
~40~
~41~
~42~
~43~
~44~
~45~
~46~
~47~
Epilog
Impressum neobooks
Vorwort
Liebe Leser:innen,
vorab möchte ich kurz ein paar Worte sagen. Vielen Dank an diejenigen, die immer noch dabei sind, ich gebe mir Mühe, mich weiterzuentwickeln. Doch um weiterhin Spaß am Schreiben zu haben, schreibe ich natürlich das, was mir persönlich gefällt. Ich weiß, dass ich damit nicht jeden Geschmack treffe, aber ich möchte gerne weiterhin meine Geschichten schreiben, so wie ich sie mag. Das heißt, inhaltlich bleib ich dem treu, was ich bisher geschrieben habe, es wird weiterhin Kämpfe, Sex, Politik, Abschiede und langatmige Szenen geben – weil ich es eben einfach gerne schreibe und es für mich zu meiner Welt dazu gehört, genauso wie fragwürdige oder hassenswerte Protagonisten und ihre nicht immer sympathischen Wesensarten. (Verzeiht mir das, wirklich, ich versuche immer, mich zu bessern, aber ich schreibe am Ende das Buch, das ich gerne lesen würde) Und weil ich eben so viele Charaktere und Handlungsstränge habe, kann ich leider natürlich nicht in jedem Buch kapitelweise von jedem einzelnen Protagonisten erzählen, aber seid versichert, sie tauchen wieder auf, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Ich möchte einfach so fair sein und es explizit erwähnen, für diejenigen, die sich an vielem davon stören, damit sich niemand darüber ärgert, wenn ich mich in gewissen Punkten nicht weiterentwickle, zumindest nicht im Moment, bzw nicht in dieser Buchreihe.
Da ich aber nun schon öfter gehört habe, dass viele meiner Leser den vorherigen Band noch mal queer lesen, um in den neuen einzufinden, habe ich mich mal an einem „Was bisher geschah“ versucht. Ich gestehe, dass ich das nicht gut kann, weswegen ich es bisher vermieden habe, weil ich mich nicht wohl dabei fühlte. (Ich kann mich schlecht kurzhalten und halte alles für relevant). Ich habe natürlich im Roman selbst alle wichtigen Ereignisse an den wichtigen Stellen in kurzen, knappen Sätzen immer wieder noch einmal „angerissen“, um die vergangenen Ereignisse im richtigen Moment aufzufrischen, dennoch habe ich im folgenden Kapitel versucht, alles Wichtige noch einmal zusammenzufassen. Wer das nicht braucht, springt gleich zum Prolog ;)
Vielen Dank für euer Verständnis,
nun viel Spaß beim Lesen (hoffentlich) und bleibt gesund!
Was bisher geschah…
Vor knapp acht Jahren geriet ein Götterportal in den Tiefen des Dschungels von Zadest außer Kontrolle und drohte, das Leben der gesamten sterblichen Welt auszusaugen. König Desiderius gab sein Leben im Kampf gegen eine fremde Göttin, die durch das Portal gekommen war, um alles Leben zu versklaven. Er starb nicht umsonst, denn nur so erlangte sein Sohn Sarsar die nötige Macht, um die freigesetzte Magie des Portals zu bannen.
Sarsar verteilte diese fremde Macht auf zehn Männer, um sie wegzuschließen. Sarsar, Derrick, Place, Korah, Doragon, Vaaks, Xaith, Riath, Kacey und Desith tragen seitdem ein Stück Göttlichkeit in sich, verschlossen in ihren Seelen und mit magischen Siegeln versehen, damit sie niemals ausbrechen kann. Doch allein der Hauch dieser Macht verändert sie.
Diese zehn Männer sind die Hüter eines Geheimnisses, das niemals in falsche Hände geraten darf, denn die göttliche Macht ist weiterhin am Leben und versucht, ihrem Gefängnis zu entkommen.
Doch Sarsar überlebte den Dschungel nicht, Riath ließ ihn im Turm von Zadest zurück, als dieser einstürzte. Niemand hatte gesehen, was Riath seinem Bruder angetan hatte. Er tat es aus Furcht, Sarsar könnte die Krone ihres Vaters erben, doch als Riath erfährt, dass sein Vater nur kurz zuvor für Sarsar sein Leben gelassen hatte, glaubt er, das Schicksal hätte ihn ob seiner Tat bestraft.
Wexmell Airynn, Desiderius` Gefährte, erbt die Krone Nohvas.
Sieben Jahre nach dem Schließen des Portals, taucht Sarsar aus dem Nichts wieder auf, doch er strandet in Zadest und geriet in die Versklavung der Frauenstämme, niemand weiß, dass er noch lebt und gefangen gehalten wird. Gleichzeitig entflammt in Carapuhr ein Bürgerkrieg, ein Ziegenhirte schwingt sich zum Propheten auf und greift nach der Krone des Nordens. Desiths Zwillingsschwester, die mit Vynsu – dem Erben Carapuhrs – vermählt war und ihm zwei Erben geschenkt hat, wird scheinbar Opfer eines Kutschüberfalls. Ihre Leiche besaß kein Gesicht. Um das Bündnis zwischen Desiths Vater – dem Kaiser von Elkanasai – und dem Großkönig von Carapuhr – Vynsus Onkel – zu wahren, verloben sich Desith und Vynsu. Doch was als Zweckehe gedacht, wurde schnell zu Respekt und schließlich zu Liebe. Gemeinsam decken sie in Carapuhr eine Verschwörung auf, dabei haben sie unerwartet fremdländische Hilfe von Riath und seinem Freund Marks, die nach Riaths Bruder Xaith suchen. Es schien zunächst so, als ob Xaith mit dem Krieg in Verbindung stünde.
Doch schließlich entdeckt Desith, dass der Bürgerkrieg und das Verschwinden seiner Schwester mit Riaths Anwesenheit zusammenhing, denn er war es, der diesen Ziegenhirten durch Magie Träume einpflanzte, die ihn zum Verräter machten und gegen den Großkönig intrigieren ließ, und Riath war es auch, der Desiths Zwillingschwester verführt und ihren Tod inszeniert hatte, bevor ihr bewusstwurde, dass es Riath nicht um sie, sondern nur darum gegangen war, Melecay zu schaden.
Desith findet schließlich seine doch noch lebende Schwester in einem Geburtenhaus, wo sie von Xaith vor Riath versteckt wurde. Sie gebar Drillinge, zwei der Kinder überlebten, sie selbst starb bei der Geburt. Eines der Kinder wurde von Xaith entführt, das andere versteckten Vynsu und Desith bei sich.
Es gelang Desith und Vynsu schließlich, den Aufstand in Carapuhr zu zerschlagen, allerdings entwischte ihnen Riath, der mit einem Schiff in Richtung Elkanasai floh…
Prolog
Wenn man jung ist, vergeht die Zeit viel zu langsam. Die Jahre ziehen sich wie kleine Ewigkeiten dahin und man kann den nächsten Geburtstag kaum erwarten, um groß und endlich ernst genommen zu werden. Ein Kind dachte nicht an verpasste Chancen, nicht an ungelebte Träume oder Verlust, es wollte schnell den Kinderschuhen entwachsen, um seinen eigenen Weg zu gehen.
Kinder dachten nicht über Sorgen, Kummer oder Zukunftsängste nach, sie sehnten sich nur nach Selbstbestimmung und vermeintliche Freiheit.
Die Ernüchterung kommt schnell genug und man wünschte sich zurück in ein Leben, als die Eltern noch den Zeitpunkt bestimmten, wann man zu essen und zu schlafen hatte. Und dass man vor dem zu Bettgehen noch einen Apfel essen sollte.
Am besten einen grünen. Das hatte sein Vater immer gesagt. Nimm einen grünen. Xaith M´Shier, Sohn des Blutdrachen – König Desiderius M`Shier –, mochte bis heute die grünen Äpfel lieber als die roten, und obwohl er mittlerweile ein junger Mann und sein Vater vor mehr als sieben Jahren aus dieser Welt gerissen worden war, aß er vor dem Schlafen einen grünen Apfel. Nun ja, sofern er denn einen im Gepäck dabeihatte und nicht gerade nach einer gerauchten Pfeife im Sitzen einschlief.
Der Morgen erhob sich über dem dichten Regenwald, goldene Streifen durchzogen das Rot am Horizont, der durch hellgrüne Blätter leuchtete.
Xaith hätte seine Freiheit, sein Leben, seine Unabhängigkeit gerne wieder eingetauscht, um Jahre zurück in die Vergangenheit zu reisen, damit er seinem damaligen Ich in die Augen sehen und sagen konnte: »Hör auf zu heulen, du Memme, in einem Jahrzehnt wirst du dir wünschen, dein einziges Problem wären Kinder, die dich hässlichen finden und Steine nach dir werfen, wenn deine Brüder nicht hinsehen. Denn man wird dir den Vater rauben – und damit all deinen Halt in der Welt.«
Aber genug der Melancholie, wie er so vortrefflich zu seinem eingebildeten, jüngeren Ich sagte: Hör auf zu heulen!
Wobei, geheult hatte er schon lange nicht mehr. Der Bengel hingegen schrie sich bereits die Lungen heraus, hatte etliche Vögel verscheucht und hungrige Raubtiere angelockt.
Es war wohl wieder an der Zeit, aufzustehen.
Xaith reckte sich, ließ den steifen Nacken knacksen und die Schultern rollen. Er hatte die Nacht mal wieder an einem Baum gelehnt verbracht, halb schlafend, halb meditierend. Nun ja, das, was man Nacht nennen konnte, wenn man mit jemanden reiste, der alle paar Stunden aufschreckte, Rotz und Wasser heulte, nach Essen verlangte und einem die Schultern vollkotzte. Oh und die vollgekackten Tücher nicht zu vergessen. Nein, die konnte er ganz bestimmt nicht vergessen. Selten hatte er je so etwas Schreckliches wie Neugeborenenkacke gesehen – und er hatte mal knietief in zusammengeflossenen, klebrigen Leichenteilen gestanden.
Er hörte hinter sich das Unterholz knistern. Wer auch immer sich dem winzigen Lager näherte, war nicht gerade ein Schleicher, eher ein Elefant. Äste knackten, Blätter raschelten, gedämpfte Schritte auf dem von Moos bewachsenen, nachgebenden Waldboden.
Xaith lauschte, wartete still darauf, dass derjenige näherkam. Noch näher. Komm schon, du kleine Ratte, noch näher!
Das Gebrüll des Säuglings ebbte nicht ab, vielleicht glaubte der Eindringling, man könnte ihn deshalb nicht hören. Die Schritte kamen zielstrebig auf sie zu.
Blitzschnell sprang Xaith auf, zog seinen Dolch aus der Scheide und huschte lautlos hinter den Schatten, der gerade aus dem Schutz des Unterholz trat und erschrocken einen Haufen getrockneter Äste zu Boden fallen ließ.
»Ich bin´s!«
Xaith atmete aus und nahm die gezogene Klinge von der schmalen Kehle des Jungen. »Dummkopf!«, schalt er ihn und gab ihm einen sanften Stoß ins Lager. »Ich hätte dich umbringen können.«
Der Junge – schlaksig, schwarzhaarig und etwa dreizehn Sommer alt – fiel auf die Knie und klaubte die Äste wieder auf. »Ich wollte dich nicht wecken, ich habe nur Feuerholz gesucht. Ich dachte, du wüsstest, dass ich es bin.«
»Ich nahm an, du schläfst noch.« Xaith schob den Dolch zurück in die Scheide an seinem Gürtel und trat demonstrativ gegen die zerwühlten Decken neben der Glut, die aussahen, als ob darunter noch ein schmächtiger Körper schlief. »Und du solltest dich trotzdem nicht wie eine Kutsche durch den Wald bewegen, du könntest Räuber herlocken.«
Der Junge blinzelte zu ihm auf. »Tut mir leid, ich passe besser auf.«
Xaith gab ein trockenes Schnauben von sich. Ja, klar… er passte besser auf. Er wollte nicht gemein sein, aber der Junge kannte sich mit dem Überleben außerhalb der Gossen einer Großstadt genauso gut aus wie ein Xaith mit Säuglingen.
Apropos. Er drehte sich nach dem greinenden Bündel um, das verzweifelter schrie, je länger sich niemand um es kümmerte.
»Ist ja gut.« Xaith beugte sich drüber und betrachtete das rotgeweinte Pausbackengesicht. Der kleine Fratz war seinem Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten. Strohblond, grüne Augen, lange Wimpern, große Fresse. »Fang gar nicht erst damit«, warnte Xaith ihn und hob ihn aus seinen Decken. Das magische Kraftfeld, das er zum Schutz vor Raubkatzen und Schlangen um die Schlafstätte des Kleinen errichtet hatte, fiel mit seiner Berührung in sich zusammen. Die Energie kam zu ihm zurück, sodass er sich nicht mehr ganz so ausgelaugt fühlte.
Während der Junge sich um das Feuer kümmerte und Äste über dem Knie zerbrach, setzte Xaith sich mit dem Säugling unter einen Baum in die Nähe der Glut, hob einen Finger zum Mund und riss ihn mit einer seiner Luzianerfänge auf, bis ein dicker, roter Bluttropfen in der Morgensonne schimmerte. Dann schob er die Fingerkuppe in das Mäulchen des Säuglings. Sofort setzte der Reflex ein und der kleine Schreihals saugte unmenschlich stark das Blut aus Xaiths Finger, wie Milch aus einer Zitze.
Xaith spürte den Blick des Jungen auf sich. »Bist du sicher, dass das genügt? Braucht er keine Muttermilch?«
»Hast du denn Muttermilch in deinen kleinen Titten?«
Der Junge lief rot an, Zorn zuckte in seinen Mundwinken. »Nein!« Er warf einen Ast in die Glut, die langsam Feuer fing, und verschränkte die Arme vor der flachen Brust, sodass sein schmutziges, weißes Hemd Falten zog.
Sofort tat es Xaith leid. »Man siehts nicht, keine Sorge«, beschwichtigte er den Jungen, wobei er genervt klang, obwohl er es nicht wollte. Er war den Umgang mit anderen wirklich nicht gewohnt.
»Ich meine ja nur.« Der Junge ging nicht darauf ein, drehte ihm die Schulter zu und hockte sich neben das Feuer, um es anzufachen. »Kinder brauchen Muttermilch.«
»Er ist ein Luzianer, er kann allein durch Blut überleben.« Nun ja, zumindest in der Theorie.
»Hab ich noch nie von gehört.«
»Da wo du herkommst, hält man uns ja auch für Untote, was weißt du also über mein Volk?«
Ehrlich gesagt, wusste er selbst nicht, ob er das Richtige tat. Luzianer tranken eigentlich erst ab einen gewissen Alter Blut, Kinder brauchten es nicht. Aber er hatte keine Milch zur Hand, da er keine Ziege oder Kuh durch die Wildnis schleppen konnte. Blut würde den Bengel schon kräftigen, jedenfalls hatte es ihn bisher gesättigt und gesund gehalten.
Seine Erwiderung brachte den Jungen zum Verstummen, er zuckte mit den Achseln.
Siderius, einstmals Sida, stammte nicht aus einem der großen Königreiche, Xaith hatte den schmutzigen Jungen aufgelesen, oder besser gesagt, hatte Eri sich einfach an ihn gehängt und sich auch durch das rüpelhafteste Verhalten nicht mehr vertreiben lassen. Wie ein Straßenköter. Xaith war selbst schuld, er hätte ihm nichts zu essen geben sollen.
Nun reisten sie mehr oder weniger zusammen, nachdem Eri ihm zugegebener Maßen das ein oder andere Mal den Arsch gerettet hatte, indem er schlicht und ergreifend für ihn gesorgt hatte, als er nicht dazu in der Lage gewesen war. Xaith hatte dem Jungen auch einen angemesseneren Namen gegeben, weil dieser sich nicht überwinden konnte, sich selbst einen auszusuchen.
Er hatte gesagt: »Aber man gibt sich nicht selbst einen Namen.«
»Doch, vor allem, wenn man seinen nicht mag.«
»Das fühlt sich nicht richtig an«, war er stur geblieben, tiefbetrübt.
Xaith hatte mit den Augen gerollt. »Gut, dann gebe ich dir eben einen Namen.«
»Warum du?«
»Weil du es selbst nicht kannst.«
Ob der Erinnerung daran, musste er kurz schmunzeln. Er spürte wieder, wie er angestarrt wurde.
»Was ist?«, fragte er unwirsch, wodurch sich der Straßenjunge nicht abschrecken ließ, er sah ihn weiterhin mit diesem besonderen, wissenden Blick an.
»Du hattest ihn gern, richtig?«
Was für ein nervtötender Klugscheißer. »Weiß nicht, wovon zu sprichst. Und jetzt bring lieber mal was zum Frühstück herbei, ich verhungere.«
Siderius sah ihn weiter ungerührt an. »Den Magier, zu dem du immer gingst, mit den besonderen blauen Augen und dem goldenen Haar.«
Manchmal hatte er trotz aller Dankbarkeit und zarter Zuneigung das Bedürfnis, Eri etwas ins Maul zu stopfen. »Essen. Sofort.«
Er bewegte sich nicht, starrte Xaith in die Augen. »Du hattest ihn gern.«
Es war keine Frage mehr.
Na toll, der Morgen fing ja schon wieder gut an.
»Tut nichts zur Sache.« Die Sonne wanderte und warf Schattenspiele durch die Baumkronen auf ihre Gesichter. Der Bengel war satt, nuckelte nur noch schläfrig an Xaiths Finger. »Nimm ihn.« Er hob das Kind, das sie in weiche Wolldecken gewickelt hatten, dem Jungen entgegen, der nicht anders konnte, als es ihm abzunehmen oder fallen zu lassen.
Immer, wenn er den Schreihals halten sollte, riss er ängstlich die Augen auf, weil er sich fürchtete, ihn zerbrechen zu können.
Was für ein Quatsch, Luzianer waren von Geburt an robust, sie hätten mit dem Bengel Ballwerfen spielen können und es wäre ihm gut gegangen. Sonst hätte er die Reise durch die Wildnis wohl kaum länger als eine Woche überstanden. Und sie hatten noch einen sehr langen Weg vor sich.
Teil 1: Der böse Bube
Lieber Kacey,
ich habe deinen Brief erhalten, habe ihn zwei Jahre mit mir herumgetragen, ihn hervorgeholt, ihn so oft auseinandergefaltet, gelesen und wieder zusammengefaltet, dass die Ränder des Pergaments alt und abgegriffen aussehen. Ich habe dich nicht vergessen, glaub mir, du warst immer in meinen Gedanken. Aber da liegt das Problem, eine ganze Weile war mein Verstand wie eine dichte Gewitterwolke, durch die keine Klarheit dringen konnte. Ich hatte keine Ahnung, was ich will, wer ich bin, wie es weitergeht. Was ich jetzt fühle.
In meiner Heimat haben sich die Ereignisse überschlagen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell aus Liebe Hass werden kann. Doch dazu berichte ich ein andermal ausführlicher.
Ich wollte dir aus einem völlig anderem Grund schreiben, ich habe oft nächtelang grübelnd an meinem Tisch gesessen und Zeilen angefangen, doch es kam nichts Sinnvolles dabei heraus. Ebenso wie jetzt. Vielleicht ist für das, was ich dir die ganze Zeit schreiben will, einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Mein Verstand sagt mir, dass es für derlei Angelegenheiten der falsche Moment ist, das falsches Jahr, vielleicht sogar das falsche Leben. Vielleicht schreibe ich dir nie das, was ich wirklich will.
Zuvorderst gelten diese Zeilen also eher einem Dienst der Pflicht. Ich möchte dich warnen, von Magiebegabten zu Magiebegabten. Wir sind alle in Gefahr, in Nohva erhob sich ein Kult, Die Blutreinen, und sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt von der Magie zu befreien. Ein Verräter schnitt mir die Kehle durch, versuchte mich zu töten. Ich bin noch sehr schwach, ich hätte nicht überleben dürfen, ich weiß nicht einmal, warum ich noch atme. Niemand weiß das. Meine Feinde verbreiten das Gerücht, ich sei ein Dämon.
Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet dir schreibe. Vielleicht steckt mehr dahinter als meine Sorge um dich, vielleicht möchte ich mir das Chaos einfach nur von der Seele schreiben. Doch dieses Gift, das Nohva heimsucht, wird sich ausbreiten, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Ich habe Kinder brennen gesehen, nur aufgrund der Tatsache, dass sie Blumen wachsen ließen. Es ist ernst, die Stimmung ist gekippt. Und obwohl meine Magie wächst, bin ich nach dem Anschlag auf mein Leben noch immer zu schwach, um ein Schwert zu halten.
Warne so viele, wie du kannst, bereite deine Freunde in der Akademie auf die Unruhen vor. Es geht nicht um Throne, um Grenzen, um Reichtum oder Macht, sondern um die Freiheit und das Überleben aller Zauberkundigen. Ich will dafür kämpfen, das ist alles, was ich gerade weiß.
Unsere Existenz darf nicht ausgelöscht werden, wir dürfen keine Sklaven werden.
Wenn du wie ich der Meinung bist, dass wir uns wehren sollten, so schreib mir, ich werde einen Boten, dem ich vertraue, zwischen uns hin und her senden.
Spar dir Zeit und Tinte, solltest du meine Meinung nicht teilen.
Hochachtungsvoll und in Zärtlichkeit,
Kronprinz Riath M`Shier, Sohn des Blutdrachen, König Desiderius M`Shier, Erbe der Krone Nohvas.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Zweieinhalb Jahre nach König Desiderius` Tod verfasst und versendet.
Liebster Riath,
ich habe deine Briefe erhalten. Du hast Recht, ich habe nicht geantwortet, weil ich mir nicht sicher war, was ich denken soll und wem ich vertrauen kann. Dein Hass auf deine Feinde hat mich verunsichert. Und ich gebe zu, ich war noch sehr verletzt davon, dass du meinen ersten Brief so lange hast unbeantwortet lassen. Aber sei versichert, dass mich deine Zeilen oft zutiefst erschüttert und berührt haben.
Gleichwohl fürchte ich eine Entscheidung, die nicht rückgängig zu machen ist. Doch nun sitze ich hier und halte mich für einen Dummkopf, denn wie du befürchtet hast, hat sich das Gift ausgebreitet und sogar hier, im immer magischen Elkanasai, ist es in die Ohren einiger Bürger gedrungen, die nun glauben, sie allein sähen die Gefahr, die von der Magie ausgehe. In den Heilstätten weigern sich Bürger, ihre Gebrechen von einem Magier behandeln zu lassen, da das Gerücht umgeht, wir würden sie auf diese Weise mit Flüchen und Bannzaubern belegen, ihnen ihren Verstand verdrehen und sie zu Sklaven der Magie machen. Es ist vollkommen verrückt, das mit anzusehen. Ebenso wie bei Euch in Nohva, verliert die Obrigkeit an Autorität.
Ich würde lügen, würde ich behaupten, ich hätte keine Furcht. Es braut sich etwas Düsteres zusammen, ganz gewiss.
Es betrübt mich ebenso zu hören, dass du nach dem Anschlag noch immer außerstande bist, eine Stahlwaffe zu halten. Deshalb, und als Entschuldigung dafür, dass ich an deinen Absichten zweifelte, sende ich dir ein besonderes Schwert. Nur Mut, hebe es an, ich habe es eigenhändig verzaubert, es wird für dich leicht wie eine Feder sein. Und sollte dich einmal das Glück verlassen, so ist es imstande, die Zeit zu verlangsamen, damit du deinen Kopf retten kannst.
Möge dein Schakal Mak den Brief und das Schwert sicher zu dir tragen.
Ich erwarte, im Gegensatz zu dir, sehr wohl eine Antwort!
Sag mir, wie ich helfen kann.
Wir sind eins.
In aller Liebe und Zärtlichkeit,
dein Kacey.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Ein Jahr nach Erhalt des ersten Briefes verfasst und versendet
~1~
Es genügt ein einziges, unscheinbares Ereignis, um die Welt ins Wanken zu bringen. Eine winzige Veränderung, um alle zu spalten.
Und am Ende stand die Frage, auf welcher Seite du stehst, wohin du gehörst.
Wofür du kämpfst, macht dich zu dem, was du bist.
So und nicht anders drehte sich die Welt für Riath, Sohn des Blutdrachen, seit seine magischen Kräfte erwacht waren. Er hatte schneller als jeder andere gelernt, sie zu kontrollieren, die Macht in sich für, statt gegen sich arbeiten zu lassen, Herr seiner Magie zu werden. Er hatte sich angestrengt, sich Nächte und Tage um die Ohren geschlagen, um niemals einen fatalen Fehler zu begehen, um niemals die Kontrolle zu verlieren. Es war hart gewesen, denn er war nicht mit diesen Kräften geboren worden, sie waren erst vor wenigen Jahren im Kampf erwacht. Unerwartet.
Er hatte sich den Arsch aufgerissen, um allen zu beweisen, dass er mit großer Macht verantwortungsvoll umging. Er hatte nie mit seiner Magie gespielt, sie niemals eingesetzt, um schlicht zu imponieren. Er hatte seine Kräfte stets ernst genommen. Bücher gewälzt, nächtelang meditiert, es war ein Kampf gegen sich selbst gewesen, Gefühle und Kräfte gingen Hand in Hand, er musste lernen, beides zu kontrollieren, und das war das mit Abstand Schwerste, was er je erlernt hatte.
All die Mühe war am Ende doch vergebens, denn es genügte, dass er der Zauberei mächtig war, um seinem Volk Angst einzuflößen. Für viele Menschen in Nohva kam ein Hexenkönig nicht in Frage, es stand lange Zeit im Gesetz verankert, dass jemand wie er nicht über alle herrschen durfte.
Dass er dieses Gesetz kurzerhand außer Kraft hatte setzen wollen, aufgrund von Diskriminierung und weil es schlicht veraltet war, hatte den alten Säcken im Adel natürlich überhaupt nicht gepasst.
Aber er fing jetzt nicht an, deshalb rumzuweinen. Es führte zu nichts. Und zugegebener Maßen hatte er nicht gerade dazu beigetragen, den Konflikt friedlich zu lösen. Lange Zeit hatte er nur dagesessen und zugesehen, hatte die Gerüchte ertragen, gute Miene zu bösem Spiel, wie Wexmell es von ihm erbeten hatte. Am Ende brannten Städte, Fanatiker zogen Hexen allen Alters auf die Straßen, folterten sie, demütigten sie. Weshalb? Es genügte Angst und Hass gegenüber der Magie als Rechtfertigung für Mord. Riath hatte aufgehört, nur zuzusehen, hatte aufgehört zu glauben, mit guten Argumenten kämen sie gegen diese Volksverhetzer an, und er hatte zum Schwert gegriffen und seine Feinde entgegen jeden guten Rates niedergemetzelt, mit einer Armee, die ihm treu ergeben war, weil er den Namen seines Vaters trug. Er hatte Stahl und auch Magie gegen seine Gegner eingesetzt, sie zurückgetrieben, Zauberkundige befreit, gerettet, zusammengeführt. All das war sein Verdienst gewesen, er hatte Feuer gelöscht. Und doch war er es, der sich vor jedem Schatten in Acht nehmen musste, wie ein Verräter. Dabei war er der letzte Mann, der Wexmell verraten hätte.
Er wusste sehr genau, dass er alles andere als ein Opfer war und schlicht immer wieder das bekam, was er verdiente.
Das bedeutete aber nicht, dass er sich einfach damit abfinden würde. Nein, im Gegenteil, wenn ihm jemand ans Bein pisste, schlug er eben zurück. Das war immerhin sein gutes Recht.
Niemand konnte ihm weiß machen, ob gut oder böse, dass er sich ungestraft niederknüppeln ließ und dann liegen blieb, weil es für andere so besser wäre.
Er war nun mal nicht wie Wexmell, der sich für das Wohl aller selbst opfern würde, der immer das Gute in seinen Untergebenen sah, der immer alles vergeben konnte. Nun ja, fast alles. Und der immer den diplomatischen Weg einschlug.
Es gab so vieles, was sie entzweite, und doch dachte er jeden Abend und jeden Morgen an seinen Ziehvater, seinen König, und an seine Heimat. Er vermisste alles davon, doch wäre er geblieben, wäre er ein Heuchler gewesen, denn Wexmells Art zu regieren traf nicht mit seinen eigenen Überzeugungen überein. Sie dachten zu unterschiedlich und deshalb enttäuschten sie sich beide immer wieder gegenseitig.
Wexmell musste endlich die Augen öffnen und begreifen, dass er auf Riath hätte hören sollen.
Und er würde es begreifen. Bald.
Ganz sicher.
Definitiv.
»Mein Prinz?«
Riath drehte den Kopf, ein Sonnenstrahl fiel in das Zelt, und braune, treue Augen suchten besorgt das Innere ab, tasteten über die königliche Einrichtung, die massiven Möbel, die edlen Teppiche und Wandbehänge, suchten ihn an seinem Tisch, der leer war, da er noch nicht aufgestanden war.
Endlich fand Marks, Sohn von Lady Sigha aus dem Schwarzfelsgebirge, ihn unbekleidet und von einem dünnen Laken umhüllt auf seinem Lager liegen.
Marks straffte sich, nahm Haltung an, seine dunklen Schmalzlocken umspielten sein markantes Gesicht. Er war ein großer Mann in schwarzer Lederkluft und einem violetten Band, das er streng um seinen Oberarm gebunden hatte. Riaths Linke Hand, einer seiner engsten Vertrauten – und er wirkte nervtötend besorgt. »Mein Prinz, Ihr solltet frühstücken.«
Sollte er wohl. Nach wochenlanger Seefahrt, die ihn unentwegt zum Kotzen gebracht hatte, waren sie seit zwei Tagen endlich runter von diesem scheißschwankendem Schiff und hatten festen Boden unter den Füßen. Sein Magen fühlte sich noch immer flau an und er wusste nicht, ob er bereits etwas in sich behalten konnte, doch wenn er nicht bald aß, würden ihn seine Beine nicht mehr tragen.
Der einzige Grund, weshalb er noch immer im Bett lag, obwohl die Sonne schon seit Stunden am Himmel stand, und sich unnötigen Grübeleien hingab, war schlicht, dass er sich zu geschwächt fühlte, um sich aufzusetzen. Seine Beine waren wie knochenlos und sein Kopf war wie mit Wasser gefüllt, das ihn schwanken ließ, sobald er sich auch nur im Geringsten bewegte.
»Gibt es Blut?«, fragte er und blickte an die Zeltdecke, auf der sich wegen des Regens letzter Nacht – trotz, dass das Lager im dichten Urwald verborgen und von Baumkronen geschützt lag – dunkle, feuchte Flecken gesammelt hatten.
Marks ließ endlich den verdammten Zelteingang los, sodass der verirrte Sonnenstrahl ausgesperrt wurde. »Die Jäger haben einen Hirsch erlegt. Ein riesiges Vieh, sag ich dir. Ich kann dir einen Becher von ihm bringen, oder…« - er öffnete seine gepanzerte Armmanschette - »…du trinkst von mir.«
Riaths Mund verzog sich zu einem kühlen Grinsen. »Du hasst es doch, gebissen zu werden.«
»Du bist mein Prinz, ich würde einen Schwertstich für dich abfangen, ein paar Tropfen Blut sind nichts dagegen.« Er sagte das mit solch einer trockenen Selbstverständlichkeit, dass man ihn einfach lieben musste.
Riath drehte ihm den Kopf zu und bereute die Bewegung sofort. »Hirschblut klingt köstlich.«
Marks zog die Riemen seiner Manschetten wieder zu, sie klimperten hell. »Ich werde dir einen Becher organisieren, zusammen mit einem nahrhaften Frühstück.«
In der Zwischenzeit sollte er wohl versuchen, sich aufzusetzen. Auch wenn er es seinem Getreuen zutraute, dass er ihn wie einen Greis auf dem Sterbebett füttern würde, wollte er sich und ihm diese Peinlichkeit ersparen. Na ja, vor allem sich.
»Gibt es neue Meldungen?«, fragte er und lüftete das Laken. Scham? Kannte er nicht, vor allem nicht Marks gegenüber, neben dem er auch ungeniert pissen und scheißen ging.
»Mak traf soeben ein, aber seine Tasche war wie bei den letzten Malen leer.«
Verdammt. »Gut.« Nein, es war nicht gut, er nahm die Nachricht nur zur Kenntnis. Warum antwortete Kacey seit Wochen nicht?
»Auf Sari und auf Botschaften aus Nohva warten wir noch«, schloss Marks ab und beäugte Riath neugierig, während er nähertrat.
Das Zeltinnere schwankte und verschwamm, als Riath sich aufgesetzt hatte. Er petzte für einen Moment die Augen zusammen und massierte mit zwei Fingerspitzen seine Schläfe. Die schwüle Hitze war ein Graus, ein feiner Schweißfilm schimmerte auf seinen nackten, glatten Muskeln, er fühlte sich klebrig und unsauber, stank. Das Aufsetzen hatte seine Atmung angestrengt, seine Lunge fühlte sich ausgetrocknet an und stach, als hätte er einen Berg bestiegen, sein Herz klopfte schwer.
Verdammte, sterbliche Hülle.
»Ich weiß, du kannst meine Sorgen darüber nicht mehr hören« - Marks griff zu einem silbernen Krug und goss Wasser in einen Kelch - »aber bist du dir wirklich sicher, dass er uns nicht verraten wird?«
Riath sah zu ihm auf, als er ihm das Wasser reichte, und trank gierig und dankbar. Kühl und wohltuend floss die klare Flüssigkeit seine Kehle hinab und bekämpfte den Schwindel. Erst nachdem er seinen Durst gestillt hatte, antwortete er.
»Warum sollte er das tun?« Er wusste, warum, und wich deshalb grimmig Marks Blick aus, indem er so tat, als wollte er den Kelch austrinken.
»Immerhin«, Marks druckste etwas herum, »war sie seine Schwester.«
Riath wischte mit dem Unterarm über seine feuchten Lippen und stellte den Kelch mit einem lauten Geräusch auf den kleinen Tisch neben seinem Lager. »Wir können Kacey vertrauen, er weiß, dass es um mehr als um die Familienehre geht.«
Marks wirkte noch immer besorgt, er verzog die vollen Lippen.
»Wo bleibt mein Becherchen mit Blut, Mutti?« Riath klimperte mit scheinheiliger Unschuld mit seinen langen Wimpern, wodurch er nur verdeutlichte, dass für ihn das Thema beendet war.
Es genügte, wenn er sich den Kopf zerbrach, Marks‘ Sorgen verstärkten im Moment nur seine eigenen, und wenn er nervös war, konnte er keine klugen Entscheidungen treffen.
Ein Ruck ging durch Marks. »Ja. Natürlich.« Er wandte sich eilig ab.
Als er zum Zelt hinaus ging, schlüpfte Mak hechelnd herein. Der Goldschakal sprang freudig auf Riath zu, der sofort die Arme ausbreitete und lachend den kleinen Scheißer empfing.
Mak und Sari waren sozusagen seine ersten Kinder gewesen, zwei Schakale, die er bei einer Jagd gefunden und liebevoll aufgezogen hatte. Und sie waren die mit Abstand treusten Diener und vertrauenswürdigsten Boten.
»Nächstes Mal«, sagte Riath zu Mak und strich ihm über die weichen Ohren, »beißt du Kacey in seinen süßen, kleinen Schwanz und zwingst ihn für mich zu einer Antwort, dann bekommst du zur Belohnung auch ein echtes Würstchen.«
Der Schakal hechelte und drehte sich auf Riaths Schoß auf den Rücken, sodass er sich fast an der eigenen, langen Zunge verschluckte. Er verstand die gesäuselten Worte als Lob, nicht als fiesen Scherz.
Riath kraulte ihm den Bauch. »Ich muss das wohl einfach selbst in die Hand nehmen.«
Auch wenn ihn ein Weg in die Hauptstadt des Kaiserreichs höchstwahrscheinlich den Kopf kosten würde. Er brauchte einen verdammt guten Plan.
Und um diesen zu schmieden brauchte er erst einmal ein saftiges Frühstück.
*~*~*
Der Tee war erkaltet und er verzog das Gesicht, als er unwissentlich daran nippte. Unglücklich stellte er ihn zurück auf das Silbertablett und schob beides von sich.
War denn wirklich bereits so viel Zeit vergangen, dass er nicht bemerkt hatte, wie sein Getränk erkaltet war? Er war sich sicher gewesen, dass einer der Diener seinen Tee gerade erst aufgebrüht hatte. Doch nein, ein Blick zu den Terrassen hinaus, die sich um das rechteckige Gebäude zogen, und er entdeckte, dass die Sonne zwischen den weißen Marmorsäulen weitergewandert war.
Er sah sich in der Versammlungshalle des Gerichtshauses um, hunderte von Menschen mit Titeln oder schlichtem, bescheidenem Reichtum tummelten sich in dem riesigen Saal auf weißen Marmorbänken, die Tribünenartig an drei Wänden hochgezogen waren. Eine Ansammlung alter und junger Elkanasai in knappen Tuniken und Togen und bunten Seidenschärpen, geflochtenen Frisuren und spitzen Ohren. Auf der höchsten Empore saß für gewöhnlich der Kaiser – heute vertreten von der Kaiserin – üblich flankiert von den fünf weisen Männern des Rates – Der Rat der Fünf. An den Seiten der Halle nahmen alle anderen Platz, die glaubten, sie hätten eine Stimme. Normale Bürger wurden selten empfangen, niedere Landbesitzer nahmen auf Holzbänken auf dem Boden zwischen den Emporen Platz, wie Angeklagte vor dem Richter.
Kacey saß von der Kaiserin aus an der rechten Wand ganz oben zwischen seinen hochrangigen Magierkollegen, als Vertreter und Sprecher der Akademie von Solitude. Der größten und berühmtesten Magieruniversität des gesamten Kaiserreichs. Vor genau drei Tagen hatte man ihm den Titel Oberster Magister verliehen, womit ihm die Schule quasi gehörte, nachdem sein Vorgänger nun leider seiner langen, leidensvollen Krankheit erlegen war.
Und so unschicklich sein nächster Gedanke auch war, der alte Mann hätte nicht zu einem günstigeren Zeitpunkt abtreten können, denn er war zuvor schon nicht in der Lage gewesen, die Belange der Akademie und der Schüler angemessen zu verwalten, vom Bett aus und halb im Delirium wie er nun mal war, war es ohnehin Kacey gewesen, der alles am Laufen gehalten hatte, doch leider waren ihm oft die Hände gebunden gewesen, da er für alles die Zustimmung und die Unterschrift des im Sterben liegenden Greises – die Götter mögen ihm gnädig sein – benötigt hatte.
Auch wenn er es niemals offen sagen würde, es gab leider häufig zu viele ältere Personen – vor allem in Führungspositionen –, die an ihren alten Denkweisen festhielten. So auch in Bezug auf die Sicherheit der Schule, nachdem sie zweimal angegriffen worden war. Die alten Magister waren sich einig, dass die Wachen und der Schutz der Stadt vollkommen genügten, immerhin wurden bisher alle Angriffe abgewehrt. Dass die Angreifer ihre Verteidigung irgendwann durchschauen würden, wollten sie nicht begreifen, sie hielten sich für klüger – und handelten doch unsäglich dumm. Sie hielten an ihren Traditionen fest, sich auf die Waffenkraft allein zu verlassen, obwohl vor einer Woche eine junge Schülerin umgekommen war und immer mehr Magier die Akademie verließen. Der Tod eines Mädchens war nicht genug, um zu erlauben, dass sie Magier auf den Kampf vorbereiteten, nicht einmal einen Schutzschild aus gebündelter Kraft wollten sie zulassen, dabei ginge es nur um die Verteidigung der Anlage und ihrer Bewohner. Kacey hatte seine treuen Schüler einfach zu sich genommen und gemeinsam einen Schutzschild beschworen – und viel Zorn und Unglauben geerntet. Doch zum Glück wählten nicht nur die älteren Lehrer den neuen Magister, sondern alle, auch die Schüler, und so übernahm er das ehrenwerte Amt.
Kurz um, er trug nun die gesamte Verantwortung für alle Magier des Kaiserreiches. Er sollte nervös sein, er sollte Angst haben, doch das hatte er nicht. Noch nie im Leben hatte er sich so sehr einer Verantwortung gewachsen gefühlt. Dort, wo er jetzt saß, dort gehörte er hin, denn er wusste genau, wofür er sich einsetzen wollte, und er würde nicht weniger als sein Leben dafür hergeben, um seine Schützlinge vor Schaden zu bewahren.
Deshalb hatte er die ganze Nacht an seinem Tisch verbracht, um sich auf die Versammlung vorzubereiten, hatte seine Worte aufgeschrieben und mehrfach umgeschrieben, und war am Ende doch nicht zufrieden. Er hatte Briefe verfasst, um die geflohenen Schüler zur Akademie zurück zu bitten, da er es in der derzeitigen Situation für zu gefährlich hielt, wenn sie ungeschützt in ihren Elternhäusern verweilten. Er fürchtete, jemand könnte ihnen auflauern. Zusammen wären sie stärker.
Trotz, dass die Versammlungshalle groß genug war, um einen stehenden Drachen – einen von den ganz großen – unterzubringen und es weder Fenster noch Vorhänge gab, schien die Luft so dick im Raum zu stehen, dass er sie in Scheiben schneiden könnte. Hunderte Personen waren zusammengekommen, jeder stieß heißen Atem in die schwüle Luft Elkanasais, und selbst der kühle Stein, aus dem das Gebäude erbaut war, und das Fehlen von Fackeln machten es nicht erträglicher. Selbst er, der kälteempfindliche Kacey, hatte einen schimmernden Schweißfilm auf der makellosen, kleinen Stirn. Seine goldenen Löckchen klebten ihm im Nacken und kräuselten sich.
Zuerst hatte die Kaiserin sich die Belange der Stadträte und Verwalter angehört, allerlei über Wasserversorgung, Überfischung des Flusses, Streitfragen über Verbote, Tierschutz und Sklavengesetze, Nachbarschaftsstreit, Töchter und Söhne, die ihre Väter wegen versuchter Zwangsheirat anklagten. Die Kaiserin vertrat ihren Gemahl – Kaceys leiblichen Vater – mit beneidenswerter Geduld. Nicht ein einziges Mal hatte Kacey sie schnaufen gehört oder gesehen, dass sie die Augen verdrehen musste, sie nahm alle Belange ernst und ließ nicht zu, dass sich auch nur der kleinste Bürger ungehört fühlte, selbst dann nicht, als ein Tuchmacher sich über die Abwasserentsorgung beschwerte, da er kostengünstiger an Urin zu gelangen versuchte, um seine Stoffe einzufärben.
Kacey war an diesem Tag froh, dass er eine farblose, traditionelle Toga trug und keine seiner eingefärbten, aus Seide und Damast bestehenden, aufwändigen Magierroben. Natürlich wusste er, wie gewisse Stoffe zu gewissen Farben kamen, doch so genau wollte er nichts über den Prozess hören.
Kaiserin Ari wurde hin und wieder von einem spärlich bekleideten Diener mit einem weichen Tuch abgetupft, Zofen wedelten ihr etwas Luft zu und zupften ihre aufwendig geflochtene Frisur zurecht, während sie sich alle Belange Stunde um Stunde anhörte und Entscheidungen fiel. Sie war eine zierliche, hochgewachsene Frau, mit langen, braunen Haaren, durch die sich silberne Strähnen zogen, wie vom Mondschein angestrahlte Flüsse durch einen düsteren Wald. Sie war wunderschön, besaß kaum Falten, doch darüber hinaus war sie auch klug und stark, ihr Körper unter dem silbernen Seidenkleid war gestählt, denn einst war sie eine Kriegerin gewesen. Genau wie ihr Gemahl Eagle, und genau wie Kacey, stammte sie aus Nohva und besaß runde Ohren. Die Kaiserkrone von Elkanasai hatte Eagle durch seinen Vater erhalten, König Wexmell Airynn von Nohva, der nach seiner Wahl zum Kaiser die Bürde an seinen Sohn übertragen hatte, um in Nohva an der Seite seines mittlerweile gefallenen Gefährten Desiderius zu regieren.
Es war und würde immer das größte aller politischer Wunder in ganz Elkanasai darstellen, dass Wexmell Airynn, Erbe eines anderen Königreiches, zum Kaiser der Spitzohren gewählt worden war, nur auf Grund der Tatsache, dass er war, wie er war. Gerecht, Aufopfernd, dem Frieden zugeneigt, und sich nicht vor Dämonen fürchtete. Aber zuvorderst natürlich, da durch ihn ein Bündnis mit dem gefährlichen Carapuhr und seinem rachsüchtigen König ausgehandelt werden konnte.
Manchmal war die stärkste Waffe, die man im Kampf um eine Krone besaß, die Bündnisse, die man fähig war, einzugehen.
Kacey wusste über die Geschichte der großen Reichen fast alles, über den Krieg in Nohva, den Kampf gegen die Dämonen, den blutigen, jahrzehntelangen Krieg zwischen Elkanasai und Carapuhr. Er hatte die Geschichte studiert.
Nach seiner Kindheit in Zadest, wo seine Mutter mit ihm während der Dämoneninvasion hin geflüchtet war und wo er als magischer Sklave in den Frauenstämmen gelebt hatte, abgeschottet vom Rest der Welt, hatte er alles über die anderen Reiche erfahren wollen, hatte wissen wollen, was alles geschehen war, wissen wollen, wovon er so lange keinen blassen Schimmer gehabt hatte.
Ihm war es wichtig gewesen, Versäumtes aufzuholen, die Reiche zu kennen, mit denen er nun zu tun hatte. Immerhin war er der Bastard des Kaisers und er war ein Airynn. Er hatte wissen wollen, was es bedeutet, diesem Haus anzugehören, hatte seine Vorväter verstehen wollen, die Geschichte seines Geschlechts – und allen, die damit verbunden waren.
Man hatte ihm als Kind seine Magie abgezapft, um damit ein Götterportal zu speisen, er war wie eine Kuh gemolken worden. Noch heute zierte eine kreisrunde Narbe seine Stirn, die ihn als magischen Sklaven auszeichnete. Nur ein Objekt. Zwar hatten sie ihn nie körperlich misshandelt, doch nachdem seine Mutter gestorben war, war er in seiner Zelle vereinsamt, weshalb er es noch heute kaum ertrug, allein in einem stillen Raum zu sitzen, und sich eigentlich immerzu danach sehnte, von jemanden berührt zu werden. Und sei es nur eine Hand, die auf dem Markt flüchtig und ungewollt die seine streifte. Er brauchte das, weil er nur dann zu atmen vermochte. Doch das verbarg er gut hinter einem immerzu frohen Lächeln, und indem er sich in die Arbeit stürzte.
Die offensichtliche Narbe auf seiner Stirn verdeckte er durch einen goldenen Reif. Gedankenverloren berührte er das Schmuckstück, während einer der Stadtverwalter über das Eintreffen einiger Händler sprach, und wie er deren Stände auf dem großen Markt der Stadt unterzubringen gedachte, welche anderen Händler er zu verjagen bevorzugte, da sie ihre Pacht seit zwei Monden nicht mehr gezahlt hatten, und allerlei.
Warum dachte Kacey ausgerechnet jetzt über die Vergangenheit nach? Etwas hatte ihn darauf gebracht, er wusste nur nicht genau, was es war. Vielleicht hatte ihn die Langeweile und die tristen Gespräche dorthin abschweifen lassen.
Ha, von wegen. Er machte sich etwas vor, die Vergangenheit war stets präsent, immer unter der Oberfläche, das spürte er in allem was er tat und dachte, wonach er sich sehnte. Sie bestimmte ihn, ob er das wollte oder nicht.
Doch in diesem speziellen Moment war er darauf gekommen, weil er Ari angesehen und ihre stolzen, starken Gesichtszüge bemerkt hatte, wie sie genau wie Eagle handelte und immer die Interessen ihres Mannes durchsetzte, selbst in seiner Abwesenheit, da er zurzeit noch in Carapuhr verweilte. Sie waren so ein starkes Paar, so verliebt, eine Einheit, trotz vieler Schicksalsschläge und trotz verlorener oder weggelaufener Kinder. Sie hatten immer einander, selbst wenn sie nicht gerade im selben Raum – oder auch nur im selben Land – waren.
Und so kleinlich es in dieser schwierigen Zeit auch war und es gewiss tausend andere Dinge gab, die wichtiger waren als das, aber verdammt noch mal, er sehnte sich nach dem, was sein Vater mit Ari hatte. Liebe, Zuneigung, Vertrauen, Nähe.
Besonders Nähe, selbst wenn man sich räumlich fern war.
Etwas, das ihm irgendwie immer verwehrt war.
Unwillkürlich dachte er an Xaith, und …
Nein! Er schloss die Tür zu dieser Erinnerung und hing ein dickes Schloss davor.
Genug davon, sagte er sich und brachte sich mit einem lockeren Kopfschütteln zurück in die Gegenwart.
Der Verwalter endete gerade, und Ari gab ihr Einverständnis mit einem knappen Nicken, auch über ihren Hals lief nun der Schweiß. Kein Wunder, es war bereits Nachmittag und die Sonne hatte ihren höchsten Punkt überschritten. Die Hitze hatte den Boden aufgeheizt und die heißesten Stunden des Tages brachen an. Trotzdem war die Versammlung nicht vor dem Abend zu ende.
Kacey seufzte, griff nach seiner Tasse und trank von dem kalten Tee. Er hätte längst einen frischen ordern können, doch seine Diener schwitzten selbst, trotz ihren leichten Leibchen, und er traute sich nicht, den Arm zu heben, da er den Schweißfleck unter seiner Achsel fürchtete. Sein Nebenmann saß nämlich dicht an seiner Schulter.
Endlich kamen die Tagesthemen zu den für ihn wichtigen Belangen, zu den Magiern, und Kacey durfte im Namen der Akademie seine Stimme erheben. Ari nickte ihm mit einem Lächeln zu, sie hatte ihn mit Wohlwollen in ihre Familie aufgenommen und ein gewisser Stolz funkelte in ihren Augen, als sie ihn aufforderte: »Oberster Magister Kacey, als neuer Leiter der Akademie besitzt Ihr das Wort. Bitte erhebt Euch.«
Kacey stand auf, alle Blicke lagen auf ihm. Schon lange machte ihn das nicht mehr nervös, er war so oft bei Versammlungen vorgetreten, um seine Meinung kundzutun, hatte Zustimmung und Abweisung geerntet, dass es für ihn so normal geworden war wie der tägliche Gang zum Abort.
»Verehrte Lords und Ladys, Räte, Stadtverwalter, Gutsbesitzer und weitere«, er las von seinen Notizen ab, schob Blätter knisternd auseinander und faltete dann die Hände vor dem Bauch. »Ich spreche heute für alle Magier und es besteht Grund zur Sorge. Ich weiß, dass die Kaiserin und der Kaiser alles in ihrer Macht stehende tun, um uns zu schützen, doch nach dem letzten Angriff, habe ich große Zweifel.« Er pausierte kurz, sah dabei auf, fuhr dann fort. »Ihr wisst sicher alle, was ich getan habe, und ich stehe dazu und erwarte, wenn gewünscht, meine Strafe. Deshalb spreche ich heute vor, um zu erklären, was passiert ist.« Er sah sich um, einige Gesichter waren voller Argwohn, andere tuschelten, zweifelsohne über ihn, andere waren schlicht neugierig. »Die sogenannten Hexenjäger drangen erneut in die Akademie ein, mit Schwertern und silbernen Schilden bewaffnet, und griffen alles an, was sich bewegte. Es war mitten in der Nacht, sie verschafften sich leise Zugang, schlugen drei Gardisten nieder und überraschten eine junge Magierin im Erdgeschoss. Sie war sechszehn Sommer, als sie sich in der Küche etwas Milch warm machte. Sie wurde von fünf Schwertern durchbohrt.« Er blickte ernst in die Menge und betonte es noch einmal. »Fünf Schwerter. Breite Klingen, Ritterwaffen, die ein zierliches, kleines Mädchen niederstreckten. Meine Herrschaften, das war grausamer Mord, wie wir es auch drehen und wenden.«
Er erhielt zustimmendes Gemurmel und Nicken, doch es gab auch trotz aller Traditionen genug Elkanasai, die die Arme verschränkten oder spöttisch schnaubten. Er ignorierte sie.
»Daraufhin habe ich entgegen des guten Rates meiner Kollegen«, er deutete nach links und rechts zu den beiden Professoren, die ihn begleiteten und sich sichtlich von seinen Entscheidungen absondern wollten, indem sie nickten, »einen Schutzschild um die Akademie gezogen. Es handelt sich dabei um ein intelligentes, selbsthandelndes Kraftfeld, das den Verstand eines ungebetenen Eindringlings verwirrt, ihn vergessen lässt, wo er war, wohin er wollte, sogar wie er heißt, und seinen Fluchtinstinkt weckt, indem es sich bedrohlich zeigt. Es ist ein Alptraumfeld.« Er leckte sich die Lippen, er war stolz auf seine Arbeit, wusste aber auch, dass sie nicht bei allen Zustimmung fand. »Somit fällt diese Art von Schutzschild bereits in die Kategorie der magischen Kriegsführung. Mir ist bewusst, dass diese Art der Zauberei innerhalb der Stadt und innerhalb einer Friedensperiode verboten ist, doch möchte ich darauf hinweisen, dass wir bereits zwei Angriffe abwehren mussten, und einer endete für eine von uns blutig und tödlich.« Auch dieser Worte ließ er wirken, er musste leise schlucken, dann sah er auf. »Ich möchte nicht erneut einer Familie schlechte Nachrichten überbringen. Deshalb beantrage ich, das Kraftfeld bestehen zu lassen und fordere für die Sicherheit der Magier Elkanasais, dass an Akademien wieder Verteidigungszauber und auch Kampfmagie gelehrt werden darf« - er musste ob des durcheinandergeratenen Stimmengewirrs lauter sprechen - »damit wir gegenüber dem Feind, der sich erhoben hat, nicht völlig machtlos dastehen. Ich bitte um genaue und objektive Betrachtung und Beurteilung der Vorfälle und fordere deshalb ein Eilverfahren zur Aufhebung des Verbots der Zerstörungsmagie.«
Er hatte die letzten Zeilen von seinen Notizen abgelesen, obwohl dort etwas völlig anderes stand. Die ganze Nacht hatte er überlegt, wie er den Begriff geschickt umgehen konnte, denn es war nicht das, was er wirklich wollte. Zerstörung war solch ein hässlicher Begriff. Er wollte nichts zerstören, er wollte schützen. Als er nun aufsah, war er seit Jahren doch das erste Mal wieder nervös.
Die Anwesenden gingen beinahe über Tische und Bänke, während sie untereinander diskutierten. Es war ähnlich wie auf einem der Gemälde in den Fluren des Palastes, auf denen Versammlungen festgehalten wurden, Momente, als neue Zeitalter anbrachen und neue Denkweisen auf alte trafen, wo Tradition sich gegen Erneuerung auflehnte. Aufgebrachtes Rufen, erhobene Hände, tadelnde Finger, rote Köpfe.
Kacey verstand nicht ein Wort, doch die Decke und der Boden schienen unter dem Tumult zu vibrieren. Und plötzlich wusste er, wie Riath sich gefühlt haben musste, als er vor sein Volk getreten war und verkündet hatte, dass seine Kräfte erwacht waren und Wexmell ihn zu seinem Erben ernennen würde. Ähnlich wie das Bild, was sich Kacey bot, hatte Riath diesen Tag im Thronsaal in einem Brief an ihn beschrieben. Es war beängstigend zu sehen, wie viele Gegner die Magie besaß, nachdem alle Völker so lange von ihrem Nutzen profitiert hatten. Aber es schien ein Unding, dass die Magie verlangte, sich selbst zu schützen.
Doch was war so viel anders an einem Mann mit einem Schwert als an einem Mann mit Magie, beide konnten sowohl damit töten als auch schützen. Warum durften Wachen Speere und Schilde tragen, aber Magier mussten ungeschützt umherlaufen?
Kacey verstand das System nicht, denn in Kriegszeiten wurden seine Schüler dazu genötigt, zu töten, aber wenn man sie persönlich angriff, war Magie zum Einsetzen der eigenen Verteidigung ein Gräuel?
Die Welt der Magier war ungerechter, für einige Anwesenden in dieser Halle waren Hexer und Hexen nicht mehr als Hunde, Haustierchen, die den Hof bewachen konnten, aber einen Maulkorb aufgezwungen bekamen, wenn sie sich vor einem tierhassenden Besucher verteidigten, der nach ihnen trat.
Kacey würde es nie verstehen, wie es in Elkanasai zu dieser Art Konflikt gekommen war. Die Elkanasai waren gebildet, fortschrittlich und haben schon immer Seite an Seite mit Magiern gelebt, das halbe Volk war der Magie mächtig. Wie war es möglich, dass Angst und Hass so schnell wie ein Lauffeuer die Runde machen konnte? Ohne ersichtlichen Grund, nur aufgrund von gruseligen Geschichten aus Nohva, wo Kinder angeblich ihre eigenen Eltern während eines Wutanfalls durch unkontrollierte Magie getötet hatten. Wo Hexen Ehemänner verführten oder Liebhaber auf ewig verfluchten, nur weil sie ihre Liebe nicht erwidert hatten. All dies waren doch keine Gründe für solch einen Argwohn, für solchen Hass, dass man Magier regelrecht verfolgte.
Nur weil in Nohva ein Hexenprinz den Thron hätte besteigen sollen.
Doch es war, wie Riath es einst so vortrefflich in einem seiner Briefe formuliert hatte:
…es hat weder Sinn noch Verstand, Kacey, es ist völlig irrational. Angst geht Hand in Hand mit Wut, so hat Wexmell es gesagt, doch die Ängste des Volkes sind leichter zu entfachen, als sie wieder zu nehmen. Ich habe es hier beobachtet, ich kann mir auch nicht erklären, wie so eine Nichtigkeit eine Verfolgung einer ganzen Völkergruppe nach sich ziehen kann. Vermutlich ist es die Angst vor Dämonen, oder die Angst vor etwas, das sie nicht verstehen. Wir könnten ewig darüber grübeln, warum oder weshalb, vielleicht ist es jedoch schlicht ein Vorwand oder der einzige Weg, jemanden wie mich zu stürzen, indem man alle Zauberkundigen zu Sündenböcken macht.
Sie sind dumm, Kacey, man kann ihre Beweggründe nicht erklären. Sie sind einfach dumm, und der Hass auf etwas, das sie nicht verstehen, gibt ihrem tristen Leben Würze.
Während der lautstarken Diskussionen steckte die Kaiserin mit dem Rat der Fünf – der seit dem geisterhaften Verschwinden eines ihrer Mitglieder noch immer nur zu viert war – die Köpfe zusammen. Sie wirkte konzentriert, denn das Thema war äußerst brisant und bewegte derzeit alle Königreiche. Sie musste ihre Entscheidung umsichtig treffen, um alle Seiten zu beruhigen.
Wie sollte man mit Magie verfahren, wie viel Freiheit war ihr erlaubt? Tatsächlich diskutierten die Politiker bereits darüber, ob ein Kult wie die Hexenjäger vielleicht staatlich gemacht werden sollte, um sie einerseits zu kontrollieren, und andererseits, um gefährlich gewordene Magier zu jagen und unschädlich zu machen. Die Hexenjäger waren in Nohva emporgekommen, doch sie trugen ihre Wahrheit mittlerweile wie religiöse Missionare über jede Grenze hinweg, wie eine Seuche. Und statt sich davor zu schützen, handelten alle Reiche genauso abwartend wie König Wexmell in Nohva, wägten ab, beschwichtigten, zögerten hinaus, und wunderten sich hinterher, wenn der Aufstand nicht mehr aufzuhalten war.
Es ging den Jägern nicht nur um Nohva, sie wollten die Magie überall in Knechtschaft zwingen, damit niemals irgendwo ein Zauberkundiger auf einem Thron saß. Sie fanden in jedem Land Zustimmung, überall gab es jemanden, der schon immer einen persönlichen Argwohn gegen Magie gehegt hatte, viele Leute wollten auch einfach gegen die Obrigkeit rebellieren, sich wichtig fühlen. Wie Riath sagte, die Hexenjäger wollten schlicht, dass alle Magier litten, damit keiner von ihnen je Macht – und damit absolute Freiheit erlangte. Gleichberechtigung war nur ein Trugschluss, als es darauf ankam, zu den Magiern zu halten. Wer nicht gegen sie war, hielt sich lieber raus.
Kacey verstand ihre Angst sogar, Magie schien wie Wunder, sie war für Normalsterbliche unbegreiflich, sie sahen nicht die Energieströme, Auren oder geisterhaften Kräfte, nicht die Schönheit, die der Magie innewohnte. Die wahre Natur war für das normale Auge nicht sichtbar, nur Magier besaßen diese Sicht. Für alle anderen war das, was Zauber bewirkten, unerklärlich, vielleicht dämonisch. Doch Magie war ein Teil ihrer Welt, lebte im Boden und in jedem von ihnen, Seelen waren Magie. Und Magier, die diese Ströme lenken konnten, waren unglaublich wichtig, gerade im Kaiserreich, wo durch den Zusammenbruch des Sklavenhandels die Wirtschaft angegriffen war und wo das Klima lebensfeindlich sein konnte, brauchten sie Magie, um die Ernten zu retten und ihre Erträge zu verdoppeln, um fauliges Wasser wieder trinkbar zu machen oder sogar, um gefährliche Stürme abzumildern, damit keine ganzen Städte in Schutt und Asche verwandelt wurden.
»Zauberkundige sind da, um zu dienen«, erhob sich eine kräftige Frauenstimme von der gegenüberliegenden Wand über das Stimmengewirr, die Halle hörte sie an. »Magie sollte immer nur zum Wohle aller eingesetzt werden, zum Heilen und zum Erneuern, so will es das Gesetz.«
Kacey sah die Frau an, bemerkte ihre Empörung und beschwichtigte sie mit einer Geste. »Ich weiß, mein Antrag klingt drastisch, aber bitte, ihr kennt mich mittlerweile alle, habt mich oft angehört, ich war immer der festen Überzeugung, dass Magie dazu da ist, dem Wohl der Gemeinschaft zu dienen, und ich bin selbst ein Feind der Vorstellung, magische Kriege zu führen. Doch hier geht es darum, dass wir die Erlaubnis bekommen, uns selbst zu verteidigen. Denn hätte das Mädchen ihre Angreifer, die ganz offensichtlich nach ihrem Leben trachteten, in einem Impuls durch magisches Feuer oder Eis niedergestreckt, würde sie wegen ihres Vergehens hängen.«
Nun brach erneutes Chaos aus, denn seine Magierkollegen stimmten lautstark zu und es wurden sich verschiedene Ansichten durch den Raum entgegengerufen.
Ein älterer Lord erhob sich, schneeweißes Haar und glatte Wangen, strenges Gesicht, er fuchtelte wütend mit einem Arm. »Ihr sagt, wir würden Euch kennen? Was, wenn Ihr uns die ganze Zeit etwas vorgespielt habt, um unser Vertrauen zu erschleichen, um es jetzt auszunutzen?«, klagte er Kacey an, sodass einige andere sichtlich ins Grübeln kamen. »Ihr tut so, als ob Ihr nur das Wohl aller im Sinn habt, und dann bringt Ihr uns dazu, Verbote aufzuheben, damit Ihr die Herrschaft über die Stadt übernehmen könnt!«
Was?! Kacey war auf alles vorbereitet gewesen, aber nicht darauf, dass man ihm unterstellen könnte, dass er die Stadt an sich reißen wollte. Entsprechend ungläubig blinzelte er den Mann an.
»Ich sage Nein!«, rief der Mann aus und sprach nun zu allen, bevor Kacey sich hatte fangen können und begriff, wie die Stimmung kippte. »Wo kämen wir denn da hin, meine Lords und Ladys, wenn wir plötzlich alle Gesetze aufheben würden. Unsere Vorväter haben sich etwas dabei gedacht, als sie diese Verboten aufschrieben, sie wollten uns schützen! Die Magie ist mächtig, sie muss ihre Ketten anbehalten. Vergessen wir nicht, dass dieser Kult von Hexenjägern nicht ohne Grund entstand! Wir würden ja auch keinen Jaguar unter uns herumlaufen lassen und darauf hoffen, dass sein Instinkt, zu töten, nicht erwacht!«
»Vergebung«, mischte Kacey sich ein, freundlich und nachsichtig, obwohl ihm der eigene Herzschlag in den Ohren rauschte. »Aber bitte vergessen wir nicht, dass die Richtlinien für Magie von den gleichen Männern verfasst worden waren, die auch dafür verantwortlich waren, alle kurzlebigen Völker mit runden Ohren und ohne Fänge zu dem puren Bösen zu erklären, und außerdem Sklaven hielten.«
Davon wollte der Elkanasai gar nichts hören, er winkte grunzend ab, als ob Kacey ein schmutziger Straßenjunge wäre, dessen Meinung ihn nicht interessierte. »Ihr seid doch gar nicht objektiv, Ihr stammt nicht von hier, Ihr wart Sklave und vor allem seid Ihr selbst ein Magier!« Und wieder wandte er sich an alle. »Wenn wir erlauben, dass Magie zur Verteidigung eingesetzt wird, dann wird sie auch bald zur tödlichen Waffe gemacht. Und am Ende nehmen sie sich das ganze Land oder gar das Reich der Götter!«
Ein anderer aus den unteren Reihen stimmte ihm zu und erhob sich mit den Worten: »Schaut doch, was in Nohva geschehen ist, wo die Magier keine Akademien besitzen und keine Regeln bezüglich der Magie! Dort, wo die Magie frei ausgelebt werden durfte, nach eigenem Ermessen, starben so viele Menschen, ob gewollt oder durch Unfälle, dass sich ein Kult erhoben hat. Aus purer Verzweiflung!« Er wandte sich an die Emporen der Magier, legte seine Hände aneinander und verneigte sich tüchtig. »Verzeiht, ich will keinem etwas unterstellen, ich profitiere selbst von der Magie, aber wir Normalsterblichen müssen uns auch vor ihrer dunklen Seite schützen – und wir wollen euch vor euch selbst schützen.«
Nobel, dachte Kacey, aus diesem Mann sprach lediglich die Angst. Doch die Diskussion brannte heiß im Raum, mit solch einem Tumult hätte er niemals gerechnet. Dass man ihm durch die Bürokratie Steine in den Weg legen würde hatte er erwartet, aber eine offene, hitzige Debatte war für Elkanasai äußerst untypisch und zeugte davon, wie brisant dieses Thema bereits war.
Es hatte sich in die Köpfe der Bürger geschlichen, war bis in die hohe Politik vorgedrungen und spaltete sie. Innerhalb weniger Wochen.
»Wir haben sicher nicht vor, die Magie gegen unsere eigenen Brüder und Schwestern zu wenden«, wandte Kacey ein, »und ich spreche auch nicht davon, dass wir jedem Magier gestatten, überall und nach Belieben Zerstörung anzurichten.« Er musste lauter rufen, wenn er Gehör finden wollte, und erhob die Stimme. »Es geht lediglich darum, dass sich ein Magier mit seiner eigenen Magie verteidigen darf!«
»Dann soll er doch ein Schwert tragen«, rief jemand. Kacey konnte ihn unter all den aufgebrachten Togenträgern nicht herauserkennen.
»Wie soll sich ein einziger Magier mit einem Schwert gegen fünf Angreifer zur Wehr setzen?«, sagte nun auch der Professor zu seiner Linken. Dankbar legte Kacey dem älteren Kollegen eine Hand auf die Schulter seiner nachtblauen Robe.
»Wir können auch nur ein Schwert benutzen, um uns zu verteidigen, warum soll euch mehr gestattet sein als uns?«
Neid. Ein weiterer Grund, die Magie zu hassen. Kacey schloss kurz die Augen, musste sich sammeln. Es war völlig surreal, was hier geschah, er konnte es nicht begreifen. Und doch wusste er, dass der Fehler bei ihm lag, denn in einer so heiklen Situation hätte er nicht um mehr Freiheiten für seinesgleichen bitten dürfen, das hatte ihren Gegnern nur noch mehr Brennholz für Argwohn und absurde Geschichten und Ängste geliefert.
Aber was für eine Wahl hatte er, wenn er seine Schule schützen wollte?
Irgendwo hörte er jemanden zu einem anderen sagen: »Und am Ende tritt er die Wahl zum Kaiser an. Stell dir das mal vor, erst soll in Nohva ein Hexenprinz auf den Thron, dann wollen die Magier das Kaiserreich übernehmen.«
»Das kann er doch nicht, oder?«
»Jeder darf sich zur Wahl stellen.«
»Aber nur, wer die Gesetze achtet.«
»Na ja, der ist doch auch ein Prinz, Sohn des Kaisers, viele schätzen ihn. Warts nur ab, in ein paar Jahren haben die Magier uns ganz übernommen, dann gibt’s uns nicht mehr.«
Empörtes Einatmen folgte.
Kacey wünschte, er hätte das nicht mit angehört, Zweifel und Missgunst ihm gegenüber gingen ihm immer besonders nahe, da er nichts mehr wollte, als gemocht zu werden.
Er machte eine beschwichtigende Geste. »Ich versichere, dass wir lediglich um unsere Sicherheit besorgt sind. Wir wollen euch allen weiterhin dienen…«
»Brauchen wir sie denn wirklich, geschätzter Rat?«, rief eine junge Lady zur Empore der Kaiserin hinauf. »Ist es vielleicht nicht sogar Zeit, diese Akademie dicht zu machen? Dann kann sie nicht mehr angegriffen werden!«
Der Rat ignorierte Zwischenrufen, solange er mit der Kaiserin flüsterte. Doch ihre Worten fanden weitere Zustimmung. Und plötzlich stand die Frage im Raum, ob die Stadt die Magier überhaupt brauchte.
»Wir wollen euch dienen!«, rief Kacey und spürte doch, wie ihm die Zuhörer entglitten. »Wir wollen euch heilen, eure Ernten retten, eure Kinder sicher zur Welt bringen! Um euch zu dienen, brauchen wir aber auch euren Schutz und eure Zusicherung, dass wir nicht hängen, sollten wir uns einmal selbst verteidigen müssen!«
»Wer stirbt, wie viel Ernte es gibt und wessen Kind lebt oder nicht, bleibt allein den Göttern überlassen«, konterte der Mann mit der strengen Miene. »Das ist nun mal das Gesetz der Natur!«
Und so etwas von einem Elkanasai, der ohne die Magie wohl kaum sein Alter erreicht hätte – oder einfach Glück gehabt hatte.
»Verzeiht«, sagte Kacey beherrscht und kummervoll zu ihm, »aber das würdet Ihr bestimmt nicht sagen, hättet Ihr eine Frau oder ein Kind bei der Niederkunft verloren. Oder andere Angehörige, die zu früh aus der Welt schieden, weil die Pest sie holte.«
Nun erntete er laute Zustimmung, denn viele im Raum hatten gewiss schon einmal von der Magie profitiert und dank ihrer ein Familienmitglied aus dem Griff des Todes gerettet.
Er konnte nicht fassen, was er da hörte, wie kalt und ignorant diese Bürger sein konnten. Ein wenig begriff er Riaths Wut, er hatte das Gefühl, mit bloßer Vernunft und Logik gegen Wände zu laufen, oder gar noch mehr Misstrauen zu wecken.
Der Rat und die Kaiserin hatten zu ende beratschlagt. Als Ari ihre Hand zu einer beruhigenden Geste hob, verstummten alle Anwesend schlagartig. Als hätte das ganze Chaos nie stattgefunden.
»Danke, Oberster Magister Kacey«, sagte die Kaiserin mit ihrer samtenen Stimme ruhig zu ihm und bedeutete ihm, sich zu setzen.
Kacey strich die weite Toga glatt und nahm Platz.