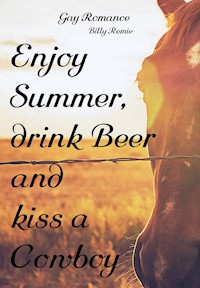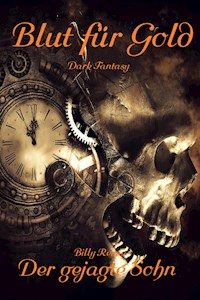5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Bruderschaft 7
- Sprache: Deutsch
»Statt für Veränderungen, sorgten wir für Verdammnis…« Seuche und Krieg wälzen sich wie ein Meer aus Zerstörung und Tod von allen Seiten über Nohva, um es zu verschlingen. Die Spannungen zwischen Xaith und Desith spitzen sich zu, Sarsar kämpft sich mit seinen Gefährten wider Willen durch die Heimtücke des Dschungels, Ragon blickt hinter Masken und Melecay reißt Mauern ein. Wexmell stürzt in einen tiefen Abgrund und an Kacey zerren Vernunft und Liebe wie zwei urgewaltige Stürme, bis er nicht mehr weiß, ob er seinen eigenen Gefühlen überhaupt noch trauen kann. In dieser ungewissen Zeit und in all der Dunkelheit keimen und gedeihen Sehnsüchte ebenso wie Hass – und der ein oder andere wird vor die Wahl gestellt, ob er seinem Herzen folgt oder seinem Versprechen treu bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1018
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Billy Remie
Geliebte Erben
Erwachen der Gebannten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil 2: Im Auge der Verdammnis
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Teil 3: Zorn des Bruders
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Impressum neobooks
Prolog
Der sternenklare Nachthimmel funkelte in all seiner Pracht über dem Land. Eine tiefblaue Dunkelheit, mit hellleuchtenden Sternen durchzogen, wie Diamantensplitter auf dunklem Samt. Der Mond stand hoch und leuchtete grell, sein silbriges und kaltes Licht beschien die gefrorene Schneedecke, die das Land wie eine zu üppig geratene Kuchenglasur bedeckte. Nur im Lager, zwischen all den Zelten, war die weiße Masse zertreten und mit Schlamm vermischt, dass kaum noch etwas von den ausgestreuten Tannennadeln zu sehen war, die den von Fackeln gezäumten Weg geziert hatten, wie Rosenblüten den Mittelgang einer Kirche, wenn Hochzeit gehalten wurde.
Doch selbst in dieser Hinsicht war diese Vermählung anders. In fast allen Belangen war sie anders.
»Warte auf mich«, kicherte Jin und stolperte immer wieder über seine eigenen Füße, ein wenig betrunken vor Glück, aber auch betrunken vom vielen schweren Wein, der sich bereits auf seine Zunge gelegt hatte wie ein weicher Pelz.
Xaiths Hand umklammerte die seine, nicht zu fest. Niemals zu fest. Aber die langen und eleganten Finger, die eine Gleve genauso kunstvoll schwingen konnten wie einen Pinsel, hielten ihn doch mit einer eisernen Entschlossenheit fest, die unmissverständlich war. Er würde ihn nicht loslassen.
Xaith sagte nichts, er tauchte in das Lager ein, stahl sich wie ein Dieb von den Festlichkeiten fort, zog Jin an der Hand zwischen zwei engstehende Zelte und weiter, immer weiter, auf Schleichwegen in die Richtung, in der sein Zelt lag. Ihr Zelt. Des Prinzen Zelt – und seines Gemahls, Jin.
Ihm schwindelte, wenn er daran dachte, dass er jetzt zum Königshaus gehörte. Ausgerechnet er, und ausgerechnet Xaith war sein Gemahl. Sein Vater drehte sich vermutlich im Grabe herum, einmal aus Freude, einmal aus Sorge. Doch diese wäre unbegründet und Gerüchten geschuldet gewesen, die in keiner Weise der Wahrheit entsprachen. Xaith war nicht der Junge, für den Jins Vater ihn gehalten hatte. Nicht grausam, nicht arrogant, nicht gefährlich. Nicht »seltsam«. Könnte er ihn heute sehen, dachte Jin, könnte er sie doch nur beide sehen, er wusste, dass sein Vater seine Meinung geändert und sich entschuldigt hätte, je an seinem Prinzen gezweifelt zu haben.
So wie viele aus dem Volk ihre Vorurteile seit Beginn des Krieges bereuten.
»Es ist noch Zeit«, flüsterte Jin erheitert, während er hinter seinem frisch gebackenen Gemahl her stolperte. Seine Finger waren rot und steif von der Kälte, der Frost war in der Nacht über sie gekommen, ein eisiger Wind flüsterte zwischen den Zelten, der selbst die Schatten frieren ließ. Aber das spürte Jin vor lauter Trunkenheit nicht, vielleicht hatte er einen Becher zu viel. In Anbetracht der Umstände.
»Wir müssen dich nüchtern bekommen«, sagte Xaith trocken, ohne sich umzudrehen.
»Mir geht es gut!« Jin stolperte wieder, noch bevor er die Worte ausgesprochen hatte, dieses Mal war sein Fuß an einem Pflog im Boden hängengeblieben, der ein Zelt gespannt hielt. Er taumelte gegen Xaith und musste sich an ihm festhalten, wobei er dessen Mantel ein paar Rabenfedern ausriss.
Xaith kommentierte das nicht, wofür Jin ihn glatt noch mehr liebte. Stattdessen drehte er sich um und schob ihn um die Ecke und durch den Eingang ihres Zeltes.
Schwaches Kerzenlicht empfing sie, als die Planen hinter ihnen zufielen und die Kälte und die Nacht aussperrten. Die weißen Kerzen waren zu Stumpen niedergebrannt, einige waren erloschen, andere glommen schwach vor sich hin. Es sah schön aus, warm und anheimelnd, zusammen mit den glühenden Feuersteinen in den Kohlepfannen, die für die nötige Wärme sorgten. Es roch nach Xaith, nach jungen Tannen und Freiheit und Heimat.
Etwas Samtenes und gleichsam Warmes drückte sich auf die empfindliche Haut in Jins Nacken, Atem floss unter seinen Kragen, und zärtlich legten sich schlanke Finger um seine Seiten. Jin schloss die Lider und drehte das Gesicht nach hinten.
Xaiths Lippen lösten sich von seinem Nacken, küssten sein Jochbein, und flüsterten: »Ist dir kalt?«
Sofort schüttelte Jin den Kopf. »Nein.« Er drehte sich um und Xaiths Hände legten sich um sein Gesicht, um es anzuheben und festzuhalten. Er küsste Jins Lippen mit einer Zärtlichkeit, als wollte er einen Schmetterling fangen. Küsste ihn noch einmal, und nochmal, immer ein wenig länger, intensiver. Sein hochgewachsener und schlanker Leib drängte gegen Jin, drängte ihn durch das Zelt in Richtung Bettstatt, während ihre Hände unter die Mäntel fanden, unter die Westen, Knöpfe und Schnüre lösten, damit die kühle Luft ihre erhitzte Haut erreichen konnte.
»Xaith…«, flüsterte Jin zwischen zwei Küssen, bevor seine Worte wieder sanft erstickt wurden. Ihm schwirrte der Kopf und Xaiths Lippen ließen ihn schwindeln und unvorsichtig werden. Er wollte ihn nicht aufhalten, das war das Letzte, was er wollte, genau deshalb musste er ihn warnen. Er konnte nicht klug sein, nicht vorsichtig, und er wollte ihn nicht auf die Probe stellen. Also musste er ihn warnen, vor sich selbst. Wenn auch schwach, sehr schwach… Nur noch ein paar Herzschläge lang und er würde sich nicht mehr zurückhalten können. Er wollte ihn berühren, überall, alles von ihm streicheln, alles von ihm küssen. Ihn einatmen, einsaugen, sich einverleiben. Jin legte die Arme um Xaiths Mitte, die Hände flach in sein leichtes Hohlkreuz, dort, wo sein Leib zur Hüfte hin schmäler wurde, als er es an den Schultern war. Ein perfektes, schmales, drahtiges V.
»Hab keine Angst«, hauchte Xaith und streichelte Jins Wangen besänftigend, »Vertrau mir.«
Jins Herz machte einen verräterischen Satz, er blinzelte, nun betrunken vor Lust, die durch seinen Leib prickelte. »Ich hab keine Angst«, erwiderte er rau vor Begierde. Angst? Im Gegenteil. Seine schwerhängenden Lider und der verklärte Blick zeigten Xaith, dass er mächtig auf dem Holzweg war.
Im Halbdunkel forschten die Drachenaugen noch einen Moment in Jins Blick, eher Xaith ihm wieder den Mud auflegte. Drängender, aber nicht minder liebevoll.
Xaith löste den Umhang, er fiel raschelnd zu Boden und sie stolperten darüber. Jin tat es ihm mit seinem Umhang nach. Sie drehten die Gesichter im Kuss, ihre Zungen fanden sich, kosteten sich, streichelten sich. Nur selten holten sie Atem, mit geröteten Mündern und Wangen – und funkelnden Augen, als hätten sie Fieber.
Das Fieber der Leidenschaft.
Kalte Finger fanden unter Kleidung, die sich schnell an ihrer Hitze aufwärmten. Westen, Hemden landeten zu ihren Füßen. Zärtlich hielt Xaith ihn im Arm, seine nackte Brust versprach eine Wärme, die kein Feuer je spenden könnte, und Jin labte sich regelrecht daran. Sie stolperten aus den Stiefeln, aus den Hosen, Jin kicherte, zerbarst fast vor Glück, wenn Xaith ihn wieder an sich zog und ihre Zungen sich wieder fanden. Er schien überall, auf Jins Lippen, auf seiner Brust, in seinem Nacken, seinen Rücken, wo seine Hände ihn so zärtlich streichelten, dass er eine Gänsehaut bekam.
Jin wusste nicht, ob er vielleicht nur träumte. Aber selbst wenn, es war ein schöner Traum, er würde nicht aufwachen wollen. Es sei denn, Xaith weckte ihn, um genau das zu tun.
Sie fielen in die Decken und Kissen, Xaith über ihm. Die gelbgrünen Drachenaugen leuchteten im Halbdunkeln mystisch wie Waldseen. Ohne zu lächeln, sah Xaith auf ihn herab, die schwarzen Strähnen seines seidigen Haares hatten sich aus seinem lockeren Knoten gelöst und umrahmten sein hübsches, schmales Gesicht. Jin streckte die Hände aus und berührte es, fuhr sacht mit den Fingerkuppen über die glatten Wangen, die immer ein wenig hohl wirkten, über die hohen und scharfkantigen Jochbeine, die aussahen, als lägen Klingen unter der Haut, und hinab zu den schmalen, aber sanften Lippen, zu dem spitzen Kinn. Und sein Herz zog sich zusammen, weil er so viel Liebe für all das empfand, dass er sie fast nicht ertrug.
Sie sahen sich in die Augen.
»Ich weiß«, sagte Xaith dunkel und ernst, »und ich dich.«
Jin musste lächeln, eine Woge unbeschreiblichen Glücks rieselte durch sein Bewusstsein, dass es sich anfühlte wie eine wohlige Gänsehaut.
»Vertrau mir«, bat Xaith und seine Züge wurden weicher, fast wirkte er verletzlich. Verletzlich, weil er sich vor Zweifeln fürchtete.
Jin lächelte wärmer und fuhr mit den Händen in das schwarze Haar seines Geliebten. Seines Gemahls. »Ich habe keine Angst«, hauchte er zärtlich und legte den Kopf schief, während er zu ihm aufsah. »Wenn du glaubst, du kannst dich kontrollieren, dann glaube ich erst recht an dich.«
Xaith sah zwischen Jins zimtbraunen Augen hin und her, forschte in ihnen, lange und tief, als könnte er in seine Seele blicken. Jin schaute unbeirrt mit Liebe zurück, kraulte Xaiths Nacken.
Dann senkte er sich herab und küsste Jin erneut. Tief und innig. Sie atmeten einander, pressten ihre nackten Körper aufeinander, als wollten sie in den jeweils anderen hineinkriechen. Xaith ließ sich Zeit, er tat ihm nicht weh, festumschlungen und im Kuss vereint bereitete er Jin vor, woraufhin sie beide im Moment der Verschmelzung mit aneinander gepressten Stirnen wohlig keuchten, und sich dann Arm in Arm wiegten, bebten, zitterten.
Kapitel 1
Es war ihm gleich, dass es mitten in der Nacht war. Es war ihm gleich, dass die Schiffe gegeneinanderprallen könnten, als er befahl, ihn hinüberzulassen. Es war ihm egal, dass er vielleicht herrisch oder unliebsam erschien, als seine Stimme immer schneidender wurde, während er all jenen Konsequenzen androhte, die ihn daran hinderten, auf das andere Schiff zu kommen. Sie. Sollten. Gehorchen.
»Es ist mir gleich, welche Gefahren den Schiffen bei Dunkelheit drohen. Wenn ihr so gute Kapitäne seid, wie uns angepriesen wurdet, dann dürfte es doch kein Problem sein, die Schiffe eng nebeneinander zu manövrieren und mit ein paar Planken zu verbinden«, konterte er der dem Kapitän seines eigenen Schiffes, während sie in dessen Kabine saßen.
Der Mann hatte zu schwitzen begonnen. »Herr Kacey, die Segel-«
»Prinz«, musste er korrigieren. Normalerweise hätte er auf jedwede Anrede und jedwedes Arschkriechen verzichtet, es war dem echten Kacey nicht wichtig, aber ein Teil von ihm kochte so sehr vor Wut, dass es ihm nur willkommen war, den Mann noch mehr zu verunsichern. Kaceys schlanke Finger umklammerten die Stuhllehnen, sodass seine Knöchel weiß wie der Schaum auf den Wellen waren. Ein schwerer Tisch trennte ihn vom Kapitän und verhinderte, dass Kacey ihn ansprang.
Sofort neigte der Kapitän den Kopf. »Verzeiht, Eure Majestät, aber die Segel-«
»Dann holt sie ein!« Er war aufgestanden, so schnell, dass der Mann zuckte. »Werft die Anker. Mir egal. Aber tut, was ich sage, und zwar gleich!«
Der Kapitän blickte verwundert auf. »Wir fahren mit-«
Kacey wirbelte wieder herum. »Wenn Ihr es wagt, mir die verdammte Anzahl Knoten zu nennen, schwöre ich, dass ich in die See springe und eigenhändig rüber schwimme. Mal abgesehen davon, dass Riath Euch die Haut abzieht und kopfüber an den Maßt hängt, weil Ihr zuließt, dass ich mich in Gefahr begebe, was denkt Ihr, würden die Drachenreißer mit Euch machen, solltet Ihr gezwungen sein, mir nachzuspringen, um Euren verdammten Kopf zu retten?«
Mit offenem Mund sah der Kapitän zu ihm auf, da er noch mitten im Satz gewesen war. Das breite Gesicht des Mannes war ein Ausbund an Unbehagen und offensichtlichem Ärger, den er nicht preisgeben durfte. Nach ein paar Herzschlägen klappte er endlich die Lippen wieder zu. Und nickte.
»Wir verstehen uns.« Kacey drehte sich um und verließ die Kabine.
Draußen nahmen die Leibwachen Haltung an. Zwei Magier der Elkanasai warteten ebenfalls auf ihn, dick eingepackt in mehrlagige Roben aus dunkelblauem Samt, auf den goldene Sichelmonde und Perlweiße Vollmonde bestickt waren. Kaceys hatte die Idee dazu gehabt, sie sahen aus wie der Nachthimmel.
Kacey selbst trug gefütterte Hosen, einen Mantel und einen Umhang – und fror trotzdem.
»Magister…«, begann einer der beiden Elkanasai und fummelte nervös an seinen Fingern, als sie sich seinem Schritt anschlossen. »Könnten wir Euch einen Moment sprechen…«
»Nicht jetzt«, presste Kacey durch die Zähne. Die beiden waren jung, jünger als er, so wie die meisten Magier aus Elkanasai, die keine große Wahl gehabt hatten, als zu dem einzigen Wappen zu fliehen, das ihnen in diesen Zeiten noch Schutz versprach. Riaths Banner. Der purpurne Drache auf schwarzem Grund, das Wappen des Hexenprinzen.
Er spürte die Enttäuschung der beiden, als er sie abwies und sie stehen bleiben mussten, vielleicht war es sogar ein Hauch Verzweiflung, der sie umgab.
Damit konnte er sich jetzt nicht befassen.
Seinem Willen entsprechend holten sie zum Flaggschiff auf. Und siehe da, wenig später eskortierten sie ihn hinüber auf das weitaus größere Schiff mit den purpurnen Segeln.
Zwei Gardisten in geschwärzten Rüstungen wollten ihm den Zutritt versperren. Ihm! Er schritt auf die dunkle Tür zu und fegte ihnen die Stangenwaffen mit einem lockeren Winken aus den gepanzerten Händen, woraufhin die Waffen in die Wand schlugen und schwingend steckenblieben.
Kacey streckte die Hand vor und stieß die Tür zur Kabine mit einer leichten Druckwelle auf. Krachend schlug sie gegen die Wand »Wo sind sie?«, blaffte er und trat durch den offenen Rahmen. Die Luft knisterte durch seine wütend wallende Aura.
Riath fuhr kerzengerade auf, als hätte er gerade geschlafen, doch er hatte noch Stiefel, Hemd und Hosen an, sodass er wohl eher nur auf dem Bett geruht hatte. »Wie bitte?«
»Spar dir dein dummes, charmantes Grinsen.« Kacey machte eine Handbewegung über die Schulter, sodass die Tür zurück in den Rahmen knallte. »Wo sind sie?«
Riath lehnte sich genüsslich wieder zurück, winkelte ein Bein lässig an und musterte Kacey von Kopf bis Fuß, während er noch charismatischer grinste. Ein Lausbub, mit allen Gewässer gewaschen, und ein Verführer, der einen allein durch Blicke auszog. »Ich bin charmant, sagst du?«
»Riath!« Kacey musste sich davon abhalten, wütend mit dem Fuß aufzustampfen. »Ich meine es ernst!« Er ging auf ihn zu. »Wo sind die Drachenreißer?«
Sein Geliebter schaute drein, als könnte ihn kein Wässerchen trüben. »Sie sind draußen und fliegen oder schwimmen.«
Kaceys Nasenflügel blähten sich wütend. »Verkauf mich nicht für dumm, Riath. Ich weiß genau, dass ein paar fehlen.«
Sie starrten sich an, drei, vier Herzschläge lang. Dann endlich ließ Riath die Schultern hängen und setzte sich seufzend auf. »Es sind so viele, wie konnte dir das auffallen?«
Fassungslos starrte Kacey ihn an und verfolgte ihn mit Blicken, als Riath aufstand und sich das Gesicht reibend an ihm vorbei zu seinem Tisch ging.
»Wolltest du es mir nicht sagen?«
»Wozu?«, fragte Riath und hob eine gläserne Kugel aus der Öffnung eines Krugs, um sich Wein einzugießen. »Wir hätten uns nur unnötig gestritten.«
»Wir streiten jetzt«, knurrte Kacey durch die Fänge.
Wieder ein mattes Seufzen aus Riaths Kehle, der seinen Pokal anhob und davon trank. Sein strohblondes Haar fiel offen über seinen breiten Rücken, wie ein Vorhang bewegte es sich, als er den Kopf zurücklehnte und in einem Zug austrank, als müsste er sich Geduld antrinken.
»Wo sind sie?« Kacey wusste es. Er wusste es ganz genau und hoffte doch, dass er sich täuschte.
Riath stellte den Pokal wieder ab. »Ich habe ein paar von ihnen mit Marks entsandt. Er wird sie brauchen.«
Kacey konnte nicht einmal in Worte fassen, wie wütend er war. Und wie hintergangen er sich fühlte; ein Schwert mitten ins Herz hätte weniger geschmerzt. »Du hättest mich fragen müssen!«, herrschte er ihn an.
Riath drehte sich um und seine Gleichgültigkeit ließ Kacey beinahe den Verstand verlieren. »Ich muss dich nicht um Erlaubnis bitten, du bist nicht mein Vater. Und auch nicht der Vater dieser Tiere.«
Ihm klappte der Mund auf. »Ich habe sie erweckt!«, erinnerte er Riath, tippte sich dabei auf die eigene Brust, auf sein verdammtes Herz, und ging auf ihn zu. »Meine Magie hat Xais Eier entsteinert. Meinetwegen leben sie.«
»Sie sind eine Waffe, Kacey.« Jetzt sprach er so ruhig und verständnisvoll, als wäre Kacey ein verdammtes Kind. »Was hast du geglaubt, was wir mit ihnen machen?«
»Sie sind mehr als das! Du hast sie einfach ohne einen von uns ins Ungewisse geschickt! Sie könnten sterben!«
»Ich weiß, dass du sie gernhast, aber du verschließt die Augen vor der Wahrheit. He! He, komm schon!« Riath griff nach seiner Hand. »Du wusstest, wofür du sie erweckt hast. Was hat sich geändert?«
Ja, er wusste es, aber er wollte es nicht mehr wissen. Auch wenn das keinen Sinn ergab. Jetzt, da sie lebendig waren und er eine Verbindung zu ihnen aufgebaut hatte, war einfach alles anders.
Und es verletzte ihn, dass Riath genau das wusste und sie trotzdem in Gefahr brachte.
Kacey entzog ihm seine Hände energisch und stierte zornig zu ihm auf. »Du hattest kein Recht dazu, Riath! Sie gehören dir nicht!«
»Sie gehören auch dir nicht!« Mit zuckersüßer Stimme legte Riath die Hände um Kaceys Gesicht. »Sie sind nicht deine Schoßhündchen! Sie sind Bestien, keine Haustiere! Das weißt du.«
Zischend schlug Kacey seine Hände weg. »Gilt das auch für Xai?«
Riath legte den Kopf schief und hob eine Augenbraue. »Selbstverständlich gilt das auch für sie, sie ist ihre Mutter! Und ich habe nie den Fehler gemacht, sie zu vermenschlichen.«
»Vermenschlichen?«, echote Kacey. Die Wut erstickte ihn beinahe. »Ich vermenschlich sie also?«
Riath hob die Hände in einer Geste, als wollte er sagen. »Was soll ich tun, es ist Fakt.«
Der Knoten aus Wut in Kaceys Magen zog sich heiß zusammen. »Du Scheißkerl.« Er stieß ihm vor die Brust. »Du weißt genau, was sie mir bedeuten, nachdem dein Bruder mir das Licht gestohlen hat!«
Riath taumelte nicht einmal, er packte sanft Kaceys Handgelenke und riss ihn an sich. »Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir uns einig waren, sie gegen unsere Feinde einzusetzen, Kacey. Es sind Bestien, sie wurden zum Töten geboren, nicht um gekuschelt zu werden.«
Kacey wehrte sich zornig. »Lass mich los!«
»Du wusstest, wofür du sie erweckt hast! Du warst derjenige, der sie zu einem einzigen Zweck aus der Versteinerung befreite!«, sprach Riath auf ihn ein.
Kacey funkelte warnend zu ihm auf. »Du. Tust. Mir. Weh.« Er betonte jede Silbe mit einem gefährlichen Flüstern.
Riath wirkte gelangweilt, als er demonstrativ die Finger öffnete, um ihn loszulassen.
Kacey riss die Arme nach unten. »Du weißt genau, was du falsch gemacht hast. Deshalb bist du auf dein eigenes Schiff zurückgegangen. Feigling!«
»Ich hatte keine Lust zu streiten«, antwortete sein Geliebter schlicht.
»Du weißt, dass viele von ihnen sterben könnten!« Kaceys Kehle schnürte sich zu. Es war für ihn, als ob er ein Rudel Welpen mit der Hand aufgezogen hätte, und Riath die Hälfte von ihnen gegen ein Rudel Wölfe gehetzt hätte. Es fühlte sich an… als ob Kacey sie verraten hätte, weil er ihn nicht aufgehalten hatte.
Riaths ruhiger Gesichtsausdruck war wie Öl auf dem Feuer, das Kaceys Wut noch mehr anfachte. »Wir ziehen mit ihnen in den Krieg, Kacey. Worüber streiten wir? Dass du eine Entscheidung getroffen hast, hinter der du jetzt nicht mehr stehen willst?«
Seine Stimme klang hart und gnadenlos. Und anklagend. Es ging nicht mehr nur um die Drachenreißer, das konnte er selbst durch die schwarze Augenbinde erkennen, hinter der nur zwei leere Höhlen lagen. Es war schwerer als je zuvor, Riaths wahre Absichten zu erkennen, seit er keine Augen mehr hatte. Früher war Kacey sich sicher gewesen, dass er Riaths Absichten immer in seinen Augen lesen konnte, doch nun tappte er im Dunkeln. Stetig, wann immer sie redeten.
Er fühlte sich auf einmal so müde. »Leck mich«, säuselte er und drehte auf dem Absatz seiner Stiefel um.
»Wo willst du hin?«, fragte Riath düster.
»Zurück auf mein eigenes Schiff«, antwortete Kacey trotzig, »vielleicht zurück nach Malahnest.«
Riaths tiefes Knurren klang wie das Grollen eines Drachen und erfüllte den gesamten Raum, der plötzlich durch Magie dunkler und kälter wurde. »Du bleibst!«
Aber Kacey lachte trocken und marschierte zur Tür. »Ich sehe nicht zu, wie dieser Kampf uns alles kostet.«
»Kacey…« Riaths Stimme verzerrte sich, wurde zu etwas unnatürlich Dunklem. Und Kacey wusste, wenn er über die Schulter geblickt hätte, hätte er Riath in seiner anderen Gestalt erblickt, mit Hörnern und Drachenflügeln aus Schatten.
Aber er drehte sich nicht um.
»Du kannst ja mitkommen, wenn du mich liebst-«
»AAAARGHT!«
Erschrocken zuckte Kacey vor dem Geschoss zurück, das knapp an seinem Kopf vorbeiflog und an der Tür lautstark zu Bruch ging. Tonsplitter und Wein spritzten zu allen Seiten, bevor sie zu Boden regneten.
»ICH SAGTE, DU BLEIBST!«, donnerte Riath mit einem Zorn, der einen kleinen Sturm in der Kabine verursachte, an Kaceys Kleidern und Haar riss, und alle Kerzen erstickte.
Doch Mondschein fiel durch die Fenster herein und Kaceys Luzianeraugen konnten auch bei dem wenigen Licht genug erkennen. Vor allem den zerbrochenen Krug am Boden.
Fassungslos drehte er sich zu Riath um. Wie erwartet hatte er sich verwandelt und hinter der Augenbinde waberte schwarze Magie aus seinen leeren Augenhöhlen, die Hörner schienen noch gewaltiger als sonst aus seinem Kopf zu sprießen, und er hatte drohend die Flügen ausgebreitet, als würde er sich, wenn nötig, vorwärtsstürzen.
Er hatte den Krug nicht mit der Hand geworfen, sondern kraft seines Willens. Und sein Zorn ließ auch andere Gegenstände im Raum schweben, als wäre er eine eigene Umlaufbahn.
»Was fällt dir ein?«, zischte er Kacey an, seine Nase blähte sich, seine breite Brust dehnte sich weit. »Hast du eine Ahnung, in was für einer Situation wir uns befinden? Die verdammte Welt ist hinter uns beiden her, unsere Verbündeten sind schwindelerregend gering, und du machst mir Vorwürfe, dass ich unseren einzigen Trumpf benutze? Ich hab verdammt noch mal nichts anderes im Sinn, als dein Leben zu beschützen, und du machst mir Vorwürfe?«
Die Magie im Raum war so mächtig, dass sich Kaceys Haare aufstellten. Doch sie war nicht der einzige Grund, warum er eine Gänsehaut hatte. Er sagte nichts.
»Ich bin fast gestorben für dich!«
Kacey zuckte zusammen, als hätte Riath ihn geschlagen.
»Mein eigener Bruder durchbohrte mich mit einer Klinge, die erschreckend ähnlich dem Schwert meines Vaters war!«, fuhr Riath fort und schritt langsam auf ihn zu. »Mein Herz ist schwach, es schlägt nicht richtig, ich kann keine Treppen gehen, ohne zu schnaufen wie ein alter Gaul.«
Kacey kostete es erhebliche Selbstbeherrschung, nicht zurückzuweichen.
»Ich kann nicht schlafen, ich habe Alpträume«, knurrte Riath anklagend, »ich habe meinen eigenen Bruder bekämpft, ich hätte ihn für dich getötet. Ich würden jeden verdammten Mann, jede Frau, jedes Kind für dich aufschlitzen, nur damit du sicher bist! Und du willst nicht einmal ein paar Bestien opfern, um uns zu beschützen? Willst du das damit sagen?«
Tja… also… tja. Kacey öffnete den Mund, schloss ihn wieder. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er wusste gar nichts mehr.
Plötzlich zog sich die Dunkelheit zurück, Becher und Kissen fielen abrupt zu Boden, die zuvor in der Luft geschwebt hatten, die Kerzen flammten wieder auf und Riath taumelte mit einem Keuchen. Er verwandelte sich zurück, streckte suchend nach Halt einen Arm aus und sank auf einen Stuhl.
Schwer atmend hielt er sich die Wunde, die Sarsar ihm im Zwischenreich zugefügt hatte. Sein Körper zeigte keine Narbe, keine Wunde, weil das Schwert seine Seele durchstoßen hatte.
Riath zitterte geschwächt. »Geh nicht«, bat er deutlich erschöpft.
Kaceys Kehle war so eng geschnürt, dass er kaum schlucken konnte, er ballte immer wieder die Hände zu Fäusten, lockerte sie, ballte sie. »Du hättest mich fragen müssen.«
Riath zog gequält die Augenbrauen zusammen und ließ den Kopf hängen. »Ich weiß.« Er seufzte matt, als läge die Last der gesamten Welt allein auf ihm.
Nein, nicht die Last der Welt, etwas viel Schwerwiegenderes. Ihr Überleben.
»Ich wusste, es würde dir wehtun«, gestand er, »ich hatte gehofft, du bekommst es gar nicht mit, sodass dir dieser Kummer erspart bleibt.«
Kacey wollte wütend auf ihn sein. Wenn er ehrlich war, tat es gut, wütend auf ihn zu sein, das löste ein wenig die Angst, die er um Riath hatte, je näher das Festland rückte.
Er gab sich einen Ruck, hob einen umgekippten Stuhl auf, stellte ihn dicht neben Riath und setzte sich zu ihm. »Du sagtest, wir sind gleich. Du und ich. Und dann triffst du so eine Entscheidung ohne mich«, hielt er ihm vor und suchte seinen augenlosen Blick.
Riath drehte ihm dann das Gesicht zu. »Wir sind gleich.«
»Sag es nicht nur, beweise es auch.«
»Ich will dich nur beschützen!«
Darauf hatte er gewartet. »Dann lass uns zurückgehen.«
Auch ohne Augäpfel konnte er die Überraschung in Riaths Blick lesen.
Kacey griff nach seiner Hand und zog sie in seinen Schoß. »Scheiß auf unsere Familien, scheiß auf Nohva, scheiß auf die Barbaren! Wir haben einen Sohn, der in Malahnest als Erlöser gefeiert wird! Wir können dort leben, Riath!«
»Was ist mit dem Licht?«, fragte Riath ernst. »Was ist mit unserer Rache an Melecay und Dainty? Wir waren uns doch beide einig, du wolltest es so sehr wie ich!«
Jetzt klang er verletzt und Kacey konnte es verstehen. Er änderte oft seine Meinung.
»Ich war zerfressen von Angst«, bedauerte er, »und blind vor Zorn. Aber ich hätte dich beinahe verloren! Sarsar hätte dich beinahe dort im Zwischenreich getötet, Riath! Wir haben es nicht nur mit ein paar einfachen Barbaren zu tun. Deine Brüder – unsere Brüder – sind zu mächtig!«
Verächtlich verzog Riath das Gesicht und wandte es ab.
Kacey griff nach seiner Wange und zog ihn wieder herum. »Ich habe erkannt, dass ich es nicht ertragen könnte, dich zu verlieren, Riath. Keine Rache der Welt ist mir das wert! Lass uns all das hinter uns lassen! Wir haben einen Sohn und wir haben einen Ort, wo wir willkommen sind. Wenn du bereit bist, auf deine Krone zu verzichten, dann… dann…«, es fiel ihm schwer, es auszusprechen, »… dann kann ich auch das Licht zurücklassen. Für dich. Für uns.«
Grimmig starrte Riath vor sich hin, doch Kacey spürte, dass er ihn zum Grübeln gebracht hatte. Hoffnung machte sich in ihm breit und eine Brise Erleichterung. Vielleicht war schon bald alles gut.
Riath streichelte mit dem Daumen über Kaceys Knöchel, schwieg fünf, sechs Atemzüge lang.
»Das geht nicht, Kacey«, erwiderte er dann ernst und wandte ihm wieder das Gesicht zu, als könnte er ihm in die Auge blicken. »Du hast das Siegel gebrochen. Ich kann nicht für einen Augenblick lang riskieren, dass die anderen ihren Eid erfüllen wollen und zu uns kommen.« Er beugte sich zu ihm und strich ihm zärtlich über die Wange, während seine Stimme von einem tiefen Schmerz durchsetzt war. »Wir waren uns einig, dass wir all unsere Feinde auslöschen müssen. Nur so können wir wirklich in Frieden leben.«
Das wusste er, zumindest hatte er lange genug daran geglaubt, aber jetzt sah er klarer. Sie zerstörten sich damit nur selbst, sie hatten schon genug Blut an den Händen. Wollte er wirklich noch mehr? Die Wahrheit war, er hatte Angst, sich zu verlieren, wie damals in den Ruinen auf Malahnest, als etwas Kaltes ihn ergriffen hatte.
»Du hast Derrick entführt, damit er für uns spricht«, erinnerte Kacey Riath. »Lass ihn genau das tun, entsende ihn zu den anderen, damit er sie davon überzeugt, uns in Ruhe zu lassen!«
Ein müdes Lächeln trat auf Riaths Lippen. »Es ist schön, dass ein paar deiner alten Seiten noch in dir stecken.«
Verwundert runzelte Kacey die Stirn.
Riath seufzte und schüttelte dabei gequält den Kopf. »Ich kann nicht, Kacey. Ich kann nicht so naiv sein, um darauf zu hoffen, dass sie uns in Ruhe lassen. Nein, ich muss herausfinden, wer gegen uns ist, und all unsere Feinde vernichten.« Seine Finger zerquetschten plötzlich Kaceys Hand. »Ich kann nicht riskieren, dass du wieder in Gefahr gerätst. Ich muss dich beschützen.«
»Und wer beschützt dich?«, fragte Kacey bitter.
Doch Riath schüttelte nur weiter mit zusammengepressten Lippen den Kopf, als wäre er gerade ganz wo anders. »Ich hab dich schon einmal nicht beschützen können, das darf nicht wieder passieren. Er hätte das auch nie zugelassen.«
Verwundert legte Kacey den Kopf schief. »Was meinst du?«
»Ich bin ohne dich geflohen und du wurdest gefangen genommen…«
»Du konntest nicht wissen, dass das passiert…«
»Ihm wäre das nie passiert«, Riath zeigte dem leeren Raum die Zähne. »Er hat Wexmell immer beschützt, immer. Ich konnte dich schon einmal nicht beschützen, aber das passiert mir nicht wieder.«
Kacey schüttelte verwirrt den Kopf. »Redest du von deinem Vater?«
Endlich sah Riath ihn wieder an, das Gesicht hart wie Granit. »Ich werde dich beschützen, Kacey, und wenn ich alle bis auf dich und mich töten muss. Er hätte nämlich nicht weniger getan als das, um Wexmell zu beschützen.«
Es lief Kacey ein eiskalter Schauder über den Rücken. »Wie…wieso fängst du immer damit an, uns mit deinen Vätern zu vergleichen?«, flüsterte Kacey. »Ich sagte doch, wir sind nicht sie.«
»Nein, wir müssen besser sein«, entschied Riath und stand auf. »Ich werde besser sein. In Carapuhr hätte Desiderius Wexmell beinahe verloren, genauso wie ich dich. Aber ich konnte dich befreien, du musstest nicht wie Wexmell allein überleben. Und ich werde dich beschützen, mehr als er jemals Wexmell beschützt hatte.« Er drehte sich um und sah auf ihn herab. »Du und ich, wir werden das bessere Königspaar sein und ihre Liebesgeschichte genauso in den Schatten stellen wie ihre Heldentaten. Wir beide werden sie überragen und bald wird man nur noch uns lieben.«
Kacey konnte nicht genau benennen, warum ihm in diesem Moment so unwohl wurde. Irritiert und traurig sah er zu Riath auf, und obwohl dieser keine Augen mehr besaß, spürte er ganz genau, was in Kaceys Mimik vorging.
»Ich liebe dich!«, schwor Riath plötzlich und ging vor ihm auf die Knie, nahm Kaceys Hände behutsam in seine und ließ sie nicht mehr los. »Es tut mir leid, dass ich dir wehtun musste, aber uns bleibt keine andere Wahl, wir müssen die Reißer einsetzen. Das verstehst du doch, oder?«
Nein. Ja. Er verstand es schon, aber das machte es am Ende weder besser noch leichter. Seufzend ließ er die Schultern hängen. »Riath…«
»Ich liebe dich«, flüsterte Riath dazwischen und streckte das Gesicht, um ihn zu küssen.
Kacey spürte, wie Wärme in sein Herz rieselte und Riaths warmer Atem und samtene Lippen seinen Bauch flattern ließen. Ergeben fiel sein Kopf gegen Riaths, er schloss die Augen.
»Es wird alles gut«, schwor dieser Kacey und löste eine Hand, um ihm über das goldene Haar zu streicheln. »Sie können uns verletzen, sie können uns schwächen – aber wir werden niemals fallen. Nicht, wenn wir zusammenstehen.«
Kacey konnte die Zweifel nicht so einfach abschütteln, leidend sah er auf. »Ich habe Angst.« Er konnte sie nicht mehr verbergen, seine Sicht verschwamm ein wenig, seine Stimme brach.
Riath lächelte beruhigend und streichelte liebevoll Kaceys glattrasiertes Kinn. »Du musst wirklich keine Angst haben, mein Geliebter«, raunte er beinahe ehrfürchtig, »du bist jetzt das mächtigste Wesen in dieser Welt.«
Das überzeugte ihn überhaupt nicht, denn wenn er gegen die Wut in sich ankämpfte und die Kälte niederdrückte, dann fühlte er sich alles andere als stark oder übermächtig. Im Gegenteil, die Magie in ihm flüsterte ihm stetig zu, dass er schwach und verletzlich war, wenn er ihr nicht endlich die Oberhand über sich gewährte.
Doch aus irgendeinem Grund, den er nicht bestimmen konnte, fürchtete er sich davor, es Riath zu erzählen. Er fürchtete, Riath könnte ihn drängen, diese Macht einfach zuzulassen.
»Wenn ich so mächtig bin, warum fürchtest du dann so sehr, du könntest mich nicht beschützen?«, hielt er dann dagegen. »Ich brauche ja dann gar keinen Schutz.«
»Jeder braucht Schutz, und oft genug muss man dich vor deiner Nachsicht schützen.« Riath sah ihn mit einem Schmunzeln an, als wollte er sagen: Das weißt du genau. »Du könntest ein Gott sein und ich nur ein einfaches Kaninchen, ich würde dich trotzdem vor den Wölfen beschützen.«
Beinahe musste er zurückschmunzeln. Kacey senkte den Blick und schürzte die Lippen, Wärme durchflutete ihn wieder. Zuneigung für diesen großen Holzkopf mit all seinen dummen Eigenarten. »Weil du mich liebst?«, feixte er und zupfte an Riaths Hemd.
»Ja.« Riath nahm Kaceys Kopf zwischen die Hände und drückte ihm die Lippen auf die Stirn, während er aufstand. »Und weil du mir gehörst. Mir allein.«
Kapitel 2
Ein Kitzeln lockte ihn sanft aus dem Schlaf und er zuckte mit der Schulter, um es zu vertreiben. Hinter ihm raschelten die Laken und ein spitzes Kinn bohrte sich in seinen Arm.
»Bist du wach?«, flüsterte Jin und blies ihm zärtlich ins Ohr.
Mit geschlossenen Augen zog Xaith den Mundwinkel hoch. »Sollte ich wach sein?«
Jin legte einen Arm um ihn, unter der Decke lagen ihre nackten Leiber eng aneinandergeschmiegt, so hatten sie sich wie Katzen gewärmt und unter dem Stoff und dem Pelz hatte sich ihre Hitze gestaut.
»Du hast gezuckt und gemurmelt«, sagte Jin mit samtener und besorgter Stimme.
Xaith öffnete die Augen und sah das von wenigen Kerzen erhellte Inneren seiner Zeltbehausung vor sich. Noch deutlich erinnerte er sich an das, was er geträumt hatte, bevor Jin ihn in die Gegenwart zurückgeholt hatte – mit seiner zärtlichen Berührung. Er drehte sich zu seinem Gefährten um und die Wärme in den zimtbraunen Augen lullte ihn umgehend in Sicherheit und stille Liebe.
»Nur ein Traum«, sagte er und strich ein paar rote Strähnen aus dem süßen Gesicht.
Jin wirkte noch immer nicht beruhigt, er stützte sich auf einen Ellenbogen. »Ein Traum wie ein Traum – oder ein Traum, der dir die Zukunft zeigt?«
Wie schlau er doch war, wie viel er doch insgeheim über Xaith wusste, ohne dass er es ihm haarklein erklären musste. Xaiths Herz flatterte, so viel Liebe empfand er für ihn.
»Ich weiß es nicht«, gestand er. »Ein immer widerkehrender Traum, aber ich sehe nicht die Zukunft.«
Jin zog die Brauen zusammen. »Woher weißt du, dass es nicht die Zukunft ist?«
»Hmm, ich weiß nicht«, gab er zu und strich immer und immer wieder die rote Strähne zurück, die sich nicht bändigen lassen wollte. »Es ist nur so ein Gefühl.«
Nachdenklich senkte Jin den Blick und hob dabei eine Hand, um Kreise auf Xaiths nackte Brust zu zeichnen. »Verrätst du mir, was du träumst?«
»Wenn ich es selbst verstehe, verrate ich es dir«, flüsterte er und seine Stimme verriet, dass er mit den Gedanken ganz wo anders war.
Jin schmunzelte und schielte unter dichten Wimpern wieder zu ihm auf. In seinen Augen spiegelten sich die Flammen der Kerzen. »Woher wusstest du, dass du es heute kannst?«
»Träumen?«, scherzte Xaith.
Jin legte den Kopf schief und tadelte ihn stumm.
Xaith lächelte in sich hinein, atmete tief durch und inhalierte den schweren Duft, der ihre Leidenschaft im Zelt hinterlassen hatte. Animalisch und süß kitzelte er in seiner Nase.
»Ich weiß, dass ich dir nicht wehtun kann, seit ich in Malahnest entschied, dich anstelle meines Vaters zu retten«, erklärte er ernst und stützte sich ebenfalls auf, bis ihre Gesichter sich beinahe berührten. Er senkte die Stimme noch weiter. »Nicht einmal der Blutdurst kann stärker sein, als der Drang, dich zu beschützen.«
Jins Augen klebten an Xaiths, er sah mit süßer Hingabe von einem zum anderen. Dann schlug er ihm die Faust gegen die Brust, sodass ein dumpfes Klatschen das ansonsten stille Zelt erfüllte und Xaith überrascht zusammenzuckte.
»Und du hast mich so lange warten lassen?«, schimpfte Jin mit ihm, die gespielte Empörung machte sein Gesicht noch puppenhafter.
Xaith zuckte mit den Schultern und entgegnete trocken: »Ich wollte wirklich sicher sein.«
Grinsend streckte Jin sich ihm entgegen, stupste ihn mit seiner Nasenspitze an, auf denen die Sommersprossen im Fackelschein schimmerten. »Ich wusste, dass du es kannst. Du warst schon immer stärker, als du dir zugetraut hast, und seit du allein in die Welt gezogen bist, hast du es mit jedem Atemzug bewiesen!«
Wärme flutete Xaiths Brust. Jins Vertrauen gab ihm so viel mehr, als er sich je hätte vorstellen können. Er konnte dieses Gefühl nicht einmal in Worte fassen, aber er hatte versucht, es auf unzähligen abstrakten Gemälden festzuhalten. Wenn in all dem dunklen Chaos, das ihn all die Zeit haltlos hin und her gespült hatte, plötzlich ein Anker auftauchte, an dem er sich festhalten konnte – so fühlte sich die Zeit mit Jin an.
Xaith schloss die Augen, legte die Stirn an Jins und berührte seine zarte Wange mit den Fingerspitzen. »Kann die Nacht nicht ewig dauern?«
»Wenn Frieden herrscht, werden wir unser Bett nie mehr verlassen müssen«, versprach Jin sanft.
Xaith runzelte die Stirn, er spürte wieder diese unsichtbare und doch weltschwere Last auf seinen Schultern. Er wurde ernst. »Dieser Krieg muss enden, bevor auf beiden Seiten wahrer Hass entbrennt.«
Jin schmiegte das Gesicht an ihn, um ihn zu beruhigen. »Desith respektiert dich! Und genau wie du, erstickt er jeden Hass im Keim, den seine Leute auf uns haben. Er will Nohva nicht niederbrennen. Es geht ihn nur um Riath, mit dir hat er keinen Zwist.« Er zog sich etwas zurück und lächelte verhalten. »Er schätzt dich.«
Xaith wurde still und starrte auf das Laken unter ihnen. »Vielleicht wird er das nicht mehr lange«, murmelte er.
*
Der König von Grent lag vollkommen reglos in den Pelzen in seinem Zelt. Er wirkte beinahe wie tot, hätte sich seine schwere Schulter nicht unter tiefen Atemzügen gehoben und wieder gesenkt.
Da lag er, dieser Riese von einem Mann, dieser Barbar, der stark wie ein Ochse war, und tagelang marschieren und kämpfen konnte – ausgelaugt, erschöpft, seiner Kräfte beraubt wie ein Toter.
Desith zurrte seine dunkle Kluft fest, während er auf seinen Gemahl niederblickte und nicht umhinkam, sich selbst ein wenig dafür zu loben.
Vyn schlief seelenruhig und war tief in seiner Traumwelt versunken, dafür war kein Zauber von Nöten gewesen, bloß eine Liebesnacht mit ihm.
Hunderte Weiber hatten bei dem Barbar gelegen, dutzende hat er in einer einzigen Nacht befriedigt ohne selbst je zu ermüden, und Desith vermochte es ganz allein ihn in diesen Zustand tiefer Erschöpfung zu versetzen.
Diesen Sieg konnte ihm keiner nehmen.
Und den nächsten auch nicht, dachte er bei sich, nahm sein Schwertgehänge und schnallte es sich um, während er lautlos hinausglitt.
Es war noch Dunkel, als er durch das nächtliche Lager schritt, die anderen warteten schon am Palisadentor auf ihn. Bragi sprang von einem Fass und biss von einem Apfel, das saftige Krachen war überlaut in der Nacht zu hören. Genau wie alle anderen trugen er dunklen Stoff, den sie eng um ihre Leiber gebunden hatten, damit er nicht bei jeder Bewegung raschelte.
Als Desith sich ihnen näherte, schloss Rurik sich Bragi an, und beide traten auf ihn zu.
»Jori?«, fragte Desith.
Bragi lächelte mit vollem Mund. »Schläft.«
Desith nickte zufrieden und wollte zum Tor.
»Wollt Ihr das wirklich tun?«, fragte Rurik ihn. »Immerhin habt Ihr dem Prinzen von Nohva Euer Wort gegeben.«
Desith drehte sich zu ihm um und sah ihm ungerührt ins Gesicht. Von allen Anwesenden war Rurik der größte Schemen und ragte wie ein Berg aus einem Wald voller dünner Bäume aus der Menge empor.
»Ich gab ihm einen Tag«, wandte Desith ein und schmunzelte kühl, während er gen Himmel zum ersten Licht des Tages blickte. »Und gerade beginnt ein neuer Morgen.«
*
Er war eingeschlafen. Das wusste er in dem Moment, als er den Schmerz spürte. So sehr er auch gegen die Müdigkeit angekämpft hatte, irgendwann übermannte sie ihn doch immer wieder. Und er fand sich sofort in einem regelrechten Alptraum wieder, der sich gegenwärtiger anfühlte, als ihm lieb war.
Sein Körper fühlte sich bleischwer an und er konnte sich nicht bewegen, hatte keinerlei Kontrolle über seine eigenen Gliedmaßen. Selbst seine Gedanken waren schwer und Erinnerungen wateten durch einen dichten, schwarzen Morast, der in seinem Kopf herrschte.
Es war, als wäre er noch immer dort in der Zwischenwelt, wo Sarsar ihn verwundet hatte. Noch immer spürte er die Eiseskälte, die sich durch seinen Leib fraß, bevor Derricks dunkle Magie ihn zurückgebracht hatte. Doch dieser Schmerz schien alles zu sein, was ihn noch halbwegs bei Verstand bleiben ließ.
Riath kniete auf einem harten Boden, seine Arme hingen in der Luft und er spürte feste Schlingen um seine Handgelenke, wie von Krallen, die ihn aufrechthielten. Sein markantes Kinn hing schwer auf seiner Brust, Schweiß rann über ihn. Er sollte all das gar nicht spüren, er träumte, und doch fühlte er. Mehr sogar, als er noch in der echten Welt empfinden konnte. Er spürte den grünen Nebel um sich herum, sah die vielen wirbelnden Magieströme durch sein magisches Auge, die ihn umgaben, die kein Anfang und kein Ende kannten, wie zwei enden eines Seiles, das durch die Luft getragen wurde. Doch sie verschwammen, alles verschwamm, als sei ihm schwindelig. Er konnte sich nie lange auf seine Wahrnehmung konzentrieren, der schwarze Morast in seinem Kopf nahm alles ein.
»Du kämpfst«, sagte die Stimme, die ihn heimsuchte. Sie war dicht an seinem Ohr und er wollte sich aufbäumen, sich befreien. »Warum kämpfst du, du armes Geschöpf?« Säuselnd kniete die Kreatur neben ihm nieder und strich ihm mit einer Klauenhand über den Kopf.
Knurrend bäumte er sich auf und das Wesen zuckte zurück.
Er konnte es nur als schwarzen grünen Nebelschwaden wahrneben, nur ein mannsgroßer Fleck zwischen all den anderen Strömen. Aber das Wesen war anders, es handelte und es dachte selbstständig, war sein eigener Herr und Wirt. Und aus welcher Magie es auch bestand, sie war ihm fremd und sie verursachte ihm eine scheußliche Übelkeit.
Er übergab sich auf seine Brust, aus ihm floss schwarzgrüner Nebel, keine Galle.
»Nein!« Das Wesen packte seinen Kopf und drückte sein Kinn nach oben. »Du musst es in dir behalten, kämpfe nicht dagegen an, es wird dich stärker machen.«
Riath wollte den Kopf aus dem Griff des Wesens reißen, die Nähe brachte ihn noch mehr zum Würgen, aber er war zu schwach. Auf ihm lag ein Zauber, der schwerer wog als ein Mantel aus Fels.
»Nicht wehren«, sagte das Wesen und bemühte sich, beruhigend zu sprechen. »Shhh, du musst noch stärker werden. Denk an deine Feinde, denk an den Hass in dir.«
Riath spannte alle Muskeln an, warf sich hin und her, jedoch gelang ihm nur ein leichtes Schwanken. Erschöpfung flutete ihn wie eine Lawine, begrub ihn unter noch mehr Schwäche. Er spürte seinen Körper nicht mehr, die Finger, die Füße.
Das Wesen stand auf, als Riaths Kinn zurück auf seine Brust sank und aus seiner Nase und seinem Mund die fauliger Nebel waberte.
»Mein armer Prinz«, es strich ihm durchs Haar wie eine Mutter dem Kind, »sie haben dir so viel genommen, sie haben dir dein erstgeborenes Kind entrissen, dich deiner rechtmäßigen Krone beraubt, deine eigenen Brüder stellen sich gegen dich…« Es ging neben Riath erneut in die Hocke und flüsterte ihm ins Ohr. »Warum wehrst du dich so gegen die Macht, die ich dir verleihe? Wir könnten sie büßen lassen, sie alle. Du weißt, dass du es willst, ich kenne deine geheimsten Wünsche, ich bin in deinem Herzen, warum belügst du uns also beide?«
Riath wollte etwas erwidern, aber er hatte keine Stimme, seine Lippen wollten sich nicht bewegen. Er versuchte, den Kopf zu schütteln, aber es ging nicht. Er war gefangen in seinem eigenen Leib und alles, was ihn bei Verstand hielt, war der eiskalte Schmerz, den Sarsar ihm zugefügt hatte.
Verzweifelt klammerte er sich daran, klammerte er sich an die frostige Magie seines Bruders, an diese winzige Verbindung.
Denn das Wesen kitzeltet eine Dunkelheit in ihm, die er schon immer selbst gefürchtet hatte. Er wollte weinen und er wollte schreien, um sich selbst und all das, was ihm widerfahren war.
Kacey! Er dachte an Kacey. Er rief sich das Gesicht seines Geliebten vor Augen und klammerte sich an die Liebe zu ihm.
»Du willst ihn beschützen.« Das Wesen verfolgte seine Gedanken. »Aber du weißt, dass es dir nicht möglich ist. Die ganze Welt wird ihn sich holen, wenn du nicht stark genug bist.« Er senkte die seltsam krächzende Stimme zu einem Raunen. »Du weißt, dass du mich brauchst.«
Nein!, dachte Riath trotzig. Raus aus meinem Traum!
Die Kreatur strich mit einer Kralle über seine Brust, über sein Herz. »Der dunkle Dorn in dir ist stärker als in den anderen, das weißt du. Der einst gesäte Samen wurde in deiner Blutlinie von Kind zu Kind weitergereicht, doch er konnte nie keimen. Bis du kamst. Du spürst es, du hast es immer gespürt. Wehr dich doch nicht dagegen, es macht dich zu dem, der du bist.« Der Nebel berührte fast sein Gesicht, unheilvoll flüsterte das Wesen weiter. »Wir beide kennen dein Herz und die Wahrheit, du kannst dich noch sehr an irgendeine Liebe klammern, sie wird dich nicht vor dir selbst bewahren. Du willst alles oder nichts – und nicht weniger steht dir zu. Wehr dich nicht, es wäre nur eine weitere Lüge. Sie haben dir alles genommen, Prinz, du wirst keinen Frieden haben, bis du dir zurückgeholt hast, was man zurückholen kann, und gerächt hast, was für immer verloren ging.«
Riath runzelte angestrengt die Stirn, während er an Kacey dachte und versuchte, keinem einzigen dieser Worte zu lauschen, aber er hörte sie nicht nur in seinem Ohr, die Stimme war tief in seinem Kopf. Und sie klang fast wie seine eigene.
Ein dunkles Lachen erklang, es wirkte fast vergnügt. »Nur Kinder glauben, dass wahre Liebe alles rettet. Dein Herz war schon vor meiner Berührung schwarz, du willst es nur nicht wahrhaben, da du dich als Held sehen willst.«
Es tat weh, mehr als Sarsars eisige Klinge, doch warum es so wehtat, wollte Riath lieber nicht ergründen. Nein, er klammerte sich mit aller Macht an das, an das er sich seit Jahren klammerte. Dass er ein guter Mann und guter König war, dass er geliebt wurde, und zwar von einer ganzen Generation von Magiebegabten und von seinem Volk.
»Die Frage ist, ob es wahre Liebe ist.« Das Wesen kannte keine Gnade, aber nun ging es zu weit. Riath fand plötzlich genug Kraft, um sich fauchend aufzurichten und die Kreatur anzufallen. Die Fesseln hielten ihn mit einem Ruck zurück und seine Blitze schienen sofort zu ersticken.
Der faulige Nebel war zurückgewichen und manifestierte sich vor ihm wieder. »Und wenn du wählen müsstest?«, bohrte es in sicherer Entfernung weiter. »Würde dir die Liebe deines Gefährten genügen, wenn du sonst nichts hättest?«
Wut wallte in ihm auf und weckte seine Lebensgeister, drängte den Morast in seinem Kopf zurück. Seine Fänge wuchsen und er knurrte drohend wie ein Tier.
»Wenn du entscheiden müsstest, ob er oder deine Krone und die Bewunderung deines gesamten Volkes – vielleicht sogar der gesamten sterblichen Welt…«, bohrte das Wesen weiter, »würdest du wirklich ihn wählen?«
Riath setzte zu einem Ja an, doch noch immer wollte seine Stimme nicht mehr als tierische Laute erzeugen.
»Denn das wird passieren«, behauptete das Wesen.
Riaths Knurren stockte. Ungewollt, er hatte es nicht steuern können. Beinahe spürte er die Genugtuung des Wesens.
»Wie tragisch, nicht wahr? Du bist so besessen davon, geliebt zu werden, so besessen davon, ihn zu beschützen, dass dir das Offensichtliche nicht auffällt.« Das Wesen mimte Bedauern, verhöhnte ihn. »Dabei könnte er dich alles kosten. Dein Volk, deine Krone, deine Rache – deine Macht.«
Du lügst, sagte er in Gedanken, er stärkt mich.
»Diejenigen, die in ihm eine Bedrohung sehen, werden euch jagen. Du weißt, dass du sie nicht umstimmen kannst, und wenn du zu ihm stehst, werden sie dich auch jagen und hassen.«
Riath zeigte wieder die Fänge wie ein bedrohter Hund. Das ist mir egal.
Das Wesen besaß für Riaths blinden Blick keine Mimik, doch er würde hinterher schwören, dessen kaltes Lächeln gespürt zu haben.
»Schau dich an, er trieb bereits einen Keil zwischen dich und deine Brüder, du wärest für ihn gestorben. Und wer hätte dann dich gerächt? Niemand. Du wärest vergessen worden, das weißt du, obwohl du größer sein wolltest als dein Vater. Besser, stärker.«
Das ist nicht wichtig, hielt Riath dagegen, sprach in Gedanken mit sich selbst, mit seiner dunklen Seite, kämpfte jedwede andere Gedanken nieder.
»Und die, die ihn liebe und die ihn beschützen wollen, die sind nur wegen ihm bei euch und würden dich bei der ersten Gelegenheit verraten, nur um ihn zu schützen. Egal, was du tust, du hast nichts erreicht, außer der Leibwächter eines größeren Mannes zu sein. Du weißt das, du weißt, dass er mehr geliebt wird als du, dass die Magier aus Elkanasai sein Banner tragen, nicht mehr das deine.«
Riath schüttelte den Kopf, er suchte nach Sarsars` kalter Magie, suchte den Schmerz, denn er hielt ihn besser bei Verstand als alles andere.
»Du wolltest, dass die ganze Welt zu dir aufsieht, du wolltest ein Held sein, du wolltest geliebt werden… und ein König sein!«
Halt. Den. Mund.
»Aber schau dich jetzt an! Du denkst, du hast alles, aber dein Herz kennt die Wahrheit. Du bist allein, du bist immer noch allein, all deine Brüder wandten sich gegen dich, dein eigener Vater verwehrt dir deine Krone. Du lässt immer noch zu, dass man dir alles wegnimmt, und du kämpfst nicht für das, was du willst. Du bist feige, du hast Angst, ganz gleich wie groß du dich gibst, wir beide kennen die Wahrheit über dich. Du willst nicht allein sein, du willst geliebt werden – und das steht deinem Sieg im Weg!«
»Ahhhhh – Lügen!«, brüllte Riath und riss mich mit einem Aufbäumen von Magie und Körper von den Fesseln los und stürzte sich auf das Nebelwesen wie ein Puma auf ein verletztes Reh.
Er schlug mit dem Kinn auf den Boden, das Wesen hatte sich aufgelöst. Doch der harte Aufprall hatte ihn regelrecht aufgeweckt, wenn auch nicht aus dem Alptraum befreit.
Verwirrt hob er den Kopf, konnte die nicht verbundenen Energieströme im Schleier mit dem magischen Blick ´plötzlich glasklar sehen.
»Du kannst nicht vor dir selbst fliehen.« Das Wesen tauchte hinter ihm auf. »Ich bin nicht dein Feind, ich will, dass wir uns gegenseitig helfen. Du hast mehr verdient, wir beide wissen das. Nimm dir, was du tief im Herzen wirklich ersehnst. Geliebt zu werden ist für die Schwachen, werde ein König, den man respektiert!«
Riath stöhnte, die Schwere legte sich zurück auf seinen Körper und wollte ihn wieder lähmen, er kämpfte dagegen an, legte die Hände auf den Boden und stemmte sich hoch.
»Wir könnten sie gemeinsam für alles büßen lassen«, sagte das Wesen. »Sie nahmen dir dein Kind!«, rief es empört, und diese Empörung sprach ihm tief aus der Seele. »Aber niemand stand zu dir!«
Auch das sprach aus seiner Seele, aus einer tiefen und nie verheilten Wunde.
»Deine Feinde töteten deine Tochter und deine eigene Familie stand nicht zu dir.«
Eigentlich… hatte das Wesen recht. Riath wehrte sich gegen diesen Gedanken, schüttelte den Kopf, als könnte er ihn dadurch vertreiben.
In seiner Verzweiflung rief er stumm nach seinen Brüdern. In all den anderen Träumen seit das Wesen ihn heimsuchte, hatte er immer versucht, Kacey zu rufen. Doch er hatte ihn nie erreicht, vielleicht weil ein Teil von ihm vor Kacey verbergen wollte, was in ihm wütete.
Warum, das wusste er nicht. Er fürchtete sich, Angst in Kaceys Augen zu sehen. Angst vor ihm.
Also packte er seine Blutlinie und riss daran, in der Hoffnung, seine Brüder würden es spüren. So sehr sie sich auch bekämpften, sie würden ihn bestimmt nicht dieser Kreatur überlassen.
»Du bist abgeschnitten«, sagte diese bedauernd. »Sie werden dich nicht hören, sie sind blind und taub für dein Leid, so wie sie es immer waren. Du bist allein.«
Riath biss die Zähne zusammen, seine Magie packte die Verbindung mit eisernen Griff und zerrte, während er versuchte, sich hochzustemmen.
»Riath!«, ertönte plötzlich eine laute Stimme.
Er riss den Kopf hoch, wie ein gut dressierter Hund, sein Herz blieb einen Moment stehen. Nein, das konnte nicht sein! Unmöglich, er musste sich verhört haben.
»Riath!«, rief es erneut irgendwo in der Ferne, kraftvoll, energisch – panisch.
»Hör nicht hin!«, sagte das Wesen und es klang plötzlich nervös, Riath spürte dessen Blick auf sich, wie ein Hundeführer, der nicht sicher war, ob sein junger Rüde ihm gehorchte. »Es geht ihm nicht um dich. Es ging ihm nie um dich!«
Riaths Herz raste mit seinen Gedanken um die Wette, er wusste einen Moment nicht mehr, ob all das vielleicht doch nur ein sehr grausamer Traum war.
»Riath!«
Etwas an dem Ruf erreichte einen längst verblassten Teil in seinem Herzen und erweckte ihn zu neuen Leben. Mit einem Ruck stolperte er auf die Füße und seine Beine trugen ihn wie von selbst.
Er rannte. Er rannte, wie er noch nie gerannt war, blind und stolpernd.
»Hier«, rief er dabei, »ich bin hier!«
»Riath!«
»Vater!« Er rannte mit keuchendem Atem auf die Stimme zu. »Hier, ich bin hier!«
Der schwarze Nebel tauchte neben ihm auf. »Es wird sich nichts ändern, du folgst dem Kind in dir.«
Riath rannte weiter, einfach weiter, auf die Stimme seines verstorbenen Vaters zu, es war ihm gleich, ob es eine Illusion war, sie hinderte ihn daran, weiter zuzuhören.
»Lauf weiter!«, rief sein Vater, »hör nicht auf ihn, lauf weiter!«
»Ich laufe«, stammelte er atemlos, »ich laufe!«
Die Stimme seines Vaters kam aus der Wand freigesetzter Magie, die wie eine Mauer aus Gewitterwolken vor ihm aufragte.
»Vergiss nicht, wie sehr er dich verletzt hat, wie sehr seine Verachtung dich zerstörte!«, warnte das Wesen.
»Nein«, keuchte Riath, rannte weiter, eilte auf die Wand aus Magie zu – und prallte mit voller Wucht dagegen.
Es war seine eigene Magie, er konnte es spüren, aber sie stieß ihn einfach zurück.
Irritiert betastete er sie.
»Riath!« Sein Vater schien genau auf der anderen Seite zu stehen. So nah und doch getrennt. Beinahe spürte Riath, wie ihre Hände aneinander lagen.
»Du bist hier«, raunte Riath kopfschüttelnd. »Du kannst nicht hier sein, du bist tot… du bist tot! Das ist eine Illusion.«
»Du musst mich reinlassen«, drängte sein Vater, Riath konnte spüren, wie er gegen die Wand ankämpfte und sich gegen sie schmiss. »Es ist deine Magie, Riath, du musst mich reinlassen!«
Aber Riath wusste nicht, wie. »Ich… ich kann nicht…«
»Du kannst!« Desiderius klang ungewohnt geduldig. »Riath, du kannst. Lass mich dir helfen!«
»Lass ihn nicht rein«, warnte das Wesen. »Er ist nur hier, um uns zu töten. Und dann tötet er Kacey und alle anderen, die dir folgten.«
Ein Donnern ging durch die Wand, als sein Vater auf der anderen Seite versuchte, sich hindurchzukämpfen. Riath zuckte zurück.
»Weg von meinem Sohn!«, brüllte Desiderius und wieder schlug er mit der Klinge auf die Wand ein.
Riath schrie auf, es war, als ob ihm jemand ein Schwert über die Brust zog und ihn aufschlitzte, um sich mit der Schulter in die Wunde zu werfen. Er taumelte zurück und konnte sich kaum halten.
»Lass ihn zufrieden und stell dich mir!«, verlange sein Vater, die Wut in seiner Stimme vermischte sich mit etwas, das Riath nie bei ihm vernommen hatte. Ehrliche, tiefe Sorge. »Wage es nicht, ihn anzurühren! Riath! Riath, du musst mich reinlassen! Riath!«
Aber Riath hörte ihn kaum noch, je mehr sein Vater gegen die Wand ankämpfte, je mehr verletzte er ihn. Es rauschte in seinen Ohren und der Schmerz ließ ihn auf die Knie fallen. Warmes Blut sickerte aus seiner Nase und den Ohren, der Druck in seinem Kopf wurde übermächtig und er brüllte.
»Riath!«, hörte er seinen Vater noch rufen, krank vor Sorge und Ratlosigkeit.
»Genug!«, schrie das Wesen und seine faulige Macht vermischte sich mit Riaths, ließ seinen Kopf beinahe zerbersten, als sie dröhnend durch ihn fuhr und die Wand vor ihm durchzog.
Das Letzte, was er wahrnahm, war der Schmerzensschrei seines Vaters, als die Magie ihn wie einen Hammer traf und wegschleuderte – und die Stimme des Wesens in seinem Kopf, die sanft auf ihn einsprach: »Er will dich aufhalten, mein Prinz, nicht retten. Wer nicht in Gefahr ist, muss nicht gerettet werden.«
Dann wachte er mit einem heftigen Zucken auf und schreckte hoch. Noch immer war er blind, doch er wusste instinktiv, dass der Traum vorüber war, denn es roch nach Kerzen und Meer.
»Alles in Ordnung?«
Kaceys verwunderte Stimme erklang rechts von ihm, wo das Bett stand, und sein süßer Duft nach Birnenkompott kitzelte Riath in der Nase.
»Ja«, sagte er und musste sich räuspern, er richtete sich auf und strich über die Karte, über der er an seinem Tisch eingeschlafen war. Zwar konnte er nichts sehen, nicht so wie früher, aber er konnte mit seiner Magie seinen Tastsinn verstärken und die Linien auf dem Pergament erfühlen. Genauso las er Briefe. »Ich bin wohl eingenickt.«
»Du solltest ins Bett gehen, um zu schlafen«, Kacey klang tadelnd, wenn nicht sogar genervt. »Du musst dich ausruhen.«
»Ich will nicht schlafen«, entgegnete er nur und widmete sich wieder den Karten.
Er wollte nie wieder schlafen.
Kapitel 3
Wie er erwartet hatte, war es spielend einfach an den wenigen Wachen vorbeizukommen, die in den Tiefen Wäldern stationiert waren. Beinahe war Desith von Xaiths Nachlässigkeit enttäuscht, er hätte ihm wirklich mehr zugetraut. Wobei, vermutlich hatte Xaith nicht einmal viel zu sagen, er unterjochte sich ja dem Befehl des Generals, was – wie Desith fand – unter Xaiths Würde war.
Sie würden schon merken, was sie davon hatten.
Durch die Festlichkeiten waren die Nohvarianer abgelenkt, sie wiegten sich in Sicherheit und rechneten nicht mit einem Angriff, bevor die Sonne am Himmel stand. Sie saßen gut gelaunt im Wald, tranken und schwatzten teilweise.
Das graue Licht der Dämmerung warf genug Schatten, dass selbst Desiths Männer – ein Dutzend schwarzgekleidete und in der Kunst der Heimlichkeit geübte Krieger – mit der Dunkelheit verschmelzen konnten, um sich an die unaufmerksamen Soldaten ranzuschleichen und mit Schlafpulver außer Gefecht zu setzen.
Leider trug keiner der vermeintlichen Feinde ein violettes Tuch um den Oberarm, was bedeutete, dass keiner von ihnen einer von Riaths Anhängern war. Desith ließ sie leben, sie würden einige Zeit tief und fest schlafen – und durchgefroren neben Lagerfeuern wieder aufwachen.
Lautlos durchquerte er den Wald, bis sich vor ihm die gefrorene Ebene auftat – und das Heerlager.
Desith trat um einen Baum herum und besah die Befestigungen, sein Atem waberte als weißer Nebel aus seinem Mund.
Hinter den Palisaden brannten Fackeln und er hörte noch vereinzeltes Gelächter und den schiefen Gesang der Betrunkenen. Die Pferde schnaubten, am Rande konnte er den geschmückten Bogen erkennen und den zertretenen Schnee, der sich in Matsch verwandelt hatte. Der Ort, wo Xaith und Jin verbunden worden waren, vor dem Volk und dem Gesetz, letzte Nacht erst. Für immer.
Es gab diesen einen winzigen Moment, da seine Entschlossenheit schwankte und er einfach umkehren wollte. Vyn würde niemals wissen, dass er fort gewesen war, Xaith würde nie wissen, dass er hier gewesen war.
Aber sie waren im Krieg und er war nicht nach Nohva gekommen, um zum Schein zu kämpfen. Xaith hatte seinen Standpunkt selbst gewählt, er hatte sich zwischen Desith und Riath positioniert.
Jeder Mann wählte sein eigenes Schicksal.
Desith zog das schwarze Tuch bis unter die Augen und die dichten Atemwolken versiegten. Er sah nach links und nickte, sah nachts und nickte erneut. Bragi und Rurik waren fast unsichtbar, doch er bemerkte, wie sie den anderen Zeichen gaben.
Sie lösten ihre Umhänge, drehten sie um und wickelten sich wieder darin ein, dieses Mal mit dem weißen Pelz nach außen. Dann legten sie sich in den Schnee und krochen auf die Befestigungen zu.
Es war in jener Nacht ungewöhnlich kalt gewesen, der Schnee war eine regelrechte Eisschicht, durch die Desith sich kämpfen musste. Seine Muskeln brannten bereits nach der Hälfte des Weges wie Feuer und er musste seinen Atem kontrollieren, um nicht laut zu schnaufen. Unter ihm wurde die frostige weiße Masse von seiner Körperwäre feucht und drang durch seine Kleidung bis auf die Haut. Der Winter war beinahe so hart geworden wie jener in Carapuhr.
Immer wieder, wenn das Fackellicht der Patrouillen die Umgebung streifte, blieben sie still und legten die Köpfe in den Schnee, die weißen Pelzkapuzen aufgezogen. Mit viel Geduld krochen sie näher und näher und kamen unbemerkt an der Palisade an.
Desith drückte sich gegen das Holz und lauschte angespannt, doch er konnte weder Schritte noch Gelächter noch lautes Schnarchen hören. Zehn, fünfzehn… zwanzig Herzschläge harrte er bewegungslos aus. Dann drehte er den Kopf über die Schulter und besah seine Leute. Sie hatten sich genau wie er in den Schnee gelehnt und sahen aus wie Verwehungen, die an der Palisade hochkrochen.
Bragi war direkt hinter ihm, seine Augen schauten aus einem ansonsten völlig vermummten Gesicht und unter der weißen Kapuze hervor – er schüttelte den Kopf; er konnte auch nichts hören.