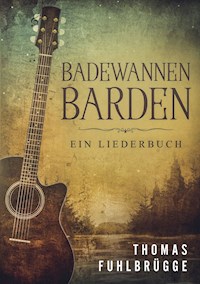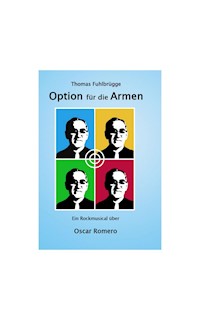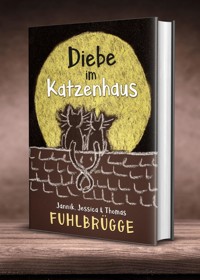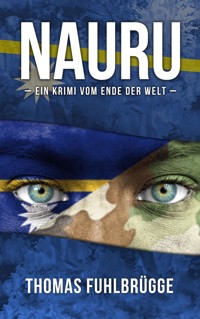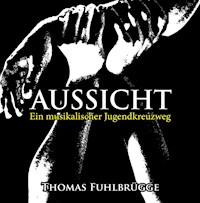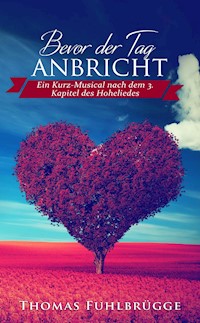2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Neu im Coortext-Verlag: Die Muna bei Münster ist ein geschichtsträchtiger Ort. Zuerst produzierten die Nazis Bomben und Granaten. Noch heute ranken sich Gerüchte, um riesige, unterirdische Anlagen. Eine Sprengung der Bunker in den letzten Kriegstagen hinterließ ein munitionsverseuchtes Gelände. Anschließend bauten die Amerikaner den Stützpunkt aus. Lagerten dort Atomwaffen. Bis sie 1995 plötzlich abzogen. Seither ist das eingezäunte Gelände ein `lost place´, ein `weißer Fleck´ auf der Landkarte. Geheimnisumwittert und gefährlich. Und es zieht dunkle Gestalten an. Ein Jahr später ereignet sich dort eine Explosion. Die Polizei denkt zunächst an einen Blindgänger. Doch als Kommissar Rüssmann und sein Team anrücken, entdecken sie die zerfetzte Leiche eines jungen Mannes. Unfall oder Mord? Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare bald auf Widerstände von ungewohnter Seite. Denn die Muna birgt ein tödliches Geheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thomas Fuhlbrügge
Muna
Ein Münster / Altheim Krimi
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Prolog
Sonntag, 9.6.1996
Montag, 10.6.1996
Dienstag, 11.6.1996
Mittwoch, 12.6.1996
Donnerstag, 13.6.1996
Freitag, 14.6.1996
Samstag, 15.6.1996
Sonntag, 16.6.1996
Montag, 17.6.1996
Dienstag, 18.6.1996
Mittwoch, 19.6.1996
Donnerstag, 20.6.1996
Freitag, 21.6. 1996
Samstag, 22.6.1996
Sonntag, 23.6.1996
Montag, 24.6.1996
Dienstag, 25.6.1996
Mittwoch, 26.6.1996
Donnerstag, 27.6.1996
Freitag, 28.6.1996
Samstag, 29.6.1996
Epilog
Nachwort
Zur Recherche bzw. Inspiration verwendete Literatur
Internetquellen (Auswahl):
Thomas Fuhlbrügge (Jahrgang 1974) ist Lehrer für Katholische Religion, Politik & Wirtschaft, Ethik und Philosophie an der Bachgauschule in Babenhausen. Der Autor, Musiker und Liedermacher lebt mit seiner Frau und seinem Sohn im südhessischen Altheim.
Impressum neobooks
Prolog
Für Jessica und Jannik.
Meine Lieblingsmenschen.
»Mit Jusos kann man keine Bullen schrecken,
ihr Schlachtfeld ist doch nur der Infostand!«
Zitat der Rodgau-Monotones aus
`Die 7 starken Männer von außerhalb´
»Die Revolution sagt: ich war, ich bin, ich werde sein!«
Zitat von Rosa Luxemburg, aber auch Ende der
`Auflösungserklärung´ der RAF vom 20. April 1998
Thomas Fuhlbrügge
Muna
Ein Münster/Altheim-Krimi
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
2. Unveränderte Auflage 2022
© 2022 -Verlag, Altheim
Umschlag: Germancreative
Lektorin: Silke Walz
Druck: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Samstag, 27.3.1993 – 0.27 Uhr
»Es kann nur einen geben!« Der tragbare Sanyo-Fernseher war alt. Es zuckte auf der Mattscheibe. Erneut wurde ein Schwert in den Himmel gereckt. Der RTL-Schriftzug baute sich dazu auf. Er deutete das Ende des Films und eine weitere Werbepause an. Die letzte war gefühlt keine zehn Minuten her.
Herbert Schmidt rutschte von einer Pobacke auf die andere. Er reckte sich, um die Fernbedienung zu erreichen. Wo blieben bloß die modernen Bürostühle? Sollten die nicht längst da sein? Er hatte keinen Dunst, was schiefgelaufen war. Jedenfalls quoll schon der Schaumstoff aus den Nähten der alten.
Sein Kollege Walter Hömke reichte Schmidt die abgewetzte Fernbedienung. Das Batteriefach war offen und die beiden Mignonzellen hielten nur durch mehrere Schichten Tesa. Doch er war froh, dass es diese Kiste überhaupt gab. Nach dem Einschalten zeigte sie zunächst ein grünliches Bild, das sich manchmal erst nach Stunden und leichtem Klopfen auf die Seitenwand normalisierte. Ohne dieses Gerät wäre die Nachtschicht in der Pforte der Justizvollzugsanstalt unerträglich. Er entblößte die Raucherzähne, um herzhaft zu gähnen.
Herbert Schmidt trug die grüne Uniform des `Allgemeinen Justizvollzugsdienstes´. Hömke hatte dagegen eine schwarze Hose und ein weißes Hemd mit dem Firmenlogo der `Nefarius-Security´ an. Ein privater Sicherheitsdienst. Er beugte sich vor, führte die Hand geschickt an der Licher-Flasche vorbei, um nach der Chipstüte zu greifen.
Sie hatten auf SAT1 die Freitagsspiele der Bundesliga gesehen. Bochum gewann gegen Nürnberg und Uerdingen verlor zuhause gegen Bremen. Seine Eintracht würde erst am Nachmittag gegen Mönchengladbach spielen. Hoffentlich war Edgar Schmitt wieder in Form.
Im hinteren Bereich döste das Küken der Wachhabenden auf einem Feldbett. Der Azubi Zdenko Kucera beteiligte sich mit seinem gebrochenen Deutsch ohnehin nicht an den Gesprächen über Fußball. Auch spielte er miserabel Skat. Daher hatte er sich vor Mitternacht hingelegt. Um 2.00 Uhr würde er die `Hundswache´ übernehmen, die keiner wollte und Hömke konnte endlich schlafen.
Der Wachmann gähnte erneut. Gleichzeitig griff er nach der Zigarettenschachtel und dem schweren Schlüsselbund. »Ich mach die Runde«, murmelte er. Der Kollege Schmidt würde bei RTL die Wiederholung von `Schreinemakers live´ schauen. Mit dem viel über das Niveau sagenden Titel: `Und sowas wie ihr hat Kinder?´. Hömke grinste. Für ihn war diese Art Sendung nichts.
Am 1. April würden die Gefangenen aus Preungesheim überführt. Die dortige Haftanstalt war in die Jahre gekommen. Weiterstadt sollte hingegen die modernste und schönste in ganz Europa sein. 300 Millionen Mark für 495 Gefangene. Manche hielten die Kosten für zu hoch und die Bauweise für übertrieben. Eine architektonisch gestaltete Zaunanlage in Stahl und die mit profilierten und eingelegten Fliesen versehenen Fertigstützteile vom Typ `Schlossgartenbegrenzung´ für immerhin 1,8 Millionen Mark. Dazu kam eine Untergrundbewässerung der bis zu 20 Meter hohen Bäume, die mit 1,85 Millionen in den Büchern stand. Innenhöfe mit künstlerisch gestalteten Naturensembles aus den Elementen Fels, Wasser und Pflanzen. Kosten allein für die dekorativen Natursteinquader: 470.000 Mark. Nicht zu vergessen die Schwimm- und Sporthalle, die mit 19,5 Millionen Mark berechnet wurde und der Brunnen aus Taubertaler Muschelkalk. Die hessische Justizministerin legte bei der Bauplanung den dritten Paragrafen des deutschen Vollzugsgesetzes auf sehr gediegene Weise aus. Das Gesetz besagte, dass `das Leben im Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden soll´. Das war vortrefflich gelungen, fand der Wachmann, der seinen Urlaub in der Türkei oftmals in schlechteren Unterkünften verbringen musste. Es war die in Architektur gegossene `Unschuldsvermutung´ eines Untersuchungsgefangenen.
Alles lag in einem seligen Dornröschenschlaf. Die mehrstöckigen Zellentrakte, die Werkstätten, Sportanlagen und der Verwaltungsbereich. Die Kirche gefiel ihm besonders gut. Bunte Glasfenster spendeten ein angenehmes Licht. Sogar eine Schwerhörigenschleife komplettierte die Technik. Sollte einmal ein besonders alter Gefangener mit Hypakusis einsitzen.
Der Hessische Rundfunk hatte sich angesagt, die Justizministerin und die Pressemeute. Ein Eröffnungsfest war geplant. Mit allem Drum und Dran. Er und seine Kollegen vom privaten Wachdienst wurden dann nicht mehr benötigt.
Die schweren Panzerglastüren der Schleuse standen offen. Sie waren mit je einem Keil festgestellt. Er brauchte die Außentür nur aufzustoßen. Im Normalbetrieb waren sie elektronisch gesichert. Zu öffnen ausschließlich mit einem Summer von der gepanzerten Zentrale aus.
Immerhin war der Köter zu Hause geblieben. Sonst hätte er für seine Runde nicht diesen gemütlichen Gang einlegen können. Der Schäferhund zerrte ihn immer in alle Richtungen. Er war sich sicher, dass so ein Tier spürte, dass er diese Vierbeiner nicht sonderlich mochte. Seine Frau und er hielten sich einen Kater. Es gab eben Hunde- und Katzenmenschen. Außerdem schaute ihn das Vieh immer so misstrauisch an, als wollte er sagen: »Das letzte Mal, als ich einem Menschen vertraut habe, bin ich aufgewacht und meine Eier waren weg!«
Der Wächter ging an der inneren Mauer entlang und blies einen Rauchkringel in die Nacht. Tagsüber überprüfte er die Bauarbeiter. Trotzdem verschwand ständig Material. Auf dieser Großbaustelle gab es Dutzende Baufirmen, Subunternehmen, Zeitarbeiter. Alle zu kontrollieren war unmöglich. Es gab Hilfsarbeiter aus Osteuropa, die plötzlich kein Wort Deutsch verstanden, aber bei allen Vorfahren schworen, dass sie die Hilti bei Arbeitsbeginn selbst mitgebracht hatten.
Er kannte diese öden Nächte. Es passierte nie etwas. Man wurde höchstens einmal von einem tieffliegenden Raben erschreckt. Einsame Stunden, in denen man sich die Beine in den Bauch stand und die Blase alle paar Minuten drückte.
»Keinen Mucks, wir sind die RAF.« Eine weibliche Stimme. Jung. Energisch. Und der harte Lauf einer Waffe in seinem Rücken. Drei weitere, vermummte Gestalten schälten sich aus der Dunkelheit. Einer griff nach seinem Funkgerät. Zwei rissen ihn zu Boden. Handschellen klickten hinter Hömkes Rücken.
»Steht die Tür zur Schleuse offen?« Wieder die weibliche Stimme. Sie sprach gebieterisch, was nicht zu ihrer sanften Stimme passte. Dabei wirkte die Terroristin auf den Wachmann fast nett. Wäre nicht die Maschinenpistole gewesen, die sie auf ihn richtete. Wie die anderen trug sie eine Strumpfmaske. Lange Haare quollen an den Seiten heraus. Alle waren schwarz gekleidet.
Walter Hömke nickte. »Ja, wir...«
»Schnauze«, fuhr ihn einer der Terroristen an. Neben seiner Waffe in der einen, hielt er eine Sprühflasche zum Pumpen in der anderen Hand. Hömkes Frau benutzte so ein Ding zu Hause zum Gießen ihrer Orchideen. Ein Hauch von Ammoniak lag in der Luft. Außerdem lugte ein Maulkorb griffbereit aus dem Rucksack. »Wie viele sind in der Schleuse und wo ist der Köter?«
»Der Hund ist nicht da«, japste der Wachmann. Die Männer besaßen Pistolen mit Schalldämpfern. »Und drinnen sind zwei Mann.« Er fragte sich, woher die Gangster etwas von einem Wachhund wussten?
»Sind die Kameras an?«
»Nein, das Überwachungssystem…« Weiter kam er nicht. Er wurde auf die Beine gezerrt. Zwei packten seine Arme. In schnellen Schritten ging es zurück zur Schleuse. Die Frau voran. Einer mit erhobener Waffe hinter ihm. Immer dicht an der Mauer. Durch das Panzerglas sah Hömke den laufenden Fernseher. Zwei Frauen schienen sich gerade anzuschreien.
»Hände über den Kopf. Hinlegen!« Die Frau brüllte Schmidt an. Die Chipstüte rutschte aus seiner Hand. Er warf sich auf den Boden. »Wir sind vom Kommando Katharina Hammerschmidt und haben 200 Kilo Sprengstoff dabei.« Im Nebenraum erwachte der Azubi Kucera mit einem Schalldämpfer an der Schläfe. Sekunden später waren beide mit Handschellen hinter dem Rücken gefesselt. `Wer ist bloß Katharina Hammerschmidt?´, schoss es Hömke durch den Kopf.
Sonntag, 9.6.1996
Der Altar hatte die Form einer nackten Frau. Mit breit abgespreizten Beinen und hervorgereckter Vagina. In den modellierten Händen hielt die verrenkte Person je eine schwarze Kerze. Auf der Tischplatte befanden sich ein Kelch mit Blut und dreieckige Hostien, aus einer schwarzfleckigen Rübe geschnitzt.
Darauf war der `Oberste Meister´ besonders stolz. Schon an dem Altar hatte er in der Werkstatt, die einmal seinem Opa gehörte, drei Wochenenden gebastelt. Er verarbeitete dafür zwei Schaufensterpuppen, die er im Sperrmüll bei `Zörgiebel´ gefunden hatte. Es war sehr aufwendig, das sperrige Ding mit dem Mopedanhänger zu transportieren. Die Arme hielten nicht sonderlich gut, trotz mehrerer Lagen Heißkleber und Gaffatape.
Der Kelch war ein alter Henkelpokal, den sein Großvater 1967 beim Preisskat in Altheim gewonnen hatte. Das Blut darin stammte von echten Schweinen. Die Colaflasche, in der er es abgefüllt hatte, war leider undicht. Sein Rucksack stank nun erbärmlich und klebte.
Der große, leere Bunker war mit einigen fleckigen Tüchern und anderen Requisiten dekoriert: verschnörkelte, schwere Bronzeleuchter und ein Poster mit Dämonenfratze. Das Kreuz, das auf dem Kopf stand, durfte dabei natürlich nicht fehlen. Es gehörte einmal seiner Großmutter und hing 40 Jahre lang im Wohnzimmer über dem Fernseher. Dort natürlich richtig herum. Jeden Palmsonntag mit einem frischen Zweig versehen.
Die fünf Satanisten befanden sich derweil je an der Spitze eines mit roter Kreide auf den Betonboden gezeichneten Pentagramms. In dessen Mitte stand der schaurige Altar. Sie sangen eine Litanei: »Heilige Hölle«, stimmten sie die Übersetzung des Liedes `Seven Churches´ von `Possessed´ eher kläglich an, »Tod für uns, Teufelswasser beginnt zu fluten, Gott ist geschlachtet, trinkt sein Blut.« Zur Unterstützung klangen die Originalklänge, mit einer an Kehlkopfkrebs erinnernden Stimme und den auf einen Bass heruntergestimmten Gitarren aus einem Kassettenrekorder. Es wäre sicherlich stimmungsvoller gewesen, wenn die alten Batterien die Bandgeschwindigkeit konstant beibehalten hätten.
Die schwarzen Kutten, mit den tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen reichten bis zum staubigen Boden. In den ersten Sitzungen waren sie `in Zivil´ gewesen und hatten sich mit Heavy-Metal-T-Shirts begnügt. Die Kutten versprühten jedoch viel mehr Charme.
Die Mitglieder des Zirkels fassten sich an den Händen. Der `Oberste Meister´ wollte ursprünglich an dieser Stelle der Zeremonie unheiliges Weihwasser versprenkeln. Das bestand aus dem Urin einer Hexe. Aber `Arkana´ hatte keine Lust, in die extra mitgebrachte Plastikschüssel zu pinkeln. Die 17-jährige, schwarz gekleidete und weiß geschminkte junge Frau, hieß eigentlich Elke und war das einzige weibliche Wesen der Gruppe. Stattdessen kraulte sie die meiste Zeit eine junge, schwarze Katze. Die sollte später auf dem Altar geopfert werden. Zehn Mark hatte der `Oberste Meister´ bei Bauer Appel dafür bezahlt.
Irgendwie lief alles nicht rund. Er hatte sich die ganze Sache viel mystischer vorgestellt. Drei Monate waren seit der Gründung der `geheimen Satanisten-Loge Münster´ vergangen. Als Absolvent der `Fraternitas Okulti´ hatte er auf Orgien mit willigen, jungen Priesterinnen gehofft. Jedenfalls erzählten die anderen Kursteilnehmer stets von Sex, Drugs und Black Metal, während er ein Ekeltraining über sich ergehen ließ. Bei dem Gedanken daran wurde ihm erneut schlecht. Doch seine Lehrlinge waren, bis auf Arkana, die ebenso blass wie mager wirkte, übergewichtige Nerds. Sie unterhielten sich am liebsten über die Fußball-EM in England und Computer-Strategiespiele (»das neue `Command & Conquer: Alarmstufe Rot´ ist echt der Brüller!«). Keiner las Nietzsche. Und nicht einer war seinem Vorbild gefolgt und hatte sich ein Intimtattoo stechen lassen. Ihm brannte nach zwei Wochen immer noch der Schniedel. Die Schlange, die sich um seinen Penis windete, hatte im unerregierten Zustand eher etwas von einem Regenwurm. Aber er gab sich immerhin Mühe.
Nun war das satanistische Gloria an der Reihe: »Gloria Deo, Domino Inferi« intonierte er und seine Stimme hallte im alten Bunker wider. Dabei hielt er das Messer mit der langen Klinge hoch. »Et in terra vita hominibus fortibus. Laudamus te. Benedictimus te, adoramus te, glorificamus te propter magnam potentiam tuam: Domine Satanas, Rex Inferus, Imperator omnipotens.1« Er bedeutete Arkana, ihm das schwarze Kätzchen zur Opferung zu reichen. Sie zögerte.
Plötzlich klatschte dem `Obersten Meister´ schmerzhaft ein Geschoss gegen seine Kapuze und es tropfte gelb herunter. Aus dem Eingang des Bunkers und von hinten aus Richtung eines Verbindungsgangs, kamen eilige Schritte. Dann flogen unzählige Gelatinekugeln durch die Luft. Jeder der Satanisten war nach wenigen Sekunden mit glibberigen, bunten Farbklecksen bedeckt. Deren Aufprall tat selbst durch die Kleidung hindurch höllisch weh. Auch hinterließen sie blaue Flecken an sehr unangenehmen Stellen.
Einer der Angreifer trat schließlich vor. Sie sahen einen Kampfanzug, samt Helm und Schutzbrille. Der `Oberste Meister´ bebte vor Zorn. »Seid ihr völlig bescheuert? Samstags sind wir hier!«
»Wir dachten, ihr würdet bis nach dem Deutschlandspiel fertig sein«. Der Paintballspieler nuschelte unter seinem Visier. Offenbar der Teamleiter.
»Wir brauchen doch die Dunkelheit«, kam es fast entschuldigend aus dem Mund des Satanisten. Die okkulte Truppe rieb inzwischen die schleimige Farbe aus den Gewändern. Dies erzielte jedoch den gleichen Effekt, wie der Versuch, ein weißes Hemd mit Wasser und Einweghandtüchern zu reinigen, nachdem man sich am Schokoladenbrunnen eingesaut hatte.
Arkana widmete sich derweil dem völlig verängstigten Kätzchen. Es wurde um ein Haar von einer grünen Kugel getroffen. Panisch hüpfte das Tier darauf vom Altar. Nicht ohne eine deutliche Kratzspur auf der Hand der satanistischen Hexe zu hinterlassen.
»Wie ist das Spiel gegen die Tschechen ausgegangen?«, fragte `Vernon´. Er hieß im realen Leben Siggi. Umständlich zog er seine Kutte aus. Dabei entblößte er ein verwaschenes T-Shirt mit der Aufschrift: `Meine Nachbarn hören Heavy Metal – ob sie wollen oder nicht´. Es nervte ihn besonders, dass die Messe beim ersten Deutschlandspiel stattfand.
»Wir haben 2 : 0 gewonnen«, antwortete ein hilfsbereiter Gotchaspieler. Aus Versehen löste sich ein weiterer Schuss aus seiner Druckluftwaffe und traf den Altar an einer unanständigen Stelle. »Ziege und Möller. In der ersten Halbzeit. Dabei hat sich Käpt´n Kohler nach zehn Minuten verletzt. Innenbandriss und Knöchelbruch. Für den ist die EM vorbei.«
»Und wann geht’s gegen die Russen?« `Nuwanda´, der sonst auf den Namen Carsten hörte, war in der Lage, den `Club der toten Dichter´ auswendig mitzureden.
»Erst am kommenden Sonntag«, antwortete der Anführer der Paintballer. »Allerdings um 17.30 Uhr.«
»Dann lasst uns nicht vor acht anfangen«, sagte der Kuttenträger in Richtung des `Obersten Meisters´.
»Ich glaube ihr spinnt. Wenn ihr den zweiten Grad erringen wollt, um `Scholasticus voluntatis´ zu werden, dürfen wir nicht in unserem Eifer nachlassen.«
»Das Spiel ist echt entscheidend. Hoffentlich stellt Vogts nicht den ollen Bierhoff auf«, sagte ein Satanist.
»Vergiss es!«, Der `Oberste Meister´ zischte die Worte. »Und ihr verschwindet. Wir wollten gerade die Katze opfern.« Alle sahen zu dem kleinen, schwarzen Fellknäuel, das sich hingebungsvoll putzte.
»Wir haben doch erst mit unserem `Center flag´ angefangen«, protestierte der Anführer. »Mein neuer Markierer ist nicht mal halb leer.«
»Feuere deine Knarre irgendwo anders ab, Chuck Norris!«
»Du bist voll der Noob!«, gab der Angesprochene zurück und ballerte zum Spaß eine Gelatinekugel an die Bunkerdecke.
Mittlerweile hatten sich die vier Paintballer und die fünf Satanisten aggressiv gegenüber aufgebaut. Eine direkte Konfrontation schien nur eine Frage von Sekunden.
Da knallte es außerhalb des Bunkers ohrenbetäubend. Die Wände zitterten wie bei einem Erdbeben und Staub rieselte von der Betondecke. Alle zuckten zusammen.
»Was war das?«, fragte Arkana erschrocken und blickte in Richtung der schweren Stahltür, die den Bunker und alles, was sich darin befunden haben mochte, bis vor wenigen Jahren sicher verwahrte.
»Wahrscheinlich ist ein Wildschwein auf einen Blindgänger im Wald getreten«, vermutete `Nuwanda´. Als Mitglied der Münsterer Feuerwehr wusste er von der Gefährlichkeit des Geländes.
»Dann sind bestimmt gleich die Bullen da«, vermutete ein Gotchaspieler. Schleunigst packte er seinen Druckluftbehälter in einen Rucksack. Die anderen beeilten sich ebenso beim Gedanken an die Polizei, schnell zu verschwinden. So gruselig und verlassen das alte Militärgelände war, so verboten war es natürlich, sich hier aufzuhalten. Keiner wollte sich dabei erwischen lassen. Das brachte großen Ärger ein. Und eine saftige Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.
»Helft mir wenigstens mit dem Altar«, flehte der `Oberste Meister´ den anderen hinterher. Doch seine Autorität schien wie verflogen. Nur der Anführer der Paintballer war geblieben. Beide sahen sich eine Weile an.
»Was schenken wir eigentlich Mama morgen zum Geburtstag?«, fragte er in Richtung des Satanisten. Der hatte bereits angefangen, seinen Anhänger herbeizuziehen und das Mofa anzukuppeln.
»Wie wäre es mit der Katze?«, entgegnete er seinem Bruder. »Seit `Mister Miau´ tot ist, wünscht sie sich doch eine.« Damit war dieser einverstanden. Er hob das Tier vorsichtig in den kleinen Karton mit den Luftlöchern und half anschließend, über dem Altar eine Decke mit mehreren Expandern zu befestigen.
»Wie heißt das Vieh?«, wollte der Bruder wissen.
Der `Oberste Meister´ dachte an das schwarze Kätzchen. »Wir werden ihn `Satan´ nennen.«
Sie schoben das Moped aus dem Bunker auf den Betonweg davor. Es war stockdunkel. Sie beeilten sich, den Ausgang des Geländes zu erreichen. Instinktiv achteten sie auf Polizisten und Wachhunde. Die Mitstreiter beider Lager waren durch ein Loch im Drahtzaun geflüchtet. Der Anhänger passte natürlich nicht hindurch. Also nahmen sie den Weg bis zu dem breiten Schiebetor. Das Vorhängeschloss lag am frühen Abend aufgebrochenen im Gras. Er musste gar nicht seinen eigenen Bolzenschneider bemühen.
Der Satanist deutete auf den Wald. »Da muss die Explosion gewesen sein.« Hoch in der Luft war undeutlich der Kringel einer Rauchwolke zu erahnen. Außerdem roch es intensiv nach Pulver.
Darauf blockierte das Rad des Mopedanhängers. »Mist, der Arm ist abgefallen und hat sich in den Speichen verhakt«, sagte der Freund des Luftdrucksports.
»Kann nicht sein«, antwortete sein Bruder. »Die habe ich vorhin extra abgemacht und ganz unten in den Hän-ger gelegt.« Seine Stimme klang unsicher, als er das Moped losließ. Er bückte sich und begutachtete das unerwartete Hindernis.
Zwischen den Speichen steckte eindeutig ein menschlicher Arm. Jedoch ein echter aus Fleisch und mit viel Blut. Als sich die Brüder entsetzt umsahen, entdeckten sie weitere menschliche Überreste, die verteilt herumlagen.
***
Sorgsam verschloss er den Umschlag mit dem Brief für Sonja.
Er wog die Pistole in der rechten Hand. Nie war sie ihm so schwer erschienen. Die SIG Sauer P225 war durchgeladen. Spürbar kroch die Kälte des Stahls in seine Fingerkuppen. Bevor er die Waffe auf der Tischplatte ablegte, schob er die beiden leeren Schnapsfläschchen zur Seite. Sie waren von der Tanke. Daneben schwitzte eine Tüte mit Fastfood. Seine Henkersmahlzeit.
Der Korn brannte sich derweil einen Weg durch seine Eingeweide. Er hatte ihn auf nüchternen Magen heruntergekippt. Gleich würde der Burger folgen. Gierig biss er hinein, auch wenn er fast kalt war. Senf und Ketchup quollen an seinem Mund vorbei. Eine Scheibe Gewürzgurke fiel ihm auf die Jeans. Sie hinterließ einen hässlichen Fleck. Normalerweise hätte er sich darüber geärgert. Doch jetzt machte es ihm nichts mehr aus. Im Tod war eine dreckige Hose ohne Bedeutung. Er wusste, der Suizid würde seine Probleme nicht lösen. Aber beenden.
Die Sache mit der Pistole lag auf der Hand. In den Mund. Nach oben zielen. Bloß nicht wackeln. Abdrücken. Gab es Schlimmeres, als einen Fehlschuss? Einen `halben Kennedy´ nannte man das. Keine Reise im bequemen Sarg, sondern als sabbernder Pflegefall in einem Heim.
Das Telefon klingelte. Er sah nicht einmal hin. Fast zärtlich nahm er die Waffe. Er betrachtete sie, als ob er die Pistole zum ersten Mal sehen würde. Immer schwerer schien sie in seiner rechten Hand zu werden. Er hob sie versuchsweise in Richtung Kopf.
Das Telefon läutete hartnäckig. Sein Blick wanderte noch einmal zum Brief an seine Tochter auf dem Tisch. So viele schöne Momente verband er mit ihrem Namen: S-o-n-j-a. Eine Kissenschlacht am Sonntag im Bett. Sie im Kommunionkleid. Ihr erstes Handballtor.
Wieso war es plötzlich so still? Ach ja, das Telefon. Der Anrufer hatte aufgegeben. Es klingelte nicht mehr.
Und wenn sie es gewesen war, die ihn anrief? Der Gedanke ließ ihn die Waffe senken. Sie hatte sich so lange nicht bei ihm gemeldet. Beim letzten Mal sagte seine Tochter viele unschöne Worte zu ihm. Es waren dieselben alten Vorwürfe, alles zerstört zu haben. Dass er immer auf der falschen Seite stand. Am Ende schrie sie ihn an.
Wenn sie doch nur anrufen würde.
Erneut klingelte das Telefon. Schrill hing der Ton in der Luft. Es musste einfach Sonja sein. Er griff nach dem Hörer.
»Guten Abend, Herr Kommissar«, meldete sich eine männliche Stimme am anderen Ende der Leitung. »Entschuldigen sie die späte Störung. Sie haben doch Bereitschaft. Es wurde ein Leichenfund in Münster bei Dieburg gemeldet. Ein Streifenwagen holt sie gleich ab.«
Kommissar Rüssmann sagte kein Wort und starrte auf den Telefonhörer in seiner linken und die Waffe in der rechten Hand.
»Herr Kommissar?« Draußen fuhr ein Wagen vor. Das Blaulicht war ausgeschaltet. Rüssmann erkannte es durch das Fenster. Eine Wagentür schlug. Es läutete an der Tür.
»Ich komme gleich.« Er legte auf. Dann steckte er kraftlos die Dienstwaffe zurück in seinen Holster.
Bei den wenigen Schritten zur Tür sah er in den Spiegel an der Garderobe. Überprüfte sein maskenhaftes Lächeln, das er immer aufzog, wenn es in ihm dunkel wurde und keiner es merken durfte. Mit einem Grinsen im Gesicht begrüßte er die Kollegen und nahm hinten im Vectra Platz. HR3 spielte den Song `Insomnia´ und der Kommissar sah aus dem Fenster.
Während der 20 Minuten Fahrt durch menschenleere Ortschaften verdichtete sich in Rüssmann die Gewissheit, dass er auch ohne den Einsatz in dieser Nacht wieder nicht den letzten Schritt getan hätte. Aber es half ihm in seiner Situation, die Möglichkeit dazu, seinen eigenen Tod, immer und immer wieder durchzuspielen. Im Autoradio begannen die Mitternachtsnachrichten.
Montag, 10.6.1996
»Was eine Sauerei«, sagte Kriminalkommissar Sven Leu, als sein Partner Jo Rüssmann am stabilen Rolltor zur Muna in Münster aus dem Streifenwagen stieg. Ein leichter Dunst von Alkohol lag sekundenlang in der Luft. Normalerweise fuhr der 50-jährige jeden Tag bei Wind und Wetter die Strecke bis nach Darmstadt ins Präsidium und zurück mit dem Rad. Jetzt hatte ihn aufgrund der mitternächtlichen Stunde ein Streifenwagen gebracht.
»Scheiß Bereitschaft, Sven. Und das ein ganzes, verdammtes Fronleichnamswochenende lang«, begrüßte er seinen jungen Kollegen, der ihm die Hand schüttelte. Mit einer starken Taschenlampe wies dieser den Weg ins ehemalige Militärgelände. Ein ekliger Geschmack, aus Schnaps, sauren Gurken und Sodbrennen steckte ihm im Hals.
Sven Leu leuchtete auf den Boden. »Bist du am Feiertag wenigstens ein wenig Rad gefahren?«
»Wie man´s nimmt. Wollte durch Dieburg Richtung Messel. Bin voll in die Prozession gelangt. Erst nach elf Strophen `Großer Gott wir loben dich´ durfte ich weiterfahren.«
In einiger Entfernung erkannten sie Feuerwehrfahrzeuge aus Münster, die einen Lichtmast ausfuhren. Bald darauf erstrahlte das Gelände in einem gleißenden Schein.
»Hast du das Dänemarkspiel gesehen?«, fragte der junge Beamte. Er war erst vor wenigen Wochen zur Kriminalpolizei nach Darmstadt versetzt worden und stammte aus dem tiefsten Odenwald.
»Nein, aber meine Nachbarn ließen mich an ihrem Fernseherlebnis teilhaben. Ich versuchte recht früh im Bett zu sein«, schwindelte sein Kollege. »Immerhin hatte ich einen Burger zum Abendessen.«
»Hab ich gesehen. Du hast einen entsprechenden Fleck auf der Hose«, wies ihn sein Kollegen hin.
Inzwischen hatten sie den Rand eines mit rot-weißem Band abgesperrten Bereichs betreten und wurden vom Erkennungsdienst begrüßt. Ohne eine sichtbare Regung nahmen Rüssmann und Leu die verschiedenen Körperteile in Augenschein, die auf dem Weg verstreut lagen.
»Wer der oder die Tote ist, wissen wir noch nicht«, erläuterte der Kollege Thorsten Hildebrandt in seinem weißen Papieranzug. Er war dabei, kleine Nummerntafeln an den Gliedmaßen zu verteilen. In einiger Entfernung flackerte das Blitzlicht eines weiteren Kollegen auf, der mit der Spurensicherung beschäftigt war. »Ich tippe auf einen recht jungen Mann«, sagte er und deutete auf den brüchigen Asphalt vor sich, »wenn ich mir den rechten Arm, der hier liegt, genauer betrachte.«
»Hoffentlich kein Kind«, fragte Leu nach. Er wurde sehr jung Vater.
»Glaube ich nicht, dafür ist die obere Extremität doch zu lang und muskulös«, bekam er zur Antwort. »Die Gerichtsmedizin wird sicher bald mehr herausfinden.«
Zwischenzeitlich hatten sich die Kommissare von der Bereitschaft mit den obligatorischen weißen Anzügen und den blauen Schuhüberzügen versehen, um keine Spuren zu kontaminieren. Sie traten vorsichtig näher an den Wald heran. Zwischen den Bäumen erkannten sie im Waldboden ein Loch mit etwa einem halben Meter Durchmesser. Überall darum befanden sich Blut und unkenntliche Innereien.
»Vorsicht«, kam es von dem Mitglied des Erkennungsdienstes, der die Fotos machte, »der Wald ist munitionsverseucht!« Beide blieben abrupt stehen.
»Auch so nah an der Straße?«, fragte Leu in Richtung des Kollegen.
»Anscheinend schon«, gab dieser zurück. »Die Firma, die hier die Entmunitionierung vornimmt, ist verständigt. Es kommt immer wieder einmal vor, dass ein Reh oder Wildschwein auf einen Blindgänger tritt. Dass an dieser Stelle welche liegen, scheint zumindest möglich. Der Bombentrichter deutet auf ein solches Geschoss im Boden hin.«
»Ein Pilzsammler war es bestimmt nicht«, brummte Rüssmann und besah sich einige Kleidungsfetzen, die sich neben dem Schildchen mit der Nummer 17 befanden. »Wer hat die Polizei verständigt?«
Sven Leu blätterte in einem kleinen Block. »Um 22.42 Uhr kam in der Zentrale ein anonymer Notruf an. Wohl von einer Telefonzelle. Es könnte die am Ortsausgang von Breitefeld Richtung Münster sein. Kollege Reifenberg sieht sich dort nach Fingerabdrücken um. Eine männliche Stimme berichtete kurz von einer Explosion auf dem Munagelände und dem Fund einer Leiche. Dann legte er auf. Wir haben außerdem den Anruf eines gewissen Jaroslav Volac. Aus der Asylunterkunft, die im alten Kasernenbereich untergebracht ist, von 22.37 Uhr. Der sprach von einer Explosion und einer Erschütterung.«
»Mit dem sprichst Du nachher. Interessant ist dieser anonyme Anrufer. Fünf Minuten nach dem Asylbewerber? Da hätten die Kollegen aus Dieburg fast jemanden in der Telefonzelle sehen müssen, als sie ankamen«, erwiderte Jo Rüssmann und machte sich seinerseits Notizen.
Weitere Personen erschienen am Ort. Ein Gerichtsmediziner, der Staatsanwalt. In ihrer Mitte ging ein Mann in einem schlecht sitzenden Anzug. Es war der Schichtleiter der Firma `Columbida´, die seit dem Abzug der Amerikaner letztes Jahres bereits tonnenweise Bomben, Granaten und Munitionsreste geborgen hatten. Ungläubig schüttelte er den Kopf, als er die Auswirkungen der Explosion sah.
»Ist es gefährlich hier?«, wollte Rüssmann sogleich von dem Mann wissen, der sich als Hans Theilig vorstellte.
»Unser Arbeitsfeld ist viel weiter hinten im Wald«, sagte dieser und verscheuchte eine lästige Stechmücke mit dem Handrücken. »Das Gelände ist eigentlich seit Langem sauber.«
»Könnte eine vielleicht unentdeckte Bombe tief in der Erde gelegen haben?«, fragte Leu.
»Unmöglich ist das nicht, allerdings sehr unwahrscheinlich«, erwiderte der gelernte Sprengmeister, der seit seinem Aufstieg in der Firma die Arbeiten koordinierte und überwachte. Er besah sich einen Metallsplitter, der unweit im Gras lag und die Nummer 47 trug.
»Warum liegt hier denn so viel Zeug herum?«, fragte der Hauptkommissar. »Das kann doch nicht alles aus dem Zweiten Weltkrieg stammen.«
»Doch«, sagte der Feuerwerker. »Die Warnschilder, die überall stehen, tun dies leider nicht ohne Grund.« Er deutete auf das Metallstück auf dem Boden. »In der Muna, die im Zweiten Weltkrieg offiziell `Luftwaffen-Haupt-Munitionsanstalt 2/XI´ hieß, produzierten und lagerten die Nazis ab 1939 Bomben und Bordwaffenmunition vom Kaliber 13 Millimeter bis 3,7 Zentimeter.« Sie standen auf und traten ein paar Meter zurück, da nun die Fotografen ihrer Arbeit an dieser Stelle nachkamen.
Der Feuerwerker kramte einen Lageplan des Geländes aus einer Umhängetasche. Unter dem Lichtmast der Feuerwehr zeigte er auf die zentralen Punkte der Anlage.
»Wir sind momentan hier. Dort drüben befindet sich der Bahnanschluss. Schon damals war in dieser Region alles recht dicht bewaldet, sodass die Amis lange nichts von der genauen Lage der Muna wussten. Sie war kurz vor Ankunft der Amerikaner trotz aller Nachschub-schwierigkeiten in Betrieb und gut gefüllt. Leider kam ein übereifriger Nazi auf die Idee, zumindest einige der Bunker im März ´45 sprengen zu lassen, damit die Munition nicht den Amerikanern in die Hände fiel. Also karrten sie alle auf einen riesigen Haufen.« Herr Theilig deutete auf einen der großen Teiche in der Nähe. »Wie das halt bei solchen Sprengungen ist. Es sind lediglich einige der gelagerten Granaten explodiert und haben beispielsweise dieses Loch im Boden hinterlassen, das sich später mit Grundwasser füllte. Andere rissen nur auf. Vielen Geschossen passierte gar nichts. Sie wurden allerdings durch die Detonation in der Gegend verteilt. Nach dem Krieg versuchte man zunächst unter amerikanischer Regie, die in der Umgebung gefundene Munition sowie Blindgänger aus dem ganzen Rhein-Main-Gebiet zu sammeln. Es wurde erneut gesprengt. Mit denselben katastrophalen Folgen. Man hatte nichts aus den ersten Versuchen gelernt.«
Der Kommissar ging in die Hocke und besah sich ein weiteres, recht kleines, zackiges Metallteil. Es war sogar bis hierher geflogen und noch gar nicht von der Spurensicherung geborgen. Er steckte seine Hand wieder in einen Gummihandschuh und hob es auf. »Das war eine deutsche Granate?«
»Äh, nein, das Teil ist amerikanisch, denke ich«, erwiderte der Mann von der Entsorgungsfirma und besah sich das Fundstück genauer. »Das sieht man unter anderem an der Farbe des Metalls. Viele amerikanische Bomben hatten einen ziemlich heimtückischen Verzögerungszünder. Er detonierte erst, wenn die Bevölkerung nach einem Angriff die Schutzräume verlassen hatte und sich die Schäden besah.« Der Mann zeichnete eine Skizze auf den Rand des Lageplans. »Die Bomben besaßen ein Leitwerk, sodass sie steil nach unten fielen. Am Zünder an der Spitze des mit Sprengstoff gefüllten Behälters saß ein kleiner Propeller mit einer Spindel. Drehte sich die Spindel bis zum Ende, zerdrückte sie eine Ampulle mit Aceton. Dieses tropfte auf eine Zelluloidscheibe, die den Schlagbolzen bis dahin von der Zündladung zurückhielt. Hatte die Chemikalie das Hindernis weggeätzt, krachte es.«
»Das ist wirklich fies«, pflichtete Leu dem Feuerwerker bei. »Da hatte man das Glück, dieser Bombenhölle entkommen zu sein und wird doch noch erledigt.«
»Das sollte die Moral der Deutschen zusätzlich schwächen«, sagte Theilig. »Nicht immer ging die Rechnung der Bombenwerfer auf. Das lag beispielsweise an Vereisung. Denn in 5000 Metern Höhe herrschen zweistellige Minustemperaturen. Nicht bloß im Winter. Wenn der kleine Propeller am Zünder festfror und sich nicht drehte, blieb die Acetonampulle manchmal unbeschädigt. Die Folge war, die Bombe detonierte nicht und bohrte sich metertief in den Boden. Wo sie unentdeckt liegen blieb. Nur am Eindringtrichter erkannte man manchmal überhaupt, dass ein Sprengkörper vom Himmel gefallen war. Wenn nach Jahrzehnten durch Materialermüdung und die Acetondämpfe die Zelluloidscheibe im Zünder brüchig wird, kann es immer noch spontan zu einer fürchterlichen Detonation kommen.«
»Ich dachte, die Muna wurde nicht von den Alliierten gefunden«, sagte Kommissar Rüssmann und legte den Bombensplitter zurück auf den Boden. Gleichzeitig bedeutete er den Kollegen vom Erkennungsdienst, ein weiteres Schildchen aufzustellen und Fotos zu machen.
»Sie wussten von einem Munitionsdepot, die exakte Lage kannten sie allerdings nicht. 1944 griffen zwei `P-47 Thunderbolts´ die Zugverbindung zwischen Eppertshausen und der Einfahrt in den Wald an. Sie warfen mehrere Bomben ab. Das ist historisch belegt. Es gab einige Schäden in Münster. Auch in der Nähe krachte es. Einem französischen Kriegsgefangenen, der sich beim Fliegeralarm im Wald versteckte, wurde dabei die Nase weggeschossen«, sagte der Sprengmeister. »Bei einer Fliegerbombe wäre der Krater viel größer. Ich vermute, dass es sich bei der Sprengladung, die das angerichtet hat, um ein Überbleibsel der Amerikaner handelte. Vielleicht eine alte Gewehrgranate. Doch die finden wir normalerweise eher in diesem Bereich«, er deutete auf den Lageplan, »in dem wir aktuell bergen. Dort liegen diese Höllendinger manchmal wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche. Es ist jedes Mal eine gewisse Unsicherheit dabei, wenn unsere Messsonden ausschlagen. Wir müssen mit dem Spaten nachsehen, ob es Schrott ist, ein alter Stahlhelm oder eine intakte Bombe.«
»Wie kann dann eine solche Granate hier am Waldrand jemanden in Stücke zerreißen?«, fragte Leu.
»Vielleicht hat sie das Opfer hinten im Wald gefunden und wollte sie durch das Tor vorne zur Straße tragen, als sie hochging«, spekulierte Theilig und deutete auf den Lageplan. »Der ganze Bereich ist munitionsverseucht. Wir sind mit unseren Arbeiten etwa in diesem Areal«, sagte er und ließ den Zeigefinger auf einem Gebiet der Karte kreisen. Ziemlich viel des umzäunten Waldes schien noch nicht geräumt.
»Was ist das dort hinten?«, fragte Rüssmann und deutete auf ein einzelnes Gebäude mitten im Wald.
»Das ist Bunker drei. Bis dahin sind wir noch lange nicht gekommen. Da herum, sieht es ganz übel aus. Das haben uns die Amis erzählt, bevor sie abzogen. In dem Schutzraum sollen jede Menge alte, deutsche Phosphorbomben liegen. Die sind hochgradig explosiv. Wahrscheinlich ist eine Bergung viel zu problematisch und kostspielig und man lässt das Zeug einfach drin.«
»Ist das nicht auf Dauer gefährlicher?«, fragte Rüssmann.
»Nicht unbedingt. Hier wohnt ja weit und breit niemand. Das ganze Gelände gleicht einem Minenfeld und das Betreten ist lebensgefährlich. Da sind selbst die Amerikaner nicht rein. Auch die Münsterer Feuerwehr hat die Order, wenn es zu Selbstentzündungen kommen sollte, notfalls alles kontrolliert abbrennen zu lassen und lediglich die Ausbreitung zu verhindern. Die aktive Bekämpfung des Feuers wäre viel zu riskant. Man bräuchte einen Löschroboter. Wir konzentrieren uns mit unserer Arbeit derweil auf diesen Bereich.« Wieder zeigte Theilig auf den Plan. »Damit haben wir Jahre zu tun. In der Mitte der Anlage befindet sich unser Lagerbunker. Ich sehe gleich einmal danach. Nicht dass etwas abhandengekommen ist.« Auf die fragenden Blicke der beiden Kriminalpolizisten ergänzte er: »Wir transportieren nicht jedes Fundstück sofort zur sachgemäßen Entsorgung ab. Deshalb sammeln wir sie im ehemaligen Bunker Nummer sieben. Natürlich alles vorschriftmäßig gesichert. Ich kontrolliere das mal.«
»Gut, tun sie das bitte. Und wir checken auf jeden Fall alle Fahrzeuge, die in der Nähe abgestellt sind«, versicherte Jo Rüssmann und gab einem Kollegen die entsprechende Anweisung. »Bisher sieht alles nach einem schrecklichen Unfall aus. Wahrscheinlich bekommen wir morgen früh die Vermisstenmeldung irgendeiner Mutter, die ihren Sohn sucht. Der fand es spannend, ein wenig explosive Schatzsuche zu spielen.«
Mittlerweile waren sie weiter in Richtung der Bunker gegangen. Auch dort hatten die Kollegen vom Erkennungsdienst bereits mehrere Lampen aufgestellt und Absperrband angebracht.
»Jo, schaut euch das an«, sagte der Kollege Kurt Mahnkopf und trat aus einem der offenstehenden Erdbunker. Diese waren oben mit Gras bewachsen und hatten ein schweres Eisentor auf der Vorderseite.
Drinnen zeigten sich Anzeichen von Verwüstungen. Im vorderen Bereich waren einige Möbel sorgfältig aufgetürmt worden, damit sie eine Art Hindernis darstellten. Überall klebten bunte Gelatineflecken. Trotz der weißen Überschuhe, die verhindern sollten, wichtige Fußspuren zu zerstören, versuchten die Kommissare auf Zehenspitzen an dem Tischhaufen vorbeizukommen.
»Das sieht nach einem regelmäßigen Gotchaschlachtfeld aus«, sagte Rüssmann zu seinem Kollegen Leu. »Ist denn das Gelände nicht gegen unbefugtes Betreten abgesichert?«
»Natürlich«, gab dieser zurück und deutete auf frisch aussehende Fußspuren in der klebrigen Masse, die wohl von Turnschuhen stammten. »Seit die Amis weg sind, wird sporadisch mit Wachhunden kontrolliert. Alles andere wäre zu teuer. Es ist nicht einmal ganz klar, wem das Ganze gehört. Der Gemeinde Münster, dem Staat oder den Amis. Es scheint jedenfalls Lücken in der Absicherung zu geben.«
»Mit der Leiche wird das hoffentlich anders. Das ist ja lebensgefährlich«, sagte Rüssmann und besah sich weiter den Abenteuerspielplatz. »An den nicht zerplatzen Kugeln könnten Fingerabdrücke sein. Vielleicht können wir auf diese Weise den anonymen Anrufer als Zeugen überführen.« Er wies auf mehrere grüne und blaue Geschosse, die neben einem als Barriere umgedrehten Tisch lagen.
»Das müsst ihr gesehen haben«, sagte der Kollege Mahnkopf aus dem angrenzenden Bunkerraum. Ein Halogenscheinwerfer leuchtete ihn gleißend hell aus. Es roch ein wenig nach Räucherstäbchen. Der Kollege stand vor einem mit roter Kreide auf den Betonboden gezeichneten Pentagramm. »Hier sind Reifenabdrücke. Wohl ein Bollerwagen.« Der Fotoapparat blitzte und hielt alle Einzelheiten von verschiedenen Blickwinkeln her fest.
»An Spuren mangelt es wahrlich nicht«, sagte Jo Rüssmann und schritt den Raum ab. »Da ist Blut auf dem Boden«, entdeckte er eine fast schwarz aussehende Pfütze. »Sag der Gerichtsmedizin Bescheid. Vielleicht war es doch ein Verbrechen. Das Opfer starb hier und wurde anschließend, um Spuren zu verwischen, draußen in die Luft gesprengt. Die sollen einen DNA-Test machen.«
»Eine merkwürdige Form für eine Blutlache«, stellte Sven Leu fest, der neben seinen Kollegen getreten war. »Es sind keine Tropf- oder Schleuderspuren zu sehen, auch keine Schleifabdrücke. Wer weiß, ob das überhaupt von einem Menschen stammt. Denk doch an das Pentagramm.«
»Das wird ja immer besser. Blutrituale. Ein totes Tier haben wir bislang nicht gefunden.«
»Jo und Sven, kommt rüber zum anderen Bunker«, teilte Kurt Mahnkopf seinen Kollegen mit und senkte das Funkgerät vom Ohr. »Es gab anscheinend einen Einbruch in das Bombenlager der Entsorgungsfirma.«
***
Das schwere Stahltor von Bunker sieben stand weit offen. Es wirkte an der Seite, an dem es normalerweise mit der Betonwand verschlossen war, merkwürdig deformiert. Drinnen erhellten Neonröhren den Raum. Neben der Wand prangte ein kleines Plastikschild mit dem Firmennamen `Columbida´. Vor dem Bunker waren mehrere Eisencontainer aufgestellt. Außerdem ein einfacher Bauwagen. In diesem verbrachten die Bombenentschärfer wahrscheinlich ihre Mittagspause oder wärmten sich im Winter auf.
Rüssmann trat näher. Es tat ihm gut, bei all seinen düsteren Gedanken auf dienstliche Routine umschalten zu können. Das gab ihm Halt und ein wenig Sicherheit. Die depressive Stimmung wich zurück und versteckte sich in den Tiefen des Unterbewussten. Doch er wusste, dass sie wie eine fette, haarige Spinne, die sich vor einem schlagbereiten Hausschuh unter das Bett gerettet hatte, jederzeit hervorkriechen konnte.
Der Erkennungsdienst war auch hier bereits im Einsatz und versuchte, an dem Schiebetor Fingerabdrücke zu sichern. Der Feuerwerker Hans Theilig kam aus dem Inneren des Baus, mit einigen Blättern Papier in der rechten Hand. Er wirkte fassungslos.
»Aufgebrochen!«, sagte er und fuchtelte mit den Zetteln an der Stahltür herum, bis ein Polizist etwas dagegen unternahm. »Da waren früher Kernwaffen drin! Das Tor hält den Beschuss eines Panzers aus. Jetzt sind die Sperrbolzen einfach aus der Wand gerissen!«
»Wurde denn was entwendet?«, fragte Leu und machte sich seinerseits Notizen.
»Einiges«, gestand der Chef der Bombenentschärfer kleinlaut. »Ich verständige sofort das Innenministerium.«
»Das können sie gleich tun. Haben sie einen ersten Überblick?«
»Hinten in der Ecke lagerten mehrere amerikanische `Demo 50 Lb´ und eine `Demo 100 Lb´, jeweils mit ausgebautem mechanischem Aufschlagzünder. Die sind alle weg. Eine Katastrophe.« Der Feuerwerker wirkte fast panisch, was gar nicht zum sonst ruhigen Auftreten passte. »Ob was von dem Kleinkram fehlt, weiß ich noch nicht.«
»Damit ich das richtig verstehe«, sagte Rüssmann mit ruhiger Stimme. »Hier wurde in der letzten Nacht in einen bestens gesicherten Bunker eingebrochen und mehrere gefährliche, jedoch vom Zünder her entschärfte Bomben gestohlen?« Der Mitarbeiter nestelte aufgeregt am Bändel seiner Jacke. »Wieviel Sprengstoff war denn drinnen?«
»Die 100er ist mit Compositi B gefüllt. Das ist eine Mischung aus zwei Sprengstoffen. Standardmäßig besteht sie zu 63 Prozent aus RDX, 36 Prozent aus TNT und 1 Prozent aus Wachs. Dieses verbessert dabei die Handhabung des Sprengstoffs«, sagte der Feuerwerker, als er Rüssmanns fragenden Blick bemerkte.
»Wie der Name sagt, ist das Gesamtgewicht der Bombe 100 kg. Der reine Sprengstoffanteil davon beträgt zwischen 60 und 80 kg. Das Ding ist so groß wie eine Regentonne. Sowas klemmt man sich nicht einfach unter den Arm und spaziert damit nach draußen. Da braucht man mehrere Leute, einen LKW und am besten einen Kran.«
»Und die anderen Bomben?«
»Die beinhalteten etwa 30 kg Trinitrotoluol, manchmal mit Beimischungen bis zu 40 Prozent Ammonsalpeter und haben die Größe einer Sauerstoffflasche.«
»Könnte eine solche Sprengfalle das Opfer im Wald zerfetzt haben?«, fragte Leu.
»Dann hätten sie den Knall bis nach Münster hören müssen und der Krater wäre viel größer. In diesem Metallkorb lagerten amerikanische Gewehrgranaten. Da sind zwar nur 20 bis 30 g Sprengstoff verbaut. Wenn einem sowas in der Hand explodiert, bleibt nicht viel übrig.«
»Wir müssen auf jeden Fall mögliche Reifenspuren sichern«, sagte Leu und betrachtete den Boden. »Welches Modell fahren sie und die Leute ihrer Firma?«
»VW-Transporter. Außerdem kommen wir natürlich mit unseren privaten Wagen hierher.«
»Wir müssen von allen die Reifenprofile sichern«, sagte der Kommissar. »Können sie mir eine entsprechende Liste anfertigen? Am besten gleich mit den Telefonnummern der Mitarbeiter, damit die Autos möglichst nicht mehr bewegt werden, bis der Erkennungsdienst die Spuren gesichert hat.«
Derweil war der junge Staatsanwalt Dr. Dienert aus Darmstadt hinzugetreten. Auch er war in einen weißen Tatortanzug aus dünnem Stoff gekleidet und schüttelte allen erst einmal die Hand. Dann ließ er sich von Kommissar Rüssmann die ersten Ermittlungsergebnisse berichten. Der Diebstahl von einigen Bomben, die voll mit explosionsfähigem Sprengstoff waren, verunsicherte ihn. Gleich ließ er über Funk Verkehrskontrollen im halben Rhein-Main-Gebiet anordnen. Besonders Kleinlaster und Lieferwagen sollten nach der explosiven Fracht untersucht werden.
»Nach allem was wir bisher wissen, müssen mehrere Personen an dem Diebstahl beteiligt gewesen sein«, schloss Rüssmann seine Ausführungen. »Es ist Montag früh, 3.03 Uhr. Wie lange wurde denn gearbeitet, Herr Theilig?«
»Wir schaffen am Freitag bis gegen Mittag. Ich war der letzte, der gegangen ist. Gegen 13.30 Uhr sperrte ich ab. Ich fuhr nach vorne zum Tor und sicherte dieses mit dem Vorhängeschloss.«
»Also war der Diebstahl von Freitagnachmittag an möglich«, sinnierte der Staatsanwalt. »Und Sonntagabend stirbt jemand bei einer Detonation. Durch eine Waffe, die aus dem Einbruch stammen könnte. Wir werden auf jeden Fall eine Sonderkommission einrichten«, sagte er zu Rüssmann und Leu. »Ich telefoniere gleich nachher mit dem Polizeipräsidenten. Ich möchte, dass sie beide dabei sind. Vielleicht wird sogar eine Mordkommission daraus. Würden sie die Leitung übernehmen, Herr Rüssmann und mir sagen, wen sie gerne dabei hätten?«
»Mache ich«, sagte dieser nach außen hin leidenschaftslos. Innerlich hing er bereits wieder seinen düsteren, schwarzen Gedanken nach, die ihn noch vor wenigen Stunden in tiefe Hoffnungslosigkeit führten. Er wusste, eine solche Sonderkommission konnte viel Arbeit bedeuten, gerade am Wochenende. Das Team würde in dieser Zeit fast zur Familie. Etwas, was er momentan nicht besaß. Wonach er sich aber sehnte und was seinem trostlosen Leben zumindest zeitweise einen Sinn gab. Vielleicht war dies ein Strohhalm, nach dem er greifen konnte. Rüssmann atmete tief durch, versuchte auf Routine umzuschalten und wandte sich noch einmal an den Leiter der Feuerwerker: »Wie bekommen sie denn den Sprengstoff aus den Bomben?«
»Wir haben eine Anlage im Vogelsberg«, sagte dieser. »Dort werden in einer ferngesteuerten und besonders gesicherten Maschine die Bombenkörper in Scheiben zersägt.« Der Sprengmeister zeigte mit seinen Händen etwa 20 cm lange Stücke in die Luft. »Dann können wir diese Ringe in einer speziellen Vorrichtung gezielt abbrennen lassen. Fackelt ganz gut, das `Composit B´-Gemisch. Übrig bleiben nach wenigen Minuten Brenndauer nur die rostigen Eisenringe, die zum Schrottverwerter gehen. Selten wird noch gesprengt. Dazu nutzen wir den Bundeswehr-Truppenübungsplatz Schwarzenborn. Da bilden wir auch Soldaten im Handwerk der Entschärfung aus.«
»Ich möchte wissen«, mischte sich Staatsanwalt Dr. Dienert in die Ausführungen ein, »wie es den Tätern gelungen ist, ihren Lagerraum zu knacken. Gab es keine Alarmanlage?«
»Nein, das ist nicht vorgeschrieben. Die US-Armee hatte in diesen Bunkern immerhin ihre ABC-Waffen gelagert. Besonders Artilleriegranaten für die Kaserne in Babenhausen.«
Der Staatsanwalt besah sich die Stelle an der Betonwand genauer. »Wie ich die Sache sehe«, sagte er, »hat jemand einen hydraulischen Spreizer eingesetzt.« Alle schauten ihn ungläubig an. »Ich bin doch bei der Feuerwehr in Weitengesäß. Da haben wir letzten Monat mit sowas geübt, einen verunfallten Wagen zu öffnen. Geht wie geschmiert.«
Die Kommissare machten sich Notizen. »Wir sollten einmal bei den Wehren im Umkreis nachfragen, ob jemand einen vermisst.«
»Kann man damit eine solch massive Tür aufbrechen?«, fragte Leu den Staatsanwalt.
»Das könnte sein. Unsere Ausbilder haben demonstriert, wie viel Kraft die Anlage hat. Damit können die Wehren oder das THW Eingeschlossene aus eingestürzten Häusern befreien, wenn sich die Türen dermaßen verzogen haben, dass man sie nicht manuell aufhebeln kann.«