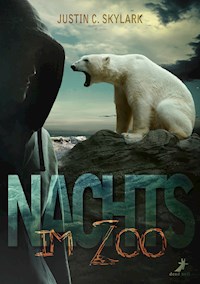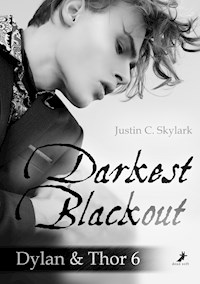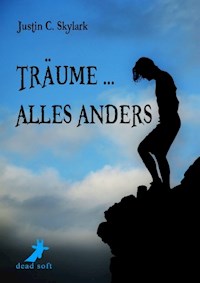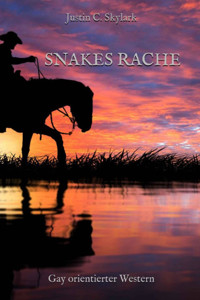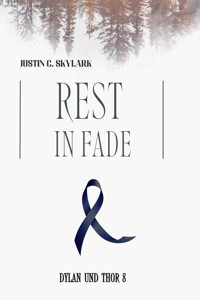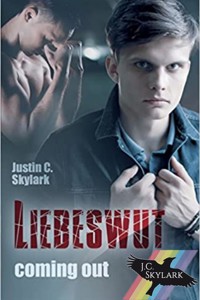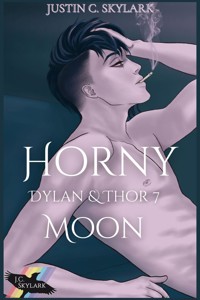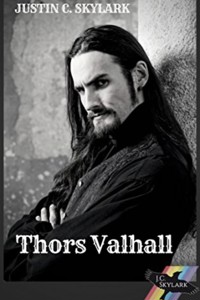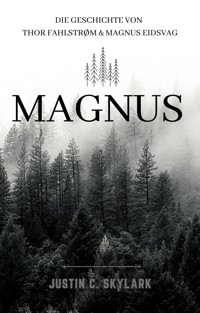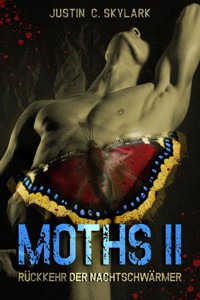
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Jahr ist vergangen, seitdem Jonathan die Liebe zu dem Untoten Maurice de Sangui-Juela erfahren und schweren Herzens verloren hat. Inzwischen ist Ruhe eingekehrt. Mit seinem Liebhaber Eliot, genießt Jonathan prickelnde Stunden. Doch lange währt das sorglose Leben nicht an. Eliot offenbart, dass er Vater wird und seit dem Biss eines Blutsaugers spürt er beängstigende Veränderungen in sich. Als Maurice plötzlich wieder auftaucht, begeben sich die drei Männer in erneute Gefahr. Der Untote wurde aus seinem Clan verbannt und seine Feinde sind ihm dicht auf den Fersen ... 1. Band: Moths - Nachtschwärmer 2. Band: Moths - Rückkehr der Nachtschwärmer 3. Band: Moths - Die Rache der Nachtschwärmer
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Moths 2
Die Rückkehr der Nachtschwärmer
Prolog
Es war eine nervenaufreibende Arbeit, die verpackten Exponate aus den Transportkästen zu befreien. Mein Freund und Mitarbeiter William war darin geübt. Während er ohne Skrupel an den Scharnieren werkelte und zu guter Letzt den Hammer nahm, um die Metallriegel zu lockern, stand ich andächtig daneben. Kaum war der erste Deckel gelöst, trat ich näher. Ein modriger Geruch strömte mir entgegen. Ein Duft von verjährtem Leben, von einer Zeit, an der wir nicht teilhaben durften. Eine Gänsehaut überzog meinen Körper, als ich mich vorbeugte und einen gründlicheren Blick riskierte.
Von Angesicht zu Angesicht stand ich vor dem Geschöpf und sah in seine tiefschwarzen Augen. Obwohl es leblos war und meinen Blick nur abwesend erwiderte, ergriff mich die Faszination.
„Es sieht wunderbar aus, William! Sagenhaft!“
Teil 1
Aufgrund der Scheinwerfer des Wagens war meine Ankunft sichtbar gewesen. Dennoch drosselte ich das Tempo. Bevor ich die Auffahrt zu Eliots Anwesen hinauffuhr, blickte ich mich mehrfach um. Ein unnützes Verhalten, wohl gemerkt. Dass Eliot und mich seit Jahren eine enge Freundschaft verband, war kein Geheimnis. Allerdings hatte sich in den letzten Monaten einiges geändert. Wahrscheinlich war das der Grund, warum ich mich sonderlich benahm. Vorsichtiger, abwartender.
Wir kannten uns seit Studienzeiten. Ich, angehender Biologe und Eliot, künftiger Mediziner, hatten zusammen mehrere Stunden im Anatomieunterricht verbracht. Etliche Male hatten wir um einen Tisch herum gestanden; diskutierend und lachend, meist mit einem Skalpell in der Hand. Einige Male mit einem toten Lebewesen vor den Augen. Ich liebte es, Eliot zu betrachten, wie er seine schlanken Finger in die engen Handschuhe schob, sie spreizte und sich über den Arbeitstisch beugte, um die wehrlosen Objekte zu sezieren.
Er fand keinen Gefallen daran, wie er mir gleich zu Beginn unserer Arbeiten offenbart hatte. Sein Ziel war die moderne Chirurgie gewesen, die plastische.
Dennoch mussten wir für die Prüfungen Erfahrungen sammeln. Das tat er mit Geschick und Ausdauer. Es kam oft vor, dass sich die Kommilitonen um den Arbeitstisch scharten. Gern sahen ihm andere Studenten zu. Vornehmlich die weiblichen, wie ich feststellen musste. Nicht selten verbrachte ich Stunden mit Eliot, dicht an dicht, arbeitend und schwitzend. Aber den Tag ließ er lieber an der Seite einer Frau ausklingen.
Schnell hatte ich mein Herz an ihn verloren und nie gewagt, es ihm zu gestehen.
Claudia, so hieß seine Gattin. Selbstverständlich hatte sie ein hübsches Gesicht ohne Makel. Sie war gertenschlank und verfügte dennoch über die nötigen Rundungen, die einen Mann zum Schwärmen brachten.
Obgleich Eliot zu unseren Studienzeiten kein Kostverächter gewesen war und die weiblichen Begleitungen gewechselt hatte wie seine fein gebügelten Hemden, stand schnell fest, dass Claudia die Frau seines Lebens war.
Kaum hatte Eliot sein Studium beendet und den Doktortitel in der Tasche, heiratete er sie. Er eröffnete eine Praxis und wurde sesshaft. Das Geschäft boomte. In wenigen Jahren konnte er sich und seiner Frau ein schönes Anwesen kaufen. Die plastische Chirurgie war ein beliebtes Gebiet der reichen Leute und Eliot wurde ein viel beschäftigter Mann, dessen Ruf ihm vorauseilte.
Meine Liebe zu ihm erlosch in keinem Moment. Auch nicht, als ich als Trauzeuge die Ringe vor den Altar trug und ihm zur Hochzeit gratulierte.
Es war ein Abend, an dem ich mich grenzenlos betrank und niemand den Grund dafür wissen wollte.
Ich blieb Junggeselle.
Verschroben genug, um mich einzig und allein an meinen Exponaten zu erfreuen; an der Arbeit, die mich jeden Tag für Stunden beschäftigte. Als Direktor des Naturkundemuseums gab es selten einen ruhigen Moment, der mich in Melancholie gefangen hielt. Für triste Augenblicke blieb keine Zeit.
Wenn der Morgen begann, gerieten die kleinen Zahnräder in Betrieb, dann lief das Werk in mir automatisch. Verbrachte ich die Tage nicht im Museum, hinter meinem Schreibtisch oder zwischen den Schaukästen, arbeitete ich in der Wohnung.
Das Präparieren und Sammeln von Insekten war meine Leidenschaft – die jedoch Leiden schuf, wie ich vor nicht allzu langer Zeit schmerzlich erfahren musste.
„Du bist spät.“ Eliot empfing mich mit einem Kuss, den er sinnlich auf meine Wange hauchte. Kaum spürte ich seine Nähe, pochte mein Herz aufgeregt.
Er ließ mich eintreten und öffnete die schwere Haustür dabei weit. Ein letztes Mal drehte ich mich prüfend um. An diesem Abend hatte ich ein ungutes Gefühl, als ich meinen Freund aufsuchte. Ich konnte mir nicht erklären, woran es lag.
In seiner Villa waren meine befremdlichen Eindrücke allerdings nebensächlich.
Wie immer trug er einen maßgeschneiderten Anzug, darunter ein weißes Hemd mit spitzem Kragen. Er besaß dichtes, dunkles Haar. Wie ich hatte er die 30er Grenze um einige Jahre überschritten. Kleine Fältchen zierten sein Gesicht, wenn er lachte. Trotzdem wirkte er jugendlich und elegant. Ich kannte ihn nicht anders. Er war entgegenkommend, verlässlich und hilfsbereit. Er war nie laut und verlor ebenso selten die Beherrschung. Seine Anwesenheit verschaffte mir den erforderlichen Ausgleich zwischen Alltag und Wahnsinn, der oft näher schien, als mir lieb war.
„Es tut mir leid. Die Vorbereitungen für die Ausstellung laufen auf Hochtouren. Ich konnte nicht ...“
Ehe ich meine Verspätung erklärte, umarmte er mich. Wir küssten uns. Ich vergaß, was ich berichten wollte. Er schmeckte wunderbar, sodass ich den Kuss innig erwiderte und mich kaum trennen mochte.
Letzte Unsicherheiten blieben. Vorsichtig sah ich mich um.
„Sie ist wirklich weg? Das Dienstmädchen auch?“
„Wie immer ...“
Er hörte nicht auf, an meinem Hals zu züngeln. Er schob den Kragen meines Hemdes beiseite und leckte über mein Schlüsselbein. Ich wurde hart und fragte mich, ob er es mit Absicht tat. Wollte er mich bewusst in Verlegenheit bringen, kaum hatte ich das Haus betreten?
Wie gewohnt zogen wir uns in die Bibliothek zurück, wo antike Schränke, alte Bücher und ein plüschiges Sofa für die passende Atmosphäre sorgten. Während ich Eliot folgte, musste ich mir zum wiederholten Male vergegenwärtigen, was für ein Glück ich gehabt hatte.
Die besten Jahre meines bisherigen Lebens hatte ich auf ihn gewartet. Ständig mit der Tatsache vor Augen, dass meine Sehnsucht nach ihm ohne Hoffnung war.
In dem Moment, in dem ich ihm meine Liebe gestanden hatte, hatte ich mit allem gerechnet. Nur nicht damit, dass er meine Avancen erwidern würde. Ich hatte mich in Geduld geübt und überraschenderweise wurde ich dafür belohnt.
„Ich habe uns ein paar Canapés gemacht. Möchtest du einen Schluck Champagner? Er ist frisch aus der Kühlung.“
Er wartete keine Antwort ab, sondern zog mich gleich auf das weiche Sofa. Erneut küssten wir uns. Er war stürmischer als die Male davor. Ich bekam kaum Luft, so fest verschlossen seine Lippen meinen Mund.
Der Griff zwischen meine Beine entlockte mir ein inbrünstiges Stöhnen. „Du hast anscheinend ebenso darauf gewartet, wie ich.“
Er rieb mich durch den dünnen Stoff meiner Hose. Meine Männlichkeit war zum Platzen gespannt. Ich lehnte mich zurück. Sanft schob er mir die Brille von der Nase.
„Du ... Intelligenzbestie ...“
Er lachte. Die Brille glitt auf den Beistelltisch. Hemmungen hatten wir keine mehr. Unsere Hände gingen auf Wanderschaft.
Schnell fanden meine Finger den Weg. Ich öffnete seinen Reißverschluss und fasste hinter die engen Shorts. Dort erwartete mich eine stramme Härte. Wir streichelten einander, bis wir uns keuchend entluden und letzten Endes träge in den Armen hingen.
Erst danach legte sich die Anspannung in mir.
„Die Schnittchen sehen gut aus.“
Ich betrachtete den Teller mit den Canapés und angelte nebenbei meine Brille vom Beistelltisch. Vorsichtig rückte ich sie auf der Nase zurecht. Eliot entging meine Verlegenheit nicht.
„Mein lieber Jonathan“, säuselte er. „Ist dir das Ganze immer noch unangenehm?“
Wie ein Gentleman griff er in die Seitentasche seines Jacketts. Er zog ein Stofftaschentuch hervor, das er mir reichte.
Ich lächelte und nahm das Taschentuch an, um mich zu säubern. Sperma klebte auf meiner Hose. Auf meinem Bauch glänzte das Ergebnis meines Höhepunktes.
Eliot ging die Sache gelassener an. Er wischte sich lediglich mit der Hand über die feuchte Haut und zog anschließend die Hose hoch. Jede Bewegung war galant. Mit spitzen Fingern strich er sein Haar zurück. Unsere Tuchfühlung hatte Spuren hinterlassen.
„Es mag vielleicht pervers klingen, aber unsere Zusammenkünfte wirken auf mich außerordentlich berauschend.“
Bei seinen Worten erschauderte ich. Genau verfolgte ich, wie er seine Hand hob und den Duft unserer Vereinigung tief inhalierte.
Sein Verhalten verunsicherte mich.
Bis vor Kurzem kannte ich Eliot nur diszipliniert, hochgeschlossen und äußerst diskret. Hatte er auch noch so viele Frauen gehabt: Er blieb ein Charmeur, ein entgegenkommender Gastgeber und ein vertrauensvoller Gesprächspartner, der sich seine Leidenschaften selten anmerken ließ.
Obwohl es viele Nächte gegeben hatte, in denen ich mich weinend nach ihm gesehnt und an ebenso vielen Tagen neben ihm gestanden und mit mir gerungen hatte: Die Vorstellung, mit ihm intim zu werden, befremdete mich. Mittlerweile konnte ich ihn fühlen und schmecken, und das in einer Deutlichkeit, die ich mir nie erträumt hatte.
Das war ein unfassbares Phänomen. Eliot hatte recht. Ich war verlegen.
„Du musst entschuldigen.“ Ich schloss meine Hose und kam auf die Beine. „Für mich ist das nach wie vor eine bizarre Situation. Und Claudia ...“
„Pst.“ Er legte seine Finger auf meinen Mund. „Zerstöre nicht den Moment.“
Er strich über meine Wangen. Er küsste mich, wieder zärtlich. Dabei schloss er die Augen und genoss.
Seine Leidenschaft war echt, obwohl er verheiratet war. Vielleicht war es das, was mich nicht losließ.
Seiner Frau gegenüber fühlte ich mich schäbig. Es war nie meine Absicht gewesen, sie zu hintergehen. Noch weniger wollte ich ihr den Mann ausspannen. Doch es geschah einfach. Es ging mit uns durch. Schockierend war die Gegebenheit, dass sie von unserer Liebschaft wusste – und sie tolerierte.
„Du musst zugeben, dass es ungewöhnlich ist.“ Mein Körper beruhigte sich. Hunger machte sich breit. Ich probierte ein Schnittchen.
„Claudia weiß, was wir treiben, während sie weg ist. Ich kann diese Tatsache nicht vollständig verdrängen.“
Das Canapé mit Lachs und Frischkäse schmeckte köstlich. So köstlich wie Eliots Küsse. Er schenkte uns ein Glas Champagner ein. Ohne Frage war er ein perfekter Liebhaber.
„Ich verstehe dich.“ Sanft stieß er sein Glas gegen meins. Wir nahmen einen Schluck. „Auf uns.“ Er zwinkerte mir zu. Dennoch blieb sein Gesichtsausdruck ernst.
„So sehr ich unser Arrangement schätze, muss ich dir leider mitteilen, dass es in der Form nicht weitergehen kann.“
Ich hatte es geahnt! Den ganzen Weg hierher hatte ich es geahnt. Das ungute Gefühl, das ich mit mir trug, hatte mich nicht getäuscht.
Dennoch erschütterten mich seine Worte. Ich atmete tief durch. Eine Antwort fand ich so schnell nicht.
„Claudia wird in der nächsten Zeit nicht mehr regelmäßig unterwegs sein.“
Ich schluckte benommen. Der berauschende Geschmack des Champagners lag auf meiner Zunge, doch beflügeln tat er mich nicht.
Eigentlich war es absehbar gewesen. Eliot schickte Claudia jedes erste Wochenende im Monat auf einen Wellnesstrip. Bewusst arrangierte er ihre Abwesenheit, damit er mit mir ungestört sein konnte. Er spendierte ihr Massagen und Beautyanwendungen, sodass sie sich entspannte und nicht fortwährend daran dachte, was ihr Mann in der Zwischenzeit tat.
Ein paar Monate ging das gut und ich glaubte, dass es ewig so weitergehen würde. Bis zu diesem Abend.
„Wieso ...“ Ich räusperte mich. „Wieso jetzt?“
Die Frage klang deprimiert, wenn nicht gar vorwurfsvoll. Ich ahnte Schlimmes. Vielleicht hatte Claudia ihre Meinung geändert? War sie so schlau gewesen, ihren Mann vor eine Forderung zu stellen? Entweder sie oder ich. Beides sollte nicht mehr funktionieren. Ein anderer Grund tat sich gar nicht vor mir auf. Unmöglich konnte ich glauben, dass Eliot die Beziehung zu mir beenden wollte. Ich spürte seine Zuneigung und sein Verlangen. Nein, das konnte es nicht sein ...
„Claudia ...“ Eliot presste seine Worte schwerfällig hervor. „Sie ist schwanger.“
„Schwanger?“ Meine Mundwinkel zuckten. Sollte ich lachen oder fluchen? Zugegeben, mit dieser Neuigkeit hatte ich am wenigsten gerechnet.
„Aber ich dachte, ihr seid ... Ich dachte, mit euch ...“
Ich stammelte vor mich hin. Vorsichtig stellte ich das Glas beiseite. Was ich gedacht hatte, musste ich nicht weiter erklären. Eliot liebte seine Arbeit. Wie ich konnte er sich stundenlang in seiner Praxis beschäftigen und dabei alles andere vergessen. Für mein Leben war dieses Verhalten nicht von großer Bedeutung. Ich war Single und konnte den Arbeitstag hinauszögern, solange ich wollte.
Auf Eliot wartete dagegen eine Frau. Jeden Abend, oftmals vergebens. In den Jahren ihrer Ehe lebten sie sich auseinander. Kinder waren kein Thema. Urlaub eine Seltenheit, obwohl Eliot einiges dafür tat, um seine Frau glücklich zu machen. Doch er selbst machte sich rar.
Als ich Eliot meine Liebe gestanden und er sie zuerst nur zögerlich erwidert hatte, war uns beiden bewusst gewesen, dass seine Ehe zum Scheitern verurteilt war.
Offen hatte mir Eliot offenbart, dass die Beziehung aus sexueller Sicht buchstäblich stagnierte. Dass Claudia bei ihm blieb, obwohl er ein Verhältnis mit mir begann, hatte ich ihr hoch angerechnet.
Dass sie schwanger war, konnte ich mir nicht vorstellen.
Eliot wand sich unter meinem fassungslosen Blick.
„Ich weiß auch nicht.“ Wollte er eine Entschuldigung aussprechen?
„Aber in letzter Zeit läuft es wieder gut.“
Wollte ich das hören? War es geschmacklos, dass er mir davon erzählte?
„Diese Blockade ist fort.“ Er sah mich an: mit ehrlichen Augen. Ihre braune Farbe hatte mich schon immer fasziniert. „Ich bin jetzt öfter zu Hause. Manchmal beginne ich erst am späten Nachmittag mit der Arbeit.“
„Das ist ja schön für euch!“ Die Stimmung kippte. „Herzlichen Glückwunsch!“
Ich wandte mich ab. Die Erniedrigung konnte nicht größer sein. Wieso tat er mir das an? Waren meine Gefühle nicht mehr wichtig? Hatte er mich benutzt? Das konnte nicht sein!
„John, warte!“
Er eilte mir nach.
„Ich wüsste nicht, auf was ich noch warten sollte!“
Meine Stimme wurde unnatürlich laut. Tränen der Wut machten sich bemerkbar, als ich den Mann meines Lebens näher betrachtete.
„Es wird sich zwischen uns nichts ändern!“ Er fasste mich bei den Schultern. Wie stellte er sich das vor?
„Meinst du allen Ernstes, ich mache so weiter, während deine schwangere Frau nebenan sitzt und uns dabei zuhört?“
Es lag auf der Hand, dass Claudia die kommenden Monate lieber zu Hause verbringen und keine Wochenenden wegfahren, sondern ein Kinderzimmer einrichten würde. Wenn das Kind geboren war, musste sich Eliot darum kümmern. Das stand außer Frage, das musste man erwarten.
„Es wird sich eine Lösung finden ...“
Ich schüttelte den Kopf. „Ohne mich, Eliot. – Es tut mir leid.“
Ich bewahrte die Fassung und wurde nicht ausfallend. Stattdessen zog ich den Kürzeren; beherrscht und erhobenen Hauptes.
Dennoch eilte ich aus dem Haus, so schnell ich konnte. Eliot lief mir nach. Er wollte mich aufhalten, sich erklären, mich festhalten, doch ich entwich ihm mit eisernem Willen. Die Reifen quietschten, als ich das Anwesen verließ.
Ich fuhr zu schnell, dabei hatte ich von dem Champagner kaum etwas zu mir genommen. Aber die Enttäuschung wollte nicht weichen, sodass ich fester als sonst auf das Gaspedal trat. Ich überquerte dunkle Landstraßen, die zu später Uhrzeit spärlich befahren waren.
Immer wieder verschwamm das Bild vor meinen Augen. In nur wenigen Sekunden war mein Glück zerstört. So schnell, wie sie begonnen hatte, war die Affäre mit Eliot beendet. Ich konnte es nicht fassen.
Obwohl er mir nachgelaufen war und signalisierte, die Bindung mit mir nicht lösen zu wollen, gab es für mich nur den Weg der Trennung. Oder?
Inzwischen regnete es und die Straßen glänzten nass. Kein ideales Wetter, um den Heimweg im rasanten Fahrstil zu nehmen. Schwer konnte ich mich auf die Fahrbahn konzentrieren, denn Eliot und seine Worte gingen mir nicht aus dem Kopf.
Claudia ist schwanger ... Es läuft wieder gut mit uns ...
Plötzlich tauchte eine Person in der Dunkelheit auf. Sie kam wie aus dem Nichts und stand mitten auf der Straße. Meine Reflexe waren verlangsamt. Ich trat auf die Bremse und wich aus. Der Wagen drehte sich um die eigene Achse und rutschte auf den Fahrbahnrand. Kurz vor der Böschung blieb er stehen. Doch das war das Wenigste, was mich schockierte. Meine Reaktion war nicht schnell genug gewesen. Ich konnte sehen und hören, wie mein Auto die Person erfasste. Ein dumpfes Geräusch erfüllte das Wageninnere. Die Gestalt glitt über den Kühler wie ein rutschiges Stück Seife. Es war unmöglich gewesen, auszuweichen.
Meine Güte, wen trieb es des Nachts auf die dunkle Landstraße?
Ich schwang mich aus dem Wagen. Die Rücklichter des Gefährts erleuchteten den Fahrweg. Es war keine Einbildung gewesen. Auf dem Boden lag tatsächlich eine Person. Mir blieb an diesem Abend nichts erspart!
„Ist Ihnen etwas passiert?“ Waghalsig traute ich mich näher. Die Person trug einen schwarzen Mantel und schwarze Hosen.
Wie hätte ich sie rechtzeitig sehen sollen? „Geht es Ihnen gut?“
Meine Beine zitterten. Trotzdem wagte ich mich weiter vor. Ich war auf der Hut. Niemand konnte mir sagen, in welcher Absicht die Person ihren Weg hierher gefunden hatte.
Mir fiel ein Stein vom Herzen, als sie sich regte und auf die Beine kam. Die Verletzungen, wenn es denn welche gab, konnten nicht schwerwiegend sein.
„Soll ich einen Krankenwagen rufen?“
Die Person wandte mir den Rücken zu. Ich erkannte dunkle Haare, die sich im Wind bewegten. Unverkennbar handelte es sich um einen Mann, der sich umdrehte. Im nächsten Moment blickte ich in sein fahles Gesicht, in seine pechschwarzen Augen.
„Maurice?“
Sein Anblick war wie ein Schock für mich. Er war es tatsächlich: Maurice de Sangui-Juela. Mehr als ein Jahr war seit unserer letzten Begegnung vergangen.
Meine Hoffnung, ihn jemals wiederzusehen, schwand mit jedem Tag, der zu Ende ging. Oftmals hatte ich abends auf dem Balkon auf ihn gewartet. Mehr als einmal hatte ich an ihn gedacht, an seine Küsse und seine unnatürliche Art.
Jeder Tag, der verstrich, ohne dass er zurückkam, ließ die Erinnerung an ihn schwinden. Mittlerweile versuchte ich, mir einzureden, dass es besser war, nicht mehr an ihn zu denken. Wenn ich nachts von grässlichen Träumen geplagt erwachte, musste ich annehmen, dass er gar nicht existierte und meine überreizten Sinne mir nur einen Streich gespielt hatten.
Doch an diesem Abend stand er plötzlich wieder vor mir. Greifbar nahe und zum Erschaudern schön.
„Du bist zurückgekommen.“ Meine Worte waren leise, zweifelnd. Ich starrte ihn ungläubig an.
Ein Auto kam die Schnellstraße entlang. Das Scheinwerferlicht blendete mich und dennoch war ich nicht in der Lage, mich zu bewegen.
Beschützend legte Maurice einen Arm um mich. Sogleich bemerkte ich den süßen Duft, der seinen leblosen Körper umgab. Es war ein Duft, den ich fürchten sollte und der mich ebenso betörte.
„Ich kann es nicht glauben.“
Mit geschlossenen Lidern lehnte ich mich gegen seine Brust. Er umarmte mich und streichelte mit seinen kühlen Händen meinen Nacken.
„Jonathan“, wisperte er mit einer mir vertrauten Stimme. Wie sehr hatte ich ihren Klang vermisst. „Es ist schön, dich zu sehen.“
Ich seufzte tief und sah auf. Was passierte, war kaum fassbar.
„Ich dachte, ich sehe dich nie wieder.“
Ich presste die Lippen zusammen. Da er nicht weinte, wollte ich es auch nicht tun.
Ein weiterer Wagen preschte an uns vorbei. Maurice kniff die Augen zu.
„Wir sollten einen anderen Ort aufsuchen ...“
„Selbstverständlich!“
Ich wischte mir über das feuchte Gesicht. Der Regen hatte unsere Kleidung durchnässt. Wässrige Tropfen saßen in unseren Haaren. Für ein sinnliches Wiedersehen war dieser Ort wahrlich nicht der richtige.
Maurice folgte mir zum Auto, wo er auf dem Beifahrersitz Platz nahm.
„Musstest du mich derartig erschrecken?“ Ich lachte. Mein Leib zitterte hingegen noch immer. Ich nahm den Weg in die Stadt wieder auf. „Ich dachte, ich hätte jemanden umgefahren.“
Maurice erwiderte mein Lächeln. „Du weißt: Ich liebe spektakuläre Auftritte.“
Ich nickte. Hätte er ohne Ankündigung vor meiner Tür gestanden, hätte es mir wohl einen ebenso großen Schrecken eingejagt.
„Du bist wirklich nicht verletzt?“
Er schüttelte den Kopf. Ein paar Regentropfen glitten von seinen Haarspitzen.
Da er mir auf einer einsamen Landstraße aufgelauert hatte, stellte ich einige Vermutungen an.
„Bist du schon länger in der Stadt?“
„Eine Weile.“
Er blickte geradeaus. Sein Lächeln war verschwunden. In diesem Moment wusste ich, dass nicht nur ich der Grund für seine Rückkehr war.
Wir fuhren zu mir nach Hause. Als ich im Flur das Licht anstellte, wich Maurice zurück. Selten hatte ich ihn so lichtscheu erlebt. Das Wohnzimmer wurde nur durch den Mondschein erhellt. Anstelle der grellen Schreibtischlampe entzündete ich Kerzen.
„Ich kann dir leider nichts anbieten.“ Der erste Schock war überwunden, stattdessen wurde ich nervös. Normalerweise hätte ich einem Gast Kaffee angeboten, etwas Gebäck oder ein Glas Wein. Bei Maurice war einiges anders.
Er war mir gefolgt und legte seinen Mantel ab. Wie gewohnt trug er darunter einen Anzug, doch im Schein des Kerzenlichtes bemerkte ich, wie mitgenommen er aussah.
Draußen war es mir nicht aufgefallen. Beim genaueren Hinsehen erkannte ich tiefe Furchen auf seinen Wangen und Schatten um seine geröteten Augen.
„Du siehst müde aus.“
„Wann sehen Nachtschwärmer nicht müde aus?“ Er quittierte meine Aussage mit einem Lächeln. Doch er konnte mich nicht täuschen. Etwas war geschehen. Etwas, das ihn zu mir zurückbrachte.
„Warum bist du zurückgekehrt?“ Diese Frage lag mir brennend auf der Zunge.
Er wandte sich ab und ging ein paar Schritte über den Boden. Seine Bewegungen waren nahezu lautlos.
„Ich habe ein Jahr auf ein Zeichen von dir gewartet.“ Meine Verzweiflung konnte ich nicht verbergen. Ich hatte angenommen, dass unsere Trennung für immer war.
„Was ist passiert?“
Ich trat näher. Als ich seinen Arm berührte, registrierte ich, wie angespannt er war.
„Bitte, geh duschen!“, fauchte er unerwartet. „Eliots Duft haftet noch immer auf deiner Haut!“
Ich zog meine Hand zurück. „Natürlich ...“
Eine Diskussion kam mir unsinnig vor. Ich wusste um Maurice‘ Gaben. Ich wusste, dass er Gedanken lesen konnte und über ausgeprägte Sinnesfunktionen verfügte. Vor ihm konnte ich kaum etwas verbergen. Da ich tiefe Gefühle für ihn hegte, war mein Seelenleben ein offenes Buch für ihn.
Die Dusche tat gut und brachte meine Lebensgeister zurück. Dennoch fühlte ich mich schäbig, als ich das Duschgel auf meiner Haut verrieb. Ich liebte Eliots Duft. Ich mochte es, wenn meine Kleidung nach ihm roch, wenn ich nach einem unserer romantischen Abende an ihn dachte und noch immer das Gefühl hatte, ihn zu spüren.
Eliot. Ich seufzte. Hatte ich vielleicht zu voreilig reagiert? Hätten wir miteinander reden sollen?
Nur in einen Bademantel gehüllt, kam ich ins Wohnzimmer zurück. Meine nackten Sohlen erzeugten auf dem Laminat keinen Laut, trotzdem bemerkte Maurice meine Anwesenheit.
Er kam auf die Beine. „Es tut mir leid.“
Er erwiderte meinen hilflosen Blick und schließlich lagen wir uns in den Armen.
Noch immer reagierte ich sensibel auf seine Nähe. Als sich meine Wange an seiner rieb, durchströmten heiße Wellen meinen Körper. Wie kleine Stromstöße jagten sie durch meinen Leib.
Mir wurde die Kraft genommen. Meine Knie sackten weg. Er packte mich fest und wir landeten im Schlafzimmer auf dem Bett.
Seine kühlen Lippen liebkosten meinen Mund. Ich öffnete ihn einen Spalt und gewährte seiner Zunge Einlass. Weitere heiße Wellen erfassten mich. Maurice löste meinen Bademantel und glitt über meinen Körper. Ich stöhnte benommen. Obwohl er bekleidet war, spürte ich ihn deutlicher als je zuvor. Er nahm Besitz von mir und ich ließ es zu. Seine mentale Anwesenheit reichte aus, um die ersehnte Befriedigung zu erlangen. Umso erstaunter war ich, als er mit sehr menschlichen Zügen über meinen Körper strich, ihn streichelte, als würde es ihn erregen.
Ich wusste, dass er dabei nichts empfand. Das Einzige, was seinen toten Körper in Wallungen brachte, war frisches Blut.
Trotzdem schenkte er mir die Aufmerksamkeit, die ich ersehnte. Seine Gedanken waren in meinem Kopf. Er steuerte mich und meine Hormone. Er wurde Teil meines Nervensystems, über das ich die Kontrolle verlor. In seiner Gewalt waren Raum und Zeit nebensächlich. In seinen Armen erlebte ich Höhepunkte der besonderen Art.
Sie kamen schnell und waren nicht lenkbar. Sie tauchten mich in einen intensiven Rausch, der mich lähmte, gegen den ich mich nicht wehren konnte.
Wenn ich stöhnend neben ihm lag und ejakulierte, war es das Ergebnis seiner geistigen Stimulation.
An diesem Abend gab er sich außerordentliche Mühe. Vielleicht lag es daran, dass wir uns lange nicht gesehen hatten. Wahrscheinlich war die aufgestaute Sehnsucht Grund dafür, dass Maurice sein Verhalten änderte.
Er glitt mit den Händen über meine Seiten. Seine Zunge wanderte an meinen Leisten abwärts, bis er meine Härte mit seinen Lippen umschloss. Der Höhepunkt erfasste meinen ganzen Körper.
Während der ergreifenden Erlösung nahm ich nichts wahr. Erst, als ich Maurice dicht vor mir erblickte.
Seine Lider flackerten wild, seine Stimme vibrierte.
„Das hat mir gefehlt, Jonathan.“ Er haderte mit sich. Immer wieder fixierte er meinen nackten Leib in seiner ganzen Pracht. Mir entging nicht, dass sich sein Mund dabei öffnete und schloss, schnell und unkontrolliert. Ich erkannte seine spitzen Eckzähne, die mir länger vorkamen, als ich in Erinnerung hatte.
Unweigerlich rückte ich von ihm ab. Und er von mir.
Wir sprachen es nicht aus, doch dachten wir an dasselbe.
Ich schloss den Bademantel und verbarg meinen erhitzten Körper.
Maurice erhob sich so schnell, dass es unnatürlich wirkte.
„Ich muss noch einmal fort“, stammelte er.
Es war nachts. Seine wache Phase hatte begonnen. Die Zeit, in der er jagte und aß. Mein rauschendes Blut hatte ihn hungrig gemacht. Das musste er mir nicht erklären.
„Du hast keine feste Bleibe?“
Er schüttelte den Kopf. Ich hatte es vermutet. Er sah nicht so aus, als ob er tagsüber in einem feinen Hotel logierte. Wie selbstverständlich deutete ich zur Balkontür.
„Du kannst jederzeit wiederkommen.“
Ich fand keinen Schlaf, was in Anbetracht der Ereignisse kein Wunder war. Die Spannung zwischen Eliot und mir trübte die Stimmung. Zudem war auch noch Maurice aufgetaucht. Ohne Vorwarnung und mysteriöser als zuvor.
Augenblicklich wurde mir erneut bewusst, wie verworren mein Liebesleben war. Ich wollte keinen von ihnen missen. Trotzdem brachten die Gefühle für sie Probleme mit sich.
Unruhig wälzte ich mich im Bett hin und her. Ich entsann mich, an die Zeit, in der ich Maurice kennengelernt hatte.
Heimtückisch und ungehobelt hatte er sich in mein Leben geschlichen, mich und meine Arbeit observiert und zu seinen Gunsten benutzt.
Mehr als einmal hatte ich ihn verflucht und gefürchtet, nicht nur, weil er das Museum bestahl und sich in meine Gefühlswelt schlich wie ein Parasit.
Er war anders. Er war kein Mensch. Wie ich nach und nach erfuhr, verbarg sich hinter der hübschen Fassade eine seltene Spezies.
Ich begann, ihn zu erforschen, von ihm zu lernen und über ihn zu staunen. Obwohl ich mich mit meinem Handeln in eine große Gefahr begab, lernte ich ebenfalls, ihn zu lieben.
Dass er Gefühle für mich entwickelte, kam unverhofft. Mit der Mission, seinen Ziehvater aus einer langen Ruhephase zu erwecken, geriet ich mehr als gewollt in seinen Fokus. Juan de Sangui-Juela, sein Beschützer und Erschaffer, befand sich als transformierter Falter, als präparierter „Trauermantel“, in meiner Obhut. Ich wusste nicht, welche Zeitbombe sich unter den Dächern des Museums verbarg. Das wurde mir erst bewusst, als sich Maurice mir anvertraute und mich in eine Welt entführte, die mich faszinierte und zugleich erschütterte.[Fußnote 1]
Er präsentierte mir eine Lebensform, von der ich, als Wissenschaftler, nie zu träumen gewagt hatte. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, sich darauf einzulassen.
Der Morgen graute, als er zurück in das Schlafzimmer schlich und sich leise entkleidete. Er wirkte entkräftet und sank neben mir auf das Bett, wo er in eine leblose Starre verfiel. Ich war wach, bewahrte das Schweigen.
Schemenhaft erkannte ich seinen wachsweißen Körper und fragte mich, ob seine Rückkehr eine gute Entscheidung gewesen war.
†
Es war kein Traum gewesen. Am Morgen lag Maurice noch neben mir. Sein Anblick erschütterte mich nicht. Ich hatte gelernt, ihn zu ertragen. Wenn er schlief, glich sein Antlitz einer Totenfratze. Seine Haut wurde aschgrau. Seine Augenfarbe verblasste ebenso wie sein kirschroter Mund. In seiner Ruhephase war er nichts weiter als ein lebloser Körper. Mit halb geöffneten Lidern lag er da und stierte an die Decke. Die Atmung, die er in seiner Wachphase tatsächlich besaß, setzte aus.
Doch eins war mir bewusst: Sein Geist erlosch nie.
Ein neuer Tag brach an, an dem ich die Vorhänge des Schlafzimmers nicht zur Seite schob. Das Tageslicht war Gift für seinen Körper. Es verbrannte ihn.
Ich wusste nicht, was mich in nächster Zeit erwartete. Dass Maurice‘ Rückkehr nicht ohne Grund erfolgt war, lag nahe.
Auch die Geschichte mit Eliot war nicht aus der Welt. Unter der Dusche kamen mir unzählige Gedanken, die sich mit dem Wasser nicht wegspülen ließen.
Kaum wusch ich mich zwischen den Beinen, dachte ich an Maurice‘ Liebkosungen. Ein sanfter Schmerz setzte ein, während ich mein Geschlecht reinigte. An der Außenseite meines Gliedes befand sich ein Kratzer. Hatte Maurice in seiner Hingabe nicht daran gedacht, dass seine spitzen Zähne Blessuren hinterlassen konnten?
Im Museum angekommen, lichtete sich mein Gedankenflug. Andere Dinge waren plötzlich wichtiger. Ich vergaß die aktuellen Ereignisse privater Art und konzentrierte mich auf die Arbeit. Wieder einmal sollte es eine gesonderte Ausstellung geben und die erforderte Vorbereitungen.
Ich hielt die Anordnung der Exponate bildlich fest, indem ich Aufnahmen mit einer Kamera machte. Hier und da packte ich die schweren Podeste an den eckigen Kanten und brachte die Ausstellungsstücke in eine andere Position.
Mehrere Monate hatten die Vorarbeiten für das Tundraprojekt gedauert. Inzwischen waren es nur noch wenige Tage, bis zur Eröffnung der Sonderausstellung.
Dementsprechend gereizt reagierte ich, als William meine sorgfältige Betrachtung störte.
„John? Eliot ist da. Er möchte dich sprechen.“
„Ich kann jetzt nicht.“ War es nicht offensichtlich, dass ich beschäftigt war? Ich drehte mich nicht einmal um.
„Er sagt, es sei dringend.“
Mir entwich ein leiser Seufzer. Bei der Arbeit gestört zu werden, war eine Sache. Den Mann, den man liebte, abzuweisen, eine andere.
Vielleicht hätte ich dezent darauf hinweisen sollen, dass das Museum zwar auch sonntags geöffnet hatte, der Direktor allerdings für Fragen nicht zur Verfügung stand?
Es war ein Fehler, dass ich mich umdrehte. Kaum erfasste ich seine Silhouette im Eingangsbereich, wurde ich schwach.
Mit langsamen Schritten verließ ich den Ausstellungsraum, der für Besucher geschlossen war und trat in die Empfangshalle. Ich bemerkte Eliots fragenden Blick. Doch ebenso huschte ein Lächeln über sein Gesicht.
„Du hättest gestern nicht gehen sollen“, begann er. Seine Stimme war gedämpft.
„Für mich gab es nichts mehr zu besprechen.“
Meine Aussage klang kühl.
„Warum sagst du das?“ Mit seinen schlanken Händen griff er nach mir. Flehend sah er mich an. „Bitte, lass uns noch einmal darüber reden.“
Ich starrte auf die Kamera, die zwischen meinen Fingern ruhte. Reden musste ich ohnehin mit ihm. Seit der vergangenen Nacht hatte sich einiges geändert.
„Heute Abend um 20 Uhr?“ Ich wusste, dass Claudia erst am Montag zurückkam. Er atmete erleichtert aus und nickte.
Kaum war er gegangen, bemerkte ich William neben mir.
„Gibt es Probleme?“
Wie gewohnt machte er sich Sorgen um mein Seelenheil. Er war mein treuer Wegbegleiter und das nicht nur beruflich. Als ich in seine fragenden Augen blickte, mahnte ich mich zum wiederholten Male, dass ich ihn noch nicht eingeweiht hatte. Damals, vor einem Jahr, als die Katastrophe geschehen war, als Dinge passiert waren, die wir uns nicht erklären konnten, als mir bewusst wurde, dass die Evolution eigenartige Wege beschritten hatte; Wege, die der Menschheit gefährlich werden konnten, hätte ich ihm alles erzählen sollen.
Bis jetzt hatte ich es nicht getan, und es war oftmals von Vorteil, dass er sich mit wenigen Informationen zufriedengab. Er vertraute mir.
„Maurice ist wieder da.“
Aus meinem Mund klangen die Worte tatsächlich unglaublich. William blieb zuerst die Luft weg. Das konnte ich sogar nachvollziehen. Welches Chaos Maurice und seine Sippe damals zurückgelassen hatten, war auch vor William nicht verborgen geblieben.
„Dann kann ich verstehen, dass Eliot besorgt ist.“
Ich lächelte müde. Dass Eliot noch nichts über die Rückkehr meines Nachtschwärmers wusste, behielt ich für mich.
Die Dämmerung setzte verlangsamt ein. Ich saß am Bett und wartete darauf, dass Maurice erwachte. Da es Sommer war, blieb es lange hell. Ich schielte zur Uhr. Zu meiner Verabredung mit Eliot wollte ich mich nicht verspäten. Noch immer schimmerte ein Lichtstrahl durch die zugezogenen Vorhänge. Ich hauchte einen Kuss auf Maurice‘ Wange. Einen Toten zu küssen kostete mich keine Überwindung mehr.
„Ich muss los ...“
Vielleicht hörte er mich, obgleich er nicht erwachte. Ich stand auf und warf einen letzten Blick auf meinen mysteriösen Freund. Ich bemerkte, dass er seinen Siegelring nicht mehr trug.
Diesmal gab es keine Schnittchen und auch keinen Champagner. Stattdessen saßen wir nebeneinander auf dem Sofa, wie zwei Jungen, die was ausgefressen hatten. Ich war froh, dass Eliot zuerst das Wort ergriff.
„Ich habe dir etwas mitzuteilen.“
Oh, ja, das hatte ich ebenfalls. Dennoch ließ ich ihm den Vortritt.
„Es gibt triftige Gründe dafür, dass alles so gekommen ist. Auch wenn es wie eine Ausrede klingt, aber ich kann nichts dafür.“
Seine Verzweiflung war spürbar und ich glaubte ihm. Er war ein verlässlicher Mensch, der sich nie etwas zuschulden kommen ließ. Was warf ihn derart aus der Bahn?
„Aber seit diesem Vorfall ...“
Er stoppte und schüttelte den Kopf. Ich wusste, worauf er hinauswollte. Vor einem Jahr wäre er beinahe gestorben. Um ein Haar wäre er von mir gegangen, und das in meinen Armen. Deutlich hatte ich das Bild vor Augen. Wann immer ich daran zurückdachte, erschauderte es mich. Aus einer Halswunde hatte er mehr Blut verloren, als ein gesunder Mann normalerweise verkraften konnte. In einem Krankenhaus hatte man ihn wieder „zusammengeflickt“. Eliot war stark gewesen. Er hatte den Kampf mit dem Tod gewonnen, doch um welchen Preis?
„Ich bin einfach nicht mehr ich selbst.“
Er drehte seinen Kopf und wir blickten uns an. Ich konnte zuerst nichts erwidern und schluckte hörbar.
„Es tut mir leid, Eliot ... Ich ...“
Sein Blick ging mir durch Mark und Bein. Eine ganze Weile starrten wir uns an, bis er zu zittern begann. Er atmete schwer und viel zu schnell. Ohne Vorwarnung griff er nach meinem Körper. Ich erschrak, doch wehrte ich mich nicht. Er küsste mich fordernd, wild. Schließlich zog er mich vom Sofa. Nicht zärtlich, sondern hart und unkontrolliert. Vor dem Sofa glitt ich auf den Boden. Eliot drehte mich herum und schob meinen Körper auf die Sitzpolster.
Er fasste nach meiner Kleidung. In Windeseile hatte er den Gürtel der Hose gelöst und sie von den Hüften geschoben. Ich ächzte und wagte nicht, seine Handlung zu unterbrechen.
Er öffnete seine Hose und presste sich von hinten an mich. Mit feuchten Fingern bereitete er mich vor. Eher achtlos, als sensibel.
Eine stramme Härte drückte sich gegen meinen Spalt. Ich harrte aus und ließ es geschehen. Zerreißend zwängte er sich in mich. Treibende Stöße folgten.
Wie ein Tier vollzog er den Akt. Er stöhnte und krallte sich an mich.
Der anfängliche Schmerz ebbte ab und ich spürte Lust. Ich war auf das Sofa gedrückt und schrie in die Kissen.
Viel zu schnell war alles vorbei.
Eliot löste sich keuchend. Dann setzte eine sonderbare Stille ein.
Als ich mich umdrehte, wich er meinem Blick aus. Er zitterte am ganzen Körper. Er war nervös, seine Bewegungen fahrig. Mit hektischen Fingern schloss er seine Hose.
„Oh, John ...“ Er jammerte und drehte sich dem Fenster zu. Ich registrierte, wie er sich die Hand vor die Augen hielt. „Bitte, verzeih mir ... Bitte ... Wie konnte das passieren?“
Er schämte sich sichtlich.
Ich war hingegen eher überrascht, als schockiert. Es schlich sich sogar ein Lächeln auf mein Gesicht.
„Das ist absolut in Ordnung, Eliot.“ Ich schloss meine Hose. Diesmal benutzte ich kein Taschentuch, um die feuchten Spuren unserer Kopulation zu beseitigen. Ich wollte sie genießen, solange es ging.
Da Eliot nichts erwiderte, richtete ich mich auf. Meine Knie waren weich. Mein Herz klopfte viel zu schnell.
„Ich hätte das von dir bloß nie erwartet.“
Da drehte er sich um. „Ja, denkst du, ich?“
Sein Blick war verstört. Er war entsetzt über sich. Zu Recht? Obwohl wir uns in den vergangenen Monaten näher gekommen waren, hatten wir gewisse Grenzen nie überschritten. Eliot war nicht schwul. Da war ich mir sicher. Mit mir lebte er lediglich seine bisexuellen Phantasien aus. Ich hatte immer angenommen, dass Analsex mit Männern nicht zu seinen Vorlieben zählte. An diesem Abend wurde ich eines Besseren belehrt.
„Was ist bloß in mich gefahren?“
„Also ehrlich gesagt ...“ Ich war noch immer bewegt. „Mir hat es gefallen.“
Meine Aussage besänftigte ihn nicht.
„Ich glaube, wir missverstehen uns. Ich spreche nicht von dem Sex, den ich zugegebenermaßen in dieser Form noch nie erlebt habe. Vielmehr ist es die Art und Weise, wie ich mich dir gegenüber verhalten habe.“
Ich hörte ihm still zu.
„Wie ich deinen Körper benutzt habe, war nicht meine Absicht.“
„Nun ...“ Ich machte wenige Schritte durch den Raum. In diesem Moment hätte ich einen Drink gebrauchen können.
„Möchtest du auf den Schreck einen Cognac?“
Ich starrte ihn ungläubig an. War es Zufall, dass er meine Gedanken erahnte?
„Äh, ja ... Ein Cognac wäre nicht schlecht.“
Er eilte zur Vitrine, entnahm ihr ein Glas und die Karaffe. Seine Finger zitterten, als er das Glas füllte.
„Du nimmst nichts?“
„Nein, nein ...“ Er schüttelte den Kopf. „Ich vertrage das nicht mehr so gut.“ Selten hatte ich ihn so planlos erlebt.
Dann stand er vor mir, peinlich berührt.
Ich nahm das Glas an mich und leerte es in einem Zug. Das war wirklich nötig gewesen. Das feurige Gefühl in meiner Kehle verschaffte mir Klarheit.
„Bitte, lass uns hinsetzen.“ Ich deutete zum Sofa.
Eliot folgte der Geste. Er beruhigte sich nur zögerlich.
Es lag an mir, das Gespräch wieder aufzunehmen. Es war nicht leicht, die angemessenen Worte zu finden. Also kam ich auf den Anfang unseres Dialoges zurück:
„Ich nehme an, deine Veränderungen betreffen auch Claudia?“
Er nickte still.
„Na, wenn du bei ihr ebenso flott bei der Sache bist ...“ Ich stieß einen leisen Pfiff aus. „Dann ist es verständlich, dass sie schwanger ist.“
Aus traurigen Augen sah er mich an.
„Aber das ist doch gar nicht mein Stil!“ Empörung klang in seiner Stimme mit. Ich musste ihm recht geben. Er war ein ruhiger Zeitgenosse. Ein Genießer. Er legte Wert auf Romantik, auf die Kunst der Verführung. Deswegen mochten ihn die Frauen und sicher auch Claudia.
„Was sagt sie denn dazu?“
Jetzt lachte er aufgesetzt. „Sie? Sie ist hin und weg ... Eliot, sagt sie, ich wusste gar nicht, welches Feuer in dir steckt ...“
Ich lächelte. Mir hatte das Feuer auch gefallen. Noch immer verspürte ich eine wohltuende Wärme in meinem Inneren. Dennoch entging mir nicht, dass Eliot mit der Entwicklung unzufrieden war. Ich wollte ihn unbedingt trösten.
„Es kommt häufiger vor, dass man seine Vorlieben ändert.“ Ich dachte daran, dass er die Leidenschaft für Männer auch erst seit kurzer Zeit auslebte. „Gewisse Dinge kann man im fortgeschrittenen Alter besser genießen. Das ist doch nicht tragisch.“
Er schüttelte den Kopf.
„Du verstehst mich immer noch nicht.“ Er holte tief Luft und versuchte, sich zu erklären: „Es bricht aus mir heraus. Es überkommt mich. Ich kann es nicht steuern.“
Aus seinem Mund klang es wie eine unglaubliche Sensation.
„Ich habe ein immenses Verlangen in mir und fühle mich wie ein Tier, das sich erst wieder beruhigt, hat es seinen Hunger gestillt.“
Er dämpfte seine Stimme, als sei es ihm unangenehm, darüber zu reden.
„Es passiert nicht nur beim Sex. Auch beim Essen ...“
Ich staunte und ließ ihn weiterschildern.
„Ich habe ein unheimliches Verlangen nach Fleisch.“ Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. „Hatte ich sonst nie gehabt.“
Ich entsann mich, dass er die vegetarische Küche bevorzugte, obgleich er die Köstlichkeit eines gut zubereiteten Steaks zu schätzen wusste.
„Auch diese Geschmäcker ändern sich“, fügte ich hinzu.
„Ich mag es am liebsten English“, gestand er. „Blutig, fast roh ... Claudia lacht darüber, aber ich finde das überhaupt nicht normal.“
Bei diesem Geständnis blieb mir die Sprache weg. Gezwungenermaßen dachte ich an ...
„Ich komme morgens kaum noch aus dem Bett. Das Tageslicht empfinde ich als störend und erst, wenn es dämmert, kann ich meine Arbeit in der Praxis beginnen.“
Er stoppte. Da ich nichts sagte, fuhr er fort:
„Ich habe die Termine inzwischen auf die Abendstunden gelegt, damit ich überhaupt die erforderte Leistung erbringen kann. Obwohl ... An Energie fehlt es mir dann nicht. Ich fühle mich stark, gesund und ... potent.“
Zwischenzeitig war mein Mund sprachlos geöffnet. Ich konnte ihn nur anstarren. Meinen Eliot. Was er mir berichtete, war unglaublich.
„Potent“, wiederholte ich geistesabwesend. Diese Aussage gefiel mir am meisten. Gern wollte ich Eliots neu entdeckte Potenz am eigenen Leib erleben. Die erste Kostprobe davon war delikat gewesen.
Vielleicht hätte ich staunen und lachen sollen, denn nach seinen Erzählungen wäre so eine Reaktion verständlich gewesen.
Trotzdem machte sich ein anderes Empfinden breit. Es verstärkte sich, als er mehr und mehr berichtete, was sich an ihm geändert hatte.
„Du meinst, das hat alles mit dem Vorfall zu tun?“
„Ich bin mir absolut sicher.“
Was für eine Nachricht.
„Zuerst habe ich mich dagegen gewehrt, aber inzwischen kann ich meinen Bedürfnissen nicht mehr nachgeben.“
Ich konnte nicht mehr sitzen und stand auf.
Was bedeutete das? Ehe ich eine Erklärung fand, kam Eliot mir zuvor: „Ich habe meine Blutzellen untersucht; bei mir in der Praxis. Sie sind durch die Bank weg alle entartet.“
Ich sah meinen Freund schockiert an. „Oh, mein Gott, Eliot!“
Er schüttelte den Kopf. „Es ist keine uns bekannte Zellveränderung. Kein Blutkrebs oder dergleichen.“
„Sondern?“
„Die Zellen sind kräftiger und sterben langsamer ab. Sie haben einen dickeren Zellkern, arbeiten auf Hochtouren, ohne viel Energie zu verbrauchen. Rote sowie weiße Blutkörperchen sind äußerst robust geworden.“
„Und das bedeutet?“ Ich mochte meine Frage kaum stellen, da ich, als Biologe, sehr wohl erahnte, was das hieß. Doch Eliot, als Arzt, besaß vielleicht bessere Kenntnisse über diese Art von Mutation.
„Ich bin weniger anfällig für Krankheiten. Die Zellen altern extrem langsam, das heißt, mein Körper verändert sich ebenfalls kaum. Das Plasma in den Zellen ist reduziert. Ich benötige weniger Energie, um den Stoffwechsel zu regulieren. Die neuen Zellen arbeiten wie ein Kraftwerk, das schwerlich zerstörbar ist.“
Betroffenes Schweigen. Ich musste mich wieder setzen. Diese Informationen waren sensationell.
„Bitte halte mich nicht für verrückt“, begann ich mit vibrierender Stimme, „aber wenn das alles mit dem Biss zusammenhängt, muss ich annehmen, dass Juans Körperflüssigkeit in deinen Kreislauf gelangt ist. Seine Zellen haben sich vermehrt, sie breiten sich aus ... Sie haben dich verändert.“
„So wird es sein.“ Er erwiderte meinen Blick. „Eine andere Erklärung habe ich auch nicht.“
Das Lachen war mir vergangen. Inzwischen jagten kalte und heiße Schauer meinen Rücken entlang. Was Eliot mir offenbarte und welche Schlüsse wir daraus zogen, brachte eine schlimme Befürchtung mit sich.
„Kann es sein, dass du dich komplett veränderst?“
Er zuckte mit den Schultern.
„Möglich. Vielleicht?“ Er fuhr sich durch das schwarze Haar, das bei all der Aufregung an Form verloren hatte. Sein Pony fiel ihm ins Gesicht. Er lächelte sanft, irgendwie gefasst, dabei mussten ihn die Vorgänge in seinem Körper ängstigen.
„Hab zuvor von keinem Fall dieser Art gehört.“
Ich noch weniger. Dass es sie gab, die Untoten, das hatten wir beide inzwischen begriffen und am eigenen Leibe erlebt. Dass Menschen infolge eines tödlichen Bisses vollständig mutieren konnten, das hatte mich Maurice gelehrt. Es war möglich. Nur durch Juans Zutun konnte Maurice einer von ihnen werden. Aber das Vorgehen seines Ziehvaters war gewollt gewesen. In fester Absicht hatte er Maurice zu sich geholt.
Und Eliot? Er sollte sterben. Für Juan war er nichts weiter als ein Opfer gewesen. Ein Lieferant, der ihm energiereiches Blut schenken sollte. Hätten Maurice und ich die Attacke nicht unterbrochen, wäre Eliot am Blutverlust gestorben.
Dass er den Angriff überlebte, war nicht geplant gewesen.
Nun zirkulierten Juans Zellen in Eliots Körper und veränderten ihn. Wer konnte uns sagen, wie weit diese Veränderung gehen würde? Wer konnte uns darüber aufklären, was Eliot zu befürchten hatte?
Mir kam nur eine Antwort in den Sinn. Es kam der passende Moment, um meine Neuigkeit loszuwerden.
„Maurice ... Er ist wieder da.“
Zu meinem Erstaunen reagierte Eliot gelassen. „Ich weiß.“
Meine Lider schlossen sich betroffen. „Hast du ihn etwa gespürt?“
„Meine Sinne sind empfindlicher, ja. Ich habe geahnt, was in dir vorgeht.“
„Mein Gott!“ Die Ereignisse überschlugen sich. „Was machen wir bloß?“
Er war ebenso ratlos, wie ich. „Ich weiß es nicht.“
Obwohl unser Gespräch alles andere als erheiternd war, sondern eher verstörend und nervenaufreibend, war ich froh, dass wir offen miteinander reden konnten. Eine vertraute Aussprache war die beste Basis für eine feste Freundschaft. „Bitte bleib hier ...“
Er umarmte mich wärmend. Ohne zu zögern, erwiderte ich den Griff. An eine Trennung wollte ich nicht mehr denken.
„Bleib bei mir heute Nacht.“
Seine Bitte klang verlockend. Gern hätte ich ihm seinen Wunsch erfüllt. Nie zuvor hatten wir eine Nacht miteinander verlebt. Nach jedem sinnlichen Abend war ich nach Hause gefahren. Nie wollten wir Claudias Toleranz ausreizen noch der Außenwelt schmutzigen Gesprächsstoff liefern.
„Das geht nicht, Eliot.“
Ich dachte an Maurice, der inzwischen sicher erwacht war und wusste, wo ich mich aufhielt. Ich musste mit ihm reden, jetzt erst recht.
„Okay.“ Eliot löste sich, doch er sah mitgenommen aus. Ungern ließ ich ihn an diesem Abend allein.
Wie erwartet, war Maurice wach, als ich in die Wohnung trat. Seit seiner Rückkehr hatte sich sein Geruch in allen Räumen ausgebreitet. Ich konnte ihn mittlerweile ertragen. Je länger ich ihn inhalierte, desto angenehmer wirkte er auf mich. Ich war empfänglich für ihn. Mein Körper reagierte auf seine Reize. Ich war ihm ausgeliefert.
Umso unangenehmer war es, vor ihn zu treten, in der Annahme, dass er wusste, woher ich kam.
Ich hatte es mir nie ausgesucht, zwei Männer zu lieben. Damit umzugehen war kein leichter Akt.
„Hast du lange gewartet?“
Langsam kam ich näher. Er saß bei vollkommener Dunkelheit im Wohnbereich und starrte mich an. Obwohl kein Licht brannte, sah ich den Glanz seiner Augen.
„Ich bin erstaunt, dass du überhaupt den Weg zurück nach Hause gefunden hast.“
Seine Bemerkung klang bissig und kühl. Irgendwie unpassend, denn ich wusste, dass er die Bindung zu Eliot nicht achtlos übersah. Mir deswegen Vorwürfe zu machen, war falsch.
„Du warst nicht mehr da. Über ein Jahr lang warst du fort und ich dachte, du kommst nie mehr zurück.“ Ich erklärte mich, obwohl es mir eigentlich widerstrebte, mich für die Liebe zu Eliot zu rechtfertigen. Aber ich wollte Maurice nicht wieder verlieren, nicht kränken. Nicht noch einmal wollte ich Probleme mit ihm wälzen. Er war doch erst zurückgekommen.
Er nahm mich bei der Hand. Seine Haut war kühl und bei seiner Berührung erschauderte ich wohlig.
„Entschuldige, Jonathan“, erwiderte er. Sein Haupt war geneigt, seine Worte ehrlich. „Du hast recht und es liegt mir fern, dir Vorschriften zu machen.“
Er seufzte, dann sah er mich wieder an.
„Ich bin einfach schrecklich müde.“
Mit der freien Hand strich ich über seinen Rücken. Mir war bewusst, dass er dabei nichts empfand, trotzdem versuchte ich, ihn wie einen Menschen zu behandeln. Und er verhielt sich so menschlich, wie es nur möglich war. Er beugte sich vor und lehnte gegen meine Hüften.
„Deine Reise muss anstrengend gewesen sein.“
„Ja ...“
Mehr sagte er nicht und ich beließ es dabei. Dass er entkräftet war, musste er mir nicht erklären. Es war ihm anzusehen, obwohl er ein hübsches Antlitz besaß. Trotz seines übernatürlichen Alters glich er noch immer dem jungen Mann, der er einmal gewesen war.
Aber die Schatten um seine Augen waren größer geworden. Die Ernsthaftigkeit in seinem Blick machte mich besorgt.
Dennoch fragte ich nicht nach. Wenn er etwas zu erzählen hatte, würde er es tun.
„Heute Nachmittag war ich beim Schlachter.“ Ich löste mich und marschierte zum Kühlschrank. Dort, in einer Plastikschale mit Deckel, hatte ich blutige Innereien gelagert. „Der Metzgermeister hat mich zwar merkwürdig angesehen, als ich nach Schlachtabfällen fragte, doch ich bekam sie. Sogar umsonst.“
Ich drehte mich um. Maurice stand hinter mir. Ich konnte ihm die Schale unmittelbar aushändigen.
Er nahm sie entgegen und stierte darauf.
„Es ist ganz frisch.“
Neugierig musterte ich meinen Freund. Seine Begeisterung hielt sich in Grenzen.
„Das ist ... lieb von dir ...“
Seine Finger krallten sich an das Gefäß, aber er streckte es von sich, anstatt es zu öffnen. Ich hatte angenommen, dass er Hunger haben musste. „Du magst es nicht?“ Enttäuschung machte sich breit. Ich wollte ihm eigentlich eine Freude machen; ihm signalisieren, dass ich seine Lebensart akzeptierte und damit umgehen konnte.
„Momentan nicht ...“
Ich stellte die Schale zurück in den Kühlschrank. Dass er sich fortwährend bedeckt hielt, gefiel mir nicht. Konnten wir nicht über alles reden? In der Vergangenheit hatte er mir einiges anvertraut, Unglaubliches geschildert.
Warum gab er sich plötzlich wortkarg?
Ich änderte meine Meinung. Mit einem Mal wollte ich nicht mehr warten, bis er sich mir öffnete, und forderte Informationen.
„Also raus mit der Sprache! Was ist vorgefallen? Warum bist du zurückgekehrt?“
Er lächelte verstört, als wäre meine Frage überflüssig.
„Wegen dir, Jonathan.“
Es schmeichelte mir nicht.
„Das wird nicht der einzige Grund gewesen sein. Du hattest dich für Juan entschieden und bist zurück nach Spanien gegangen. Und plötzlich, nach über einem Jahr, fällt dir ein, dass du mich vermisst?“ Ich schüttelte den Kopf. „Das kann ich nicht glauben.“
Wir standen im Raum und sahen uns an. Auf einmal war er mir fremd. Irgendetwas war anders, als damals. Obgleich ich tiefe Gefühle für ihn hegte, spürte ich, dass er nicht mehr derselbe Maurice war, den ich kennen und lieben gelernt hatte.
„Ich habe mir Mühe gegeben“, beteuerte er. War es ihm jetzt möglich, zu berichten, was vorgefallen war? „Ich habe versucht, Juan ein treuer Gefährte zu sein.“
Sein Kopf neigte sich. „Ich wollte dich wirklich vergessen, Jonathan. Doch es ist mir nicht geglückt und Juan hat das bemerkt.“ Er spazierte durch das Zimmer und erzählte weiter:
„Er hat es eine lange Zeit geduldet. Er hat mich bestärkt und mir immer wieder bewiesen, dass er mich liebt.“ Maurice stand inzwischen vor dem Fenster und stierte in die Dunkelheit. „Mit Sicherheit hätte er mich nicht fallen gelassen, doch mein Zustand blieb auch vor den anderen nicht verborgen.“
Ich hörte Zorn in seiner Stimme und dachte an Ramira, Juans Schwester. Sie und andere des Clans De Sangui-Juela hatten immer ein besonderes Augenmerk auf Maurice gelegt.
Ursprünglich war er kein Untoter gewesen. Er war herangezüchtet und lediglich der Ziehsohn ihres Anführers.
Ramira bangte um das Wohlergehen ihres Bruders. Sie verurteilte Maurice, weil er wie ein Bastard in ihren geheimen Bund gedrungen war und dem Stärksten von ihnen Herz und Verstand geraubt hatte.
Juan de Sangui-Juela besaß keine leiblichen Kinder. Es gab auch keine Frau an seiner Seite, die ihm Nachkommen schenkte.
Da war nur der spanische Waisenjunge, der durch seine Barmherzigkeit eine neue Familie fand. Eine Familie, die nicht ohne Grund ein ehrfurchtvolles Ansehen genoss.
Mit der Adoption von Maurice besaß Juan nicht nur einen Sohn, sondern auch einen Geliebten, einen Weggefährten bis über den Tod hinaus. Während des Spanischen Bürgerkriegs wurde ein Großteil des Anwesens zerstört und Juan schwer verletzt.
Vermutlich wäre er für immer eingeschlafen. Wahrscheinlich hätte er resigniert und nicht weiter gekämpft, wäre der Junge nicht gewesen, der inzwischen zu einem hübschen Mann herangewachsen war.
Bevor sich Juan, vom Krieg gezeichnet, in eine jahrelange Ruhephase begab, schenkte er Maurice die Unsterblichkeit.
Ein Fluch oder ein Segen? Wie Maurice darüber dachte, wusste ich nicht.
Er wurde ein De Sangui-Juela, mit all den Grausamkeiten, die dazugehörten. Trotzdem blieb etwas Menschliches in seinem Gemüt.
Doch dass er kein ebenbürtiger Gefährte war, wurde ihm in schweren Zeiten bewusst.
„Der Ältestenrat hat beschlossen, mich aus dem Kreis auszuweisen.“
„Was?“ Betroffen hielt ich mir die Hand vor den Mund. Meine Augen weiteten sich erschrocken.
„Sie können mir nicht mehr trauen“, berichtete Maurice weiter. Er lächelte schadenfroh. „Was auch verständlich ist. Ich habe wichtige Informationen weitergegeben; an einen Menschen.“ Er drehte sich in meine Richtung. „An einen wundervollen Menschen, den ich nach wie vor liebe.“
Ich sah blutige Tränen in seinen Augen. Eine Reaktion, die zeigte, wie sehr ihm die Situation zusetzte.
„Es tut mir leid.“ Ich umarmte ihn sanft. „Was musst du durchgemacht haben?“
Augenblicklich ahnte ich, warum Maurice sich mit den Neuigkeiten bedeckt hielt. Verbannt zu werden war wohl die größte Schande, die einem Untoten widerfahren konnte. Nachfolgende Tatsachen ergaben sich von allein.
„Du musstest das Anwesen verlassen?“
„Ich darf mich in ganz Spanien nicht mehr aufhalten.“
„Meine Güte!“ Ich konnte nur den Kopf schütteln. „Wieso hat Juan das zugelassen? Er ist einer der Stärksten.“
„Gewiss.“ Maurice pflichtete mir bei. „Aber gegen einen Beschluss des Ältestenrates kann auch er nichts einwenden, ohne unglaubwürdig zu erscheinen. Er ist ein Anführer, der die Regeln unserer Vereinigung konsequent vertreten muss. Ihm blieb keine andere Wahl und zudem ...“
Er machte eine Pause, in der er sich mit den Fingern über die Lider wischte. Nahezu unbemerkt glitt seine Zunge anschließend über die blutigen Spuren an den Fingerspitzen.
„... ist er enttäuscht von mir. Dass ich meine Gefühle nicht mehr in den Griff bekomme, war offensichtlich.“ Seine Hand ballte sich zu einer zitternden Faust.
„Dafür kann man mich nur hassen.“
Er drehte sich wieder weg. Für einen Moment glaubte ich, er würde ohne weitere Worte auf den Balkon stürzen und mich verlassen. Es war spät. Normalerweise verbrachte er die Abendstunden im Freien. Nicht nur, um auf Nahrungssuche zu gehen. Er war ein Kind der Nacht, ein Träger des Schattens.
An diesem Abend war sein Hunger nebensächlich. Er hatte meine blutigen Innereien abgelehnt und es machte nicht den Anschein, als wollte ihn die Gier nach draußen treiben.
„Es muss für dich wie eine Notlösung aussehen, denn ich wusste wirklich nicht, wohin ich gehen sollte.“ Plötzlich wirbelte er herum. „Aber du musst mir glauben, John, in jeder Sekunde, die wir getrennt waren, habe ich mich nach dir gesehnt.“ Wieder umarmte er mich, dabei atmete er tief ein. „Ich wollte dich damals nicht verlassen, doch es ging nicht anders.“
„Das weiß ich ...“
Er brauchte sich nicht entschuldigen. Ohne ihn wäre Eliot mit Sicherheit gestorben und ich wahrscheinlich auch. Indem sich Maurice seinem Ziehvater hingab und mit ihm die Flucht zurück nach Spanien antrat, brachte er uns aus dem Fokus.
Ohne ihn hätte uns Juan aus Blutgier getötet. Und die anderen des Clans, die unsere Fährte verfolgt hatten, wären nicht zimperlich mit uns umgesprungen. Das stand außer Frage.
„Was wirst du nun tun?“, fragte ich leise. Ich hing noch immer in seinen Armen. Seine Nähe tat mir gut, das bemerkte ich seit seiner Rückkehr. Er gab mir Kraft.
In dem letzten Jahr war ich, trotz der Affäre mit Eliot, erneut in meinen Alltagstrott verfallen.
Arbeit und Schlafen, mehr gab es nicht. Die Treffen mit Eliot waren das einzige Highlight in meiner stupiden Einsamkeit.
In diesem Jahr hatte ich beinahe vergessen, wie Maurice auf mich wirkte, wie eine Berührung von ihm die Zellen in mir aktivierte.
Wir waren eine Symbiose, die nur zusammen einen Sinn ergab.
„Ich weiß es noch nicht“, antwortete er.
Seine Umarmung war so fest, dass mir die Luft ausblieb. Mit ganzer Kraft löste ich mich, um ihn anzusehen. „Du kannst vorerst hierbleiben.“
Er lächelte dankbar.
Irgendwann ging er. Obwohl ich spürte, dass er mit sich haderte, verließ er mich und entschwand über den Balkon in die laue Sommernacht.
Kraftlos sank ich anschließend ins Bett. Die Ereignisse des Tages bescherten mir einen tiefen Schlaf.
Allerdings wurde ich wach, als der Morgen graute und Maurice zurückkehrte.
Diesmal stieg er nicht leise und achtsam zu mir ins Bett. Im Gegenteil.
Mehrere Minuten stand er auf der Schwelle zum Schlafgemach und starrte auf meinen ruhenden Körper. Schließlich stolzierte er ums Bett herum und glitt auf die Matratze. Ich vernahm seinen lauten, lechzenden Atem und spürte seinen Körper dicht neben mir. Mit ganzer Kraft presste er sich an mich. Ehe ich signalisieren konnte, dass ich wach war, trübten sich meine Sinne. Ich war nicht in der Lage, mich zu wehren. Seine Anwesenheit betäubte mich. Ich schlief ein und bemerkte nicht mehr, wie sich seine Hände auf mich legten.
††
Der Vorfall war am Morgen fast vergessen. Ich war müde gewesen, meine Nerven überspannt. Und Maurice? Er hatte mir zu verstehen gegeben, dass er sich nach mir sehnte, mich begehrte.
Ich konnte ihm nicht verübeln, dass er den Drang hatte, mich zu berühren wie ein Tier.
Er war ein Untoter, kein Mensch. Bei ihm lief einiges anders ab, das bläute ich mir ein.
Das durfte ich nie missachten!
Die letzten Vorbereitungen für die Ausstellung liefen auf Hochtouren. Ich saß im Büro in der Bibliothek, da unterbrach mich William bei der Arbeit.
„John? Mrs. Parker ist hier und möchte dich sprechen.“
Ich stöhnte, dazu sah ich William über die Brille hinweg an.
„Muss das jetzt sein? Ich bin beschäftigt.“
„Das weiß ich, John, aber es ist dringend.“
Wenn William das behauptete, musste es stimmen. Mrs. Parker war eine nette, alte Dame, die ich ungern verärgern wollte.
Seit mehreren Jahren hatte sie unsere Jahreskarte abonniert. Sie fehlte bei keiner Sonderausstellung und war eine der spendablen Museumsbesucher.
„Schick Sie herein!“
William kam meiner Bitte nach. Ich überflog noch einmal das Konzept der Tundra-Ausstellung, wobei sich ein Wohlbefinden einstellte. Alles lief planmäßig.
„Oh, Dr. Lane, entschuldigen Sie die Störung!“
Ihre Stimme war schrill und eindringlich. Wie immer trug sie eines der Kostüme, die unweigerlich an die Mode des englischen Königshauses erinnerten.
Normalerweise kam sie nicht allein. Ein West Highland Terrier war ihr stetiger Begleiter. Aber an diesem Morgen führte sie keinen Hund mit sich. Stattdessen trug sie ein weißes Knäuel in den Armen, das von einem Baumwolltuch umwickelt war.
„Mrs. Parker, was kann ich für Sie tun?“
Ich kam auf die Beine und näherte mich neugierig.
„Mein Caesar ...“
Mehr sagte sie nicht. Das war auch nicht nötig. Ich erkannte ihren Hund, der in das Tuch gewickelt war.
„Ist er ...?“
„Ja!“ Sie schluchzte. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Im Hintergrund schloss William die Tür.
„Bitte, setzen Sie sich!“ Ich deutete auf den Stuhl. Unaufgefordert schenkte ich ihr ein Glas Wasser ein.
„Es tut mir leid, Mrs. Parker, wie ist es passiert? War Ihr Caesar alt?“ Sie schüttelte den Kopf. Ihren Hund ließ sie nicht los. Mit einer freien Hand trocknete sie die Tränen. Anschließend nahm sie einen Schluck Wasser.
„Er war nicht alt“, berichtete sie. „Krank eigentlich auch nicht.“
„Mhm.“ Ich überlegte. Erwartete sie von mir eine Diagnose? „Es ist wirklich traurig, Mrs. Parker, doch was kann ich tun? Ich bin kein Tierarzt.“
„Aber Biologe!“
Ja, da hatte sie recht. Ich schmunzelte.
„Man müsste Ihren Hund aufschneiden, um herauszufinden, was mit ihm geschehen ist. Das sollten Sie einem Tierpathologen überlassen.“
Sie schüttelte den Kopf. „Auf gar keinen Fall lasse ich fremde Hände an meinen Caesar.“ Sie presste das leblose Knäuel an sich. „Ich hatte eigentlich gedacht, dass Sie es für mich tun.“
„Ich?“ Das kam überraschend.
„Ja!“ Sie deutete um sich. In der Bibliothek waren einige Tierexponate ausgestellt. Sie standen in Vitrinen oder hingen an der Wand. Das eine oder andere Stück hatte ich tatsächlich angefertigt, doch das war vor langer Zeit gewesen.
„Sie müssen mir meinen Caesar präparieren“, befahl sie. „Dabei könnten Sie feststellen, was ihm fehlte.“
„Also, Mrs. Parker ...“ Ich holte tief Luft. Ihre Forderung klang unglaublich. „Es ehrt mich, dass Sie mir Ihren Caesar anvertrauen wollen, doch ich habe seit Jahren keine Tiere mehr präpariert, lediglich Insekten.“
„Ach, so etwas verlernt man nicht, oder?“
Sie lächelte mir zu, wobei eine letzte Träne ihre Wangen hinunter glitt. Ich gab nach. „Na schön, weil Sie es sind.“ Ich dachte an die Ausstellung, an die Turbulenzen mit Eliot, an den Untoten in meiner Wohnung. „Aber es wird einige Zeit dauern. Ich habe viel um die Ohren.“
Ich brachte den Hund vorübergehend im Keller unter. Dort, in einem Präparationszimmer, das seit Jahren nicht mehr genutzt wurde, konnte ich ihn kühl lagern.
Äußerlich erkannte ich keine Verletzungen an dem Tierkörper. Er war wohl genährt und befand sich in einem guten Zustand. Alles Weitere würde die Sektion ergeben, doch die musste warten.
Als ich den toten Hund in einer Metallschale in die Kühltruhe schob, bemerkte ich den kleinen Schnitt an meinem Finger. Aus einer schmalen Öffnung hatte es geblutet. Zwischenzeitlich war die Wunde geschlossen und glich nur noch einer roten Schramme.
Ich überlegte, doch konnte ich mich nicht entsinnen, wann und wo ich mich verletzt hatte.
Über ein Jahr hatte mich das „Projekt Tundra“ inzwischen begleitet und die Vollendung stand kurz bevor.
Wie immer, wenn ich eine Sonderausstellung plante, erfüllten mich die Arbeiten daran mit Stolz und ebenso mit Melancholie, wenn die letzten Griffe getätigt wurden.
Dementsprechend abgespannt kam ich abends nach Hause.