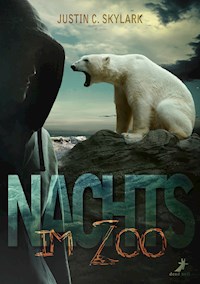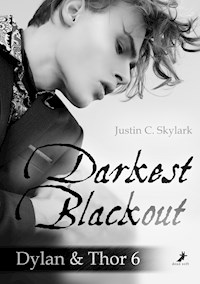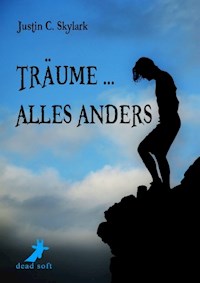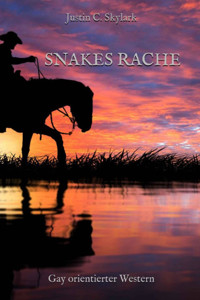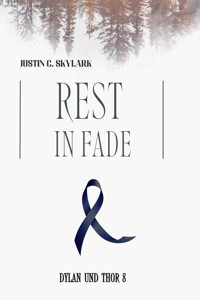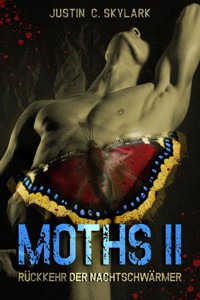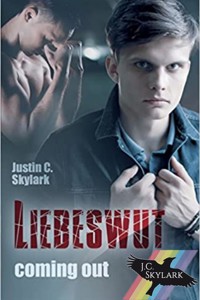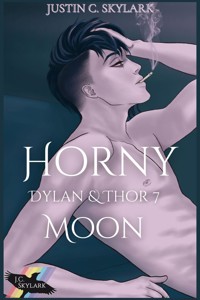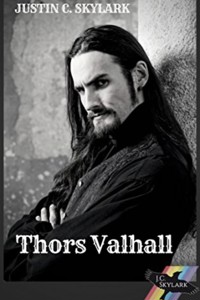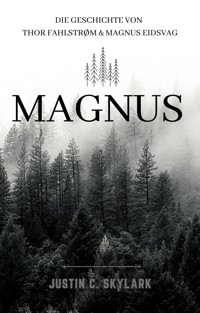5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spider Ravens Tage als erfolgreicher Musiker sind gezählt. Dennoch versucht der in die Jahre gekommene Sänger ein Comeback. Ein Herzinfarkt zwingt ihn in die Knie, ändert allerdings nichts an seiner selbstzerstörerischen Lebensweise und seinem Wunsch, wieder auf der Bühne zu stehen. Jesse, der Raven innig verehrt, muss zusehen, wie sich der Künstler weiterhin zugrunde richtet. Erst, als Ravens Herz buchstäblich stehenbleibt, geschehen plötzlich wundersame Dinge …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Spider Raven’s Heart
Impressum
©Justin C. Skylark, Schönkirchen 2021
https://www.jcskylark.de
Cover: Irene Repp
https://www.daylinart.webnode.com
Bildrechte: © christefme - 123rf.com;
© melazerg - 123rf.com;
© goldnetz - 123rf.com;
© Amandad - pixabay.com
1. Auflage
Independently published
Inspired by Summoning and Abbath
Dedicated to Silenius
Teil 1
Kapitel 1
Do you want to save my soul
You have to search for what they stole1
Gedankenversunken hatte ich am Schreibtisch gesessen, vertieft in Tabellen und Zahlen, grübelnd über Aufträge und Sachlagen, bis mich Conny rief und ich aufsehen musste. „Ein Gespräch für dich – aus Amerika.“ Mehr sagte sie nicht. Es reichte, um mich zu beunruhigen. Ich stand auf, nahm ihr das kabellose Telefon aus der Hand und drückte es gegen mein Ohr.
„Ja?“ Am anderen Ende hörte ich ein tiefes Durchatmen. Es rauschte in der Leitung.
„Hier ist Marc, sorry, dass ich störe …“
„Das macht nichts“, erwiderte ich. Die Anspannung in seiner Stimme war mir nicht entgangen. „Was gibt es denn?“
„Es geht um Raven.“ Eine kurze Pause entstand, ein Moment der Starre. „Er hatte einen Herzinfarkt und liegt im Krankenhaus.“
*
Ich legte das Telefon auf den Schreibtisch zurück. Stille ringsherum. Conny sah mich fragend an. Vermutlich war ich blass um die Nase, zumindest fühlte es sich an, als wäre mir sämtliches Blut gefroren. Meine Hände waren klamm und meine Beine steif.
„Ist etwas passiert?“, fragte sie. Ich blinzelte, erwiderte ihren Blick. Die Situation war unwirklich, surreal. Ich konnte kaum aussprechen, was geschehen war, denn es wirkte unecht.
„Raven hatte einen Herzanfall …“
Ihre Augen weiteten sich. „Oh, mein Gott …“ Sie legte eine Hand vor den Mund. Jeff, der ebenfalls im Büro saß, drehte sich wie von der Tarantel gestochen um und machte ein ebenso bestürztes Gesicht.
„Ist er … ?“
„Nein, aber es geht ihm schlecht. Er liegt auf der Intensivstation.“
Mehr musste ich nicht erklären und erst recht nicht rechtfertigen. Es lag auf der Hand, dass ich nach Amerika reisen würde. Ohne Umschweife. Ohne Diskussion.
„Reservier mir ein Flugticket nach Manhattan, so zeitig wie möglich“, forderte ich Conny auf.
Sie nickte und begab sich an ihren Schreibtisch. Derweilen fischte ich ein paar Unterlagen vom Arbeitsplatz, stopfte sie in meine Tasche und verließ das Büro. Wann ich wiederkommen würde, stand in den Sternen. Ich eilte den Flur entlang, grüßte Angestellte formell, wie an jedem Tag, gelangte in den Fahrstuhl und fuhr hinab, bis zur Tiefgarage, wo ich in meinen dunklen Jaguar stieg. Ohne Frage hatte ich einen Schock erlitten. Meine Finger zitterten, meine Knie waren weich und in meinem Magen hatte sich ein flaues Gefühl eingestellt. Ich wischte mir über das Gesicht und registrierte einen dünnen Schweißfilm. Mit quietschenden Reifen verließ ich die Garage.
*
Es musste so kommen, durchfuhr es meine Gedanken. Manchmal hatte ich regelrecht darauf gewartet; das ein oder andere Mal war ich sogar erstaunt darüber gewesen, dass nichts passiert war.
Ravens Leben war exzessiv. Und es gab niemanden, der ihn in die Schranken wies. Ich hatte die glorreiche Aufgabe, sein Berater zu sein und das tat ich gern, mit Leib und Seele. Doch war ich auch sein engster Vertrauter und das war der ausschlaggebende Punkt, ihn nicht zurechtzuweisen, mir nicht das Recht zu nehmen, ihn zu einem geordneten Lebensstil zu verhelfen, dabei hätte ich es tun müssen, mehr als einmal.
Stattdessen ließ ich ihn machen und hineinlaufen in die Misere. Ja, als ich nach Hause fuhr, machte ich mir Vorwürfe. Höchstwahrscheinlich hätte ich einiges verhindern können, denn ich war der einzige Mensch, den Raven an seiner Seite akzeptierte. Aber in seiner Nähe wagte ich keinen Widerspruch, aus Angst, etwas zu zerstören. Etwas, das zwischen uns lag wie eine zarte Bande, wie ein unausgesprochenes Gebet, das unsere Vertrautheit schützte.
Er trank zu viel, er rauchte zu viel. Vermutlich nahm er auch Drogen, ich hatte nie danach gefragt. Oftmals war er verlangsamt und mit den Gedanken weit fort. Ich hätte fragen sollen, aber die Angst vor der Wahrheit hatte mich zurückgehalten.
Nun war es zu spät.
Ich wusste nicht viel, nur, dass es ihn erwischt hatte und offensichtlich mit ganzer Wucht. Der Druck in meinem Magen wurde fester, als ich daran dachte, was vor mir lag: der Flug, der Weg ins Krankenhaus, die Gespräche mit den Ärzten, die Wahrheit, die ich nicht hören wollte.
*
Ich flog Businessclass, obwohl ich nicht geschäftlich unterwegs war. Das war Premiere. Auch war es das erste Mal, dass ich mich nicht auf ein Meeting freute und mir während des Fluges ein alkoholisches Getränk bestellte. Ich schlief sogar für wenige Minuten, aber nicht entspannt, eher von wirren Gedanken gequält. Als ich erwachte, da es aufgrund einer Schlechtwetterfront Turbulenzen gab, fühlte ich den Angstschweiß im Nacken und meinen nervösen Herzschlag.
Die Landung war mit Furcht verbunden, der Weg hinaus durch das Terminal belastend, und es freute mich nicht, dass ich sofort ein Taxi erwischte.
Auf direktem Weg zum Central-Hospital. Den Koffer in Schlepptau, die Gedanken verloren. Je näher wir der Klinik kamen, desto fester schnürte sich mir der Magen zu. Alle paar Minuten schielte ich auf mein Mobiltelefon, hatte Angst, dass ich einen Anruf oder eine Nachricht verpassen würde. Obwohl der Ton laut gestellt war, sah ich unentwegt aufs Display.
Niemand kontaktierte mich. War das ein gutes Zeichen? Immerhin bedeutete es, dass sich Ravens Zustand nicht verschlechtert hatte. Allerdings wusste ich nicht, wie schlecht es ihm tatsächlich ging.
Im Foyer der Klinik stoppte ich. Vor einem Jahr, als Raven die Gallenblase entfernt wurde, war ich das letzte Mal hier gewesen. Der behandelnde Arzt hatte schon damals eine Warnung ausgesprochen: weniger Rauchen, weniger trinken, auf ausgewogene Ernährung achten.
Raven hatte den Rat abgenickt, aber nicht danach gehandelt. Sein Leben ging weiter wie zuvor. Und ich war die Marionette, der Clown in der Geschichte, der abseits stand und alles mitverfolgte, zu feige war, um einzuschreiten.
*
„Ich möchte zu Raven Spider.“ Meine Stimme war leise und belegt, sodass ich mich räuspern musste. Nach wie vor befand ich mich in einer lähmenden Gemütslage.
„Zu wem wollen Sie?“, fragte die Dame hinter dem Tresen. Sie war ein älteres Semester, hatte kurze Haare und eine Brille auf der Nase. Ihre rundliche Statur ließ vermuten, dass sie ihren Arbeitstag am Schreibtisch verbrachte. Ich nahm an, dass sie Ravens Künstlernamen nicht kannte, dass sie nicht wusste, welche Persönlichkeit sich in diesem Hospital befand und mit dem Leben rang.
„Wiktor Vice Gárdony ist sein bürgerlicher Name.“
Sie schielte auf den Monitor, danach sah sie mich unbeeindruckt an. „Der liegt auf der Intensivstation.“
„Ja, ich weiß, ich …“ Meine Stimme zitterte. Vermutlich sah ich auch erbärmlich aus, denn meine Mundwinkel, die eigentlich ständig ein wenig spöttisch nach unten gezogen waren, bebten vor Emotionen. Das erweckte offenkundig Mitleid, da sie sich erhob und über den Tresen spähte. „Mit dem Gepäck kann ich Sie da nicht reinlassen.“
„Natürlich nicht“, erwiderte ich mit Einsicht. „Es ist nur so, dass ich vom Flughafen komme und …“
Sie hörte mir nicht mehr zu und winkte stattdessen eine Schwester heran. „Effie? Zeig dem Herrn, wo er sich bei der Intensiven melden muss. Das Gepäck kann er hierlassen.“
*
Ich stand an der Schwelle zum Krankenzimmer und traute mich nicht vor. Grundlegend war ich davon ausgegangen, dass ich mit Raven reden konnte. Nicht viel, aber zumindest ein paar Worte. Aber sein Zustand ließ es nicht zu. Er war in Narkose gesetzt worden und wurde beatmet, wie mir eine Schwester berichtete. Sie hatten ihn bewusst in den Tiefschlaf befördert. Sein Körper war an diverse Geräte angeschlossen, die seine Vitalfunktionen überwachten. Der Raum war mit piepsenden und surrenden Geräuschen gefüllt.
Alles um mich herum schien surreal. Die Schwester verschwand und ließ mich allein mit meinen Gefühlen. Die Person, die vor mir im Krankenbett lag, hatte mit Raven Spider, wie er leibt und lebt, nichts gemeinsam. Vor meinen Augen vegetierte ein kranker Mann, der dem Tode geweiht war.
Elektroden klebten auf seiner nackten Brust, die flächendeckend mit einem Spinnennetz tätowiert war. Es rankte auf seiner Haut so unkontrolliert wie sein bisheriges Leben. Warum bloß hatte ich nichts unternommen? Warum hatte ich ihn ins offene Messer laufen lassen?
Stöhnend nahm ich auf einem Stuhl Platz. Länger hätten mich meine Beine nicht tragen können.
Spider Raven – der bunte Vogel der Szene, obwohl er nur schwarze Klamotten trug. Würden morgen schon die Zeitungen von seinem Ableben berichten? Ich war mir sicher, die Nachricht über seinen Infarkt würde die ein oder anderen Sender in Alarmbereitschaft versetzen. War es an der Zeit, über einen Nachruf nachzudenken?
Mein Blick schweifte ab. Ich sah über die Dächer des Klinikums in den blauen Himmel mit den Schäfchenwolken. Jahrelang hatten wir sein Comeback geplant. Eine neue Platte, eine neue Bühnenshow. Spider Raven – gealtert aber nicht vergessen. Geld musste in die Kassen. Er brauchte es. Und ich wollte alles tun, um ihn dabei zu fördern …
*
Einige Monate zuvor ...
„Bist du so weit? Die Kollegen warten.“ Meine Worte hallten im kargen Raum. Obwohl ich eine Frage formulierte, zitterte meine Stimme. Ich kannte ihn nun schon lange genug, um zu wissen, dass unser Unterfangen ein Wagnis war. Ein Spaziergang auf brüchigem Eis, ein Trip durch die Wüste ohne Oase, ein Vorhaben, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen war?
Raven drehte sich vom Pinkelbecken weg, noch bevor er die Hose komplett geschlossen hatte. Mit erlerntem Anstand hätte ich den Blick abwenden sollen, doch wie gesagt: Wir kannten uns schon lange. Ich sah die dunklen Härchen durch den Hosenschlitz. Ich verfolgte seine Finger, die die Kleidung richteten, den Reißverschluss langsam hochzogen, so sorgsam, dass es einschläfernd war. Tat er es mit Absicht? Wollte er wieder provozieren, so, wie er es oftmals tat?
Nicht nur mich, sondern auch andere Menschen in seinem Umfeld.
Ich sah ihm ins Gesicht und erkannte keine Regung, erhaschte lediglich einen forschenden Blick, der mit Optimismus einherging.
Raven glaubte, die ganze Welt wartete auf ihn. Und ich war der Depp, der es nicht fertigbrachte, das Gegenteil zu behaupten. Ja, vermutlich hätte ich ihm schon damals sagen sollen, dass im Grunde genommen niemand wartete. Es war an ihm, die Welt neu zu erobern, den Phoenix aus der Asche zu spielen. Keine Ahnung, warum er glaubte, dass sich die globale Menschheit an ihn erinnerte. Seine Zeiten waren vorbei ... Schon lange ...
Er stolzierte zum Waschbecken und blieb wankend davor stehen. Wie hoch mochte der Alkoholspiegel in seinem Blut gewesen sein? Welche Drogen hatte er geschmissen, um diesen Tag durchzustehen?
„Rave?“, hakte ich nach. „Hast du mich verstanden? Die anderen warten.“
„Ich kann auch gehen, wenn es ihnen nicht passt“, antwortete er. Prüfend musterte er sich im Spiegel. Sah er die Schatten um die Augen, die ersten Fältchen um seine Lider, sah er denselben Mann, den ich erblickte?
Notgedrungen gab ich klein bei. Aber nicht, weil ich Angst hatte, der ehemalige Star würde aus den Herrentoiletten verschwinden und einen divenhaften Abgang proben, sondern weil im Tonstudio Leute auf uns warteten, die uns eine Menge Geld kosteten. Geld, das wir eigentlich nicht hatten. Das Raven nicht hatte. Er sollte es verdienen. Aber so, wie er sich verhielt, hörte ich keine Kassen klingeln.
*
Er hatte auf großem Fuß gelebt – schon damals, als er kein Geld besessen hatte. Nach seinen erfolgreichen Jahren als Star hatte er sein Vermögen zum Fenster rausgeworfen. Rechnungen und Kredite mussten bezahlt werden, das hatte mir sein Anwalt in einer vertrauten Runde berichtet. Das neue Album und die Tournee waren essentiell. Sie sollten ihn aus der Misere holen, ansonsten war das Leben im Schlaraffenland vorbei.
Ich wollte gar nicht wissen, wie viel er für Alkohol und Drogen ausgab, doch gewiss fraß seine Unterkunft das meiste seines Vermögens. Er lebte in Manhattan: zentrale Lage, Penthousewohnung mit Blick über die Stadt. Das Gebäude verfügte über einen Lift und einen Putzdienst. Es gab ein Foyer, an dem Tag und Nacht ein Pförtner saß. Der führte Buch darüber, wann Bewohner kamen und gingen. Mängel wurden unverzüglich an einen Hausmeister weitergeleitet.
Das war beneidenswert. An dem Abend, an dem ich von der Klinik den Weg zu Ravens Wohnsitz tätigte, war ich allerdings schlichtweg froh, jemanden zum Reden zu haben.
Steven las ich auf dem kleinen Namensschild des dunkelhäutigen Aufsehers. Alles schreite nach einem Klischee. Der farbige Diener, mit schlanker Figur und raspelkurzen Haaren. Aber in jeder Geschichte gab es den Quotenschwarzen, oder? Genau wie es den Schwulen gab oder die Lesbe. Wo war mein Platz in dieser Story?
Steven saß vor einem großen Monitor, auf denen einzelne Bereiche des Hauses per Überwachungskamera in Echtzeit präsentiert wurden.
Seufzend stellte ich meinen Koffer ab und legte die Hände auf den marmornen Tresen. Er war kühl und schimmerte unter den kleinen LED-Lampen der Decke.
„Guten Abend, ich bin Jesse Cole, der Promoter von Raven Spider.“
„Oh ...“ Steven stand unverzüglich auf. „Das freut mich, ich habe schon viel von Ihnen gehört.“ Er reichte mir die Hand, doch seine Begeisterung ging schnell in Betroffenheit über. „Wie sieht es aus?“, fragte er.
„Nicht gut.“ Ich seufzte und hatte Mühe, meine Ratlosigkeit zu verbergen. „Ist es hier passiert?“
Mein Gegenüber nickte. „Ein Nachbar wurde aufmerksam, weil der Hund nicht aufhörte, zu bellen. Ich habe versucht, Mr. Spider anzurufen, aber er ging nicht an sein Telefon. Er öffnete auch nicht die Tür, also bin ich mit dem Generalschlüssel rein ...“ Verteidigend hob er die Hände an. „Vorher hatte ich natürlich die Polizei verständigt. Mr. Spider lag im Schlafzimmer auf dem Boden.“
Ich schluckte trocken und fuhr mir über die spröden Lippen. „Verstehe ...“
Imaginäre Bilder schossen mir durch den Kopf. Ich verdrängte sie. Es war schlimm genug, zu hören, wie sich der Vorfall zugetragen hatte. Unwillkürlich musste ich mich räuspern.
„Etwas zum Trinken, Sir?“, fragte Steven sogleich.
„Gern ...“
Er hechtete ans Ende des Tresens, wo eine Karaffe Wasser und ein Kaffeeautomat standen. Eine ausgezeichnete Betreuung, dachte ich mir.
Hätte Raven doch bloß auch so einen Aufpasser gehabt!
„Was ist mit dem Hund?“, erkundigte ich mich, nachdem ich das komplette Glas geleert hatte. Steven war stehengeblieben und beantwortete meine Fragen.
„Es war eine Notfallnummer hinterlegt“, berichtete er. „Von einem Marc Taylor. Der hat das Tier erst einmal mitgenommen.“
„Marc war hier?“
Steven nickte.
Ja, sicher. Marc hatte mich angerufen, doch war damit nicht geklärt, dass er am Ort des Geschehens gewesen war. Kurz fragte ich mich, warum nicht meine Nummer für den Notfall angegeben war.
Vermutlich, weil es von London aus Stunden dauerte, um herzukommen.
„Ich werde ein paar Tage bleiben, je nachdem, wie es sich mit Raven entwickelt“, sprach ich gedämpft weiter. Um mein Anliegen zu untermalen, zückte ich die Brieftasche und präsentierte meinen Ausweis. Mein Passbild war veraltet. Inzwischen trug ich das Haar kurz. Als Rotschopf hatte man nicht immer Komplimente zu erwarten und so ließ ich meiner Naturkrause lediglich mit einem längeren Pony etwas Spielraum.
„Natürlich muss ich mich um seine Angelegenheiten kümmern ... Es gibt viele Dinge zu regeln ... Ich denke, es ist in seinem Sinne, dass ich solange bei ihm unterkomme.“
Dass ich mir insgeheim ausmalte, die Beerdigung zu planen, behielt ich vorerst für mich.
„Selbstverständlich.“ Steven prüfte die Papiere. Schließlich schob er mir ein Formular entgegen, das ich mit meinen Personalien ausfüllte. Anschließend ließ er es sich nicht nehmen, mir den Weg zum Appartement persönlich zu weisen.
Das Penthouse lag im elften Stockwerk. Während der Fahrt mit dem Lift wechselten wir kein Wort. Ich war angespannt, wusste nicht, was mich erwartete. Steven bemerkte wohl meine Unsicherheit.
„Sie waren lange nicht mehr hier gewesen, oder?“, erkundigte er sich auf dem Weg durch den Flur.
Notgedrungen schüttelte ich den Kopf. Alles Mögliche hatte mich davon abgehalten, Raven zu besuchen. Meist hatten wir uns bei Presseterminen und Fotoshootings in Hotels zwischen Tür und Angel getroffen. Es war nie der richtige Moment gewesen, um vernünftig mit ihm zu reden, um ihm klar zu machen, dass es so nicht weitergehen konnte. Suchte ich nach einer Ausrede? Wenn ja, war das erbärmlich ...
Steven ging vor und schloss die Wohnungstür auf. Nachfolgend drückte er mir den Schlüssel in die Hand und deutete nach vorn. Mir wäre lieber gewesen, er wäre vorangegangen, aber ich sagte nichts; wollte nicht offenbaren, dass ich Angst hatte. Wovor?
Mit weichen Knien schritt ich durch den Eingangsbereich und betätigte den Lichtschalter. Auf den ersten Blick schien alles normal. Ravens Lederjacken hingen an der Garderobe, als wäre er nur kurz weggegangen. Das brachte eine weitere Beklemmung mit sich. Ich sog die verbrauchte Luft tief ein.
„Kommen Sie zurecht, Sir?“ Steven war an der Tür stehengeblieben. Eigentlich wollte ich nicht, dass er ging, doch ich nickte, und so verschwand er. Danach war ich allein.
Verhalten betrat ich das Wohnzimmer. Es war dunkel, denn die Jalousien waren unten und ließen kein Tageslicht herein. Ich betätigte den Knopf neben dem Lichtschalter und der Sichtschutz fuhr nach oben. Kurz darauf präsentierten sich mir die Ledercouch, die Sessel, der Glastisch, die Bücherregale und die immense Stereoanlage samt riesigem Flat-Screen. Ja, es wirkte tatsächlich alles normal, bis ich einen näheren Blick riskierte: Volle Aschenbecher, benutzte Whiskeygläser, verräterische Flecken auf den Polstern, Pornohefte ...
Der Anblick ließ vermuten, dass die Putzfrau länger nicht vorbeigesehen hatte. Oder sie hatte es getan und wurde nicht geduldet. Ich wusste, dass Raven harsch reagieren konnte, wollte er nicht gestört werden.
Der Kloß in meinem Hals wurde fester, kaum sah ich in die Richtung des Schlafzimmers, dorthin, wo es passiert war. Die Tür stand offen, sodass ich aufs Bett blicken konnte. Die schwarze Bettwäsche lag zerwühlt obenauf. Von sicherer Entfernung sah ich Gläser und Flaschen auf dem Nachtschrank und dem Fußboden. Ich trat näher und betrachtete den Boden, auf dem Hülsen von Spritzen, aufgebrochene Ampullen, Schutzfolien von Elektroden und leere Infusionsflaschen lagen ... Dort war es also passiert. Genau vor meinen Füßen hatte der Kampf stattgefunden, das Match ums Überleben, die Schlacht um sein Herz ... Die Rettungsaktion musste schnell gegangen sein, ansonsten hätte der Notarzt keinen Müll zurückgelassen.
Mir wurde übel. Ich trat zurück und schloss die Tür.
Sollte ich es wirklich tun? Hier wohnen, wo es geschehen war, während Raven im Krankenhaus lag und mit dem Tode rang?
Ich schlurfte ins Bad, benetzte mein Gesicht mit kühlem Wasser.
Doch als ich ein Handtuch gegen die nasse Haut drückte, vernahm ich seinen Duft, als stünde er neben mir. Das gab mir den Rest. Unkontrolliert brach ich in Tränen aus ...
*
Am nächsten Tag war zumindest das Wetter erträglich und der abgestandene Geruch in der Wohnung verschwunden. Allerdings konnte ich nicht behaupten, dass es mir besser ging. Ein paar Stunden hatte ich geschlafen, aber eher vor Erschöpfung. Dennoch fühlte ich mich nicht ausgeruht. In regelmäßigen Abständen war ich nachts wach geworden. Dann hatte ich auf das Handy gelinst, aus Angst, eine wichtige Meldung verpasst zu haben.
Aber niemand hatte versucht, mich zu erreichen, sodass ich immer wieder weggedöst war. Kaum war die Sonne aufgegangen, stand ich jedoch auf.
Ich musste ins Krankenhaus, musste zu ihm ... Der Wunsch, bei ihm zu sein und seine Hand zu halten, ließ mich nicht los.
Das Frühstück fiel aus. Ich duschte und zog mich an.
Die Nacht hatte ich im Gästezimmer verbracht. Zum Glück verfügte das Appartement über diesen Raum, in dem nichts an Raven oder sein derzeitiges Schicksal erinnerte.
Ich hatte es nicht fertig gebracht, im Wohn- oder Schlafzimmer zu übernachten. Womöglich wäre ich doch in ein Hotel gezogen.
Steven hatte die Frühschicht angetreten und saß hinter dem Tresen. Er erkundigte sich nach meinem Befinden und ich beauftragte ihn damit, die Putzfrau zu benachrichtigen.
Danach machte ich mich per Taxi auf den Weg in die Klinik.
Keine Ahnung, was ich erwartet hatte. Dass es Raven besser ging, dass er auf eine Normalstation verlegt worden war oder dass er uneingeschränkt mit mir reden würde.
Die Erkundigung nach ihm brachte allerdings nur die Gewissheit darüber, dass sich an seinem Zustand nichts geändert hatte.
Von den Tatsachen gebeutelt betrat ich die Intensivstation. Er lag im Bett wie am Tag zuvor. Auch die Schläuche und Kabel, die ihn überwachten und mit dem Nötigsten versorgten, waren nicht verschwunden. Am liebsten wäre ich wieder gegangen.
Für einen Bruchteil von Sekunden wünschte ich mir, dass die ganze Quälerei bald ein Ende finden würde. Es hätte uns Leid erspart. Nicht nur ihm, sondern auch mir.
Sogleich schämte ich mich für den Gedanken, denn ich liebte ihn. Wie konnte ich mir wünschen, dass er ging? Woher nahm ich das Recht, über sein Leben zu urteilen?
Warum stellte ich meine Gefühle über sein Leid?
Zuvor hatte ich das auch nicht getan, stattdessen hatte ich ihn laufen lassen ... Ins Verderben.
Ich schlich ans Bett, setzte mich auf einen Stuhl und ergriff seine Hand. Sie war warm, doch schlaff und kraftlos. Auf seinen Unterarmen zeigten sich Kratzspuren, so wie man es von Katzenbesitzern gewohnt war. Doch Raven besaß keine Katze und sein Hund Cliff war viel zu scheu, um so ein schlechtes Verhalten zu präsentieren. Ich nahm an, dass Raven sich die Striemen selbst zugezogen hatte. Vor Nervosität und Ungeduld? Oder waren es Zeichen dafür, dass er es mit der Hygiene nicht wichtig hielt?
Ungeachtet dieser Kratzspuren strich ich zärtlich über seinen Handrücken. Ob er es bemerkte? Ob er mich bemerkte?
„Hey, Rave, ich bin’s“, sprach ich gedämpft. Ob er mich hörte? „Mensch, ich hatte so gehofft, dass es dir besser geht.“ Ich fixierte sein fahles Antlitz, den Tubus, der aus seinem Mund ragte und den Beatmungsbeutel, der in regelmäßigen Abständen Luft in seine Lungen pumpte. Kontinuierlich hob und senkte sich sein Brustkorb. Sie hatten ihn in ein Krankenhaushemd gekleidet. Sein Haar war strähnig und sein Gesicht unrasiert. Er sah fürchterlich aus. Alt und krank.
Ich war froh, dass er sich selbst nicht sehen konnte. „Raven? Hörst du mich?“ Er antwortete nicht.
„Ach, das ist ja schön, dass Besuch da ist“, erklang es stattdessen hinter mir. Sofort drehte ich mich um und erblickte einen Mann im Arztkittel. „Sind Sie ein Verwandter?“
„Oh, nein.“ Ich ließ Ravens Hand los und stand auf. „Er hat keine Familie. Ich bin ein guter Freund ... Und sein Promoter.“
Der Arzt nickte. „Die Schwestern sind ganz außer sich, so eine Berühmtheit hier zu haben.“
Ich kniff mir ein Lächeln ab. Die Umstände waren ja nicht gerade erheiternd, trotzdem freute es mich, dass zumindest die Schwesternschaft von Ravens Krankheit profitierte.
„Ich bin Dr. Thomas“, stellte sich der Arzt vor. „Kardiologe. – Wissen Sie, ob Mr. Spider eine Patientenverfügung hat? Gibt es eine Vorsorgevollmacht?“
„Keine Ahnung“, antwortete ich. „Aber ich denke, eher nicht ...“
Meine Stimme war kaum hörbar. Erneut machten sich Vorwürfe breit. Selbstverständlich hatte ich daran gedacht, mit Raven über mögliche Situationen zu reden; Ereignisse, die ihn hilflos und entscheidungsunfähig werden ließen. Aber gesprochen hatten wir nie darüber. All meine Überlegungen waren tatenlos geblieben.
Dr. Thomas sah in die Mappe, die er mit sich trug. Offenkundig Ravens Krankenakte, denn sein bürgerlicher Name stand oben auf. „Auskunftsberechtigt ist ein Jesse Cole.“
„Ja.“ Ich stieß ein verlegenes Lachen aus und strich mir eine lästige Locke aus der Stirn. „Das bin ich. Sorry, ich bin etwas konfus, die ganze Sache setzt mir zu.“ Ich sah auf das Bett. Ob Raven uns zuhörte? „Wann wacht er wieder auf? Kann man das sagen?“
„Er hatte einen schweren Infarkt“, erklärte Dr. Thomas. „Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass es schon vorangegangene Episoden gab. In den Unterlagen stand aber nichts darüber.“
Erneut musste ich passen. „Keine Ahnung, wann er das letzte Mal beim Arzt gewesen ist. Von aktuellen Beschwerden weiß ich nichts.“
Wusste ich es nicht oder wollte ich es nicht wissen?
„Aber Sie haben Kenntnis über seine schlechten Leberwerte und die COPD?“
„Ja, klar ...“ Trinken und Rauchen forderten ihren Tribut. Ich hatte es immer gesagt. Der Arzt schaute nochmals in die Akte.
„In seinem Blut fanden sich Spuren von Beruhigungsmittel und Alkohol.“
„Ja, er hat eine schwierige Phase, momentan ...“ Ich biss mir auf die Zunge, denn meine Aussage klang lächerlich. Jeder Businessmanager hatte mehr Stress als Raven. Komponieren und Singen machten ihm Spaß. Zumindest hatte er das immer behauptet. Was war der Grund dafür, dass er sich mit Schnaps und Chemie zugrunde richtete?
„Wir haben ihn in Narkose gesetzt, da jegliche Belastung zu viel für ihn sein könnte“, kam Dr. Thomas auf meine Frage zurück. „Wir werden ihn erst wecken, wenn sich sein Zustand stabilisiert hat.“
Kapitel 2
„Es ist schön, dass du es einrichten konntest“, bedankte ich mich bei Marc, der mich unaufgefordert in seinen Palast geladen hatte. Palast deswegen, weil sein Haus gleichzeitig seine Arbeitsstelle war: ein riesiger Komplex mit Aufnahmestudios, Lounges für die Künstler und einer Stage im Hinterhof. Er schwamm in Kohle, doch ließ er das nicht raushängen. Er wohnte in dem architektonischen Meisterwerk, damit er alles im Blickfeld hatte: die Aufnahmen im Studio, die Musiker und deren Arbeit. Da er einst der Bassist von Ravens überaus erfolgreicher Band Spider gewesen war, hatte er auch ein Augenmerk auf dessen Sänger gelegt, der mittlerweile die Solokarriere anstrebte.
Es hieß, dass Marc und Raven nicht im Streit auseinandergegangen waren, was man von den anderen Bandmitgliedern nicht behaupten konnte. Die Gründe dafür waren bislang nicht ans Tageslicht gekommen.
Nachdem sich die Band Spider gesplittet hatte, gab es böses Blut. Der Drummer starb wenige Jahre später an einer Überdosis. Der Keyboarder hatte wohl gar nichts mehr mit Musik am Hut und Raven, ja, der versank in Selbstmitleid. Die Musik und die Bühne waren sein Leben. Ich glaube, er hat nie versucht, etwas anderes zu machen. Die Verbindung zu Marc war indes nie abgebrochen. Ab und zu schob der Raven sogar ein paar Aufträge zu: für Backing-Vocals oder Duetts mit anderen Künstlern. Es reichte immer, um Raven über Wasser und bei Laune zu halten, aber es änderte nichts daran, dass er den Selbstzerstörungsprozess aufrechterhielt.
Marc hingegen hatte alles richtig gemacht. Er hatte sein Vermögen in ein Unternehmen gesteckt, das nach kurzer Zeit zum Selbstläufer wurde. Er hatte Familie und Drogen und Alkohol abgeschworen. Er lebte vegan und empfing mich in luftiger Kleidung auf Sandalen, sportlich und jugendlich, als hätten seine exzessiven Jahre mit Spider nie stattgefunden. Ein wenig deprimierte mich das, denn er hatte die Kurve gekriegt, während Raven den freien Fall gewählt hatte.
Wir nahmen auf der Terrasse Platz, zu der ein Café gehörte. Für Künstler und Gäste selbstverständlich mit kostenlosem Service. Zufrieden sah ich dem altersschwachen Labrador zu, Ravens Hund Cliff, der auf dem Rasen langsame Erkundungstouren lief.
„Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast“, sagte ich.
„Kein Problem. Er kann fürs Erste hierbleiben. Tierheim ist wohl keine Option“, erwiderte Marc.
„Nein. Und ins Krankenhaus kann ich ihn nicht mitnehmen.“
Betretenes Schweigen, in der uns Kaffee serviert wurde. Marc bedankte sich mit einem Nicken, während ich dem Kellner nur still bei der Arbeit zusah.
„Warst du heute schon da?“, erkundigte sich Marc.
„Kurz, ja, habe mit dem Arzt gesprochen.“
„Und?“ Marc rührte Milch und Zucker in den Kaffee. Er sprach so geordnet, als würde er über das Wetter sprechen, aber ich bemerkte seine unruhige Hand und das leichte Wippen seines rechten Beines. Im Gegensatz zu dem Gesicht, so ist es erwiesen, können Füße nicht lügen.
„Nichts Neues“, berichtete ich knapp. „Sie werden das künstliche Koma erst beenden, wenn die Werte es zulassen.“
Das Zucken in seinem Oberschenkel wurde stärker. Er schien es zu bemerken und unterdrückte die Bewegung. Stattdessen beugte er sich vor.
„Was weißt du über Raven?“, fragte er.
Eine schwammige Frage, die alles Mögliche mit sich trug. Tja, was wusste ich über Spider Raven, außer, dass er Alkohol, Drogen und Tabletten verfallen war, dass er ein paar Pfunde zu viel auf den Hüften hatte, aber trotzdem noch verdammt attraktiv aussah.
Er war eine gescheiterte Persönlichkeit und mit sich selbst nicht im Reinen. Vielleicht ein wenig wie Elvis Presley, obgleich er keine Familie besessen hatte.
„Ich weiß nicht. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen“, erklärte ich offenkundig. „Die Aufnahmen liefen zwar stockend, aber das Album ist im Kasten.“ War das ein Grund, um anzunehmen, dass mit ihm alles in Ordnung war? „Hat er dir von gesundheitlichen Problemen erzählt?“, schob ich hinterher.
„Nicht genau, aber er war in letzter Zeit immer schnell aus der Puste“, erklärte Marc. Das Wippen seines Beines hatte nachgelassen. „Steven hat berichtet, dass er das Haus eigentlich nur noch verlassen hat, um mit dem Hund zu gehen.“
Irritiert schüttelte ich den Kopf. „Aber er wird Termine gehabt haben, oder nicht?“
„Einiges habe ich ihm abgenommen. Etliches hat er auch abgesagt.“ Marc musterte mich mit zusammengekniffenen Augen. „Das sollte bei dir angekommen sein.“
Ich verneinte und strich mir über die Stirn. Vielleicht war so eine Meldung auf meinem Schreibtisch gelandet, doch ständig war etwas zu tun ... Oder hatte Raven bewusst Details zurückgehalten?
„Wenn ich mit ihm telefoniert habe, hat er stets gesagt, dass alles in Ordnung ist.“
„Ja ...“ Marc leerte seine Tasse. „Wollte er mir auch weismachen. Der unerschütterliche Raven, der Fels in der Brandung, der Herr der Immortalisierung.“
Ich stutzte. „Hat er das gesagt?“
„Was?“
„Dass er unsterblich ist ...“
Marc lachte aufgesetzt. „Nicht gesagt, aber sich so verhalten. Er hat den Tod doch herausgefordert. Und was hat er nun davon?“ Mit einem verbissenen Gesichtsausdruck sah er weg. „Eine verdammte Scheiße ist das.“ Seine Augen glänzten, aber er hatte sich unter Kontrolle, obwohl die Lage tatsächlich zum Heulen war.
Unbewusst krallte ich die Finger in meine Oberschenkel. „Das muss schlimm gewesen sein.“
„Ja.“ Mit einer schnellen Bewegung strich Marc sich über die Augen und atmete tief durch. „Die Hütte war voll, ich hatte etliche Dinge zu erledigen, als mich der Anruf erreichte.“ Er lächelte verloren. „Mein erster Gedanke war: Nicht jetzt, Raven, ich habe für solche Spielchen echt keine Zeit.“ Sein Blick wurde ernst. „Steven sagte mir, dass der Notarzt da sei und man nicht wüsste, ob Rave es überlebt, da bin ich Hals über Kopf losgefahren ...“ Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: „Als ich ankam, hatten sie ihn schon intubiert und in den Krankenwagen verfrachtet ... Ich konnte nichts mehr tun. – Steven bat mich, noch einmal nach dem Rechten zu sehen .... Meine Güte, Jesse, die Wohnung sah aus ...“ Ich registrierte die Fassungslosigkeit in seinen Augen. „Das Bad war vollgekotzt, überall Bierflaschen und Tablettenschachteln.“
„Ja.“ Ich nickte. „Das habe ich bemerkt.“
„Nein, das kannst du nicht bemerkt haben, ich habe aufgeräumt, aber nicht alles ...“ Betreten sah er zu Boden. „Es war einfach zu viel.“
„Ich habe die Putzfrau informieren lassen. Anscheinend hat er ihre Dienste zuletzt nicht mehr in Anspruch genommen.“
„Das ist wohl das geringste Übel.“ Marc seufzte. „Er wirft sein Leben weg wie einen Pizzakarton.“
*
Marcs Äußerung klang eher wie eine Floskel, zu der ich keine Lösung parat hatte. Ich wusste nicht, warum sich Raven so verhielt. Generell hatte er im Leben alles erreicht. Er hätte sich aus dem Rampenlicht zurückziehen können. Doch hatte er es nicht getan. Stattdessen hatte er sein Geld verprasst und seine Gesundheit ruiniert. Er musste ein Comeback planen, um über die Runden zu kommen. Hatte ihn die Einsamkeit zerstört? Die Tatsache, dass ein kranker Musiker nicht mehr gefragt war?
Wenn ich das Radio anmachte, hörte ich Bands mit Namen, die mir oftmals fremd waren, mit einem Sound, den Raven niemals bedient hatte. Er war ein Künstler der alten Schule, vom alten Schlag, der noch wusste, wie man Platten ohne vorgefertigte Audiodateien aufnahm, wie frisch gedrucktes Vinyl roch. Sex, Drugs and Rock’n’Roll, ja das hatte er gelebt.
Was hatte ihn auf die falsche Bahn gebracht?
Die unbeantworteten Fragen ließen mich nicht los, sodass ich am Abend nochmals ins Krankenhaus fuhr, um Raven zu besuchen.
An seinem Zustand hatte sich nichts geändert, trotzdem sprach ich mit ihm, als würde er mich hören. Er bewegte sich nicht. Ich hatte ihn stets vorlaut und ein wenig einfältig erlebt. Ihn in dieser Gebrechlichkeit zu sehen, machte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, außer hoffen, dass er sich erholen würde.
Irgendwann bat mich eine Schwester aus dem Zimmer, denn es war spät und sie meinte, dass Raven auch unter der künstlichen Narkose mitbekommen würde, dass jemand bei ihm war. Ein kleiner Trost. Bevor ich den Raum verließ, drehte ich mich noch einmal um.
Das Krankenbett war schwach beleuchtet, und die Schatten, die es warf, flimmerten vor meinen Augen.
*
Es geschah am nächsten Morgen. Ich hatte geduscht und stand mit Handtuch bekleidet vor dem Spiegel, da klingelte mein Handy. Das Krankenhaus. Dr. Thomas sagte mir, dass er Raven aufwachen lassen wollte, allerdings langsam und unter Beobachtung.
Und so beeilte ich mich, um zu ihm zu fahren.
Mehrere Tage war Raven bewusstlos gewesen. Zum Zeitpunkt des Erwachens wollte ich bei ihm sein, denn ich konnte nicht ausschließen, dass er aufgebracht oder verwirrt reagierte. Für den Fall erschien es mir sinnvoll, meine Anwesenheit zu präsentieren. Nicht nur, um ihm zur Seite zu stehen, sondern auch, um sicherzugehen, dass nichts unnötig an die Öffentlichkeit gelangte.
Die Presse hatte sich bislang zurückgehalten. Spider Raven ist schwer erkrankt, so hieß es lediglich. Dem Informationsfluss wollte ich einen Riegel vorschieben.
Ich kam rechtzeitig, um mitzubekommen, wie die Beatmungsmaschine abgebaut wurde und Raven seine ersten Atemzüge wieder allein nahm. Er war dabei nicht ansprechbar. Bewusst hatte man ihm Schmerz-und Beruhigungsmittel verabreicht, um sein Aufwachen mit Bedacht zu gestalten.
Er hustete, stöhnte und blinzelte mit den Augen – mehr aber auch nicht. Nach einer Stunde, in der sich seine Atmung stabilisierte und die Vitalzeichen keine Auffälligkeiten boten, ließ der Arzt mich mit ihm allein, doch Raven blieb zur Sicherheit am Monitor verkabelt.
Die Schwesternklingel behielt ich dennoch im Auge; ebenso wie sein fahles Antlitz, das von den Strapazen gezeichnet war. Flatternd bewegten sich seine Finger. Man konnte nicht ausschließen, dass er Entzugssymptome zeigte, denn immerhin war er starker Raucher und ich nahm an, dass er täglich Alkohol trank.
Abgesehen von seinen hohen Leberwerten waren auch seine Cholesterinwerte jenseits von Gut und Böse. Nach dem Infarkt hatte man Raven ein paar Stents am Herzen gesetzt; das waren kleine Implantate, mit denen defekte Gefäße repariert und offen gehalten wurden. Ich wollte mir nicht vorstellen, wo Ravens Adern außerdem verstopft waren.
Unsicher nahm ich neben seinem Bett Platz. Er schlief und seine Lider zuckten, als verfolgte er einen Traum. Ich gab ihm Zeit. Ohnehin hatte ich nichts vor. Mein Aufenthalt in Manhattan diente nur einer Mission: bei Raven zu sein und ihm auf die Beine zu helfen.
Letzteres glich in diesem Moment allerdings einem kleinen Wunder. Ich saß zwei Stunden am Bett und wäre fast eingeschlafen, bis er sich endlich regte.
„Raven?“ , sprach ich mit gedämpfter Stimme. „Rave? Hörst du mich?“
Er blinzelte, sah erst durch den Raum und anschließend in meine Augen.
„Jesse ...“, wisperte er. Mir war, als huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Die Erleichterung in mir hätte nicht größer sein können. Er wusste, wer ich war, und er sprach mit mir. Seine folgenden Worte brachten allerdings Bedenken mit sich.
„Abad-don“, flüsterte er. Sein Blick wurde schärfer, nahezu ängstlich. Ich beugte mich vor, um ihn besser verstehen zu können. „Abaddon“, wiederholte er.
Ich richtete mich auf und sah hin an. Unleugbar hatten ihn die letzten Tage mitgenommen. Seine Augen waren zweifelnd geöffnet. Ich hatte mal gelesen, dass man zum Zeitpunkt eines Herzinfarkts nicht nur einen starken Vernichtungsschmerz spürte, sondern auch eine immense Angst. Raven war nie furchtlos gewesen, doch ich musste davon ausgehen, dass er sich an den grauenhaften Vorfall erinnerte. Sanft legte ich eine Hand auf seine Stirn und strich beruhigend darüber. Woran er auch dachte, was auch immer ihm in diesem Moment fürchtete, er sollte die finsteren Gedanken nicht zulassen.
„Du musst dich ausruhen“, sprach ich mit sanfter Stimme. Er schloss sofort die Augen und seufzte tief. „Dein Herz benötigt Ruhe. Man wird sich um dich kümmern.“
Er antwortete nicht. Seine herrische Atmung flachte ab. Die Tür ging auf und eine Krankenschwester sah ins Zimmer.
„Sie sollten nun wirklich gehen“, sagte sie. „Die Besuchszeit ist längst zu Ende.“
„Okay.“ Ich nickte und zeigte Verständnis. Von Natur aus war ich eher der devote Typ, der Konfrontationen aus dem Weg ging. In der Firma hatte ich zwar das Sagen und den Überblick, doch in jeder Hinsicht wollte ich Stress vermeiden. Wahrscheinlich hatte ich Raven deswegen nie das Messer auf die Brust gesetzt. Mein Herz erfüllte es mit Schmerz. „Aber wenn er noch einmal wach wird, sagen Sie ihm bitte, dass ich morgen wiederkomme.“
*
In der Nacht hatte ich einen Alptraum. Es war einer dieser Träume, in denen man einen Weg geht, der nicht endete. Ein dunkler Weg, der unbezwingbar schien. Ich trat auf der Stelle und kam nicht voran. Richtig gruselig wurde es, als eine Schar von Heuschrecken vom Himmel fiel, sie den Weg bedeckten und in großer Anzahl auf meinem Körper landeten. Mit einer japsenden Atmung wachte ich schweißgebadet auf. Bevor ich einen klaren Gedanken fassen konnte, klingelte mein Handy auf dem Nachtschrank. Ich dachte sofort an Raven, richtete mich auf und nahm das Gespräch an. Es war eine Schwester aus der Klinik, die anrief. Ich spähte auf den Wecker. Es war 3 Uhr in der Frühe.
„Entschuldigen Sie die Störung“, hörte ich die Frauenstimme mit einer zerknirschten Tonlage. „Aber Mr. Spider hat nach Ihnen gefragt und war schwer zu beruhigen.“
Ich schluckte hart. Der Anruf zu nächtlicher Zeit war mir egal. Wichtig war, dass es Raven gut ging.
„Gibt es Komplikationen?“, erkundigte ich mich sofort.
Sie verneinte. „Es geht Mr. Spider den Umständen entsprechend. Er fragt nur ständig nach Ihnen. Und er will wissen, wo der Schlüssel ist.“
„Schlüssel?“, wiederholte ich. „Welcher Schlüssel?“
„Ich weiß es nicht. Aber er scheint wichtig zu sein.“
Ratlos wischte ich mir über das Gesicht. Dass es Raven gut ging, beruhigte mich, sodass die Müdigkeit siegte. „Sagen Sie ihm, dass ich in seinem Appartement bin, falls er den Wohnungsschlüssel meint. Morgen früh komme ich zu Besuch und bespreche es persönlich mit ihm.“
„Okay“, erwiderte die Schwester. Irgendetwas an ihrer Stimme gefiel mir nicht. Ich hörte Zweifel heraus. Ging es Raven doch schlechter als angenommen?
*
Er war noch nicht über den Berg, wie mir der Arzt am nächsten Tag berichtete. Die Tatsache trieb mir Tränen in die Augen. Meine Illusion über seine schnelle Genesung zerplatzte. Im Krankenzimmer versuchte ich dennoch, die Kontenance zu bewahren. Raven war wach und saß aufrecht im Bett. Sein schwarzes Haar war glatt gekämmt, die Bartstoppel beseitigt. Auch das Krankenhaushemd trug er nicht mehr, stattdessen ein dunkles T-Shirt. Die Schatten um seine Augen waren aber nicht verschwunden und eine Sauerstoffbrille klemmte vor seiner Nase. Infusionen liefen nicht, dennoch war er über Kabel unter dem Oberteil mit dem Monitor vernetzt, was mir signalisierte, dass sein Kreislauf weiterhin überwacht wurde. Eine unnütze Aufregung, so hatte Dr. Thomas erklärt, konnte schon fatale Folgen mit sich bringen. Darüber wollte ich nicht nachdenken, also setzte ich ein scheinheiliges Lächeln auf.
„Super, dass du wach bist“, startete ich den Dialog. Unschlüssig blieb ich vor dem Bett stehen. Im bewusstlosen Zustand war ich ihm viel näher gekommen, als jetzt. Meine Gedanken und Gefühle waren klarer gewesen. Nun, da er wach war, fühlte ich mich ihm gegenüber wieder klitzeklein.
„Nun steh da nicht rum wie vor einem Sterbebett, komm her!“, antwortete er in seiner unkonventionellen Art.
Die Narkose hatte er demzufolge gut weggesteckt. Ich zog einen Stuhl heran und setzte mich neben das Bett. Am liebsten hätte ich ihn umarmt und die letzte Hürde zwischen uns überwunden. Doch körperlich warnen wir uns eigentlich nie nah gewesen. Sein Gebrechen dafür zu nutzen, um das zu ändern, schien mir nicht der richtige Weg. „Wie fühlst du dich?“
„Wunderbar“, erwiderte er ohne hörbare Wertung. „Ich habe Sky-TV und die Schwestern helfen mir beim Waschen.“ Unsere Blicke trafen sich und das Blau seiner Augen sorgte für das stechende Gefühl in meiner Magengegend. Es war also nicht verschwunden. Vermutlich würde es nie verschwinden, egal, was käme ...
„Immerhin bist du nicht mehr auf der Intensivstation“, lenkte ich ein und erntete sein Unverständnis.
„Ich bin verkabelt und ständig kommt jemand vorbei.“
„Das ist wohl normal in einer kardiologischen Abteilung. Du hattest einen Herzinfarkt, du kannst von Glück sagen, dass du nicht ...“ Ich sprach nicht weiter. Das, was hätte passieren können, wollte ich nicht in Worte fassen.
„Ich will nach Hause, Jesse“, sagte er lediglich.
Kompromisslos wehrte ich ab. „Das ist zu früh ... Um deine Angelegenheiten kümmere ich mich und Marc hat den Hund. Den Ersatzschlüssel habe ich übrigens von Steven erhalten; das wolltest du doch wissen.“
Entgeistert sah er mich an. „Wann?“
„Letzte Nacht hast du nach dem Schlüssel gefragt. Eine Schwester hatte extra bei mir angerufen.“
Er hob die Schultern an. „Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.“
Ich winkte ab, dabei hätte ich seine Aussage ernst nehmen sollen. „Ist auch egal. Ich sehe bei dir nach dem Rechten, solange du krank bist.“
Er zog die Stirn kraus, was er immer tat, wenn ihn etwas unzufrieden stimmte, doch ausnahmsweise konterte er nicht. Stattdessen schlug er die Bettdecke zurück und präsentierte seine nackten Beine. Aus nächster Nähe hatte ich sie noch nie gesehen. Im Verhältnis zu seinem stabilen Oberkörper waren sie schlank und leicht behaart.
„Dann bring mich wenigstens vor die Tür. Ich will rauchen.“ Er rutschte an die Bettkante und zog seine dunkle Jeans vom Stuhl. Ich setzte an, zu widersprechen, doch der Kloß in meinem Hals ließ keine Äußerung zu. Ich hatte zu viel Respekt vor ihm – vermutlich auch Angst. Kein Stress, kein Streit, keine Differenzen, diktierte ich mir still.
Wortlos half ich ihm in die Hosen und sah zu, wie er schwerfällig auf die Beine kam.
„Ich hole einen Rollstuhl“, stammelte ich. „Bin gleich zurück.“
Vor dem Krankenzimmer atmete ich tief durch und fragte mich, was mir mehr zu schaffen machte: Raven Spider in einem absolut desolaten Zustand zu sehen oder die Tatsache, dass es unter diesen Umständen niemals zu dem geplanten Comeback kommen würde.
Kopflos irrte ich durch die Gänge, bis ich eine Schwester fand, die mir zu einem robusten Rollstuhl verhalf und gleichzeitig den Weg zur Raucherlounge beschrieb, nicht ohne mir zu sagen, dass das Rauchen für einen Herzkranken nicht von Vorteil war.
Ich lächelte sie nur müde an. Ohnehin fragte ich mich, wie Raven mit der angedachten Schonkost zurechtkommen würde. Ihm das Rauchen zu verbieten hätte mich wohl ins Abseits befördert. Diese Aufgabe wollte ich lieber dem Arzt überlassen.
Auf dem Rückweg zum Zimmer besorgte ich Kaffee und schließlich lief mir Dr. Thomas über den Weg, der kopfschüttelnd auf die Pappbecher zeigte, die ich wagemutig auf der Sitzfläche des Rollstuhls transportierte.
„Koffein ist nicht gut für Mr. Spider und ich hoffe nicht, dass Sie ihn nach draußen zum Rauchen fahren wollen.“
Zerknirscht trat ich auf der Stelle. „Oh, Sie kennen ihn nicht. Wenn er nicht bekommt, was er will, wird er komplett dichtmachen. Dann wird er auf überhaupt keinen Ratschlag mehr hören.“
„Mit seinem Verhalten bringt er sich unter die Erde“, gab der Doc eine klare Ansage.
Ich senkte den Kopf. „Das weiß ich.“
„Und wenn Sie ihn weiterhin unterstützen, werden Sie einer der Sargnägel sein.“
Im Zimmer angelangt, startete ich einen kläglichen Versuch, Raven von seiner vorzeitigen Mobilisation abzuhalten. „Der Arzt meint, dass Kaffee nicht gut für deinen Blutdruck ist. Und Nikotin schädigt deine Gefäße, die ohnehin marode sind.“
Er antwortete nicht. Hörte er mir überhaupt zu? Japsend hangelte er sich auf den Rollstuhl. Kaum hatte er die Sauerstoffbrille abgelegt, glich seine Atmung der eines erstickenden Karpfens. Zu guter Letzt rupfte er sich die Kabel vom Oberkörper, sodass ein Alarm ausgelöst wurde.
„Stell den verdammten Apparat ab!“, forderte er ungehalten. „Und dann bringst du mich zum Rauchen“, keuchte er. „Oder wofür bezahle ich dich?“
Ich lachte mit Ironie. „Du bezahlst mich überhaupt nicht“, stellte ich klar. Damit das nervige Piepen aufhörte, schaltete ich den Monitor ab. „Mir kommt höchstens deine Gage zugute. Aber wenn du so weitermachst, wird es keine Tour geben.“
Er hustete schwer und zeigte zur Tür, durch die just eine Krankenschwester schoss. „Sie dürfen noch nicht aufstehen!“, entfuhr es ihr. „Und warum haben Sie die Elektroden abgemacht? Das geht doch nicht.“
„Neue Spielregeln, Schätzchen!“, tönte er.
Ich stöhnte entnervt. So klang Raven wie gewohnt. Nichts hatte sich geändert. Dennoch schob ich ihn samt Rollstuhl hinaus.
*
Die Putzfrau hatte für Ordnung gesorgt und sich damit ein gutes Trinkgeld eingeheimst. Zugegeben: Mir war die Angelegenheit peinlich. Nicht nur, dass sie einen Haufen dreckiger Wäsche waschen musste, sondern auch, weil es in Ravens Wohnung vor Anrüchigkeit nur so strotzte. Jeder Winkel der Zimmer erinnerte an seine Saufexzesse, das Laken in seinem Bett an wilde Orgien. Ich fragte mich, mit wem er Partys gefeiert hatte. Mit wem hatte er die Nächte durchzecht? Mit wem hatte er sich die Pornos angesehen, deren Cover ausreichten, um mir die Luft zu nehmen.
Sonderbar war auch, dass er in den Küchenschränken nicht nur Alkohol hortete, sondern reihenweise Essigflaschen. Was tat er damit? Putzen offensichtlich nicht!
Auch die Tatsache, dass es nicht nur Heteropornos waren, die er besaß, stimmte mich nachdenklich. Im vertrauten Beisein eines Mannes hatte er sich bislang nur ein Mal öffentlich präsentiert. Auf einem Sommerfest seiner damaligen Plattenfirma hatte er über den Durst getrunken. Während die anderen Gäste das sonnige Wetter im prunkvollen Garten einer angemieteten Villa genutzt hatten, um gepflegte Konversationen zu halten, hatte er sich mit einem blutjungen Newcomer an den angrenzenden See verzogen. Die Sicherheitskräfte hatten ihn rausgeworfen, da er mit dem besagten Mann auf dem Bootssteg auf Tuchfühlung gegangen war. Irgendein Fuzzi von der Presse hatte sogar Fotos gemacht. Spider Raven knutschend und fummelnd in aller Öffentlichkeit – und das mit einem Kerl. Diese Schlagzeile fand man noch immer, suchte man im Internet nach Infos über ihn.
Nun, Jahre später, konnte ich mich für den ganzen Dreck nur entschuldigen und der Putzfrau versichern, dass so etwas nie wieder vorkommen würde. Sie schwieg und steckte das Geld ein.
Im Krankenhaus dann ein weiterer Schock. Raven verkündete mir, dass er am nächsten Tag nach Hause gehen würde. Er war schwach auf den Beinen und flüsterte nur, da ihn jeder Atemzug anstrengte. Doch sein Wille stand fest und ich fragte mich, warum er keine Einsicht zeigte. Nach dem Krankenbesuch, der eher aus Schweigen als einer munteren Unterhaltung bestand, versuchte ich, Dr. Thomas zu erreichen, doch der hatte keinen Dienst. Lediglich die Schwester bestätigte mich in der Vermutung, dass sie Raven nicht zwingen konnten, in der Klinik zu bleiben. Er war trotz der Defizite nicht entmündigt und würde sich höchstwahrscheinlich gegen ärztlichen Rat entlassen. Allerdings war ein Pflegedienst über den Fall informiert worden. Ein kleiner Trost.
Kapitel 3
Ehe ich mich am nächsten Morgen auf den Weg in die Klinik machte, ging die Wohnungstür auf und Raven trat herein – gefolgt von zwei Männern des Krankentransports und einer weiblichen Pflegekraft.
Ich stand im Flur und starrte sie nur verdattert an.
„Guten Morgen, Jesse“, wünschte Raven. Eine ungesunde Blässe lag auf seinem Gesicht und er atmete erneut viel zu schleppend. Er trat näher und mein Blick fiel auf seine bläulich verfärbten Lippen. „Sauerstoff!“, krächzte er und lehnte sich an die Wand. Unleugbar hatte ihn der Weg aus der Klinik an den Rand der Erschöpfung getrieben.
Ein Sanitäter eilte heran. In seinen Händen schob er eine Sauerstoffflasche mit Kabel und Maske. „Wohin?“
„Ins Schlafzimmer“, flüsterte Raven. Mit zittrigen Fingern befestigte er den Sauerstoffschlauch vor seiner Nase. Der Sanitäter schlich neben ihm her. Zusammen verschwanden sie im besagten Raum.
Ich fasste mir an die Brust, in der es unruhig klopfte. „Meine Güte, so kann man ihn doch nicht entlassen.“
Der zweite Helfer antwortete nicht. Er brachte das Gepäck herein.
Die Schwester trug einen Koffer, den sie mir vor die Augen hielt. „Sein CPAP-Gerät. Das sollte für die Nacht griffbereit liegen.“
„Sein was?“, rief ich.
„Er hat nachts Atemaussetzer, nichts Ungewöhnliches bei Herzpatienten mit Übergewicht. Er sollte das Gerät beim Schlafen anlegen, um die Atemmuskulatur zu stabilisieren.“ Sie drückte mir den Koffer in die Hand. „Der Arzt hat eine Verordnung ausgestellt, damit jemand regelmäßig nach dem Rechten sieht, die Tabletteneinnahme überwacht, seinen Zucker kontrolliert und ihm bei der Körperpflege hilft, aber das hat er abgelehnt.“
Ich nickte still, denn das kam für mich nicht überraschend.
„Sind Sie sein Lebensgefährte?“, fragte sie.
Ich reagierte zwischen Entsetzen und Erheiterung. „Ähm, nein, ich ....“
„Aber Sie sind hier, um nach ihm zu sehen?“
„Ja, also ... Momentan schon ...“
„Wenn Sie etwas brauchen, rufen Sie mich an. Die Telefonnummer steht auf dem Visitenkärtchen in den Unterlagen.“ Zum Koffer reichte sie mir eine Mappe voller Papierkram. „Und ich benötige eine Unterschrift dafür, dass Sie die Geräte erhalten haben.“ Notgedrungen musste ich den Koffer abstellen, denn sie schob ein Papierstück nach. Ich kam mit den Informationen kaum hinterher. Übergewicht? Raven war um die Hüften etwas fülliger, aber sonst? Gertenschlank war er nie gewesen. Und seit wann litt er an Schlafapnoe und Diabetes?
„Vielen Dank und einen schönen Tag noch!“ Die Schwester riss mir den unterschriebenen Zettel aus der Hand und ging. Kurz darauf verließen auch die Sanitäter die Wohnung und ich blieb allein zurück: mit dem herzkranken Raven, der jetzt schon aussah wie der wandelnde Tod.
Was sollte ich sagen, was tun?
Mit Bedacht schlich ich ins Schlafzimmer, wo Raven auf dem Bett lag, den Sauerstoff inhalierte und trotzdem mit einer Zigarettenschachtel hantierte. Das war doch nicht sein Ernst?
„Vielleicht solltest du nicht rauchen“, meinte ich.
Er hustete, entfachte die Zigarette und zog daran. „Ich werde auf die letzten Tage sicher nicht mit der Qualmerei aufhören.“ Träge lehnte er sich zurück. Mir gefiel es nicht, dass er mit Schuhen im Bett lag und über sein Befinden unpassende Witze riss.
„Die Putzfrau hat lange gebraucht, um hier alles wieder ins Lot zu bringen ...“ Ich zeigte naserümpfend auf seine hochgeschnürten Boots, die auch schon bessere Tage erlebt hatten.
„Wie wäre es mit einer Begrüßung?“, entgegnete er. „Raven, ich freue mich, dass du wieder da bist oder sowas.“ Er hustete abermals, hörte aber nicht auf, zu rauchen.
Offensichtlich nahm er meine Worte nicht ernst. Oder war er zu schwach, um die Stiefel auszuziehen? Ich griff nach der Schnürung und lockerte sie.
„Natürlich freue ich mich, dass du entlassen bist, aber ging das alles nicht etwas schnell?“
Nach und nach öffnete ich die Schnürsenkel. Nachfolgend zog ich die Boots von seinen Füßen. Er lachte nur. „Dass du mal auf meinem Bett knien und mir die Schuhe ausziehen würdest, damit hätte ich auch nicht gerechnet.“
Seufzend stellte ich die Stiefel zur Seite.
„Wie steht es mit der Tour?“, fragte er anschließend. Eine Frage, die ich erwartet aber nicht ersehnt hatte.
„Die Konzerte in London und Bristol, in drei Wochen, habe ich noch nicht gecancelt, doch für Birmingham und Oxford wirst du nicht fit sein. Über den Rest der Tour habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.“ Vielleicht hätte ich das tun sollen. Ich war sein Berater, Manager und Promoter in einem.
Raven atmete durch. Es klang unzufrieden und er neigte das Haupt. Unvorstellbar, wie er auf die Neuigkeit reagierte.
„Dir muss doch klar sein, dass du das nicht durchhalten kannst. Und mit Sauerstoffgerät gehst du nicht auf die Bühne!“ Ein eindeutiges Urteil. Es fiel mir nicht leicht, Anweisungen zu geben. In der Vergangenheit hatte ich immer das gemacht, was Raven wollte, auch wenn es den Bogen das ein oder andere Mal überspannt hatte. Er hatte das Sagen gehabt und ich klein bei gegeben.
Niemand machte dem Rockstar Vorschriften und es hatte mir jedes Mal geschmeichelt, wenn er mich um einen Rat gebeten hatte.
Nun zeigte sich das Blatt von einer anderen Seite. Ich musste durchgreifen, ansonsten hätte ich gleich seine Trauerfeier planen können.
„Wir dürfen nichts riskieren, okay?“ Ich schluckte schwer. „Du erholst dich zwei Wochen und dann sehen wir, wie weit du gehen kannst, ja?“
„Ich will auf die Bühne“, sagte er verbissen.
„Natürlich“, antwortete ich. „Aber, um das zu können, müssen wir das Konzept überarbeiten. Wir könnten auch die Zeit für die Vorband verlängern.“
Er sah mich schief an. „Die Fans wollen mich sehen und nicht die Vorband.“
„Wir holen Marc mit ins Boot, okay?“ Ja, das war mein Plan bislang gewesen. Marc hatte Ahnung und vielleicht einen positiven Einfluss auf Raven. Zudem schien es mir sicherer, einen Vertrauten in der Nähe zu haben. Da ich nicht in London war, fielen meine treuen Kollegen erst mal weg.
„Ich mache doch kein Soloalbum, um wieder mit Marc zu arbeiten!“, schnauzte Raven.
„Nicht arbeiten, lediglich planen“, erklärte ich erneut.
„Das gefällt mir nicht, Jesse.“ Wie er meinen Namen aussprach, reichte, um mir einen Schauder über den Rücken zu jagen.
„Ich weiß, aber nenne mir eine Alternative.“
Er sah zur Seite und bot keine andere Lösung. Da Marc noch gar nichts von seinem Glück wusste, hoffte ich, dass er in mein Vorhaben einstimmen würde. Er musste es einfach tun.
Raven fluchte auf Ungarisch, was ich natürlich nicht verstand. Es war klar, dass es keine positiven Worte waren, denn ansonsten hätte er sie begreiflich ausgesprochen. Ich kannte ihn inzwischen so gut, um zu wissen, dass er es mit Absicht tat: etwas in einer mir fremden Sprache faseln, um mir ein schlechtes Gewissen zu bescheren. Meine Güte, das hatte ich ohnehin. Konnte er sich das nicht denken?
„Okay, dann suche ich mir ein Hotel“, entschied ich.
Er drehte den Kopf zurück und blickte mich fragend an. „Wieso das? Du hast vorher auch hier gewohnt. Es gibt das Gästezimmer.“
„Ja, aber ...“ Meine Hände wurden schwitzig und meine Brust schwer. „Nun bist du wieder da und ...“
„Du bleibst“, befahl er. Ich wagte wie immer keinen Widerspruch. „Und zu allererst holst du mir meinen Hund zurück.“
*
Von Steven hatte ich erfahren, dass Raven kein Auto besaß. Wegen Trunkenheit am Steuer war ihm für eine längere Zeit der Führerschein entzogen worden. Abgesehen davon hatte er seinen letzten Wagen im Suff zu Schrott gefahren. Ich fragte mich, warum er mir das nicht gesagt hatte. Hatte er mir eigentlich irgendetwas erzählt, was in den vergangenen Monaten passiert war?
Je mehr ich darüber nachdachte, desto schockierender war die Erkenntnis, dass ich meinen langjährigen Freund weniger kannte als gedacht.
War ich überhaupt sein Freund, stellte sich mir die Frage. Lange hatte ich das angenommen.
Derzeit kam ich mir eher wie seine Marionette vor, die sofort spurtete, zog er auch nur an einem ihrer Fäden.
Ich rief mir abermals ein Taxi.
Es war unangenehm, Marc erneut bei der Arbeit zu stören, obgleich ich ohnehin mit ihm hatte reden müssen.
Diesmal hatte er auch nicht sofort Zeit. Eine Mitarbeiterin führte mich in sein Büro, wo ich wartete. Sein Arbeitszimmer machte was her. Es war nicht großspurig oder modern eingerichtet, jedoch war es mit diversen Trophäen und Erinnerungsstücken versehen.
In einer Vitrine standen Musikpreise in Form von Pokalen und kleinen Skulpturen. An den Wänden hingen Schallplatten in Gold und Platin; nicht nur von den Bands, die Marc über die Jahre begleitet und groß rausgebracht hatte. Ich entdeckte gleichwertige Awards für Spider.
Dazu gerahmte Bilder, die die Band bei den Preisverleihungen zeigten. Raven hatte damals umwerfend ausgesehen. Seine schwarzen Haare, die mich seit meiner ersten Begegnung mit ihm in ihren Bann gezogen hatten, ragten schon zu Spiders Zeiten bis zu den Hüften hinunter. Auch die Lederoutfits hatte er damals getragen. Mit provozierenden Gesten hatte er gern den Rebellen gemimt.
Gedanklich versank ich in der Vergangenheit, bis Marcs Stimme meine sorgfältige Betrachtung der Bilder unterbrach.
„Sorry, dass du warten musstest“, sagte er ein wenig außer Atem. „Du hättest anrufen sollen. Wusste nicht, dass du herkommst.“
Ich drehte mich von den Bildern weg und winkte ab. „Habe nicht lange gewartet. Und eigentlich bin ich nur hier, um den Hund abzuholen.“
„Okay“, erwiderte er, doch sein fragender Blick löcherte mich.
„Er ist aus der Klinik entlassen“, antwortete ich auf die unausgesprochene Frage.
„Oh!“ Marc reagierte sichtlich verwundert, vielleicht auch erschrocken. „Geht es ihm schon so gut?“
„Nein“, erwiderte ich ohne Umschweife.
„Verstehe ...“ Marc verharrte einen Moment, bevor er sich hinter den Schreibtisch begab und nach dem Telefonhörer griff. Dem Verlauf des Gesprächs zu urteilen, sprach er wieder mit einem Mitarbeiter. „Such mal bitte die Sachen von Ravens Hund zusammen. Er wird abgeholt ...“ Eine Pause entstand. „Nein, ist er nicht ... Er will ihn nur wiederhaben ...“
Marc legte auf und schüttelte den Kopf. Ein Zeichen dafür, dass sogar unbeteiligte Personen nicht so schnell mit Ravens Genesung, ja, überdies mit seinem Tod, gerechnet hatten.
„Erbärmlich, die Sensationslust der Leute, was?“, fügte ich der Sachlage hinzu. „Dabei erscheint nächste Woche sein Debüt.“ Ich seufzte tief. Die Stimmung im Raum war bedrückend. Jeder meiner Atemzüge war schleppend und auf Marcs Stirn hatten sich Falten gebildet.
„Negative Schlagzeilen breiten sich wie ein Lauffeuer aus“, meinte er, trotzdem hob er einen Mundwinkel an, was einem sarkastischen Lächeln glich. „Auf der anderen Seite, denk an das Blackstar-Album von David Bowie, das zwei Tage nach seinem Tod erschien oder die MTV Unplugged-Scheibe von Nirvana, die nach Kurt Cobains Selbstmord veröffentlicht wurde. Es gibt einige Alben, die posthum wie eine Bombe in die Charts einschlugen.“
„Raven ist aber nicht tot“, zischte ich mit Nachdruck.
Marc hob die Hände entschuldigend an. Es spiegelte sich sogar eine Art von Ernüchterung in seinem Gesichtsausdruck wider. „Sorry, ja, natürlich nicht ...“
Ich leckte mir über die trockenen Lippen. Das Gespräch wühlte mich auf. „Klar hatten wir darauf kalkuliert, dass mit dem Album und der Tour etwas Geld reinkommt, aber momentan ist mir seine Gesundheit wichtiger.“ Meine Stimme hob sich an und klang fast theatralisch. „Doch er denkt allen Ernstes, dass er die Dinge so weiterlaufen lassen kann.“
„Wirst du die Tournee absagen?“, fragte Marc.
„Die ersten beiden Gigs habe ich gecancelt, ja, die anderen noch nicht.“ Kaum überdachte ich die Lage, wurde mir schlecht. Bei einer Streichung der rund zwanzig Konzerte würden wir auf Kosten sitzenbleiben.
„Das ist wirklich übel“, äußerte sich Marc und das war gelinde gesagt harmlos ausgedrückt.
Die Unterhaltung stockte, denn die Tür wurde nach einem kurzen Anklopfen geöffnet. Eine Mitarbeiterin trat herein. An einer Leine führte sie Ravens Hund Cliff. In der anderen Hand trug sie eine Tasche mit den Sachen des Tieres: Spielzeug, Futter samt Napf und dergleichen.
Marc bedankte sich und ich nickte ihr freundlich zu. Der Hund schlich ein paar Meter durch den Raum, bevor er sich auf dem Teppich ausbreitete und mich aus traurigen Hundeaugen ansah.
Ob er sein Herrchen vermisst hatte?
„Tja ...“ Marc klatschte in die Hände und sah auf seine Armbanduhr, was mir signalisierte, dass er eigentlich keine Zeit hatte und ich besser hätte gehen sollen. Aber es war noch nicht alles geklärt.
Ich zog an der Hundeleine und das Tier damit auf die Beine. Ein letztes Mal sortierte ich die Gedanken, bevor ich mein Anliegen vortrug.
„Ich danke dir, dass du dich um Cliff gekümmert hast. Raven weiß das sicher auch zu schätzen.“
„Kein Problem“, antwortete Marc.
Ich atmete tief durch und fuhr fort: „Mir ist bewusst, dass du mit deiner Firma viel zu tun hast, und ich bewundere dich für das, was du aufgebaut hast.“
Er stutzte sichtlich und sah mich erwartungsvoll an.
„Ich weiß auch, dass deine Freundschaft zu Raven schon bessere Zeiten erlebt hat, aber dennoch wollte ich dich fragen, ob du dir vorstellen könntest ...“ Unbewusst stoppte ich, denn mir war klar, dass jedes Wort gut gewählt sein musste.
„Ja?“, hakte Marc nach.
„Du hast Ahnung vom Business und kennst Raven vermutlich besser als ich“, sprach ich weiter. Seine Augen weiteten sich und ich kam zum entscheidenden Punkt. „Klar, Ravens Platte wurde in England produziert, unter meiner Fittiche. Bei uns läuft sicher einiges anders, als in deinem Imperium ...“ Ich lachte aufgesetzt. „Trotzdem wollte ich dich fragen, ob du mir helfen könntest, diese ganze Sache wieder ins Lot zu bekommen.“
„Oh ...“ Er war sichtlich erstaunt und seine regungslose Starre löste sich auf. Die Lippen presste er aufeinander und er kratzte sich im Nacken. „Momentan hab ich echt viel um die Ohren.“
„Natürlich!“ Mit Bedacht hielt ich das Lächeln aufrecht, um mir die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Trotzdem gab ich die Hoffnung nicht auf und blieb abwartend im Raum stehen.
Deutlich erkannte ich, wie Marc mit sich rang. „Ehrlich gesagt, wollte ich nie mehr mit ihm zusammenarbeiten.“
Ich schluckte hart. Die Absage war wie ein Schlag ins Gesicht.
„Wir haben eine Vergangenheit, die ruhen sollte“, fügte Marc hinzu. Er sprach in Rätseln und ich war kurz davor, nachzufragen, was diese Vergangenheit betraf. Warum hatte sich die Band Spider aufgelöst? Was waren das für Differenzen, die noch immer nicht aus der Welt geschafft worden waren? Mich beschlich das komische Gefühl, dass mehr dahintersteckte als gekränkte Eitelkeit. Aber wieder stoppte ich an dem Punkt, der ein Durchsetzungsvermögen forderte, das ich leider nicht besaß.