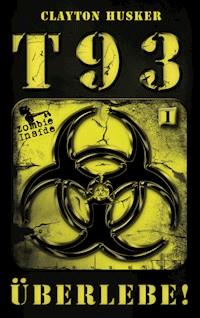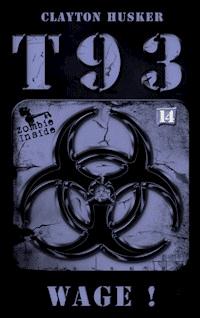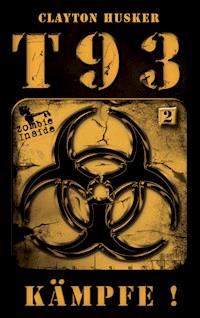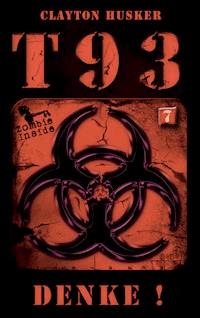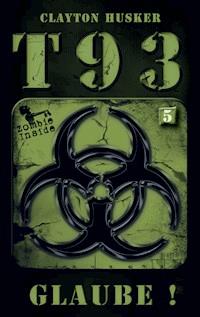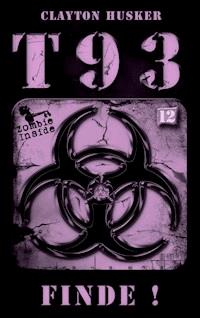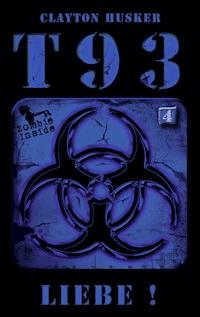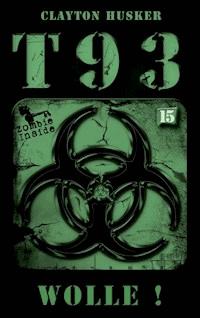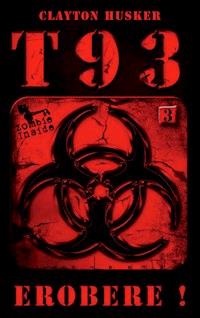8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB Verlag & Shop KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Xiuna hat ihre Feuerprobe bestanden und das Unmögliche möglich gemacht. Als erster Mensch überlebte sie ohne Schutzvorrichtung in der Todeszone. Nun scheint sie stark genug zu sein, sich der größten aller Bedrohungen zu stellen – dem Herrscher der Nephilim. Da erhalten Xiuna und Terion aus der fernen Heimat die Nachricht, dass ihre Mutter Runa bei einem Angriff der Nephilim-Zombies schwer verletzt wurde. Xiuna ist überzeugt, dass nur sie Hilfe leisten kann. Aus den Hinterlassenschaften der alten Zivilisation bauen die Geschwister ein abenteuerliches Fahrzeug, mit dem sie aufbrechen, um die gewaltige Sandwüste im Herzen Europas zu durchqueren. Clayton Husker ist ein vielseitiger Autor mit schottischen Wurzeln, aufgewachsen in Norddeutschland und seit seiner Kindheit Fan von SciFi und Weird Fiction. Er lebt sehr zurückgezogen mitten in Schleswig-Holstein, dem Land zwischen den Meeren. Seine Romane sind packend ausgearbeitet und erzählen mitreißende Geschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nephilim
Die Zombie-Serie
von
Clayton Husker
Inhalt
Titelseite
Band 5: Donner des Gerichts
Aus den Tagebüchern von Alv Bulvey
17. August im zweiunddreißigsten Baktun
18. August im zweiunddreißigsten Baktun (I)
18. August im zweiunddreißigsten Baktun (II)
21. August im zweiunddreißigsten Baktun
23. August im zweiunddreißigsten Baktun
24. August im zweiunddreißigsten Baktun (I)
24. August im zweiunddreißigsten Baktun (II)
25. August im zweiunddreißigsten Baktun (I)
25. August im zweiunddreißigsten Baktun (II)
26. August im zweiunddreißigsten Baktun (I)
26. August im zweiunddreißigsten Baktun (II)
29. August im zweiunddreißigsten Baktun
30. August im zweiunddreißigsten Baktun
Empfehlungen
Ren Dhark Extra
Nation-Z
T93
Impressum
Band 5:Donner des Gerichts
»Gottes Mühlen mahlen langsam, mahlen aber trefflich klein.«
Friedrich Freiherr von Logau (1604 – 1655)
Aus den Tagebüchern von Alv Bulvey
»Im zweiten Jahr der Apokalypse, 19. Februar.
Wir sind endlich angekommen. Gott sei Dank! Ich habe die schwersten Tage meines Lebens hinter mir. Ich verließ mit meiner Familie mein Heim im Norden, um der Diktatur dieses seltsamen Oberbefehlshabers zu entgehen. Wir haben aus dem Refugium alles mitgenommen, was sich bewegen ließ. Mein Haus zurückzulassen und mit dem Konvoi in eine ungewisse Zukunft aufzubrechen, war schwer für mich. Doch die schlimmste Prüfung ereilte mich unterwegs. Sandy, meine Ex-Gattin und Mutter von drei meiner Kinder, wurde auf der Reise von einem Zed gebissen. Sie war infiziert und begann, sich zu verwandeln. Ich musste sie erschießen, um ihr das zu ersparen. Es ist ein Unterschied, ob du irgendwo da draußen einen Zed erschießt, um zu überleben, oder ob du jemanden, der dich darum bittet, von dem Leid zu erlösen hast. Ich bin daran beinahe zerbrochen. In die Augen meiner Kinder zu sehen, nachdem ich es getan hatte, raubte mir beinahe den Verstand. Ich habe mich geweigert, Sandys Leiche dort in dem Wald zu lassen. Wir haben sie in eine Munitionskiste verpackt und mitgenommen. Sie wird in der neuen Heimaterde bestattet; ich werde das später erledigen.
Manchmal frage ich mich, welche Qualen Gott noch für mich vorgesehen hat. Ich bin nicht Hiob, ich hoffe, er sieht das ein. Es ist grausam genug, dass sämtliche Menschen um uns herum sich plötzlich in furchtbare Monster verwandeln, die es darauf abgesehen haben, sich auf uns zu stürzen und sich in uns festzubeißen. Ich will nicht auch noch meine Liebsten erschießen müssen. Ich hoffe, Gott sieht auch das ein.
Wir haben unseren Bestimmungsort erreicht: Rennes-le-Château. Ein verlassenes Dorf in den Vorpyrenäen, das die Zeds vollkommen entseelt haben. Na ja, nicht ganz. Ein älteres Ehepaar, das schon seit ewigen Zeiten hier wohnt, hat die Katastrophe überlebt. Nette Leute, sie haben sich gefreut, endlich wieder Menschen zu sehen. Erfreulicherweise sprechen einige aus unserer Gruppe fließend französisch, so gibt es erst einmal keine Verständigungsschwierigkeiten.
Sofort nach unserer Ankunft haben wir das Dorf provisorisch verbarrikadiert. Zum Glück liegt es auf der Kuppe eines Berges. Ich schätze, wir sind hier so ungefähr auf achthundert Meter Höhe. Es gibt in den Bergen nur wenige Zeds, sodass wir das Ganze relativ ruhig und gelassen angehen können. Im Gegensatz zu der Horde, die uns alle vor einigen Tagen beinahe das Leben kostete, herrschen hier geradezu himmlisch paradiesische Verhältnisse. Ich habe mit Eckhardt nach einer ersten Ortsbegehung sofort einen Plan zur Absicherung des Dorfes ausgearbeitet.
Rennes-le-Château liegt strategisch mehr als günstig auf einem Berg, es gibt nur eine Zufahrtsstraße. Den Zugang zum Dorf im Nordosten werden wir mit einem massiven Tor verbauen, aber die Befestigung rund um das Dorf herum wird wohl etwas aufwendiger. Sepp hatte die Idee, das Dorf mit einer Mauer aus Überseecontainern zu umgeben. Er meint, man könnte diese gewissermaßen modular verbauen und zusammenschweißen und so einen Festungswall konstruieren, der sogar als Lager nutzbar wäre. Der Junge hat manchmal richtig gute Ideen. Holger schlug vor, Solartechnik und Windgeneratoren zu bauen, sogar eine Biogasanlage könnte er hinkriegen, meinte er.
Materialbeschaffung dürfte nicht so das Problem werden. Auf der Tour durch die Vorpyrenäen haben wir jede Menge Ortschaften gesehen, in denen wir das Benötigte requirieren können. Hier in der Gegend haben wir seit Tagen keine lebenden Menschen mehr gesehen. Das Virus hat den Süden Frankreichs komplett entvölkert. So fällt es uns im Grunde genommen leicht, uns das zu nehmen, was wir benötigen. Man hat dann kein schlechtes Gewissen, in ein Gebäude einzudringen und Dinge, die noch vor wenigen Monaten irgendwem gehörten, einfach an sich zu nehmen. Die verderblichen Waren sorgen in den Supermärkten, die wir durchsucht haben, teilweise für eine erbärmliche Geruchskulisse, Schimmel und andere Pilze breiten sich in den dunklen Hallen aus. Insekten, Witterung und Pilzbefall zerstören mittlerweile auch die trockenen, haltbaren Lebensmittel, sodass wir uns häufig auf Konserven beschränken. Davon allerdings werden wir in nächster Zeit komplette LKW-Ladungen ins Dorf schaffen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, in denen dieser Nachschub ausbleiben wird.
Wir müssen für diese Phase unbedingt tragfähige Konzepte entwickeln, zumal unsere Gruppe durch den Zulauf auf der Reise ja jetzt nicht unerheblich gewachsen ist. Wir werden also das im Refugium erprobte Konzept für nachhaltiges Wirtschaften ausbauen müssen. Ich habe mit Eckhardt vereinbart, dass wir in spätestens zwölf Monaten sowohl den Verteidigungsring als auch die Produktionsstätten einsatzbereit haben. Wir müssen selbst in einer akuten Bedrohungslage fähig sein, das Dorf zu verteidigen und gleichzeitig unsere Produktion am Laufen zu halten. Das stellt uns vor große Aufgaben, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.
Alle hier in der Gruppe sind seit dem schwerwiegenden Ereignis an dem Tunnel, das uns beinahe das Leben gekostet hätte, hoch motiviert. Im Angesicht des drohenden Todes hat wohl jeder von uns den wahren Wert des Lebens erkannt. Diese Offenbarung war nicht für jeden leicht hinzunehmen, aber nun, wo wir beginnen, die Häuser in unserem neuen Zuhause zu beziehen, realisieren wir, wie groß diese zweite Chance ist, die uns gegeben wurde.
Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, hier in Rennes-le-Château eine neue Heimat für uns alle zu errichten, und ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch noch Zuwanderer bekommen. Eckhardt ist von dem Gedanken, Fremde bei uns aufzunehmen, nicht besonders angetan, aber letztlich bleibt uns nichts anderes übrig, denn die Hälfte unserer Leute hier ist jenseits der vierzig und wir müssen auch an die Zukunft unserer Gemeinschaft denken. Außerdem könnte ich nicht jemandem, der wirklich Unterstützung braucht, die Hilfe verweigern.
Ich frage mich hin und wieder, wie lange dieser Ausnahmezustand wohl andauern mag. Er ist natürlich schon zu einem Teil Routine geworden. Man schaut sich um, bevor man das Haus verlässt, man ist stets bewaffnet und zu jeder Minute bereit, einen Zed-Angriff abzuwehren. Ich glaube, der Begriff ›Zed‹ stammt von den britischen Militärs, die im Zuge der Streitkräftekonsolidierung in der Festung von Helgoland eintrafen. Eigentlich sind diese Zeds Kreaturen, wie sie in vielen Geschichten und Filmen beschrieben wurden. Professor Wildmark hat uns erklärt, dass die Virenkerne in die Zellen eindringen, die DNA der Infizierten quasi umschreiben und die Kontrolle über die biochemischen Vorgänge übernehmen. Tatsächlich sind die Infizierten im medizinischen Sinne tot. Dennoch wandern oder rennen sie herum und sind in der Lage, sich zu orientieren. Bisweilen werde ich das Gefühl nicht los, dass sie sogar miteinander kommunizieren. Zumindest die, welche als Hunter bezeichnet werden. Wildmark meint, ob ein Infizierter zu einem Walker oder zu einem Hunter wird, das entscheide sich anhand seiner genetischen Disposition. Je höher entwickelt ein Individuum ist, desto agiler und aggressiver ist es im Zed-Stadium. Deswegen sind wohl auch fast alle Wirbeltiere, die das Virus ebenso befällt, inzwischen verendet. Sie können nicht einmal als Zeds weiterexistieren.
Wildmark meint, das Virus könnte aufgrund seiner massiven Verbreitung unter Umständen mutieren und noch andere, vielleicht sogar aggressivere Zed-Varianten hervorbringen. Da sei der Herr vor, aber wir müssen uns auch darauf vorbereiten. Ich werde mit Eckhardt einige mechanische Verteidigungsmaßnahmen für unser Dorf besprechen, die wir beim Bau in den Wall implementieren. Da kommt einiges an Arbeit auf uns zu. Da die Zeds nicht einfach sterben wie wir Menschen – sie sind ja genau genommen bereits tot – sind wir ihnen gegenüber biologisch gesehen im Nachteil. Das Virus hat sich binnen kürzester Zeit über die gesamte Welt verbreitet und damit gigantische Armeen Untoter erschaffen, die es nach Menschenfleisch gelüstet. Wenn diese ihre angestammten Reviere leer gefressen haben, werden sie sich in Bewegung setzen, um neue Jagdgründe zu erschließen. Das bedeutet also für uns, dass es keine Frage ist, ob die Zeds in Massen kommen, sondern lediglich eine Frage des Wann. Wir müssen auf massive Angriffe vorbereitet sein, und das so schnell wie möglich.
Eckhardt spricht auch über die Abwehr von Plünderern, doch das macht mir eigentlich keine großen Sorgen. Ich vermute, in Extremsituationen wie diesen werden die verbleibenden Menschen zusammenrücken und das einzig Sinnvolle tun, nämlich sich gegenseitig unterstützen und ihre Ressourcen vereinen, wie wir es in der Gesellschaft des Willens taten und noch immer tun. Nur dadurch haben wir als Spezies überhaupt eine Chance, diese Apokalypse zu überleben.
Wir verwenden immer diesen Begriff ›Apokalypse‹ – ich tue das ja auch –, aber eigentlich bedeutet das Wort Offenbarung, Entschleierung und nicht Weltenende und Zerstörung der Zivilisation. Im Laufe unserer Reise vom Norden hierher habe ich das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung erfahren, es verstanden und dessen Tragweite begriffen. Für mich ist diese Katastrophe in der Tat eine Apokalypse, denn ich sehe am Horizont eine vollkommen neue Gesellschaftsform heraufdämmern. Eine Zivilisation, die auf einer soliden Willensethik fußt und es den Menschen, die wie Sterne am Firmament sind und ihre Bahnen ziehen, ermöglicht, ihrem eigenen Weg aus der ihnen innewohnenden Willenskraft heraus zu folgen. Ich weiß nicht, ob ich oder meine Kinder diese neue Zivilisation erleben, vielleicht muss es auch erst noch viel schlimmer kommen, bevor eine signifikante Veränderung eintritt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. In diesem Sinne birgt der Zusammenbruch auch die Chance auf einen Neuanfang, und eine Welt ohne Menschen kann und will ich mir nicht vorstellen.
Nun werde ich dieses Journal für heute schließen und die Mutter meiner Kinder begraben, in der Erde unserer neuen Heimat.«
17. August im zweiunddreißigsten Baktun
»Schöne neue Heimat«, ätzte Terion und schürte das kleine Feuerchen, auf dem er Teewasser aufgesetzt hatte. »Ein Haufen Schrott, Steine und Sand auf einem Berg.«
Xiuna schloss die Kladde und legte sie wieder in ihren Rucksack. Bei dem Journal handelte es sich um ein elektronisches Modell älterer Bauart, das jedoch noch seinen Dienst tat und sich mit einem kleinen, faltbaren Solarpaneel problemlos aufladen ließ. Xiuna hatte eine Weile gebraucht, um sich in das beinahe schon antike Betriebssystem einzuarbeiten, aber mittlerweile kam sie damit gut zurecht. Alv Bulvey hatte seine gesamten Erinnerungen und Tagebücher neben der schriftlichen Form auch digital gespeichert, und da diese Einheit über einen Festwertspeicher verfügte, kam es nicht zu Datenverlusten.
Xiuna hatte vor, die Journale ihrer Mutter zu übergeben. Sie konnte sich vorstellen, dass Runa daran Gefallen finden würde. Außerdem konnte Xiuna während der Reise weiter in den Büchern stöbern, was sie in den Pausen sehr gern tat. Sie konnte den Erfahrungsberichten der ersten Generation viel Nützliches entnehmen und sie interessierte sich dafür, zu erfahren, wie alles begonnen hatte. Auch Terion hörte sich die Geschichten gern an, allerdings konnte er ihnen nicht so viel abgewinnen wie seine Schwester.
Die beiden waren nun den zweiten Tag unterwegs Richtung Norden, um zum Castlegate-Komplex zurückzukehren, wo ihre Mutter schwer verletzt auf Xiunas Unterstützung und Hilfe wartete. Die Geschwister hatten die Nacht über eine beachtliche Strecke zu Fuß über die hohen Dünen zurückgelegt, die der Saharawind mit seinem feinen Flugsand permanent über das Gebirge legte. Die hohen Kämme der mächtigen Sicheldünen – der Barchane – veränderten ihr Muster stetig und es bedurfte profunder Kenntnisse über das Wandern in der Wüste, um sich hier nicht zu verlaufen.
Im Schatten der Ruine eines alten Fabrikgebäudes, das teilweise noch aus den Sandfluten emporragte, wollten sie den größten Teil des Tages verbringen, um während der Zeit der Mittagshitze ihre Kräfte zu sparen. Sie hatten Deckung in dem von Flugsand malträtierten Gemäuer gefunden. Der Sand hatte die alten Lehmziegel ausgeschliffen, sodass die härteren Betonfugen deutlich hervorstanden. So war quasi ein Negativrelief der ursprünglichen Mauer entstanden. Verbogenes Metall, das im Innenbereich der Ruine verrostet, außerhalb der Mauern jedoch sandpoliert war und in der Sonne glänzte, ragte skelettartig aus dem Boden. Man musste sich höllisch vorsehen, nicht in die scharfkantigen Metallteile zu treten, die teilweise nur Millimeter unter der Sanddecke verborgen lagen und einem unachtsamen Wanderer besonders üble Verletzungen zufügen konnten. Am gefährlichsten wurden hier draußen stark blutende Wunden oder jene Verletzungen, welche die Beweglichkeit einschränkten, zum Beispiel Knochenbrüche. Erstaunlicherweise bildeten Wundinfektionen in dieser von Zeds heimgesuchten Welt nur eine geringe Gefahr, denn der regelmäßige Durchzug des Megablisters sterilisierte die Wüste in bestimmten Intervallen. Gerade erst waren die violett irisierenden Wolken des Blisters über das Sandmeer gewandert, sodass man davon ausgehen konnte, zwischen den Silikatkörnchen nicht einmal eine Spur von Leben zu finden.
Terion hatte den Lagerplatz eingehend untersucht und für gut befunden, während Xiuna sich darum kümmerte, Brennholz herbeizuschaffen, was nicht besonders schwierig war, denn jedes Stückchen Holz, das man hier in der Wüste fand, eignete sich hervorragend zum Verbrennen. Terion hatte aus einigen alten Blechteilen, die wohl zur Produktionsanlage gehörten, einen kleinen Ofen gebaut, den er mit trockenen Zweigen und zerbrochenen Ästen befeuerte. So blieb das rauchlose Feuer in der Blechbox nach außen hin unsichtbar und mit wenig Brennstoff erzielte er maximale Wirkung. Nachdem er die beiden Becher mit den Teenetzen aufgegossen hatte, benutzte Terion das restliche heiße Wasser, um für sie beide etwas von der Trockennahrung zuzubereiten, von welcher er aus den Vorratskellern von Rennes-le-Château einige Beutel mitgenommen hatte. Es handelte sich um Kunststoffbeutel, die – der französischen Beschriftung nach – asiatisch anmutende Nudelgerichte enthielten. Man konnte die Nahrung direkt in diesen Beuteln zubereiten, indem man heißes Wasser hineingoss und einige Minuten wartete, bis der Inhalt aufquoll. Das karge Mahl duftete erstaunlich verführerisch, fand er und reichte seiner Schwester einen der Beutel, den sie vor sich in den Sand stellte. Sie schüttelte den Kopf und sagte:
»Das ist nicht nur ein Haufen Schrott und Steine dort …«
»… und Sand. Vor allem: Sand!«, ergänzte Terion ungefragt, schob eine Hand in den Untergrund und ließ den Sand durch seine Finger rieseln.
»Sei nicht so hart in deiner Beurteilung, Bruder. Ich habe ein RLC gesehen, das erblühte und voller Leben war. Überall wuchsen Pflanzen und die Menschen waren freundlich zueinander. Ich habe dort sogar Tiere gesehen.«
»Ja, irgendwann in der Vergangenheit, Schwesterherz. In deinen krassen Visionen. Ich hingegen bin durch das Dorf gestapft und habe eben nichts als Schrott, Steine und Sand gesehen. Du vergibst mir sicherlich, wenn ich deine Begeisterung nicht recht zu teilen vermag.«
»Warum bist du immer so negativ, Terion?«
»Ich nenne es: realistisch. Ich hab ja vollstes Verständnis dafür, dass diese Visionen dich berühren, Xiuna. Ehrlich. Und ich freue mich, dass du in der Lage bist, solche schönen Dinge zu sehen. Du hast es mir ja schließlich auch gezeigt. Dennoch ist das für mich fern, nicht greifbar, es ist eine Fiktion, deren Echo aus der Vergangenheit zu uns herüberschwappt. Ich bin im Hier und Jetzt. Ich mache mir Sorgen. Sorgen um Mutter und auch um Vater, um die Bewohner des Castlegate-Komplexes. Ich mache mir Sorgen wegen dieses irren Mutanten, der uns alle fressen oder versklaven will. Und ich mache mir sogar Sorgen darum, dass unser Klima durch den Megablister bald dermaßen einschneidende Veränderungen erfährt, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist und die Schäden derart immanent werden, dass es lebensfeindlich wird. Der Meeresspiegel steigt in einem Tempo, das mir Angst macht, Europa ist eine Wüste und das Zed-Virus hat ein Artensterben ausgelöst, wie es das seit Millionen von Jahren nicht gegeben hat. Und du fragst mich allen Ernstes, warum ich so negativ bin? Xiuna, unsere Welt geht den Bach runter!«
Seine Stimme brach beinahe, so sehr hatte er sich mit wenigen Sätzen in Rage geredet.
Xiuna schaute ihn unverwandt an.
»Wir werden das in Ordnung bringen, Terion«, antwortete sie in einem Ton, als spräche sie von einer Teetasse, deren Henkel abgebrochen war. »Mach dir keine Sorgen.«
Er sah sie an, als hätte ihn ein Pferd getreten.
»Was, bitte?«, platzte es aus ihm heraus. »Was sagst du? In Ordnung bringen? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Es geht hier nicht darum, dass jemand im Bunker in den Teich gepinkelt hat. Hier geht es um weltweite klimatische Veränderungen, Xiuna. Was willst du da in Ordnung bringen?«
Sie sah ihn mit diesem Du-weißt-schon-Blick an.
»Was machen wir in der anderen Sache?«, fragte Terion vorsichtig, auf ihren noch nicht sichtbaren Bauch deutend, um das Thema zu wechseln. »Ich meine, was sagen wir Mutter und Vater?«
»Die Wahrheit.«
»Na das kann ja heiter werden. Ich bin dann sein Vater und zugleich sein Onkel.«
»Ihr.«
»Was?«
»Ihr Vater. Das Kind ist ein Mädchen. Unsere Tochter wird den Namen Amisa tragen.«
Seine Stimme wurde urplötzlich weich und verlor den anklagenden Unterton.
»Ein Mädchen. Was bedeutet der Name?«
»Das Ende.«
»Sicher, was sonst«, entgegnete er resigniert. »Xiuna, ich weiß nicht recht, ob ich dich lieben oder hassen soll. Darüber denke ich noch nach. Aber eines ist mal sicher: Im Castlegate-Komplex wird unser Verhältnis auf erheblichen Widerstand stoßen. Das sind alles grundehrliche, strenggläubige Christen dort, und sie werden wenig Verständnis für den exotischen, spirituellen Charakter dieser Angelegenheit aufbringen. Die werden uns den Levitikus oder sogar die gesamte Biblia Cleri um die Ohren hauen.«
»Das werden sie nicht tun.«
»Ach. Und warum sollten sie darauf verzichten, uns mit Schimpf und Schande fortzujagen?«
»Weil du ihr Anführer bist.«
»Unser Vater ist der Anführer.«
»Weil du ihr Anführer sein kannst. Wir werden ihnen jetzt noch nichts sagen. Unser Aufenthalt im Bunker wird nicht von allzu langer Dauer sein. Später wird sich die Situation klären.«
Terions Miene verfinsterte sich.
»Ich möchte, glaube ich, gar nicht wissen, was meine Schwester unter klären versteht. Apropos später. Wie gedenkst du eigentlich, in deinem Zustand den Kampf gegen die Nephilim aufzunehmen? Mit einem runden Babybauch wird Prana-Bindu sicherlich nicht so einfach sein, nicht wahr?«
Xiuna reagierte völlig gelassen auf seine Stichelei.
»Amisa ist ein Teil von mir. Sie wird sich den Gegebenheiten anpassen.«
»Das weißt du.«
»Natürlich. Ich stehe in ständigem Kontakt mit ihr.«
Terion verdrehte die Augen.
»Ach ja, natürlich, ich vergaß. Dieses telepathische Was-auch-immer-Weiber-Ding. Klar. Das, was wir Männer in unserer spirituellen Tumbheit natürlich nicht erfassen können.«
Xiuna reagierte vollkommen anders als erwartet. Sie nahm blitzschnell seine Hand und führte sie an ihren Körper, legte sie auf ihren Bauch und hielt sie dort fest. Terion schaute verdutzt. Einen Moment lang geschah nichts, dann weiteten sich seine Pupillen, bis sie beinahe den gesamten Glaskörper ausfüllten. Er drehte langsam den Kopf und sah Xiuna ins Gesicht. Aus seinen Augen liefen Ströme von Tränen.
18. August im zweiunddreißigsten Baktun (I)
Blut floss aus den Augen, als der Kopf des Menschen mit einer von Torg Abilas mächtigen Scheren zerdrückt wurde. Die gellenden Schreie des Menschen verstummten schlagartig.
Der unförmige Koloss schüttelte seine gepanzerten Brustsegmente und ließ die Chitinpanzerung knarzend übereinander reiben. Die Tentakel an seinem Halsansatz schossen hervor und öffneten den geborstenen Schädel. Aus dem nur noch in Ansätzen menschlich anmutenden Mund Torg Abilas schob sich ein schmaler Rüssel und tauchte in die geöffnete Schädelhöhle. Mit widerlichen Geräuschen sog die Kreatur das Hirn des Opfers heraus.
Die Gliedmaßen des Getöteten hingen schlaff am Körper herab, doch nun rissen die Tentakel sie einfach ab und warfen sie quer durch den gewaltigen Felsendom, in welchem der Anführer der Nephilim zu residieren pflegte. Gierig stürzten sich die Arbeiterdrohnen, die ihren untoten Schwarmführer wie einen Halbgott verehrten, auf die Leichenteile. Wie ein Rudel Hyänen zankten sie sich um das Fleisch.
Torg Abila schätzte das warme Fleisch und noch mehr das Gehirn, denn durch seine telepathischen Fähigkeiten war er im Moment des Todes seines Opfers in der Lage, dessen Gedanken und Erinnerungen ebenso zu konsumieren wie das blutende Fleisch. Er schätzte diese besondere Stimulanz außerordentlich. Es bereite ihm Freude, in den Erinnerungen Sterbender zu schwelgen. Dieser Emotionstransfer glich dem Konsum einer hoch dosierten Droge, die Torg Abilas endokrines Botenstoffsystem dazu veranlasste, dopaminähnliche Substanzen auszuscheiden. Der Rausch, den diese widernatürliche Form der Stimulation erzeugte, erschütterte den gesamten unförmigen Leib des Nephilim. Das fette, krebsähnliche Wesen gluckste.
Die Arbeiterdrohnen sahen zu, sich außer Reichweite zu bringen, um nicht durch die zum Teil unkontrollierten Bewegungen des monströsen Leibes zerquetscht zu werden. Der Koloss rollte sich auf seinem steinernen Thron, dem riesigen Granitpodest inmitten der Felsendomhalle, hin und her. Er lüftete seine Schuppen und versprühte mit hohem Druck aus den Drüsen seines Aftersegments diverse Ausscheidungen, die das Gemach des Ersten Nephilim in einen übel riechenden Nebel hüllten, der sich langsam als stinkende, schmierige Schicht aus Exkrementen auf Decke, Boden und Wänden absetzte. Diesen klebrigen Film wiederum nutzten biolumineszente Bakterien und Pilze als Nahrungsgrundlage, was den gesamten Raum in ein dämmriges Licht von leicht grünlichem Schimmer tauchte.
Torg Abila liebte diesen Ort, denn es war sein Ort. Er schätzte die Sicherheit der tief liegenden Höhlen, denn hierher drang nicht einmal die Todeswolke vor, die von Zeit zu Zeit über das Land zog und es verheerte. Dies war sein Rückzugsort und das Zentrum seiner Macht. Genau genommen war es zwar nicht seine Macht, sondern die des Iad, der Schwarmintelligenz des originären Virenstamms, aber letztlich übte er die Macht des Iad physisch aus. Und das gefiel ihm. Seit den Tagen, als er aus dem finsteren Tümpel in dem Bombenkrater im Herzen St. Petersburgs gestiegen war, vervielfachte sich seine – mentale wie physische – Kraft, und die Fähigkeit, über den Hive zu herrschen, verfestigte sich.
Seine Pläne, den Hive expandieren zu lassen, waren durchdacht und intelligent konstruiert. Lediglich die Umsetzung bedurfte hin und wieder einiger Änderungen, wie zum Beispiel diese leidige Vitamingeschichte bei den Menschen. Für Torg Abila selbst hatte das keine Bedeutung. Durch seine multispinale DNA und die zahlreichen Adaptionen in seinem Erbgut hatte er auch die Fähigkeit erlangt, sämtliche für den Betrieb des Organismus notwendigen Bauteile selbst zu generieren. Er konnte seine Nahrung in die kleinsten molekularen Teile zerlegen und diese neu anordnen, um Bauteile zu erzeugen. Sicherlich war nicht jede seiner körperlichen Ausprägungen für das Dasein als Führer des Hive erforderlich. Bei manchen der seltsamen Mutationen, die seine groteske Gestalt geformt hatten, konnte man wohl davon ausgehen, dass die Natur das tat, weil sie es konnte.
Dieser – im Grunde aus unterschiedlichster Biomasse geformte – tote Koloss besaß die Ausmaße eines Schwerlasttransporters und sah aus wie eine Mischung aus Hummer, Ameise, Mensch, Tintenfisch und Reptil, nur dass die Proportionen völlig verschoben und vollkommen widernatürlich angeordnet waren. Bei Torg Abila musste man sich die Frage stellen, ob er nun tot, untot oder auf perverse Weise lebendig war. Handelte es sich um einen Zed, einen Mutanten oder um eine gänzlich neue Spezies? Diese Frage konnte wohl niemand beantworten.
Genau genommen trieb das Problem die Wissenschaftler der Menschen schon seit dem ersten Ausbruch der Seuche um, dem Beginn der Ersten Apokalypse. Die Zeds erfüllten nach medizinischen Kriterien keine der Bedingungen, die man an lebende Wesen stellte, wie zum Beispiel messbare Kreislauf- oder Hirnaktivität. Dennoch verhielten sie sich annähernd wie lebende Wesen, denn sie bewegten sich – mehr oder weniger – zielgerichtet fort, und einige von ihnen kommunizierten sogar miteinander (auch wenn niemand exakt wusste, wie sie das taten).
Das liquide System in ihren Körpern war völlig anders als das der Menschen, der Blutkreislauf kam vollständig zum Erliegen. Der Transport von Nahrungs- und Botenstoffen zu den Zellen lief über ein Fluid, das den Zwischenzellbereich füllte und offenbar von der Muskelkontraktion im Fluss gehalten wurde. Das war wohl einer der Gründe, warum Zeds so gut wie niemals stillstanden, sondern sich stets irgendwie bewegten.
Auch schien die Energie im Körper nicht durch Verbrennung zu entstehen, denn die Zeds zeigten keine Anzeichen von eigener Körpertemperatur, wie es bei ektothermen – also wechselwarmen – Tieren stets der Fall war. Darin lag einer der Gründe, warum in den extremen Wüstenregionen die Z1-Zeds häufig an Überhitzung zugrunde gingen, da sich bei mehr als 50 Grad im Schatten die Eiweißverbindungen ihrer Körper zersetzten.
Die Nephilim allerdings hatte das Z2V1-Virus mit körperlichen Merkmalen ausgestattet, die eine Wärmeregulierung in bestimmtem Umfang zuließen, so zum Beispiel die kristalline Haut der Sandwühler, die das Sonnenlicht reflektierte und die Wärmebildung verhinderte. Sie waren im Grunde Biomaschinen, die von den Virenkernen in ihren Zellen für den Einsatz unter extremen Bedingungen optimiert wurden.
Hier zeigten sich die Grenzen zwischen komplexem Leben einerseits und – nicht unbedingt weniger komplexem – Dasein andererseits fließend, unbestimmbar und nebulös.
Die Bezeichnung Zed – hervorgegangen aus der Abkürzung Z für Zombie – stand eigentlich für das Andere, das Unbekannte, das Furchterregende. Die Formen, welche diese Wesen in einem widergöttlichen Schöpfungsakt hervorbrachten, waren mannigfaltig und bisweilen grotesk, meistens überaus abstoßend. Es handelte sich um unnatürliche Mischungen aus Mensch und Tier, oft ließ sich die Grundform nicht einmal exakt bestimmen. Wie und warum sich ein infizierter Mensch in die eine oder andere Form umwandelte, würde wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben.
Torg Abila baute auf diese abstruse Mischung des Entsetzlichen seine Macht auf, er gebot inzwischen über eine stattliche Anzahl hoch spezialisierter Krieger- und Kommandodrohnen, ebenso wie über ein Heer von Arbeitsdrohnen, die den Betrieb des Hive aufrechterhielten. Das ausgedehnte und zum Teil uralte Stollen- und Schachtsystem der Brandenburg-Zeche in Oberschlesien bot dem Schwarm ausreichend Raum, sich zu organisieren und vor allem: zu wachsen. Die quasi eusoziale Struktur des Hive verlieh ihm Stärke, und eine deutlich kommunizierte Hierarchie innerhalb des Schwarms sorgte dafür, dass Anordnungen des Anführers zeitnah umgesetzt wurden.
Das Iad als höchste autoritäre Instanz hatte sich so in gewisser Weise mit einem gewaltigen, vielgliedrigen Körper umgeben, der es weit über die Grenzen des unterirdischen Labyrinths hinaus handlungsfähig machte. Durch die Kommunikation auf Basis der Magnetfeldlinien gab es fast keine räumliche oder zeitliche Begrenzung für die Aktivitäten der zentralen Intelligenz des Hive.
Torg Abila kümmerte es wenig, dass er in dieser Hierarchie nur die zweite Geige spielte. Er war mit seiner Stellung zufrieden. Der Strom an Nahrung, die ihm – wann immer er wollte – zugeführt wurde, riss nie ab. Er wurde gefürchtet und niemand wagte es, gegen ihn aufzubegehren. Allerdings fand er, dass es nun bald an der Zeit wäre, dass alle Menschenwesen von seiner Größe und seiner Macht erfahren sollten. Zu diesem Zweck hatte er eine Kampfgruppe seiner besten Kriegerdrohnen in die westliche Stadt der Menschen entsandt, um die Wesen dort zu lehren, seinen Namen ehrfürchtig und mit Respekt auszusprechen.
Nach und nach würde er eine Stadt nach der anderen unterjochen, wenn es ihm erst gelungen war, das Höhere Wesen, nach dem es das Iad gelüstete, in seine Gewalt zu bringen. Dazu hatte er Sardor ausgesandt, den Ersten der Zenturios. Dort im Westen, im großen Sandmeer mit seinen hohen Wellenkämmen und tiefen Tälern, sollte Sardor das Wesen aufspüren und fangen.
Ob dieses Unterfangen tatsächlich so einfach war, wie es zunächst anmutete, blieb wohl abzuwarten, aber Torg Abila wurde da von gewissen Zweifeln beschlichen. Das Höhere Wesen verfügte über enorme geistige Kräfte, die selbst ihm, dem mächtigsten Nephilim, einiges an Respekt abnötigten. Sardor würde sich ziemlich anstrengen müssen, um dieses Wesens habhaft zu werden.
Aus der Zellerinnerung des neuen Struggler-Nephilim-Hybriden, die über das Netz der Linien der Kraft transferiert worden war, hatte Torg Abila einige interessante Dinge erfahren. Die Trägerin der Quell-DNA des Höheren Wesens hatte allein durch ihre geistige Kraft einen mächtigen Struggler-Anführer vernichtet und die simplen kalten Wesen gehorchten sogar ihren Mentalbefehlen. Das ihr folgende Höhere Wesen hatte seine gegebenen Erbkräfte vervielfacht, und es war damit zu rechnen, dass die Festsetzung dieses Wesens mit der Existenz vieler Nephilim zu bezahlen sein würde. Aber das bedeutete Torg Abila rein gar nichts. Das Iad hatte einen Befehl erteilt und dieser war umzusetzen, egal zu welchem Preis.
Torg Abilas Tentakel entrollten sich und fuchtelten peitschenartig wild in der stickigen Luft des Felsendoms umher, bevor sie zielgerichtet auf einen bestimmten Punkt zusteuerten. Sie umschlangen ein weiteres hysterisch kreischendes Menschenwesen und zerrten es in die Reichweite der überdimensionalen Hummerscheren, die dem Brustbereich der gewaltigen Kreatur entsprangen. Aus allen Körperöffnungen entließ das zu Tode verängstigte Weibchen Sekrete und Exkremente, als Torg Abila mit einer der großen Scheren die Schädelknochen zerdrückte, als seien es Eierschalen. Und erneut sog er lautstark aus dem Schädel die weichen Bestandteile, wobei er wieder in die Form höchster Verzückung geriet, als seine Sensoren die elektrische Ladung des sterbenden Hirns aufnahmen und er sich an den projizierten Bildern ergötzen konnte. Die Tentakel drangen durch vorhandene Öffnungen in den Körper ein und rissen Stücke des warmen Fleisches heraus. Dann warf der Nephilim den toten Leib achtlos fort, um seine abartige Entourage damit zu füttern. Das Gerangel um die Nahrung fand er höchst unterhaltsam, und nur so zu seinem Vergnügen erschlug er mit seinen mächtigen Scheren zwei Arbeiterdrohnen, die sich zu dicht an ihn herangewagt hatten. Schwund war halt, fand er, bei jeder Sache. Im Hive galt das Individuum nichts.
Als Torg Abila seine Mahlzeit beendet hatte, rollte er sich zusammen und lauschte den Übertragungen der Linien der Kraft. Interessiert verfolgte er die Ereignisse in der Stadt der Menschen. Dabei fungierten die Augen seiner Nephilim wie Bodycams, zwischen denen er hin- und herschalten konnte. Ein Paar dieser Augen richtete sich gerade auf ein mehrstöckiges Gebäude, dessen Fenster samt und sonders zerbrochen waren und das leidlich aus einem Grund noch stand, nämlich, weil es im Laufe der Zeit quasi mit Sand vollgelaufen war. Der Gebäudekomplex an der Severinstraße hatte zu seinen besten Zeiten neben einem Hotel auch zahlreiche Geschäfte, Restaurants und andere Gewerbebetriebe beherbergt. Nun war er ein im Sand begrabener Sarkophag am Rande einer ehemaligen Hauptverkehrsader.
18. August im zweiunddreißigsten Baktun (II)
»Das wird unser Grab, Thomas«, flüsterte Sirenia ihrem Partner leise zu. »Da draußen sind diese Monster.«
Vorsichtig und leise schlichen die beiden durch das verwaiste Hotel. Sie bewegten sich im dritten Stockwerk, das oberhalb der Sandgrenze lag.
Thomas Bellarom und Sirenia Fleur hatten sich vor drei Jahren auf dem Schwarzmarkt der Südstadt, unweit des großen Fischweihers, kennengelernt. Dort – im ehemaligen Rheinauhafen – züchtete das Konsortium drei, für das Thomas arbeitete, Graskarpfen und Flusskrebse. Er übte eine miserabel bezahlte Tätigkeit als Zerleger aus und verkaufte in seiner Freizeit ein Pulver aus Krebsschalen, das er auf dem Dach seiner Hood im ehemaligen Katharinengraben gewann, indem er dort die Krebspanzer trocknete und zu einem Pulver zerstieß, das man auf dem Schwarzmarkt gut traden konnte. Es diente als Geschmacksstoff für die Zubereitungen der zahlreichen winzigen Suppenküchen, die ihre kargen Menüs in Hinterhöfen und Seitengassen feilboten. Die Aufseher des Konsortiums bestach er gewöhnlich mit Tabak- oder Süßwaren, die er als Tauschobjekte erhielt. So sahen sie weg, wenn er mal wieder einen großen Korb voller Schalen und Krebsbeine fortschleppte.
Er hatte Sirenia – das war ihr Künstlername – in einer heruntergekommenen Kellerbar kennengelernt, in welcher die schlanke Frau mit den hüftlangen, feuerroten Haaren und den mintgrünen Mandelaugen gegen diverse Tauschobjekte betrunkenen, grölenden Fischverarbeitern im burlesquen Tanz ihre körperlichen Vorzüge beinahe unverhüllt präsentierte. Und wer über ein transferfähiges Punktekonto verfügte, der durfte sich im Separee auch mehr als nur einen optischen Eindruck von Sirenias ausgesprochen attraktiven körperlichen Merkmalen verschaffen. Das allerdings kam in dieser abgewrackten Gegend nur selten vor. Zumeist musste sie sich der vulgären Avancen übel riechender, stoppelbärtiger Kretins erwehren, aus denen die Strahlung der Badlands am Ostufer bisweilen hässliche, verwachsene Kreaturen gemacht hatte, die in puncto Abstoßung den Zeds in nichts nachstanden.
Thomas hatte sie vor zwei Baktunen in einer klassischen Heldenaktion vor dem rabiaten Zugriff eines baumlangen, bärigen Kerls bewahrt, der ihr Nein nicht akzeptieren wollte und zudringlich wurde. Das kostete ihn ein Auge und Sirenia den Job. Seitdem verdingte sie sich für Kleines als Fortune Teller, das hieß, sie legte die Karten, warf die Knochen und deutete daraus die Zukunft ihrer abergläubischen Klientel. Zumindest gab sie vor, das zu tun, denn dass sie bereits in sechster Generation das Gesicht besaß, wie sie ihren Kunden stets vollmundig und mit geheimnisvollem Unterton versicherte, durfte man wohl getrost in Zweifel ziehen. Doch sie beherrschte die Kunst, den Menschen das zu sagen, was sie hören wollten, und trug dies in einer Weise vor, die ihre Kunden veranlasste, den oft kryptischen Worten Glauben zu schenken. Sie verstand es, während der Prozedur in einer mystisch anmutenden – und frei erfundenen – Geheimsprache zu murmeln und mit rudernden Bewegungen über dem aufgedeckten Blatt oder dem Muster der geworfenen Rattenknochen schicksalhafte Verstrickungen zu verkünden, die allein ihrer Fantasie entsprangen.
Die Kunden liebten sie, egal, ob ihre Voraussagen nun eintrafen oder nicht. Madame Sirenia wurde schnell zu einem Begriff in der Hood, und jeder Mann wusste, dass sie einen recht aggressiven Beschützer hatte, der verhinderte, dass man ihr zu nahe kam.
Auch an diesem Tag hatte sie wieder in der Nähe des Turms der katholischen Kirche an der alten Bundesstraße Hof gehalten und ihre Kunden in einer schäbigen Hütte an der Überführung empfangen, als sie von seltsamen Geräuschen aufgeschreckt wurde, die aus dem U-Bahn-Schacht kamen. Ein furchtbares Kreischen dröhnte aus den Tunneln, in welchen sich sonst fast ausschließlich kriminelle Subjekte aufhielten, um dort ihre seltsamen Bandenkriege zu führen. Diesmal jedoch war alles anders. Die Geräusche aus dem Schacht waren derart furchteinflößend, dass sie Thomas bat, diesen Ort mit ihr sofort zu verlassen und Schutz zu suchen.
Sie rannten über die Brücke und drangen in das große Gebäude ein, um sich in dem geräumigen Hotel zu verstecken. Thomas konnte die Gefahr noch nicht wahrnehmen, aber die furchtbaren Schreie, die dem eigenartigen Gekreische folgten, konnte man nicht ignorieren. Irgendetwas war dort unten, etwas Böses. Nun harrten die beiden im dritten Stockwerk des Hotels aus und hofften, der Kelch möge an ihnen vorüberziehen.
In den Zimmern standen selbst jetzt, beinahe zwei Generationen nach Ausbruch der Seuche, noch immer Möbel aus Plastik. Alles Brennbare hatten die Plünderer im Laufe der Zeit bereits entfernt und irgendwo hin verschleppt. Nur noch Kunststoff, Glas und Metall fand man hier. In einigen Schränken hingen sogar noch verblichene Kleidungsstücke. Die Innenstädter sandten von Zeit zu Zeit Besorger