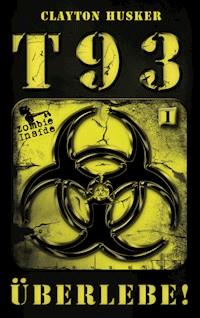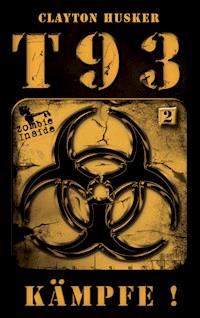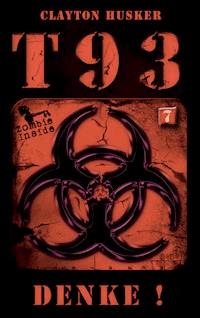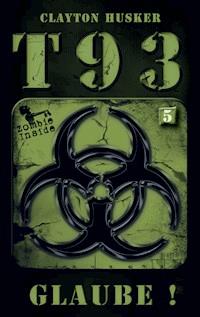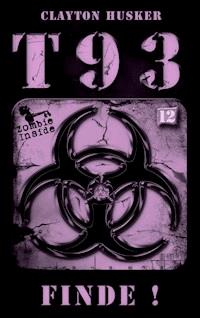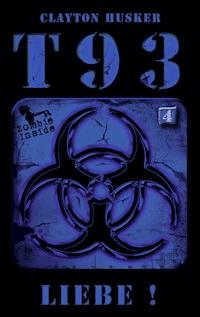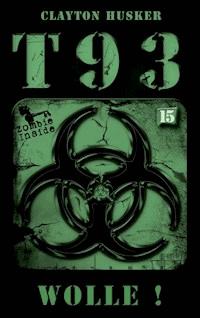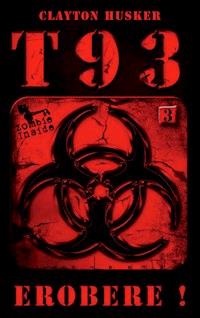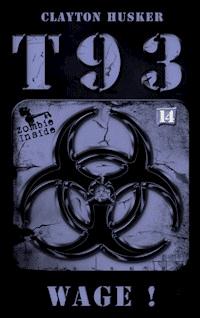
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HJB
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: T93
- Sprache: Deutsch
General Pjotrew steht vor seiner bisher schwersten Entscheidung. Soll er die Warnungen der Wissenschaftler ignorieren und die neu entwickelten Waffen einsetzen? Höchst gefährliche Waffen, deren mögliche Nebenwirkungen er nicht einschätzen kann. Doch welche Wahl bleibt ihm? Denn die Heere der Untoten haben sich bereits in Bewegung gesetzt und Millionen von Zombies beginnen mit der Erstürmung der Grenze zu den Siedlungsgebieten der Menschen. T93 – die Zombie-Serie von Clayton Husker entführt dich in eine Welt, die von lebenden Toten dominiert wird. Doch die Menschheit ist noch nicht am Ende. Mitten in der Nordsee, auf der Insel Helgoland, formiert sich der Widerstand gegen die Zombie-Invasion. Mit allen greifbaren Ressourcen treten die Menschen zum letzten Gefecht an. Der Krieg gegen die Zombies beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
T93
Die deutsche Zombie-Serie
von
Clayton Husker
Inhalt
Titelseite
Band 14: Wage!
Prolog
Jahr drei, 16. Juni, Morgen
Jahr drei, 16. Juni, Mittag
Jahr drei, 17. Juni, Morgen
Jahr drei, 18. Juni, Morgen
Jahr drei, 18. Juni, Mittag
Jahr drei, 21. Juni, Morgen
Jahr drei, 21. Juni, Mittag
Jahr drei, 22. Juni, Nachmittag
Jahr drei, 23. Juni, Nachmittag I
Jahr drei, 23. Juni, Nachmittag II
Jahr drei, 23. Juni, Nachmittag III
Jahr drei, 23. Juni, Nachmittag IV
Jahr drei, 25. Juni, Morgen
Jahr drei, 26. Juni, Morgen
Jahr vier, 13. Juli, Morgen
Jahr vier, 16. August, Mittag
Jahr vier, 16. August, Mittag
Jahr vier, 16. August, Nachmittag
Empfehlungen
Clayton Husker: T93
Clayton Husker: Necronomicon Tales
Eric Zonfeld: Nation-Z
Ren Dhark Classic-Zyklus
Impressum
Band 14:Wage!
»Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.« – L. A. Seneca
»Neue Arten der Problemlösung finden wir nur, indem wir nach neuen Wegen suchen und den Mut haben, sie zu beschreiten.« – G. Kasparow
Prolog
Leise knurrend saß er vor der Gittertür im Untergeschoss seines Verstecks, das aus einer Vielzahl von Gängen und Zellen bestand. Hier hatten die Betreiber der Bank, der dieser Bau gehörte, Wertgegenstände und Goldreserven ihrer Kunden gelagert und sie vor den Augen des devisenhungrigen Staates verborgen. Doch nun standen diese Lager leer, Plünderer hatten sie geräumt. Als ob man Geld fressen könnte.
»Bitte! Ich habe doch nichts getan! Lassen Sie mich doch bitte, bitte gehen …«
Die junge Frau in der Gitterzelle wimmerte und bettelte um ihr Leben. Sie hatte einen schweren Schlag auf den Kopf abbekommen. Ein feiner Faden verkrusteten Blutes verunzierte ihre rechte Schläfe. War sie eben noch im Wiborskipark unterwegs gewesen, fand sie sich nun plötzlich in einer Art Gefängniszelle wieder, ohne Fenster und ohne Einrichtungsgegenstände. Sie wähnte sich in der Gewalt einer dieser Jugendbanden, die hier bisweilen ihr Unwesen trieben und die Neubürger drangsalierten.
Ludmilla Proschenkowa war vor einem halben Jahr mit ihrem Mann Dimitri aus der Gegend von Kaliningrad hierher nach Sankt Petersburg übergesiedelt. Die Aussicht auf neue Horizonte beim Aufbau der Stadt hatte die jungen Leute gelockt. Sechsundzwanzig Jahre alt war sie nun, hatte im Keller einer alten Konservenfabrik die furchtbare Apokalypse einigermaßen heil überstanden und nach der Befreiung durch die neue Armee ihren Mann kennengelernt. Sie arbeitete als Kinderpflegerin im Krankenhaus, während er als Elektroingenieur half, die Versorgungsleitungen in Sankt Petersburg wieder in Gang zu bringen.
Und nun? Sie befand sich in größter Gefahr. Wahrscheinlich würde man sie vergewaltigen oder umbringen oder beides. Tränen rannen über ihr Gesicht. Dass ihr Schicksal etwas noch wesentlich Grausameres für sie bereithielt, hätte sie in ihren schlimmsten Albträumen nicht sehen können, ohne wahnsinnig zu werden.
Hier, in der kalten, dunklen Umgebung ihres Gefängnisses, in dem Tauwasser von der Decke tropfte und seltsam verzerrte Töne in den Pfützen erzeugte, bekam die Furcht eine neue, nie erlebte Qualität. Sicher, in der Zeit der Apokalypse hatte sie sich gefürchtet, mehr als je zuvor in ihrem Leben. Doch nun, hier in der ausweglosen Situation des Gefangenseins, einem Unbekannten wehrlos ausgeliefert und zu Tode erschrocken, war es nackte Panik, von der Ludmilla erfasst wurde. Im Grunde wünschte sie sich nur noch, der oder die Täter mochten ihre Untaten schnell verüben, um dann von ihr abzulassen und wegzugehen. Ja, sie sollten machen, was sie wollten und dann einfach weggehen. Einfach nur weggehen. Oder sie, Ludmilla, gehen lassen. Sie würde keinem Menschen etwas verraten.
»Hören Sie«, flehte sie mit zitternder Stimme, »ich werde niemandem etwas sagen, ich schwöre es. Nehmen Sie sich, was Sie wollen. Ich werde keinen Widerstand leisten. Ich sehe Sie nicht an und werde niemandem etwas erzählen. Aber bitte, lassen Sie mich dann gehen!«
»Du gehst nicht. Du hast eine Bestimmung.«
Die dröhnende, von tiefem Bass erfüllte Stimme donnerte förmlich durch das Gewölbe.
Ludmilla konnte den Sprecher nicht sehen, er stand etwas weiter weg, im Dunkel des unbeleuchteten Flurs verborgen. Durch einen der Seitengänge fiel schummriges Licht. Dort schien es Lampen oder ein Oberlicht zu geben, sie konnte das nicht genau ausmachen. Ihr Kopf schmerzte noch immer und diese Stimme dröhnte in ihren Ohren.
»Ich werde dir eine einmalige Gelegenheit verschaffen, alles hinter dir zu lassen, was du bislang zu erdulden hattest. Ich biete dir ein neues Leben, das ewig währen kann – wenn du es willst. Nimm meine Hand, sieh nicht hinter dich. Dann wird da ein neues Leben für dich sein.«
Der Sprecher trat in das fahle Licht des angrenzenden Flurs. Ludmilla schrie.
»Es hat keinen Sinn, wenn du schreist.«
»Wer … was sind Sie? Warum können Sie mit mir sprechen?«, presste die vor Angst schlotternde junge Frau hervor.
Der andere richtete sich auf. Er musste den Kopf etwas einziehen, um nicht an die Decke zu stoßen. Die klägliche Reflexion des Sonnenlichts, die hier unten ankam, tauchte den gewaltigen, muskelbepackten Körper des Strugglers in weiches, gelbliches Licht. Eine solche Gestalt hatte sie schon einmal gesehen, nur war dies in einem Kinofilm und das Wesen besaß grüne Haut. Doch dies hier entsprang nicht den Fantasien eines überbezahlten Hollywoodregisseurs, dies war die Realität. Das wurde Ludmilla schmerzlich bewusst, als das Wesen zu ihr sprach.
»Ich bin Heru’ur, unsterbliches Höchstes Wesen, der Nephilim, Anführer der Kalten. Ich bringe das Dunkle Licht des Einen Gottes. Durch mich wird sein Wille verkündet. Ich habe dich, Sterbliche, auserkoren, meine Zweite zu sein, mit mir eine neue Generation zu begründen, um eines nicht mehr fernen Tages über diesen Planeten zu gebieten. Mach dich also bereit, mir auf meinem Pfad zu folgen.«
Dabei ließ er es bewenden, riss die Metallgittertür brutal aus den Angeln und warf sie achtlos mit einer Leichtigkeit fort, als wäre sie aus Papier. Ludmilla sah ihr letztes Stündlein schlagen. Sie würde ihr Leben aushauchen, von einer monströsen Kreatur vergewaltigt und geschändet.
Ludmilla Proschenkowa schrie ihre Furcht, ihr Entsetzen und ihre Hilflosigkeit gellend heraus, als der massige Körper das wenige Licht verdeckte und sich über sie beugte.
Heru’ur hob den zitternden Menschen an den Kleidern zu sich empor und schlug seine Hauer in den Hals. Die junge Frau zappelte und schrie, als seine Zähne die Haut durchdrangen und das Blut aus der Wunde austrat. Der Struggler machte dabei ein glucksendes Geräusch, denn die Erschaffung eines weiteren Nephilim bereitete ihm offenbar Freude. Schmatzend saugte er den hervorquellenden Lebenssaft aus und genoss es, das warme, energiereiche Blut in sich aufzunehmen.
Im Gegenzug drangen Millionen Viren des Z1V35-Stammes über den Speichel der Bestie in das Gewebe der Frau ein, wo sie sofort damit begannen, ihr biologisches Programm umzusetzen und die Zellen des Körpers zu attackieren.
Als die Gegenwehr der kleinen Gestalt in Heru’urs Händen nachließ und die Kräfte sie verließen, legte er sie auf dem Boden der Zelle nieder. Die Verwandlung würde einige Augenblicke benötigen. Seine Aufmerksamkeit wurde in diesem Moment auf eine winzige, eher unbedeutende Verzerrung des Magnetfelds gelenkt, die ihn jedoch stutzig machte, da sie völlig unerwartet auftrat. Er ließ von der Frau ab, begab sich in einen anderen, zentraler gelegenen Teil des Untergeschosses, der direkt unter der großen Glaskuppel lag, und horchte.
Ludmilla erlebte derweil einen totalen Albtraum, der sie weit über die Grenzen erträglicher Pein hinausbrachte. Zunächst hatte diese völlig unerwartete Attacke sie komplett aus der Bahn geworfen. Dann war da dieser grausame Biss in den Hals, der ihr Schmerzen bereitete, wie sie sie noch nie erleben musste. Und zu guter Letzt saugte ihr dieses Monstrum noch das Blut aus. Das Gefühl, das sie dabei überkam, glich keiner ihr bekannten Emotion. Sie spürte das Nachlassen der Kräfte, diese unbeschreibliche Leere im Kopf, das Taubwerden der Glieder und das Erschlaffen der Muskulatur, die nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wurde. Der Blick wurde glasig, Ludmilla war nicht mehr fähig, etwas zu erkennen oder zu fokussieren. Die Gedanken, vorher in ihrer Panik noch laut und deutlich zu vernehmen, begannen nach und nach zu verstummen. Auch der Schmerz in ihren Nervenbahnen wich einer Betäubtheit, die einem Vollrausch glich. In ihrem Gehirn feuerte der Kortex ein Gewitter aus Elektronen ab und gaukelte ihren Sinnen Farben und Töne vor, die definitiv nicht vorhanden waren.
Sie spürte ihren Körper nicht mehr vollständig, alles fühlte sich an, als sei es aus Watte gemacht. Ein seltsames Wabern erfassten ihre Sinne, das jedoch tatsächlich nicht vorhanden war. Es war, als dehne sich das Fleisch auf ihren Knochen aus und zöge sich wieder zusammen. Das ursprüngliche, von nackter Furcht getriebene Hämmern des Pulsschlags verlangsamte sich zusehends, was die Panik, in der sich Ludmillas Geist befand, weiter verstärkte. Der drastische Blutverlust ließ den Kreislauf versagen, die Atmung stockte, der Tod trat aus dem Schatten der Unwahrscheinlichkeit heraus und zeigte seine hässliche Fratze. Ludmilla wollte schreien, doch dafür reichte die Energie nicht mehr. Sie spürte, dass in ihrem Inneren etwas vorging, das sie weder kontrollieren noch stoppen konnte.
Millionen von Viren fluteten ihren Körper. Sie wurden durch konvulsivische Zuckungen, die ihren Körper wie bei einem Schüttelfrostanfall erbeben ließen, in das Gewebe gepresst, von wo aus sie sich in die Zellen ihres Fleisches bohrten und dort den Zellkern angriffen. Jede einzelne Zelle wurde von vielen, meist mehr als zehn Viren penetriert und umgestaltet, um sofort neue Viren zu produzieren und diese in das interzelluläre Liquid abzugeben.
Ludmillas Körper starb, sämtliche Körperfunktionen kamen nunmehr zum Erliegen. Seltsamerweise blieb ihr Geist wach, die Wahrnehmung setzte sich fort. Bilder stürmten auf sie ein, bei denen sie nicht die geringste Ahnung hatte, woher diese kamen, denn aus ihren Erinnerungen konnten sie nicht stammen. Es waren nicht nur Bilder, die auf sie einströmten, auch eigenartige Gefühle bemächtigten sich ihrer. Der Schmerz und das Grauen des Todes hatten ihren Schrecken längst verloren und waren vergangen. Nun fühlte sie Gemächlichkeit, eine ungekannte Ruhe und etwas, das über ihre Haut strich. Wasser. Ja, es war warmes, seichtes Wasser, in dem sie sich bewegte. Sie schwamm in einem flachen, warmen Ozean und besaß einen Körper, der wenigstens zwanzig Meter lang war. Gerade als sie begann, sich in dieser Vision wohlzufühlen, wurde sie brutal herausgerissen.
Die Verteilung der Viren im Körper hatte ein kritisches Maß erreicht. Nun begann die Umwandlung in einen Nephilim-Struggler. Der Bauplan des Virus wurde über einen spezifischen Botenstoff, den die infizierten Zellen ausschütteten, aktiviert und der Komplettumbau des menschlichen Körpers wurde eingeleitet. Sämtliche Zellen begannen nun, ihre Struktur zu verändern. Die Muskelzellen vermehrten sich rasant und es wurden neue Muskelgruppen gebildet, die es vorher nicht gegeben hatte. Unnütze, für einen lebenden Organismus essenzielle Organe wurden kurzerhand demontiert, und ihre Bestandteile bildeten die molekulare Grundlage für die Neubildungen.
Der ohnehin schon gequälte Körper der einst adretten jungen Frau blähte sich unnatürlich auf. Unter der Haut wuchsen quasi im Zeitraffertempo immense Muskelpakete, die sie aussehen ließen, als sei sie ein Bodybuilder, der in einem Topf mit Steroiden gefallen war. Der Vorgang an sich bot ein völlig groteskes Bild. Unter Ludmillas Haut bildeten sich Wölbungen, die umherwanderten, bis sie den offensichtlich richtigen Platz gefunden hatten. Ein Außenstehender hätte bei diesem Anblick wohl den Verdacht geäußert, dass sich unter Ludmillas Haut irgendwelche Tiere bewegten. Die junge Frau hob ihre Arme und drehte sie im fahlen Licht, besah sich die Veränderung und schrie gellend.
Mit größter Genugtuung vernahm Heru’ur im angrenzenden Gebäudetrakt den gequälten Geburtsschrei seiner künftigen Gefährtin. Dann brach plötzlich die Hölle los.
Jahr drei, 16. Juni, Morgen
Ein hochfrequentes Sirren, das die gesamte Metallkonstruktion in Vibration versetzte, kündigte das hydraulische Öffnen des Abwurfschachtes an. Die Tupolew 160 – Rufname: Weißer Schwan – kreiste in mehr als zehn Kilometern Höhe über dem Zielgebiet.
»Ist der Einsatz der Waffe genehmigt?«, fragte der Copilot auf der Steuerbordseite des Cockpits. Der Pilot nickte und der Copilot drehte sich zum Waffenoffizier um.
»Sie sind autorisiert, die Waffe einzusetzen«, gab er den erforderlichen Befehl. Ein oftmals geübtes Szenario, das die russischen Piloten vollzogen, ohne nachzudenken. Gedacht für den Einsatz von bombergestützten Nuklearwaffen, wurde es in diesem speziellen Fall benutzt, um eine bunkerbrechende Waffe ins Ziel zu lenken. Die Maschine trug eine gewaltige Vakuumbombe – von den Militärs sarkastisch FOAB, »Father of All Bombs«, genannt –, die ein Gefechtsgewicht von mehr als sieben Tonnen mitbrachte und die Detonationskraft von vierundvierzig Tonnen TNT freisetzte. Vorab würde ein bunkerbrechender Spezialsprengkopf, der die Betondecken des Zielgebietes durchdringen sollte, abgeworfen, damit die ungeheure Zerstörungskraft der Bombe sich entfalten konnte. Der Waffentechniker zählte von drei abwärts und klinkte die Bomben aus.
»Tri – dwa – ras – sbrasywanie!«
Aus dem vorderen Teil des Flugzeugs löste sich eine GBU russischer Bauart, die den Bunker knacken sollte, denn nichts anderes war ein Banktresor. Im Bombenschacht, der in der hinteren Hälfte des Flugzeugrumpfes zwischen den beiden mächtigen Doppeltriebwerken lag, lösten sich danach die magnetischen Halterungen der Vakuumbombe und der massive Metallkörper fiel aus dem Flugzeug. Er trudelte kurz, senkte dann die Nase und schwenkte auf die vertikale Flugbahn ein, wobei er ziemlich rasant beschleunigte. Der Pilot berichtete an die Basis.
»Weißer Schwan meldet: Die Eier wurden gelegt. Wiederhole: Eier wurden gelegt.«
General Mikail Bagudijewitsch Pjotrew nahm die Meldung entgegen. Wer, zum Henker, dachte sich eigentlich immer derart alberne Einsatzcodes aus?
»Gut. Kehren Sie zur Basis zurück.«
Der Pilot wendete die Maschine und überließ die Eier ihrem Schicksal, das darin bestand, ein spezielles Gebäude in der Sankt Petersburger Innenstadt dem Erdboden gleichzumachen und jegliches Leben darin auszulöschen.
Das exakte Ziel lag am Ufer der Newa. Es handelte sich um das als Petrowski-Fort bekannte Gebäude des St. Petersburg Business Center, in welchem sich die Sankt Petersburg Bank befand und in dessen Kellergewölben sich der gefährliche Alpha-Struggler aufhielt, den Pjotrew um jeden Preis auslöschen wollte.
Diese Kreatur, die einst in ihrer menschlichen Form im Dienste des Diktators Gärtner grausame Versuche mit dem Zed-Virus an Menschen durchgeführt und sich schließlich selbst mit dem künstlich mutierten Z1V35-Virenstamm infiziert und verwandelt hatte, hauste dort im Tresorraum der Bank und befehligte mittels ihrer Mentalkräfte die Zombiearmeen im Osten, die bis vor einiger Zeit vom Struggler Kzu’ul angeführt worden waren. Heru’ur, wie er sich selbst nannte, unterschied sich von anderen Zeds dadurch, dass er zum einen über enorme telepathische Kräfte verfügte, zum anderen über ein sogenanntes Zellgedächtnis. Das bedeutete, die Masse der Viren, die in seinem Körper konzentriert war, verfügte über eine Schwarmintelligenz, deren Erinnerungsvermögen über sämtliche biologische und evolutionäre Vorstufen zurückreichte bis in die Zeit der Entstehung des Lebens auf der Erde. Genau das war es, was diese grausam entstellte Kreatur dermaßen gefährlich machte, denn sie besaß weitreichende epimorphotische Eigenschaften, konnte also sogar abgetrennte Gliedmaßen nachwachsen lassen und – was sich als besonders schwerwiegend herausstellte – beschädigte Teile des Gehirns ersetzen.
Die Menschen, die gegen die Zeds kämpften, schalteten ihre untoten Gegner zumeist aus, indem sie die Gehirne der Zombies irreparabel beschädigten. Doch wenn ein Struggler wie Heru’ur fähig war, selbst beschädigte Gehirnteile zu ersetzen, dann machte ihn das nahezu unsterblich beziehungsweise unzerstörbar.
Zudem hatte der Nephilim, wie Marschall Gärtner diese Zombieart klassifiziert hatte, Zugriff auf alle Erinnerungsengramme des Wirtskörpers, eines gewissen Doktor John Ethelston, der im Auftrag des Diktators die Veränderungen am Genpool des Virus vorgenommen hatte. Seine widernatürliche Arbeit zeitigte Erfolg und die Nephilim-Struggler wurden erschaffen. Aus ihnen wollte Gärtner eine willige Zombiearmee formen, die ihm als unsterblichem Führer dienen sollten. Das Wissen und die Kenntnisse des Wissenschaftlers lebten nun in Heru’ur weiter, der seine Fähigkeiten geschickt eingesetzt hatte, um sich zum Herrscher über alle Zombies aufzuschwingen. Dafür, dass diese Herrschaft nicht allzu lange andauerte, wollte General Pjotrew mit dem Einsatz der gewaltigen Bombe sorgen, die er auf Heru’urs Versteck hatte abwerfen lassen.
Ein hohles Pfeifen begleitete den riesigen, tonnenförmigen Sprengkörper, der durch ein Heckleitwerk stabilisiert wurde und dem voran ein KAB-1500-Penetrator lief, der bis zu zwei Meter dicke Betondecken mühelos durchschlagen konnte. Mit anderthalbfacher Schallgeschwindigkeit raste die tonnenschwere Last der Erde entgegen und tauchte in die tief hängende Schneewolkendecke über der Stadt Sankt Petersburg ein.
Unten im Bankgebäude saß Heru’ur und labte sich trefflich an den Resten einer Atzung, wie er seine blutigen, schrecklichen Mahlzeiten nannte. Er brach mit seinen gewaltigen, vorstehenden Kiefern gerade einen Oberschenkelknochen seines letzten Opfers auf, von dem er Teile in seine Höhle gebracht hatte, als der Geburtsschrei der neuen Gefährtin seine Aufmerksamkeit erregte.
Im nächsten Moment brach die Hölle über ihn herein. Die kleinere Bombe durchbrach zunächst das gläserne Kuppeldach im Innenhof des ringförmigen Gebäudes. Als der Bunker Buster detonierte, riss er ein etwa ein Quadratmeter großes Loch in die Betondecke des unter dem Kuppelraum befindlichen Kellergewölbes, in dem sich der Tresorraum befand. Als danach der eigentliche Sprengkörper eindrang, hatte Heru’ur die Gefahr erkannt. Mit einer blitzschnellen Bewegung versuchte er, den Raum, dessen schwere Betondecke auf ihn herunterprasselte, zu verlassen, doch diesmal waren selbst die extremen Reflexe eines Strugglers nicht ausreichend.
Mit der Wucht einer kleinen Atombombe explodierte die thermobarische Sprengladung der FOAB-GBU. Sie bestand im Grunde genommen aus Benzin, das von einer Treibladung fein zerstäubt und binnen Millisekunden in Brand gesetzt wurde. Die massive Ausdehnung und der Abbrand der Aerosolwolke erzeugten die vernichtenden Zerstörungen, welche dieser Bombentyp gewöhnlich hinterließ. Die Temperaturen konnten dabei partiell dermaßen stark ansteigen, dass Sand verglast wurde.
Auch in diesem Falle machte der Vater aller Bomben, wie die Russen dieses Explosionsmonster in Anlehnung an den amerikanischen Vorgängertyp nannten, dem Namen alle Ehre. Die Bombe zündete im Kellergewölbe der Bank und in Bruchteilen einer Sekunde wälzte sich die weit über eintausend Grad heiße Wolke durch das Untergeschoss. Dabei wurde dermaßen viel Sauerstoff verbrannt, dass ein enormes Vakuum entstand, die an sich massiven Wände dem Sog nachgaben und in das Zentrum der Explosion stürzten.
Wie ein gigantisches Mahlwerk zerrieben die Trümmer den Körper des Strugglers zu einem Brei aus Fleisch und Knochensplittern. Die extrem hohe Temperatur ließ das Wasser in den Zellen augenblicklich verdampfen. Als das gesamte Gebäude krachend über Heru’ur zusammenfiel, war von ihm selbst nichts mehr übrig, das man hätte identifizieren können.
Irgendwo zwischen den Tausende Tonnen schweren Granit- und Stahlbetonblöcken in dieser dystopischen Ruine klebten noch einige Zellreste. Doch an eine Wiederherstellung des ursprünglichen Gewebes war wohl nicht mehr zu denken. Der Alpha-Struggler war ausgelöscht worden.
»Hier Schwarzer Schwan. Das Ziel wurde getroffen und zerstört«, meldete der Pilot eines SU-27-Aufklärungsflugzeugs, das soeben den fast zweihundert Meter messenden Bombenkrater überflog und hochauflösende Fotos anfertigte. General Pjotrew nahm den Vollzugsbericht des Piloten entgegen, während er auf dem Weg zum Startfeld war, wo eine C-160 ihn und den Struggler von der Pjotr Weliki nach Toulouse ausfliegen sollte.
Jahr drei, 16. Juni, Mittag
»Ein wunderbarer Tag, nicht wahr?«
Alv Bulvey befand sich auf seinem Tagesrundgang durch das Bergdörfchen Rennes-le-Château. Er passierte eben das Heim von Birte und Sepp, das aus einem Hufeisen aus drei Campern bestand. In deren Mitte hatte Birte einen hübschen kleinen Garten angelegt, in den das sommerliche Licht milde einfiel, denn Sepp hatte den Raum zwischen den Wagen mit einem Segeltuchdach überspannt. Birte saß an einem rohgezimmerten Holztisch, neben sich die Wiege mit der kleinen Runa, die zufrieden vor sich hin gluckste, vor sich einen Laptop-Rechner, dessen Tastatur sie flink und geübt bearbeitete.
In der Luft lag das Aroma von Lavendel und einigen typisch mediterranen Küchenkräutern. Auch der Duft von Sommerblumen frischte das Odeur hier und da auf. Die gedämpften Geräusche des Tages wurden vom Zirpen der zahlenmäßig stark vertretenen Grillen begleitet, denn seit fast alle Wirbeltiere der Zed-Seuche zum Opfer gefallen waren, vermehrten sich einige Insektenarten über Gebühr. Im Dorf gab es seit General Pjotrews Zuzug wieder Wirbeltiere. Hühner, Ziegen, Schweine und sogar eine Handvoll Rinder lebten mit den Menschen, die den Genuss frischer Eier und Milch sehr zu schätzen wussten. Pjotrew hatte einen Zuchtstamm an Nutztieren aus einem der Hochsicherheitsställe mitgebracht, die weit im Norden lagen. Gegen Ende des Jahres würde es hier sogar erste Portionen an Frischfleisch geben, wie es aussah. Auch Birte hielt einige Hühner hier oben bei den Trailern. Diese lebten in einem überdachten, von engmaschigem Draht umspannten Gehege, das so gebaut war, dass kein virenverseuchter Singvogel eindringen und die Tiere infizieren konnte. Man hatte zwar schon seit längerer Zeit keine Singvögel oder Kleinnager mehr gesichtet – erst recht keine zombifizierten –, doch um sicherzugehen, wurden die wertvollen Tierbestände möglichst isoliert gehalten.
»Ja, herrlich, nicht wahr«, gab Birte zurück, sah allerdings nicht von ihrer Arbeit auf, in die sie so vertieft war. Alv trat an den Tisch heran und setzte sich.
»Kaffee steht da, Tassen auch.«
Birte deutete, wieder ohne aufzusehen, in die Richtung, in der eine Isolierkanne auf dem Tisch stand. Alv nahm sich eine Tasse, goss Kaffee ein und riskierte dabei einen Blick auf Birtes Monitor.
»Wichtig?«
»Wie man’s nimmt. Ich schreibe meine Erlebnisse auf.«
Alv lachte und sein dicker Bauch geriet dabei in Wallungen.
»Bedeutet das, Sepp muss los und uns nun noch eine Druckerpresse besorgen, damit du deine Memoiren auflegen kannst? Ich befürchte, wir bekommen dann bald Platzprobleme.«
Birte winkte ab. Wenigstens sah sie nun von ihrer Tastatur auf. Alv fand, dass ihr die Rolle als Mutter der kleinen Runa hervorragend stand. Sie blühte förmlich auf und wurde von Tag zu Tag schöner. Zumindest kam es Alv so vor, und er konnte sich vorstellen, dass Sepp das ähnlich sah.
»Ach Alv«, konterte sie gelassen, »wir leben doch im Informationszeitalter, oder? Und irgendwo auf seinen Servern wird Oleg doch wohl noch ein Plätzchen frei haben, an dem ich dann meine literarischen Ergüsse einer interessierten Öffentlichkeit über das Netz feilbieten kann. Falls das überhaupt irgendjemand lesen will. Eigentlich ist es so was wie Therapie. In den letzten drei Jahren hat sich mein Leben in einer Geschwindigkeit verändert, dass ich mit dem Verarbeiten kaum noch hinterherkomme. Nun war ich sogar in Amerika. Mit einem russischen Kriegsschiff. Unglaublich, oder? Ich glaube, wenn ich es aufschreibe, hilft mir das, all das Erlebte richtig einzuordnen, verstehst du?«
Alv hatte aufgehört zu lachen. Er nickte mit ernster Miene.
»Ja, ich glaube, ich verstehe ganz gut, was du meinst. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Vielleicht sollten wir alle das tun. Auf jeden Fall werde ich deine Texte lesen, wenn es so weit ist.«
Birte lächelte ihn an. Dann fragte sie:
»Wie geht es eigentlich Eckhardt? Ich habe ihn jetzt schon ein paar Tage nicht mehr gesehen.«
»Ach, der alte Haudegen ist unverwüstlich, Birte. Er hat sich von den Verletzungen gut erholt und wird uns wohl noch ein Weilchen erhalten bleiben. Er scheucht seine Soldaten schon wieder über den Kasernenhof. Business as usual, gewissermaßen.«
»Warum hast du nicht weitergemacht in Toulouse, Alv?«
Der Norddeutsche, der stets den hölzernen Charme eines Wikingers ausstrahlte, lächelte. Er trank einen Schluck Kaffee und meinte dann:
»Ach weißt du, Birte, dieses formelle Soldatending mit den ganzen Vorschriften und so liegt mir nicht. Ich mag es lieber etwas familiärer. Hier in Rennes-le-Château sind wir eine Familie. Einer ist für den anderen da, man kennt sich, übernimmt Verantwortung für den anderen und für die gesamte Gemeinschaft. In der Kaserne ist alles so … ja, ich weiß nicht … anders eben. Verstehst du? Da komm ich mir blöde vor. Ich habe auch keine Lust auf die Hahnenkämpfe mit diesen Offizieren dort. So bin ich doch lieber hier und schaue, dass unser Dorf sicher bleibt.«
Birte nickte nachdenklich.
»Wir hatten schon lange keine Zed-Angriffe mehr auf das Dorf. Glaubst du, es ist bald vorbei, Alv?«
Der richtete seinen Blick ziellos in Richtung Süden, wo man hinter der Baustelle des erneuerten Magdalenenturms die Berge ausmachen konnte. Sanft schwangen sich die grünen Hügel der Vorpyrenäen auf, um in einiger Entfernung zu einem imposanten Gebirge anzuwachsen. Vom derzeitigen Geschehen war dieser Ort weit entfernt, doch das konnte sich jederzeit ändern, wenn die Zeds durchbrachen und ihre Nation Zombie verließen, um weiter westlich wieder auf die Jagd zu gehen.
»Ich bin nicht sicher«, antwortete Alv nachdenklich, »aber ich halte es für wichtig, dass wir stets auf der Hut sind. Wir müssen darauf achten, dass unsere Wachen nicht zur Routine werden, denn darin liegt die größte Fehlerquelle. Jederzeit können kleinere und auch größere Horden die Wolgalinie durchbrechen oder aus irgendwelchen Nischen gekrochen kommen. Wir müssen zu jeder Zeit bereit sein, uns ohne Vorlaufzeit einer großen Bedrohung zu stellen. Glücklicherweise hat Eckhardt in Toulouse starke Verbände, die bei einem größeren Angriff mobilisiert werden können. Ich hatte ja immer so meine Probleme mit dem Militär, aber solange Eckhardt da das Sagen hat, bin ich ungemein beruhigt.«
Er grinste wie ein Schuljunge, der gerade die Tafel mit Spülmittel eingerieben hatte. Als Birte das sah, musste sie lachen.
»Ehrlich, als es Eckhardt so schlecht ging, da dachte ich, was wohl aus dir wird, Alv, wenn der alte Sack mal nicht mehr ist – und umgekehrt natürlich. Ohne euch wäre das hier nicht dasselbe. Also, alter Mann: Immer schön aufpassen, dass euch nichts passiert! Außerdem braucht die kleine Runa doch schließlich so etwas wie einen Großvater. Auch wenn du nicht ihr Opa bist, glaube ich, dass du diese Rolle hervorragend spielen könntest. Das gilt natürlich auch für Eckhardt.«
»Denkst du oft an deine Familie?«, wollte Alv wissen.
»Ja, das tue ich. Der Tag, an dem es geschah, wird mir niemals aus dem Kopf gehen. Aber das geht wohl vielen so, wahrscheinlich allen. Denkst du noch oft an deine Frau?«
Alv nickte.
»Natürlich. Sie war die Mutter meiner Kinder. Sie zu erlösen und vor der Verwandlung zu bewahren, war das Schwierigste, das ich je tun musste. Na ja, und es den Jungs zu erklären, das war ebenso schwer. Das wünsche ich niemandem. Aber das sind Dinge von gestern. Ist wohl besser, im Hier und Jetzt zu leben, oder was meinst du?«
»Ja, du hast recht, Alv. Und deshalb sind hier und jetzt Eckhardt und du die Opas meiner Tochter. Einfach, weil es so ist.«
Als sie das sagte, schlug sie sich auf beide Schenkel und stand dann auf.
»Machen wir einen kleinen Spaziergang mit der Kleinen, Opa?«
Alv lächelte milde und erhob sich ebenfalls.
»Das ist eine hervorragende Idee, Birte. Ich muss eh noch die Südflanke abgehen. Daraus können wir trefflich einen entspannten Spaziergang machen. Auf geht’s!«
Jahr drei, 17. Juni, Morgen
›Geiada Tabame Lonusha! Wagare darilapa – kaarpe Nokoda zodakare parami Dschisodiasod coraxo!‹
Kzu’ul ließ seine Gedanken in der Sprache des Einen Gottes auf den Linien der Kraft fliegen. Er rief den Herrn und Meister, versicherte ihm, dass die Armeen der Kalten trotz der Stärke der Warmen mit einer Kraft marschierten, die Erdbeben auslösen könne und dass der Klang ihrer Schritte der Donner des Gerichts sei. Üblicherweise lockte eine solche Formulierung den Gebieter aus der Finsternis hervor, doch diesmal blieb es still im Äther. Wieder und wieder versuchte er es, doch der Erfolg blieb aus. So sehr er auch in das Dunkel hineinhorchte, die Ehrfurcht gebietende Donnerstimme Heru’urs schwieg.
Kzu’ul hatte kürzlich mit einer riesigen Horde – dem direkten Befehl des Gebieters folgend – den Grenzfluss der Nation Zombie überschritten. Die Warmen bezeichneten stets so das Reich der niederen und höheren Kalten, für Kzu’ul besaß dieser Begriff keine wirkliche Bedeutung. In einem gewaltigen Ansturm hatte die riesige Horde, die durch Niedere verstärkt wurde, die mit der Morgensonne kamen, den Grenzzaun niedergerungen und war in das Reich der Warmen eingedrungen, wie es bereits einmal geschehen war. Tausende und Abertausende aus den Reihen der Kalten waren bei diesem Sturm gefallen, denn die Warmen setzten mittlerweile Maschinen ein, die geeignet waren, die Kalten in großen Mengen auszuschalten.
Kzu’ul hatte solche Maschinen zuvor bereits im Einsatz erlebt, als er weit westlich des Grenzflusses schon einmal ein Heer gegen die Warmen geführt hatte, nur waren die gefährlichen Maschinen damals kleiner gewesen. Sie waren anders als die Waffen, welche die Warmen stets mit sich herumtrugen und die kleine Metallsplitter schleuderten. Die Maschinen machten irgendetwas, das man nicht sehen konnte. Sie summten und brummten. Kurz darauf fielen die Kalten vor den Maschinen hin und bewegten sich nicht mehr. Ihr Fleisch roch schlecht und sie strahlten Hitze aus. Die Stimme des Fleisches erlosch und die Niederen in Reichweite der Maschinen waren nicht mehr kontrollierbar.
Nun verfügten die Warmen über derartige Maschinen in einer Größe, die es ihnen ermöglichte, tiefe Schneisen in die Front der Angreifer zu schlagen. Glücklicherweise verfügte Kzu’ul über erhebliche Kontingente an Niederen. Denn in letzter Zeit waren unglaublich viele von diesen kleinen, schmächtigen Wesen mit den seltsamen Augen im Flussgebiet angekommen, man konnte ihre Zahl schon längst nicht mehr feststellen. Wie das Wasser eines Meeres brandeten die Kalten Wesen in Wellen gegen die Bollwerke der Warmen, bis diese schließlich unter der Last der reglosen Körper zusammenbrachen und der Weg frei wurde.
Der Plan des Höchsten Wesens, die Warmen durch die schiere Masse an Niederen zu überrennen, schien aufzugehen. Der Vormarsch war kaum noch zu bremsen. Nur das Höchste Wesen selbst schien davon keinerlei Notiz zu nehmen. Dies verunsicherte Kzu’ul erheblich, denn üblicherweise kommentierte der Gebieter solche taktischen Manöver gern und wortreich über die Linien der Kraft, die alle Kalten empfangen konnten. Eigentlich genoss er diese Auftritte, mutmaßte der Struggler, doch er konnte keinerlei Anzeichen für die Anwesenheit des Höchsten Wesens ausmachen. Während seine Armee also den Fluss überschritt und sich gegen das Heer der Warmen warf, saß Kzu’ul auf einem Felsen und dachte nach.
War der Gebieter verstimmt? Sprach er nicht mehr zu seinen Untergebenen? Oder hatten die Warmen ihn mit einer dieser Maschinen derart stark beschädigt, dass er nicht mehr in der Lage war, die anderen Kalten zu erreichen? War er vielleicht vernichtet worden?
Kzu’ul dachte intensiv darüber nach, welche Veränderung ein solcher Umstand mit sich bringen würde. Für den Fall, dass es den Warmen gelungen war, Heru’ur auszuschalten, wäre er, Kzu’ul, nun wieder der Alpha-Struggler. Wobei ihm wahrscheinlich seine direkten Nachfolger schnell diese Position streitig machen würden. Es würde also zu heftigen Rangkämpfen kommen. Genau dies konnte die Armee der Kalten aber in dieser Phase des Kampfes am wenigsten gebrauchen. Selbst wenn Kzu’ul den Kalten nun befehlen würde, den Angriff abzubrechen und hinter die Linie zurückzukehren, so war es wohl keinesfalls sicher, dass die Warmen diese Geste akzeptierten und erneut Frieden hielten. Wahrscheinlicher war, dass dieser erneute Vorstoß der Kalten den Gegner nun dazu veranlasst hatte, einen totalen Krieg zu führen, der unweigerlich mit der Vernichtung der einen oder anderen Seite enden würde. Es blieb also kein anderer Weg. Kzu’ul und die Kalten mussten kämpfen bis zum Ende, so wie alles begonnen hatte.
Heru’urs Angriffsbefehl hatte eine riesige Horde in Bewegung gesetzt. Millionen von Zeds strömten gen Westen. Gierig und hungrig nach Menschenfleisch trieb es die Zeds über die Grenze, die im Zuge des Abkommens, das Kzu’ul und General Pjotrew geschlossen hatten, festgelegt worden war. Im Westen das Reich der Menschen, im Osten die sogenannte Nation Zombie. Die Menschen hatten sich bereit erklärt, zur Wahrung des Friedens den Zeds ihre Toten als Nahrungsquelle zu überlassen. Ein grausames, aber wirksames Mittel, um die unendliche Gier der Walker, Hunter und Struggler zumindest einigermaßen im Zaum zu halten. Zusätzlich lieferten die Menschen noch Nutztiere aus ihren eigenen Z1-freien Nachzuchtbeständen, damit die Struggler ihren ausgeprägten Jagdinstinkt ausleben konnten. Mittlerweile hatten auch die von Heru’ur telepathisch herbeigerufenen Horden aus dem asiatischen Raum das Grenzgebiet erreicht und drängten mit aller Macht über die Grenze. Stunde um Stunde, Tag und Nacht ergossen sich die Ströme der Untoten in das Gebiet der Menschen, in dem ein etwa fünfzig Kilometer breiter Streifen nicht mehr zivil genutzt wurde.
Inmitten dieses Streifens, in der zweiten Verteidigungslinie, stand bei Wjasniki an der M-7 die Mikrowellenbatterie MiK-802.11 unter dem Kommando von Leutnant Gerhardt Schirmacher. Südlich des Flüsschens Klijasma gruben sich die Soldaten ein, um dem Ansturm zu trotzen.
Das 11. motorisierte Schützenbataillon in der 6. Armee der eurasischen Streitkräfte hatte man erst kürzlich aufgestellt und mit der neuesten Generation an Mikrowellenwaffen ausgerüstet. Dabei handelte es sich um höchst effektive Mikrowellenstrahler im Terahertzbereich. Die Geschütze waren auf Leichtlauflafetten montiert und konnten von jedem geländegängigen Fahrzeug nahezu überallhin bewegt werden, da sie ein Gesamtgewicht von weniger als einer Tonne mitbrachten. Gespeist wurden die Geschütze von Alternativbrennstoff-Generatoren, die auf den Ladeflächen der Zugfahrzeuge montiert waren.
Leutnant Schirmacher, der aus einer bayerischen Einheit stammte, bellte seine Befehle in die Runde, als die Batterie, aus sechs Geschützen und zusätzlicher konventioneller Bewaffnung bestehend, ihren Bestimmungsort erreicht hatte. Eine Abzweigung von der M-7, die direkt in das kleine Städtchen Wjasniki führte.
»MiK eins bis drei nördliche Fahrbahn, die anderen drei im Süden! Die Schützenpanzer flankieren die Phalanx. Infanteristen absitzen und Stellung beziehen!«
Die Fahrzeugkolonne kam zum Stillstand. Die Befehle des Kommandeurs wurden nach hinten durchgereicht und der Auf- und Ausbau der Stellung begann. Schirmacher hatte eine Position gewählt, an der die sich gabelnden Wege beiderseitig von dichten Baumreihen gesäumt waren, so dass sie eine an den Flanken relativ gut gesicherte Stellung beziehen konnten. Die vier Schützenpanzer vom Typ Puma fächerten ihre Formation auf der Straße auf und bildeten mit ihren Dreißig-Millimeter-Maschinenkanonen die Distanzwaffenphalanx. Zwischen ihnen wurden die Pick-up-Trucks mit den Anhängern geparkt, auf denen die Mikrowellengeschütze montiert waren. Die etwa sechzig Infanteristen, welche die Geschützbatterie begleiteten, errichteten MG-Nester und hoben im langsam auftauenden Boden Schützenstellungen aus. Der oberflächliche Matsch wich dabei recht schnell steinhart gefrorenem Boden, so dass diese Arbeit besonders beschwerlich war. Im Hintergrund wurden die sechs LKW in Form einer Wagenburg geparkt und mit einer dunkelgrünen Plane überspannt, um einen Raum zu schaffen, in dem man sich auch bei Niederschlag aufhalten konnte.