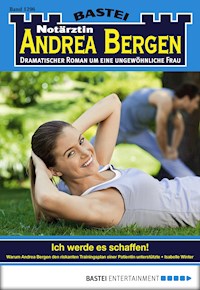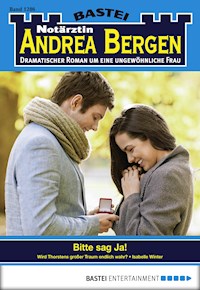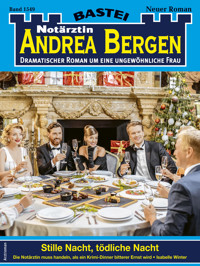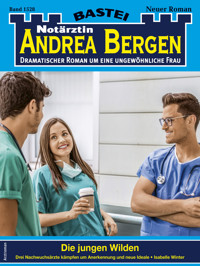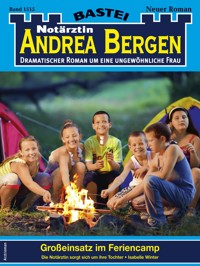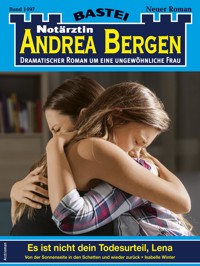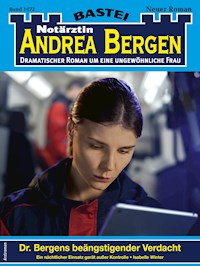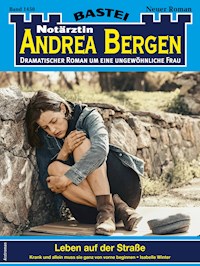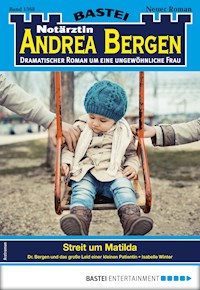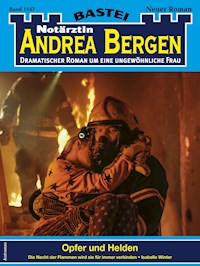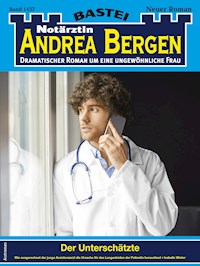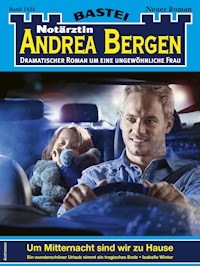1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aus den Aufzeichnungen der Notärztin:
Lilly lacht, als ich ins Zimmer komme. Doch es ist kein glückliches Lachen. Ihr Körper zuckt, ihr Blick geht ins Leere, und das Lachen klingt, als käme es von woanders. Diese Situation ist neu für mich und trifft mich tief: Ein Kind, das lacht, während es mitten in einem epileptischen Anfall steckt. Neben dem Bett kniet ihre Mutter. Sie spricht leise und flüsternd mit ihr. Ein Blick genügt, um zu erkennen, dass sie bis ins Mark müde ist - und dennoch bereit, alles für ihre Tochter zu geben. Als der Anfall endlich abklingt, bleibt eine gespannte Ruhe zurück. Das Mädchen lächelt freundlich, trotz ihrer Erschöpfung. Bislang weiß niemand, was mit ihr nicht stimmt, nur, dass sie "besonders" ist. Später erfahre ich die Diagnose: Angelman-Syndrom. Doch ich sehe kein Syndrom, sondern ein Kind, das offen und lächelnd durch die Welt geht, und eine Mutter, die nicht aufgibt. Ich bin mir sicher, Lilly wird es schaffen, denn ihre Welt wird trotz allem von Liebe getragen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Das Lächeln im Sturm
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Das Lächeln im Sturm
Lilly lacht, als ich ins Zimmer komme. Doch es ist kein glückliches Lachen. Ihr Körper zuckt, ihr Blick geht ins Leere, und das Lachen klingt, als käme es von woanders. Diese Situation ist neu für mich und trifft mich tief: Ein Kind, das lacht, während es mitten in einem epileptischen Anfall steckt.
Neben dem Bett kniet ihre Mutter. Sie spricht leise und flüsternd mit ihr. Ein Blick genügt, um zu erkennen, dass sie bis ins Mark müde ist – und dennoch bereit, alles für ihre Tochter zu geben.
Als der Anfall endlich abklingt, bleibt eine gespannte Ruhe zurück. Das Mädchen lächelt, trotz ihrer Erschöpfung. Bislang weiß niemand, was mit ihr nicht stimmt, nur, dass sie »besonders« ist.
Später erfahre ich die Diagnose: Angelman-Syndrom. Doch ich sehe kein Syndrom, sondern ein Kind, das strahlend durch die Welt geht, und eine Mutter, die nicht aufgibt.
Ich bin mir sicher, Lilly wird es schaffen, denn sie wird trotz allem von Liebe getragen.
Die Einkaufstüten schnitten in Anabells Finger, während sie versuchte, Lilly im Blick zu behalten, die fröhlich ein Stück vor ihnen herlief. Lillys lautes Lachen hallte über den Parkplatz des Einkaufszentrums, als sie die Arme in die Luft warf und sich drehte, als wäre die Welt ihr persönlicher Tanzboden.
»Können wir schnell was essen?«, fragte Frank hinter ihr. Seine Stimme war leicht gereizt, wie so oft in letzter Zeit.
Anabell nickte, schließlich war sie selbst erschöpft. Nach diesem langen Tag wollte sie wirklich weder sich selbst noch Frank zumuten, sich zu Hause in die Küche zu stellen.
Lilly, die den kurzen Austausch bemerkte, deutete begeistert auf den kleinen Spielplatz neben dem Restaurant.
»Bitte!«, rief sie aus, wobei das Wort mehr ein glucksender Laut als ein deutliches Sprechen war. Anabell verstand sie trotzdem sofort.
»Nur kurz«, sagte sie, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. »Du kannst ein bisschen spielen, bis das Essen kommt. Aber zuerst suchen wir etwas von der Speisekarte aus.«
Frank seufzte hörbar, schwieg aber. Während sie sich an einen Tisch setzten und ihr Essen bestellten, rutschte Lilly ungeduldig auf ihrem Stuhl herum. Ihre blauen Augen blitzten vor Aufregung. Sobald die Kellnerin die Bestellung aufgenommen hatte, sprang Lilly auf und zeigte auf den Spielplatz. Anabell nickte ihr zu, und Lilly rannte sofort los. Ihr honigblondes Haar flatterte im Wind.
Anabell beobachtete sie liebevoll. Es war immer wieder schön zu sehen, wie viel Freude Lilly an den einfachsten Dingen fand. Doch gleichzeitig schnürte es ihr die Kehle zu, denn sie wusste genau, dass diese Freude nicht von allen verstanden wurde.
Nur wenige Minuten später merkte sie, dass etwas nicht stimmte. Stimmen wurden lauter, ein Tumult entstand. Anabell stand sofort auf. Sie spürte Frank dicht hinter sich.
Lilly stand mitten auf dem Spielplatz, umringt von drei anderen Kindern. Ihre Haltung war unsicher; sie lachte, wie sie es immer tat, wenn sie aufgeregt oder überfordert war. Die anderen Kinder aber lachten nicht mit – sie lachten über sie.
Ein Junge zeigte auf Lilly und rief laut: »Die lacht ja wie ein Baby!«
Ein anderes Kind äffte Lillys unkoordinierte Bewegungen nach, während das dritte kicherte.
Anabell spürte, wie sich ihr Herz zusammenzog. Sie beeilte sich, zu ihr zu kommen, während sie sah, wie Lilly verunsichert die Hände rang und immer noch lachte – ihr Schutzmechanismus gegen die fremden Reaktionen.
»Lilly, komm her«, rief sie sanft.
Doch bevor Anabell sie erreichen konnte, mischte sich ein Vater ein, der neben dem Spielplatz stand. Er verschränkte die Arme und sagte laut genug, dass es alle hören konnten:
»Wenn das Kind Probleme hat, sollten Sie es vielleicht besser beaufsichtigen, statt es hier rumlaufen zu lassen.«
Anabell erstarrte.
Frank jedoch explodierte.
»Was soll das?!«, fuhr er den Mann an. Seine Stimme überschlug sich fast. »Mit meiner Tochter ist gar nichts falsch, da gibt es kein Problem, Sie ignorantes –«
Seine Wangen waren vor Stress fleckig rot, und Anabell konnte den Muskel zucken sehen, der an seinem Kiefer spielte.
»Frank, bitte«, murmelte sie und legte ihm beschwichtigend die Hand auf den Arm. Aber Frank ließ sich nicht beruhigen.
»Vielleicht sollten Sie mal Ihre Kinder erziehen, statt auf anderen herumzuhacken!«, schrie er, und nun wandten sich die Blicke aller Erwachsenen auf dem Spielplatz ihnen zu.
Anabell spürte die Blicke wie Nadelstiche auf ihrer Haut. Sie wusste, dass Frank es gut meinte. Und doch merkte sie nicht zum ersten Mal, dass es ihm nicht nur um Lillys Schutz ging. Es war ihm peinlich.
Er schämte sich.
Nicht für Lilly selbst, das wusste sie, sondern für die Tatsache, dass seine Tochter »anders« war. Dass sie aus dem Rahmen fiel. Dass sie ihn in eine Situation brachte, in der er sich erklären musste. Und es machte es noch komplizierter, dass sie beide gar nicht wussten, was genau mit Lilly nicht stimmte. Alles, was sie wussten, war, dass ihre Tochter irgendwie anders war als die Gleichaltrigen.
Anabell schluckte schwer. Während Frank sich weiter mit dem anderen Vater stritt und sich Stimmen erhoben, beugte sie sich zu Lilly hinunter. Lilly schien das alles nicht zu begreifen; sie lächelte, wackelte ein wenig mit dem Oberkörper und griff nach Anabells Hand, völlig unbeeindruckt vom Tumult.
»Komm, Schatz«, sagte Anabell sanft. »Wir gehen heim.«
Sie zog Lilly sanft vom Spielplatz weg und hielt sie dabei fest an der Hand. Frank brummte noch eine letzte wütende Bemerkung, ehe er sich zu ihnen umdrehte. Der andere Vater schüttelte nur den Kopf und murmelte etwas Unverständliches.
Als sie am Auto ankamen, atmete Anabell tief durch.
»Ich kann das einfach nicht ertragen«, sagte Frank, während er die Autotür aufriss. Er klang nicht wütend, sondern müde, verletzt. »Dieses Getuschel. Diese Blicke.«
Anabell seufzte. »Ich habe nächste Woche noch mal einen Termin mit der Logopädin. Sie meint, vielleicht ...«
Er schnaufte und schnitt ihr damit das Wort ab. »Ach was. All diese Arzttermine, und wozu? Mit unserem Kind ist alles in Ordnung. Sie ist nur ein bisschen langsam. Nicht krank.«
Sie schwieg. Es gab nichts zu sagen, was sie nicht bereits hundertmal durchgekaut hätten. Sie verstand ihn ja irgendwie; er wollte nicht sehen, dass Lilly anders war. Schließlich hatten auch die bisherigen Arzttermine nicht wirklich etwas ergeben. Und gleichzeitig tat es weh, dass es ihm so peinlich war. Dass sie nicht einfach stolz auf Lilly sein konnten, so wie sie war.
Sie setzte Lilly auf den Rücksitz, schnallte sie an und küsste sie auf die Stirn. Lilly kicherte leise und patschte mit der Hand gegen Anabells Wange.
»Alles gut, Süße«, flüsterte sie.
Während Frank sich ans Steuer setzte und mit verkniffenem Gesichtsausdruck hinausstarrte, legte sich eine schwere Stille über sie.
Anabell blickte auf ihre Tochter, die fröhlich mit ihren Fingern spielte, und spürte, wie sich Tränen in ihren Augen sammelten. Lilly merkte nichts von dem Schmerz der Erwachsenenwelt. Noch nicht. Aber Anabell wusste, dass sie kämpfen musste. Für Lillys Recht auf Freude. Auf Lachen. Auf Anderssein. Ganz gleich, wie oft sie in der Öffentlichkeit anecken würden. Ganz gleich, wie schwer es manchmal sein würde.
Wenn sie nur wüsste, was genau mit dem Kind los war!
***
Zu Hause war es angenehm warm. Das gedämpfte Licht aus der Stehlampe tauchte das Wohnzimmer in weiches Gold, während Lilly auf dem Teppich saß und ihre Puppen mit Hingabe zu einer Teeparty drapierte.
Anabell kniete sich zu ihr und lächelte. Sie griff nach einer Puppe, ließ sie freundlich nicken und sprach eine kleine Begrüßung aus. Lilly gluckste vergnügt und ließ ihre eigene Puppe durch die Luft hüpfen.
Anabell beobachtete ihre Tochter mit einem schmerzlichen Ziehen im Herzen. So fröhlich, so voller Energie – und doch so anders als die meisten Achtjährigen. Ihr Spiel war von einer kindlichen Einfachheit, die nicht zu ihrem Alter passte.
Während andere Mädchen in Lillys Alter sich über alles Mögliche unterhielten, komplizierte Rollenspiele inszenierten oder über Filme und Serien kicherten, war Lillys Welt noch voll von einfachen, wiederholenden Handlungen. Ihre Puppe sprang, lachte, wieder und wieder, als würde die Zeit für sie stillstehen.
Anabell erinnerte sich an den Schulbeginn, der zu einem Albtraum geworden war. Der verzweifelte Versuch, Lilly in einer Regelschule unterzubringen. Die ständigen Anrufe von Lehrern, die Hilflosigkeit, die Ausgrenzung. Lilly hatte geweint, gelacht, geweint, oft ohne zu verstehen, warum sie nicht mithalten konnte.
Es hatte Wochen gedauert, bis Anabell den Mut gefunden hatte, die Reißleine zu ziehen und sich für eine Sonderschule zu entscheiden. Ohne Diagnose. Ohne klare Worte für das, was mit Lilly anders war.
Frank hatte diese Entscheidung nie wirklich akzeptiert.
»Sie ist doch nicht dumm«, hatte er immer wieder gesagt, die Stirn gerunzelt, mit trockenem Blick. »Sie braucht nur mehr Förderung. Sie kann auf eine normale Schule gehen, wie normale Kinder.«
Anabell hatte irgendwann aufgehört, mit ihm darüber zu diskutieren. Was hätte sie sagen sollen? Dass Lilly kaum sprach, die einfachsten Anweisungen manchmal nicht verstand? Dass sie sich nicht in eine Gruppe einfügte, sondern in ihrer eigenen kleinen Welt lebte? Natürlich war Frank nicht blind, aber trotzdem schaffte er es irgendwie, das alles nicht so richtig zu sehen. Einerseits ärgerte er sich manchmal darüber, dass Lilly nicht »funktionierte«, andererseits verschloss er die Augen. Er war ja auch selten da. Und wenn er zu Hause war, berief er sich lieber auf die Arbeit, als sich dem komplizierten Alltag mit ihrer besonderen Tochter zu stellen.
Lilly ließ eine ihrer Puppen über den Teppich tanzen und kicherte vergnügt. Anabell zwang sich, ihre düsteren Gedanken beiseitezuschieben und griff nach der kleinen Stoffgiraffe, die Lilly so liebte.
»Wo will denn deine Puppe heute hin?«, fragte sie sanft.
Lilly kicherte erneut, deutete auf das Fenster und murmelte etwas Unverständliches. Ihre Stimme war hell und leicht, fast singend, aber die Worte verschwammen zu unklaren Lauten.
Anabell verstand sie trotzdem irgendwie. Manchmal war es mehr ein Gefühl als Sprache.
»Na gut, dann fahren wir mit dem Bus zu Oma und Opa«, sagte sie und ließ die Giraffe auf der Fensterbank »aussteigen«. Lilly klatschte in die Hände und wiegte sich leicht hin und her.
Aus dem Augenwinkel sah Anabell, wie Frank am Türrahmen stand. Die Arme verschränkt, der Blick abwesend.
»Ich muss noch mal ins Büro«, sagte er schließlich.
Anabell sah kurz auf. Die Erschöpfung in ihren Knochen war allgegenwärtig – sie hatte gehofft, er würde ihr diesmal helfen, Lilly ins Bett zu bringen. Doch sie ließ sich nichts anmerken.
»Okay«, sagte sie ruhig.
Es hatte keinen Sinn, ihn aufzuhalten oder Fragen zu stellen. Sie wusste doch längst, dass er nicht wirklich wegen vergessener Unterlagen zurückfuhr. Er fuhr, weil er es nicht ertrug. Den Tumult, das Anderssein, die anstrengende Liebe, die Lilly so dringend brauchte.
Frank trat einen Schritt näher, als wollte er etwas sagen, dann blieb er doch stumm. Kein Kuss, kein flüchtiges Streicheln über ihre Schulter. Einfach nur ein Nicken. Und dann war er weg.
Die Tür fiel leise ins Schloss. Anabell atmete tief durch, schob die Puppen beiseite und stand langsam auf. Lilly sah zu ihr auf, ein fragendes Leuchten in ihren blauen Augen.
»Papa?«, fragte sie, der Laut war weich und gedehnt.
Anabell hockte sich wieder zu ihr und strich ihr das honigblonde Haar aus dem Gesicht.
»Papa musste arbeiten, Schatz«, sagte sie sanft. »Aber ich bin da.«
Lilly runzelte die Stirn, schien zu überlegen, dann griff sie nach Anabells Hand.
»Komm, kleine Maus«, sagte Anabell und zog sie sanft hoch. »Zeit fürs Bett.«
***
Das Einschlafritual war immer eine Herausforderung. Lilly hatte große Probleme zur Ruhe zu kommen. Sie wälzte sich oft stundenlang unruhig hin und her, schlief nur leicht ein und wachte oft wieder auf.
Anabell hatte längst begriffen, dass dies Teil der Symptome war. Das unkontrollierte Lachen, die Koordinationsschwierigkeiten, die Schlafstörungen – es war alles miteinander verbunden. Doch sie hatte keine Worte dafür. Keine Diagnose, keine klare Erklärung. Nur das Gefühl, dass sie kämpfen musste. Jeden Tag.
Geduldig half sie Lilly beim Umziehen, ließ sie zwischen zwei Schlafanzügen wählen – Entscheidungen halfen Lilly manchmal, sich sicherer zu fühlen. Dann begleitete sie sie ins kleine Kinderbett, das von Kuscheltieren umlagert war.
»Geschichte?«, fragte Lilly mit einem breiten, schiefen Lächeln.
»Natürlich.« Anabell lächelte.
Sie setzte sich auf die Bettkante und schlug eines der abgewetzten Bilderbücher auf, das sie gefühlt schon hundertmal gelesen hatte. Lilly kuschelte sich an sie, das Köpfchen gegen ihre Schulter gelehnt.
Während sie las, spürte Anabell, wie sich Lilly langsam entspannte. Ihre Finger spielten mit dem Saum von Anabells Pullover, und hin und wieder gluckste sie leise, wenn ihr eine Illustration besonders gut gefiel.
Als sie die Geschichte beendet hatte, küsste sie Lilly sanft auf die Stirn.
»Ich liebe dich, mein Herzchen«, flüsterte sie.
Lilly kicherte, patschte wieder leicht gegen ihre Wange und murmelte: »Mama.«
Anabell blieb noch eine Weile sitzen und streichelte Lillys Rücken, bis ihr Atem tiefer wurde. Und doch wusste sie, dass der Schlaf nicht lange halten würde. Er tat es nie.
Als sie schließlich aufstand und die Tür leise hinter sich schloss, blieb sie für einen Moment im Flur stehen. Sie lehnte die Stirn an die Wand und schloss die Augen. In ihrem Inneren war eine seltsame Mischung aus Dankbarkeit und Verzweiflung.
Dankbarkeit für Lillys Lächeln.
Verzweiflung, weil alles so schwer war.
Und weil Frank, ihr Partner, der Vater ihres Kindes, mehr und mehr zu einem Schatten wurde.
***
Gerade als sich Anabell ächzend auf das Sofa fallen gelassen hatte, hatte sie wieder das klägliche Rufen gehört.
»Mama!«
Nicht laut, eher ein gequälter Laut, kaum als Wort zu erkennen – aber für Anabell unüberhörbar. Also war sie zurückgekehrt, hatte sich erneut zu ihrer Tochter gesetzt, ihr beruhigend über das honigblonde Haar gestrichen und leise gesummt, bis Lilly endlich wieder die Augen schloss.
Lilly hatte seit jeher Schwierigkeiten mit dem Schlaf. Manchmal dauerte es ewig, bis sie überhaupt einschlief. Und wenn sie schlief, war der Schlaf leicht und unruhig – ein Rascheln, ein entferntes Geräusch reichte aus, um sie wieder aufzuwecken. Oft lag sie nachts wach, kicherte plötzlich oder wälzte sich ruhelos hin und her. Manchmal lachte sie sogar im Schlaf – ein helles, schrilles Lachen, das Anabell das Herz zusammenschnürte. Aber all das war längst Alltag geworden.
Sie streckte die Beine aus und warf einen Blick auf die Uhr. Keine Spur von Frank. Anabell presste die Lippen zusammen. Wenn sie ehrlich war, zweifelte sie, dass sie ihn heute überhaupt noch sehen würde. Manchmal, wenn sie im Dunkeln allein auf dem Sofa saß, fragte sie sich, ob er vielleicht eine andere hatte. Eine Kollegin, vielleicht. Jemand, der unkomplizierter war als sie. Jemand ohne Sorgen, ohne ständige Müdigkeit, ohne ein besonderes Kind, das die Welt auf den Kopf stellte.
Aber Anabell wagte es nicht, ihn darauf anzusprechen. Sie fürchtete die Antwort fast mehr als das ungewisse Schweigen. Und tief in ihrem Inneren wusste sie: Selbst wenn er treu war, was würde es ändern? Ihre Ehe war doch längst nur noch eine blasse Hülle von dem, was sie einmal gewesen war.
Seufzend griff sie zur Fernbedienung und schaltete den Fernseher an. Bunte Bilder flimmerten über den Bildschirm, doch sie stellte den Ton sofort wieder aus. Die Stille war ihr lieber, und die Filme und Sendungen interessierten sie eigentlich gar nicht.