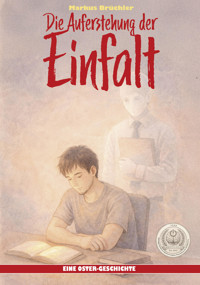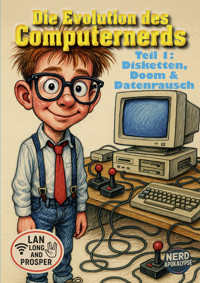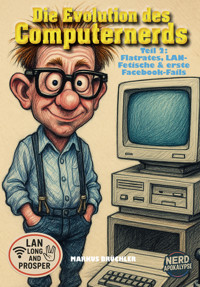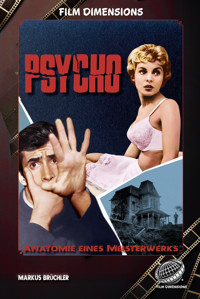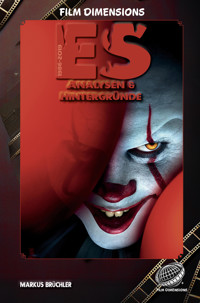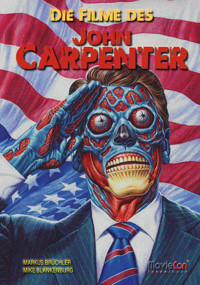9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Colla & Gen Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Ein Roman wie eine Glut – warm, rau, voller Menschlichkeit.“
Nuclear Games – Glutnester der Menschlichkeit
Von Markus Brüchler
„Vielleicht ist Menschlichkeit das, was bleibt, wenn nichts mehr übrig ist – und trotzdem jemand bleibt.“ – Max Menschlichkeit als letzte Hoffnung
- Fesselnde Mischung aus Dystopie, Poesie und emotionaler Tiefe
- Ein packender Roman über Trauer, Liebe und das, was uns zu Menschen macht
- Charaktere, die dich begleiten, lange nachdem du die letzte Seite gelesen hast
- Atmosphärisch, bildgewaltig und psychologisch fein erzählt
Kurzbeschreibung: Nach dem letzten Krieg liegt die Welt in Trümmern. Vertrauen ist selten, Menschlichkeit ein kostbares Gut. Inmitten der Ruinen treffen Max und Sarah aufeinander – zwei Fremde mit Narben, die tiefer reichen als Wunden. Zusammen mit dem dreiäugigen Wolf Canto und der klugen Stute Rika beginnt eine Reise durch zerstörte Landschaften – und zu sich selbst.
Was dich erwartet:
Eine Welt, in der jedes Feuer, jede Berührung, jeder Gedanke zählt
Charaktere, die nicht perfekt sind – aber echt
Stille Glut statt greller Explosionen: Emotion statt Effekthascherei
Eine Liebesgeschichte, die sich langsam entfaltet und nie pathetisch wird
Ein Wolf, der mehr versteht, als viele Menschen
Tiefe Gespräche, kleine Gesten, große Fragen
Das Erbe einer verlorenen Welt und der Anfang einer neuen
„Denn hier am Rand der alten Welt gibt’s kein ‘zu viel’, kein ‘zu wenig’ mehr. Nur das Flackern unserer Geschichten, nur die Wahrheit im Feuermeer.“
Nuclear Games erzählt nicht vom großen Knall, sondern von dem, was danach bleibt. Von zwei Menschen, die mehr verloren haben, als Worte fassen können – und doch lernen, einander zu trauen. Zwischen Ruinen, Mutationen und Erinnerungen entsteht eine leise Hoffnung. Das Buch ist eine Hommage an das, was in uns weiterbrennt, auch wenn alles um uns dunkel geworden ist.
„In der Asche der alten Welt haben wir etwas gefunden, das kleiner und zerbrechlicher ist als all das, was verloren ging – aber es ist echt und lebendig: Vertrauen. Freundschaft. Liebe. Menschlichkeit.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
Verlag: Colla & Gen Verlag und Service UG & Co. KG, Hauptstr. 65, 59439 Holzwickede
ISBN:
978-3-98578-956-6 (Softcover),
978-3-98578-955-9 (Hardcover)
978-3-98578-954-2 (ebook)
Cover: Heribert Jankowski
Autor: Markus Brüchler
Layout: Heribert Jankowski
Lekorat: Saskia Meyer
© 2025 Markus Brüchler
Nuclear Games
Glutnester der Menschlichkeit
Markus Brüchler
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Der vorliegende Text darf nicht gescannt, kopiert, übersetzt, vervielfältigt, verbreitet oder in anderer Weise ohne Zustimmung des Autors verwendet werden, auch nicht auszugsweise: weder in gedruckter noch elektronischer Form. Jeder Verstoß verletzt das Urheberrecht und kann strafrechtlich verfolgt werden.
Über den Autor
Markus Brüchler (* 1970) ist Autor, Verleger und Geschichtenerzähler mit einem Faible für dystopische Welten und psychologische Tiefe. In seinen Büchern geht es selten um das Ende der Welt – sondern darum, was von uns übrig bleibt, wenn alles andere zerfällt.Mit Nuclear Games erschafft er eine raue, poetische Zukunftsvision, in der Menschlichkeit selbst zur letzten Hoffnung wird.
Markus lebt und arbeitet in der Mitte Deutschlands, liebt Wölfe, Geschichten mit Ecken und Kanten – und schreibt bevorzugt bei Nacht.
Widmung
Für die Menschlichkeit.
Für all das, was bleibt,wenn Worte fehlen,wenn Hoffnung flackert,wenn alles verloren scheint –und doch jemand bleibt.
Für den Blick, der nicht wegsieht.Für die Hand, die hält.Für das Zittern, das nicht aufgibt.Für das Lachen im Staub.
Für jene, die nicht laut sind –aber echt.Für jene, die scheitern –und trotzdem weitergehen.Für jede Berührung, die nicht erklärt werden muss.
Für die Menschlichkeit –die letzte Glut im Dunkel.
Inhaltsverzeichnis
I. Erinnerungen11
II. Tristesse15
III. Die Botschaft / Der Ruf20
IV. Die Reise44
V. Die Begegnung84
VI. Überleben und Lernen119
VII. Begegnung mit Sarah138
VIII. Konflikt im Dorf161
IX. Hoffnungsschimmer und Wendepunkt207
X. Der Sturm und der Aufbruch262
XI. Die Zukunft der Menschlichkeit302
Anhang – Tagebucheinträge338
„Vielleicht ist Menschlichkeit das, was bleibt, wenn nichts mehr übrig ist – und trotzdem jemand bleibt.“
Max
I. Erinnerungen
Erinnerungen sind wie Sand an einem weißen Strand. Sie sind in vielen kleinen Stücken vorhanden und haben in sich keinen Sinn. Erst mit etwas Abstand betrachtet zeigen die Erinnerungen ihre wahre Schönheit oder einen Weg in die Hölle. Als ich hier oben auf dem Gipfel des kleinen Hügels stehe und auf die Landschaft unter mir herunterschaue, kommen die Erinnerungen aus einer längst vergangenen Zeit wieder hoch. Eine Zeit vor dem großen Knall, als es mehr Menschen gab.
Die in Trümmern liegende Straße, die sich um den Hügel herumschlängelt, fügt sich in meinen Erinnerungen zu einer belebten Tangente zwischen den vielen Ortschaften, die damit verbunden waren. Emsig fuhren die Menschen in Autos hin und her, um Besorgungen zu machen, zur Arbeit zu fahren, Verwandte zu besuchen oder einfach um Spaß zu haben. Es waren faszinierende, aber auch stressige Zeiten. Die Menschen hatten vor dem großen Knall und der Verdunkelung trotz aller Annehmlichkeiten, die das moderne Zeitalter bot, keine Zeit, um einfach glücklich zu sein.
Alles musste schnell gehen, nichts war von Dauer, viele waren unzufrieden, aber so tief in dem Trott des Alltags verwurzelt, dass es für die meisten Menschen nahezu unmöglich war, dem Unglücklichsein zu entkommen, dem Stress zu entfliehen, der Gier zu entsagen, den Zwängen zu widerstehen oder den falschen Mächtigen, die sich als die Heiler der Welt ausgaben, zu widerstehen.
Und was haben Sie geheilt? Gar nichts.
Ganz im Gegenteil. Sie haben die Welt an den Rand des Abgrundes gebombt. Der darauffolgende nukleare Winter sorgte für eine neue Eiszeit, die nur wenige Menschen überlebten. Niemand war darauf vorbereitet, denn alle waren so extrem mit sich selbst beschäftigt. Sie waren sich selbst fremd geworden. Ein unheiliger Despot von einem der größten Kontinente der Erde hat den letzten Schritt der Menschheit getan. Er hat die Knöpfe gedrückt, die die Welt, wie wir sie kannten und liebten und auch hassten, für immer verändert hatte. Er hat den Menschen die elektronischen Spielzeuge weggenommen, die Lebensgrundlage entzogen und Millionen von Menschen in den Tod geschickt.
Als die sozialen Netzwerke starben, herrschte endgültig das Chaos. Die Menschen, die die ersten Katastrophen überlebt hatten, gingen auf die Straßen und schrien um sich, als hätte man ihnen das Räppelchen weggenommen. Die Welt stürzte abermals in Anarchie und alles, was übrig blieb, liegt nun zu meinen Füssen.
„Hey, Max, komm rein, es gibt Abendessen. Außerdem beginnt gleich die Sperrstunde.“
„Ja, ich komme gleich. Und … wen interessiert die Sperrstunde hier draußen?“
Seit fast 10 Jahren leben wir nun schon auf diesem Hügel, fern ab der nächsten menschlichen Ortschaft, die von einem Militärregime, oder wie auch immer man das nennen will, was die dort treiben, regiert wird. Im Umkreis gibt es zehn solcher Dörfer. Meist leben ein paar Hundert Menschen mit ihren Tieren innerhalb der stark befestigten Tore, die so uneinnehmbar erschienen, wie die Burgen in dieser alten Fernsehserie. Sie wissen schon. Die mit den Drachen und der Königin. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre die Welt in dieser Fantasy-Serie Realität geworden. Natürlich nur in meinen Träumen, wenn ich mich an die schönen Dinge der alten Welt erinnere.
Was waren das für Zeiten. Filme, Kino, DVD, Serien und, was ganz wichtig ist, Bücher. Bücher haben wir heute noch. Wir verwahren sie in einem geschützten Raum, damit sie durch die Witterungen nicht zu sehr angegriffen werden. Regelmäßig sitze ich in diesem Raum und lesen in einem guten Buch und erinnere mich an eine fröhlichere Zeit, eine Zeit, in der die Sonne schien. Eine warme Welt mit verschiedenen Jahreszeiten und mit vielen Menschen. Leider auch vielen dummen Menschen, die uns erst in diese Situation brachten.
„Hey, das Essen wird kalt. Jetzt komm endlich rein. Du holst dir noch eine Erkältung.“
„Ja, ich komme.“ Meine liebe Frau Yvette, sie kocht immer so wundervolle Dinge, die das Leben erst wieder so richtig lebenswert machen. Geschmacksexplosionen, die wiederum die Erinnerungen aufkeimen lassen.
„Hey, alter Junge, wie geht es meinem kleinen Wolf?“
Das ist er, unser Wolf. Der treueste Gefährte, der uns jemals begegnet ist. Sein graubraunes Wolfsfell glänzt seidig im Lichte des Feuers. Ein wunderschönes Tier.
„Hier, Großer, das ist für Dich.“ Wir fanden ihn eines Tages am Fuße des Hügels in einer Höhle. Ich glaube, das müsste ungefähr fünf Jahre her gewesen sein. Er war ein kleines Fellknäuel, das kaum laufen konnte. Er war schwach und krank. Sein drittes Auge war verletzt und entzündet. Ja, genau. Er hat ein drittes Auge. Seit einigen Jahren kommen immer wieder Tiere und andere Lebewesen mit Mutationen in unsere Gegend. Einige davon sind gutartig, andere wieder nicht. Dreiaugenwölfe sind eigentlich alles andere als gutartig, denn sie wissen genau, was die Menschen der Welt angetan haben. Sie spüren in den Menschen die bösartigen Gedanken, sie wissen genau, was Menschen für schreckliche Lebewesen sein können.
Zumindest bilden wir uns das ein, weil der gute Felix immer wieder auf uns aufpasst und anderen Menschen mit Argwohn entgegentritt. Er mag keine anderen Menschen. Bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Er scheint eine Art Antenne für böse Menschen zu haben.
„Hey, Onkel Max, erzählst Du uns wieder eine Geschichte von der Welt, wie sie früher mal war? Oder … erzähle uns von der Zeit nach dem Knall.“
„Ok, Sophia, aber erst essen wir, dann erzähle ich Euch von den silbernen Türmen, die früher bis in die Wolken reichten.“
„So hoch? Ist das wahr?“ fragt Chis.
„Oh ja, sie waren unglaublich. Aber auch heimtückisch und gefährlich. Aber esst erst einmal.“
II. Tristesse
-1-
Das fahle Tageslicht, sofern man überhaupt von Licht sprechen kann, scheint durch die Fensterritzen. Schweißgebadet wache ich auf. Mist, wieder ein Traum.
„Kinder?“ frage ich laut. Aber hier ist niemand, der meine Worte hören kann. Mist. Meine Gedanken kreisen um diesen wunderbaren Traum. Das will ich auch haben. Menschen, die sich um einen sorgen und nicht für die nächste Mahlzeit einen Pfeil durch deinen Kopf schießen wollen.
„Yvette?“. Sie ist nicht hier. Wie sollte sie auch? Wir wurden bei der großen Flut kurz nach dem nuklearen Feuer voneinander getrennt. Ob sie wohl noch lebt? Ich gebe mich da keiner Illusion hin.
Ich erinnere mich genau, als dieser verrückte Despot zu immer grausameren Waffen gegriffen hat, um die gesamte Welt zu unterjochen. Mit seinen Lügen und Propaganda-Videos konnte er die Menschen zu Handlungen bewegen, die eigentlich nur ihm halfen. Wie die Lemminge folgten viele Menschen diesem grausamen Tyrannen. Als sie merkten, was er wirklich vorhatte, war es bereits zu spät.
Der Dritte Weltkrieg startete vor ziemlich genau 10 Jahren und dauerte nur wenige Monate. Als die Bomben fielen und der letzte Tag der Menschenwelt, wie wir sie kannten, angebrochen war, schlug auch Mutter Natur zurück. Sie hatte sprichwörtlich die Nase voll von der Torheit der Menschen. Ich war damals knapp 20 Jahre alt.
Wie lange das nun her ist? Da fragen Sie mich was. Uhren und Handys gibt es nicht mehr.
Kein Tik Tok, kein Piep Piep, kein Scrollen, kein Newsfeed. Zeitmessung? Durch die elektromagnetischen Impulse der Atombomben gibt es keine modernen Uhren mehr. Ich könnte nicht sagen, wie lange es bereits her ist. Ich schätze mal, dass seit der Katastrophe 10 Jahre vergangen sind. Anfangs habe ich mir selbst Kalenderblätter gemalt und jeden Tag ein Kreuz gesetzt. Aber nach unzähligen Blättern, ich schätze mal ungefähr einhundert, sind mir die Seiten ausgegangen. Außerdem erscheint mir dies wie ein Countdown zum Unvermeidlichem zu sein. Nein, wer will schon an so etwas denken.
Ich hatte neben diesen Kalenderresten noch eine alte Postkarte hängen. Oh ja, tatsächlich, eine dieser Ansichtskarten, die man früher den Menschen geschickt hat, die man liebte, oder auch nicht.
Das vergilbte Foto zeigte die Skyline einer riesigen Stadt aus Glas, Stahl und Beton. Riesige Türme, die sich anschickten, mit den Wolken im Himmel tanzen zu wollen.
Ich bin tief in meinen Gedanken versunken, als ich plötzlich ein Wimmern höre. Dieses Wimmern verheißt nichts Gutes. Eine noch nicht so alte Legende unter den Menschen aus den Dörfern besagt, dass, wenn du dieses Wimmern hörst, dein letztes Stündlein angebrochen ist. Bisher ist niemand diesem Wimmern entkommen. Ich spürte es, es war ganz nah. Dieses Ungeheuer, das erst wimmert und dich dann mit Haut und Haare zum letzten Mahl geleitet.
Mit Legenden ist das immer so eine Sache. Sie beinhalten viele dummes Zeug, aber auch ein Quäntchen Wahrheit. Das Wimmern kommt näher. Stille. Kein Laut ist zu hören. Es scheint, als wäre selbst der Wind vor Angst erstarrt. Es ist direkt vor der Tür. Habe ich sie abgeschlossen?
Ein Wimmern, das direkt durch das Gehirn zu schneiden scheint, zerteilt die Dunkelheit. Ich spüre, wie sich mein Herz zusammenzieht, die Muskeln spannen sich an. Ich bin bereit. Aber wofür? Langsam öffnet sich die Tür. Scharniere quietschen und zerren an den Nervenenden, wie ein Gitarrist sein Instrument missbraucht.
Da ist er, der Schatten, der das Ende bringt. Das fahle Mondlicht scheint durch die Tür und wirft eine Monstrosität an die Wand, das direkt aus Dantes Inferno entsprungen sein könnte. Es wimmert und mault. Das sind ja ganz andere Töne.
Das Es ist da.
Es kommt durch meine Tür und es hat Hunger.
Was ich jetzt mache?
Es ist Zeit für das Frühstück.
„Hey, mein Junge, komm rein.“
Der große dreiäugige Wolf schreitet durch die Tür und nähert sich.
„Na, Großer, wo warst Du denn schon wieder.“
Ich streichle meinen besten Freund unter seinem Kinn. Ihr müsst wissen, dass dreiäugige Wölfe erst nach der Katastrophe aufgetaucht sind. Sie sind gequälte Seelen in einer gequälten Welt. Sie wimmern, weil sie die Welt anders wahrnehmen als jedes Lebewesen dieser Welt. Aber es ist wahr, bisher hat niemand einen wimmernden Wolf überlebt.
Mein Freund hier, ich nenne in Canto, nach einem alten Husky aus einer anderen Welt, vor dem Ende, ist die pure Essenz des Lebens.
Als ich mich auf einen Stuhl setze, kommt er ganz nah an mich heran. Wie bei einem Ritual drückt er seinen Kopf direkt auf meine Stirn. Ach, was heißt hier wie, es ist ein Ritual bei jedem Mal, wenn wir uns begegnen. Ich spüre, wie sich meine Haut zusammenzieht, ein Schauer zieht sich durch meinen Körper. Es ist wie ein Rausch, wie eine Verbindung.
Er weiß genau, wer ich bin. Wahrscheinlich weiß er mehr über mich als ich selbst. Ich spüre seinen Geist in mir, wir sind verbunden.
Ich schließe meine Augen und ich sehe seinen Weg. Ich sehe, was er gesehen hat.
Was er gesehen hat? Das ist nicht für Eure Augen und Ohren bestimmt. Vielleicht später. Aber jetzt wird erst einmal gefrühstückt. Die Sonne bahnt sich langsam ihren Weg an den Bäumen vorbei und versucht zaghaft, aber unaufhaltsam den Mond zu verdrängen.
„Es ist Zeit, wir müssen gleich los.“ Canto wimmert zustimmend.
-2-
Ich will ehrlich zu euch sein, ich verstehe es ja selber noch nicht. Aber ich spüre, dass Canto ein ganz besonderer Wolf ist. Er ist anders als all die Wölfe, denen ich je begegnet bin. Die meisten Wölfe haben kein großes Interesse an den Menschen, außer vielleicht als Snack für das Rudel.
Die dreiäugigen Wölfe sind ganz anders, sie sehen die Welt, wie sie wirklich ist. Sie sind Wegbegleiter für die einen und das untrügerische Ende für die anderen. Man könnte sie als Begleiter zu einer anderen Ebene bezeichnen. Auch wenn das der Sache nicht ganz gerecht wird.
Als ich Canto fand, … na ja, eigentlich hat er mich gefunden, waren wir beide auf einem fehlgeleiteten Weg. Er hat mich gerettet, so wie ich ihn gerettet habe. Damals war er kaum größer als eine normale Hauskatze.
Seine Mutter mit nur zwei Augen lag tot neben ihm. Sie blutete aus großen Wunden. Es sah so aus, als ob ein riesiges Etwas ein großes Stück von ihrem Körper abgebissen hätte.
Der kleine Welpe wimmerte und schaute mich mit seinen drei großen Augen an. Damals wusste ich noch nicht, was das mit den drei Augen auf sich hat. Und irgendwie weiß ich das selbst heute noch nicht. Ich nahm den Welpen auf und machte mich auf dem Weg, den Hügel zu erklimmen.
Die Sonne war bereits am Zenit angekommen. Es war Zeit, nach einem Unterschlupf zu suchen, denn sonst würde der Kleine nicht überleben. Ich bewegte mich schneller vorwärts. Wir müssen hier weg. Schnell. Sie werden bald kommen.
Die Hozer. Fuck.
Ich konnte sie schon hören. Ein Pfeifen und Trillern, wie man es nur schwer beschreiben kann. Es geht durch Mark und Bein. Die Geräusche, sie sind überall. Direkt vor uns baute sich eine Schattengestalt auf. Ein Mensch, dachte ich. Ich wollte schon um Hilfe bitten, als der kleine Welpe unter meiner Jacke hervorkrabbelte und seinen Kopf auf meine Stirn drückte. Ich taumelte zurück und viel in eine Art Loch. Ich spürte eine Welle von Bildern, Gedanken und Wege.
Was bist du?
Ich erwachte kurze Zeit später und ich wusste genau, wo wir jetzt hinmüssen, um sicher die Nacht überleben zu können. Der kleine Kerl wies mir den Weg zu dieser meiner Hütte.
Ja, mein Freund Canto hat auch mich gerettet. Ich war damals ein Verlorener in einer verlorenen Welt. Ich war ein Mann ohne Ziel und ohne Heimat. Ich fühlte mich fremd in einer fremden Welt. Ganz besonders unter Gleichgesinnten, unter Menschen. Ich war immer schon anders als alle anderen. Schon vor dem Ende war ich ein Fremder im eigenen Land. Ich fühlte mich unverstanden. Die katastrophalen Zustände vor dem Ende waren nicht gerade förderlich für dieses Gefühl.
Alle diese Gefühle änderten sich, als ich auf Canto traf, er zeigte mir, wer oder was wir sind. Ich kann es nicht erklären, aber es fühlt sich richtig an.
Ich bin nun nicht mehr der einsame Verrückte, der Freak.
Ich bin der mit dem dreiäugigen Wolf.
III. Die Botschaft / Der Ruf
-1-
Blasses Morgenlicht sickert durch die Ritzen der Holzwände. Canto und ich sitzen schweigend am kleinen Tisch und teilen unser karges Frühstück. Der Tee ist dünn und bitter, das letzte Stück getrocknetes Fleisch wird zwischen uns aufgeteilt. Normalerweise ist diese Stunde still und beinahe friedlich – ein kostbares Ritual in einer Welt ohne Sicherheit. Doch heute ist etwas anders. Die Routine kippt.
Ich bemerke es an den feinen Zeichen. Canto frisst nur zögernd und hebt immer wieder den Kopf. Seine drei Augen – zwei bernsteinfarbene und das dritte, dunkel und geheimnisvoll auf seiner Stirn – starren zur Tür, als erwarte er dort etwas Unsichtbares. Seine Ohren zucken bei jedem noch so kleinen Geräusch. Dabei ist es still draußen, unnatürlich still. Nur der Wind streicht leise über den Hügel und raschelt in den toten Blättern vor der Hütte.
Nach dem Essen stehe ich auf und räume mechanisch unsere Schalen weg. Jeder Handgriff sitzt – Routine, eingeübt in Jahren des Überlebens. Wasser sparen, Vorräte prüfen, Feuerholz nachlegen. Ich knie mich vor die knisternde Glut im Ofen, doch aus den Augenwinkeln beobachte ich Canto. Er läuft unruhig hin und her, schnuppert am Boden, dann wieder zur Tür. Ein leises Wimmern dringt aus seiner Kehle, kaum hörbar, aber es lässt mir einen Schauer über den Rücken laufen.
„Alles in Ordnung, Großer?“ frage ich sanft. Meine Stimme klingt rau vom Schweigen der Nacht. Canto bleibt stehen und sieht mich an. In seinen Augen – allen dreien – spiegelt sich das graue Morgenlicht. Er wirkt angespannt, wachsam. So habe ich ihn noch nie gesehen an einem ruhigen Morgen.
Unsicher greife ich nach einem meiner Bücher, das neben meinem Schlafplatz liegt. Das zerfledderte Buch ist ein alter Begleiter; ich habe es unzählige Male gelesen. Früher hätte ich gesagt, es diente nur der Zerstreuung, doch heute ist jedes gedruckte Wort ein Schatz. Ich schlage eine Seite auf und versuche mich auf die verblichenen Zeilen zu konzentrieren. Worte als Zuflucht, jeden Tag ein paar, um die Einsamkeit zu überbrücken.
Aber die Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen. Mein Blick wandert immer wieder zu Canto. Er sitzt jetzt stocksteif vor der Tür, die Nase erhoben, als würde er Witterung aufnehmen. Sein buschiger Schwanz peitscht unruhig über den Holzboden. In meinem Magen regt sich ein ungutes Gefühl. Diese Art von Nervosität kenne ich von ihm gar nicht. Normalerweise ist er morgens nach seiner Streifrunde erschöpft und zufrieden – heute scheint er auf etwas zu warten.
Oder vor etwas zu warnen?
Ich lege das Buch beiseite. Die Stille in der Hütte lastet plötzlich bleischwer auf uns. Mir fällt auf, dass selbst die Vögel draußen verstummt sind. Nur mein eigenes Herzklopfen durchbricht die Stille. Ich taste nach dem kleinen glatten Stein in meiner Hosentasche – meinem Glücksstein, den ich vor Jahren an einem Flussbett fand. Seine vertraute Kühle beruhigt mich sonst, doch heute bleibt meine innere Unruhe.
Canto steht jetzt direkt vor mir. Bevor ich etwas sagen kann, hebt er den Kopf zu mir. Seine Vorderpfoten scharren nervös auf dem Dielenboden. Dann macht er etwas, das er sonst nur zur Begrüßung tut: Er drückt seine Stirn gegen meine. Sein drittes Auge berührt meine Haut, genau zwischen meinen Brauen.
Ich halte unwillkürlich den Atem an.
-2-
Das Stirn-zu-Stirn-Ritual. Eigentlich tun wir das jeden Tag kurz, ein Zeichen unserer Verbundenheit. Aber diesmal ist es anders – länger, intensiver. Canto presst seinen Schädel fest gegen mich, und sein drittes Auge scheint heiß auf meiner Haut zu brennen. Ein Vibrieren geht durch seinen Körper, das ich nun auch spüre, wie einen feinen Stromschlag.
Meine Augen schließen sich von selbst. Dunkelheit. Dann – kein klares Bild, nein. Sondern Gefühle, Klänge, Lichtfetzen. Ich atme scharf ein. Ein Strom fremder Empfindungen rauscht durch mich hindurch, als wäre meine Seele einen Moment lang nicht mehr allein in meinem Körper.
Da ist Wärme – ich fühle sie deutlich, obwohl die Luft in der Hütte kalt ist. Gefühle: Aufregung, Sehnsucht, drängende Unruhe, die nicht von mir stammen.
Canto?
Oder etwas in der Ferne?
Mein Herz schlägt schneller. Ich höre einen Klang, tief und hallend, wie fernes Glockengeläut oder das Echo eines Horns, das über weite Ebenen trägt. Es ist, als würde jemand in weiter Ferne eine Saite anschlagen, und der Ton zittert noch in meinen Knochen.
Unter dem Dröhnen vernehme ich beinahe Stimmen – flüsternde Laute, die ich nicht einordnen kann. Vielleicht täuscht mein Verstand mich.
Vor meinem inneren Auge glimmt ein Licht auf. Ganz schwach erst, ein fernes Leuchten, irgendwo jenseits meines eigenen Horizonts.
Mein Bewusstsein klammert sich an diesen Lichtschein. Er wächst, pulsiert synchron mit dem Rhythmus meines eigenen Blutes.
Ich spüre, wo es herkommt: der Süden.
Weit im Süden, hinter endlosen Wäldern oder Ruinen, leuchtet etwas auf. Golden? Weiß? Ich kann die Farbe nicht benennen, aber es strahlt heller als alles, was ich seit Langem gesehen habe. Und mitten in diesem Leuchten meine ich, eine Silhouette zu erkennen – die Andeutung eines gewaltigen Wesens oder vielleicht eines Baumes, riesig und alt. Etwas Mächtiges rührt sich dort, ein Leben oder eine Macht, die mich zugleich erschreckt und magisch anzieht.
Mein Herz verkrampft sich. In diesem Moment bin ich nicht mehr in meiner Hütte – ich bin reines Gefühl, reiner Klang, reines Licht.
Alles verschmilzt. Für einen Augenblick spüre ich eine tiefe Gewissheit, als hätte jemand mir einen Befehl ins Ohr geflüstert, klar und doch stumm. Ein einziges Wort formt sich in meinem Geist, unüberhörbar und dringlich:
Komm!
Mit einem Keuchen reiße ich die Augen auf. Ich wanke, taumle einen Schritt zurück. Der Kontakt ist abgebrochen.
Canto hat seinen Kopf zurückgezogen und beobachtet mich jetzt mit großen Augen. Mir ist schwindelig. Die Hütte ist noch dieselbe wie vor einer Minute – rauchiger Dunst an der Decke, bröckelnder Putz an den Wänden, unser Hab und Gut ordentlich in Kisten verstaut –, doch ich bin verändert. Meine Hände zittern. Ich presse die Finger gegen die Schläfen und versuche, meinen Atem zu beruhigen, der stoßweise geht, als hätte ich einen Sprint hingelegt.
Canto sitzt reglos vor mir, den Kopf leicht schief gelegt. Sein drittes Auge blinzelt langsam, als glimme darin noch ein Rest jenes fremden Lichts. In der Dämmerung der Hütte sieht es fast so aus, als leuchte es wirklich sanft.
„Was… war das?“, flüstere ich. Meine Stimme versagt beinahe. Natürlich kann Canto mir keine Antwort in Worten geben. Stattdessen senkt er sacht den Kopf und stupst mit seiner kalten Nase meine Hand, die immer noch zittert. Er spürt meine Unruhe.
Ein leises Winseln – entschuldigend? Drängend?
Ich bin mir nicht sicher.
Ich taste nach dem wackeligen Stuhl und lasse mich darauf nieder. Meine Beine fühlen sich an wie Gummi. In meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken.
Habe ich das eben wirklich erlebt?
Oder werde ich langsam verrückt in dieser Einsamkeit?
Die Vision – wenn es denn eine war – hat kein klares Bild hinterlassen, nur Eindrücke. Ein Licht im Süden. Ein Gefühl von Dringlichkeit. Und dieses Wort, laut und deutlich: Komm.
Ich schaue zu Canto hinüber. Er sitzt mir gegenüber, die Vorderpfoten ordentlich nebeneinander gestellt, und starrt mich an.
Wartet er auf meine Reaktion?
Er wirkt erwartungsvoll, wach.
„Hast du das auch gesehen?“, frage ich tonlos.
Canto knickt leicht den Kopf zur Seite. Es sieht beinahe aus wie ein Nicken. Natürlich könnte das Einbildung sein – ich habe ihm eine menschliche Geste angedichtet.
Aber irgendetwas in seinem Blick sagt mir, dass er weiß, was ich erlebt habe. Wahrscheinlich hat er es mir ja erst gezeigt.
Ich reibe mir übers Gesicht.
Meine Haut ist feucht – Schweiß? Tränen?
Ich fühle mich, als hätte ich etwas Unglaubliches geträumt, doch ich bin hellwach.
Vor ein paar Jahren hätte ich jeden für verrückt erklärt, der von telepathischen Wölfen und mysteriösen Rufen aus dem Süden erzählt.
Aber seit dem Ende hat sich die Definition von Wahnsinn verschoben. Ich weiß, dass zwischen Canto und mir eine besondere Verbindung besteht. Schon einmal hat er mir Bilder gezeigt, die mir das Leben retteten.
Damals, als ich ihn als Welpen fand, drückte er plötzlich sein kleines Köpfchen an meine Stirn und ich sah einen Weg – unseren Weg zu dieser Hütte, unserem sicheren Unterschlupf. Ohne dieses Wunder, nenne ich es jetzt einfach so, hätten wir die erste Nacht gemeinsam nicht überstanden.
Alles bleibt ambivalent.
War es Magie? Instinkt?
Eine Laune meines übermüdeten Geistes?
Ich habe keine Antworten, nur Erlebnisse. Und eben gerade hatte ich wieder so ein Erlebnis.
Eines, das mich nun vor eine Entscheidung stellt.
Ich atme tief durch. Meine Lunge füllt sich mit kalter Morgenluft, die durch die Ritzen hereinkriecht – oder vielleicht bilde ich mir die Kälte auch nur ein. Gedanken schwirren: Bleiben oder dem Ruf folgen?
-3-
Ich blicke mich in der Hütte um. Meine Augen streifen die sorgfältig geflickten Decken, den provisorischen Herd aus Ziegelsteinen, den Regalbrettern mit unseren wenigen Büchern und Vorräten. Diese vier Wände bedeuten Sicherheit. Hier haben wir unzählige Stürme, Winter und Nächte voll Hozerschreie überstanden. Hier kenne ich jede Diele, jedes Leck im Dach. Draußen hingegen wartet das Unbekannte – Kälte, Hunger, vielleicht der Tod.
„Warum jetzt?“, murmele ich leise und weiß doch, dass es auf diese Frage keine Antwort gibt.
Mein Verstand versucht, rationale Gründe zu finden, hier zu bleiben. Es ist Wahnsinn, einem vagen Ruf nachzugehen. Vielleicht war es nur ein Hirngespinst, geboren aus meinen einsamen Träumen. Vielleicht habe ich nichts gespürt außer der Sehnsucht, die mich ohnehin manchmal befällt, wenn ich an früher denke.
Früher… vor dem großen Knall, vor dem langen Winter, vor Yvettes Verschwinden.
War die Vision nur die Manifestation meines eigenen, tief verborgenen Wunsches, einen Sinn zu finden?
Einen Ort, an dem es besser ist als hier?
Der Süden als Symbol – als Versprechen von Licht, Wärme, Heilung. So viele Geschichten ranken sich darum. Ich habe sie in den Dörfern flüstern gehört, wenn ich einmal dort war, dass irgendwo jenseits des Horizonts vielleicht ein Land ohne ewige Kälte existiert. Ein Versprechen, ein Gerücht. Ich habe es stets als hoffnungsloses Märchen abgetan. Zu oft haben wir gelernt, dass es keine Wunder gibt, keine Paradiese mehr, nur das, was wir selbst mit unseren Händen schaffen.
Und doch…
Was, wenn an den Legenden ein Funken Wahrheit ist?
Was, wenn es wirklich jemanden oder etwas gibt, das mich ruft?
Allein der Gedanke lässt mein Herz schneller schlagen – im Takt jenes Nachhalls, den ich noch spüre, irgendwo tief in mir. Komm, hallt es leise nach.
-4-
Canto steht immer noch reglos an derselben Stelle. Er rührt sich nicht, beobachtet nur jeden meiner Atemzüge. Er wartet auf meine Entscheidung, so scheint es mir. Mein treuer Gefährte – er würde mir überallhin folgen, sogar in den Tod, das weiß ich. Aber diesmal ist er es, der mich führen will. Es war sein Ritual, sein Drängen.
Unwillkürlich stehe ich auf und gehe ein paar Schritte im engen Raum auf und ab. Das Knarren des Holzbodens ist das einzige Geräusch. Ich versuche, meine Gedanken zu ordnen, doch sie drehen sich im Kreis.
Ein Teil von mir möchte das eben Erlebte als Hirngespinst abtun, zur Tagesordnung übergehen. Holz hacken, Wasser suchen, die Fallen kontrollieren, wie an jedem anderen Tag auch.
Aber ein anderer Teil – ein längst verloren geglaubter Teil – flackert auf in meiner Brust. Hoffnung. Neugier. Ja, sogar Aufregung.
Wann habe ich das zuletzt gespürt?
Ich erinnere mich an Nächte, in denen ich wach lag und das Gefühl hatte, irgendetwas werde geschehen. Frühere Ahnungen.
Manchmal glaubte ich, Yvettes Stimme im Wind zu hören, meinen Namen rufend. Oder ich träumte von Straßenlichtern in der Ferne, die angingen – als kehre die alte Welt zurück.
Immer waren es nur Träume, geborsten beim ersten Licht des Tages. Doch diesmal… diesmal war es kein Traum. Ich war wach. Canto war bei mir, hat es ebenfalls gespürt. Das hier fühlt sich anders an. Realer.
Trotzdem zweifle ich. Ich bin gut darin, zu zweifeln – und zu zögern. Mein Kopf ist voller Was-wäre-wenn.
Was wäre, wenn der Ruf eine Falle ist?
Ein Hirngespinst, das uns ins Verderben lockt?
Was, wenn wir uns auf den Weg machen und nichts finden außer Kälte und Tod?
Meine Angst flüstert: Bleib hier. Hier lebst du, auch wenn es kein Leben in Fülle ist. Aber ist es wirklich Leben… oder nur Überleben?
Ich spüre einen Kloß im Hals. Die alte Vertraute, die Angst, erneut alles zu verlieren, kriecht meine Wirbelsäule hinauf.
Alles habe ich schon einmal verloren – Heimat, Freunde, Yvette.
Diese Hütte und Canto sind alles, was mir geblieben ist. Kann ich das aufgeben für eine ungewisse Suche?
Ich sinke wieder auf den Stuhl und lege den Kopf in die Hände. In meinem inneren Monolog kämpft die Vernunft gegen ein leises Flüstern des Herzens. Die Sekunden ziehen sich, während ich reglos sitze. Canto rührt sich nicht. Er weiß, dass dies mein Kampf ist – er drängt nicht weiter, er hat mir gezeigt, was er konnte.
Jetzt muss ich entscheiden.
„Ich brauche Bedenkzeit…“, flüstere ich ins Nichts. Meine Stimme klingt heiser. Canto blinzelt, steht dann langsam auf und trottet in eine Ecke, wo er sich hinlegt. Er bleibt jedoch hellwach, das merke ich, denn seine Ohren drehen sich weiterhin zur Tür. Er wird heute nicht mehr entspannen, das spüre ich.
Ich beschließe, den Tag über nichts zu überstürzen. Vielleicht klärt sich mein Kopf mit etwas Abstand.
Also zwinge ich mich, den normalen Aufgaben nachzugehen. Ich spalte Holzscheite vor der Hütte, schöpfe frisches Wasser aus der Zisterne. Canto folgt mir auf Schritt und Tritt, weicht nicht von meiner Seite. Er schnuppert unruhig in der Luft herum, als trüge der Wind irgendetwas Seltsames mit sich, einen Geruch oder ein Geräusch, das mein Menschenohr nicht wahrnimmt. Ich fühle mich wie in Trance, die Bewegungen gehen automatisch, doch meine Gedanken kreisen immer wieder um das Leuchten im Süden. Wann immer ich stehen bleibe und den Blick über die karge, verschneite Landschaft schweifen lasse, wandern meine Augen unwillkürlich gen Süden. Ich bilde mir ein, dass dort am Horizont das Licht etwas heller ist – aber vermutlich ist das Einbildung. Die Wolkendecke hängt düster und schwer wie immer. Die Sonne bleibt verborgen.
-5-
Gegen Abend braut sich ein feiner Nieselregen zusammen, eisig und stechend auf der Haut. Giftiger Regen vielleicht – ich kenne den Geruch. Wir verkriechen uns in der Hütte. Ich verschließe die Tür sorgfältig mit dem Riegel. Drinnen ist es dämmerig; das spärliche Abendlicht kämpft gegen die flackernden Schatten des Herdfeuers. Canto liegt zusammengerollt auf seinem Platz nahe der Tür, die Schnauze auf den Pfoten, die Augen geöffnet. Wachhund-Modus.
Er passt auf mich auf, wie so oft. Oder wartet er einfach nur weiter?
Ich versuche, etwas zu essen, doch ich bekomme keinen Bissen herunter. Meine Eingeweide sind wie verknotet. Schließlich lege ich mich in meine Decken. Vielleicht bringt die Nacht Rat – oder wenigstens etwas Ruhe.
Doch die Ruhe kommt nicht. Die ganze Nacht träume ich, in Fieberfetzen und doch mit einer Klarheit, die mich jetzt noch erschüttert. Ich weiß nicht, wann genau ich in den Schlaf fand, aber plötzlich befinde ich mich in einem Traum, der kein gewöhnlicher Albtraum dieser Ödnis ist.
-6-
Ich stehe auf einer weiten Ebene unter einem offenen Himmel. Über mir leuchten Sterne, hell und zahllos – mehr Sterne, als ich je gesehen habe. Es ist Nacht, aber am Horizont, weit im Süden, dämmert ein Licht. Kein kaltes Mondlicht, sondern warm und golden, als ginge dort in der Ferne eine zweite Sonne auf, mitten in der Dunkelheit. Ich spüre weiches Gras unter meinen nackten Füßen – Gras, lebendig und duftend, nicht das spärliche, verbrannte Moos, das hier und da unsere Realität bedeckt.
Im Traum lache ich vor Freude über das Gefühl von Gras und Erde an meinen Füßen. Neben mir bellt Canto – ein klarer, freudiger Laut, jung und unbeschwert.
Ich schaue zu ihm. Er ist kein gequältes Wesen mehr, sondern strahlt vor Kraft, sein Fell silbrig glänzend im Sternenlicht. Sein drittes Auge blickt wach und ruhig in die Ferne.
Ich folge seinem Blick. Dort, wo der Lichtschein am Horizont stärker wird, zeichnet sich eine Gestalt ab. Zunächst denke ich, es sei ein Baum – ein hoher, strahlender Baum mit ausladender Krone. Doch als ich nähertrete, verändern sich die Konturen.
Ist es ein Wesen? Menschlich? Ich erkenne es nicht genau.
Das Licht blendet mich, Tränen treten mir in die Augen.
Trotzdem gehe ich weiter. Meine Füße tragen mich wie von selbst nach vorn, Schritt um Schritt durch hüfthohes, sanft raschelndes Gras. Canto läuft voraus, immer dem Leuchten entgegen. Sein silbriger Umriss entfernt sich von mir, ich muss schneller gehen, beinahe rennen, um ihm zu folgen.
Meine Lungen brennen, aber es ist ein gutes Brennen – ich lebe, ich lebe! In meinem Traum stoße ich ein Lachen aus, das über die Ebene hallt.
Die Gestalt im Licht breitet die Arme aus, als wolle sie mich willkommen heißen. Für einen atemlosen Moment glaube ich, Yvette vor mir zu sehen. Ihre Silhouette, ihr schwarzes Haar, das sich vom Lichtkranz wie ein Heiligenschein abhebt.
Ich bin mir sicher, sie ist es!
„Yvette!“, rufe ich und strecke die Hand aus. Mein Herz jubelt. Noch ein paar Schritte, dann habe ich sie erreicht…
Doch plötzlich verschwimmt alles. Das Licht flutet über mich hinweg, wird grell und heiß. Ich reiße die Arme vors Gesicht.
Canto bellt – ein scharfer, warnender Ton. Die warme Brise schlägt um in einen glühenden Windstoß. Aus dem strahlenden Süden erklingt wieder dieses tiefe Dröhnen, erst fern, dann lauter. Lauter, bis der Boden unter mir zu beben scheint. Ich schreie auf – vor Angst oder Enttäuschung, ich weiß es nicht. Alles verschwimmt in gleißendem Weiß.
Mit klopfendem Herzen fahre ich aus dem Schlaf hoch. Draußen ist es noch dunkelgraue Nacht oder früher Morgen, das kann ich nicht sagen. Mein Atem geht schnell, Schweiß klebt auf meiner Stirn trotz der Kälte in der Hütte. Es war nur ein Traum… ein Traum.
-7-
Ich bin wieder hier. Rauer Holzboden unter mir, das fahle Zwielicht vor der Dämmerung, der saure Geruch kalter Asche im Raum. Keine Wiese, kein Lichtbaum, kein warmer Wind.
Ich spüre Enttäuschung und Erleichterung zugleich. In meinem Mund schmecke ich Salz – ich habe im Schlaf geweint.
Die Eindrücke des Traums hängen noch an mir, wie Spinnweben, die ich nicht abschütteln kann.
Yvette… ich könnte schwören, ich habe sie gesehen, für einen winzigen Moment. War das nur der Trick meines sehnsüchtigen Herzens? Oder sollte es mir etwas sagen?
Ein leises Geräusch reißt mich ganz in die Realität zurück.
Kratzende Pfoten auf Holz. Canto erhebt sich von seinem Platz an der Tür. Offenbar hat er bemerkt, dass ich wach bin. Draußen dämmert es gerade – ein fahlblauer Schimmer sickert durch die Ritzen. Morgen. Ich muss wohl doch einige Stunden geschlafen haben. Canto streckt sich und schüttelt sein Fell. Dann tapst er langsam zu mir herüber. Seine Augen fixieren mich im Halbdunkel, und in ihnen liegt etwas, das ich fast als Frage interpretieren möchte.
Ich richte mich auf und fahre mir müde durchs Haar. Mein Körper schmerzt; der seelische Kampf des gestrigen Tages scheint sich in meinen Muskeln festgesetzt zu haben. Canto kommt näher, stupst mit seiner Schnauze sanft meine Schulter. Ein stilles „Guten Morgen“. Seine Rute wedelt zögerlich, aber seine Haltung bleibt gespannt.
Er wartet immer noch auf meine Entscheidung – das wird mir in diesem Moment klar. Vielleicht hat er sogar meinen Traum irgendwie geteilt oder gespürt, wie er es manchmal tut.
Ich lege eine Hand an seine Seite und spüre seinen Herzschlag unter dem dichten Fell. Kräftig, lebendig.
Ich schlucke trocken.
Das Bild des südlichen Lichts flammt erneut in mir auf, doch nun vermischt mit dem Schmerz des Erwachens. War das eine mögliche Zukunft, die ich gesehen habe? Oder nur ein Wunschtraum?
So oder so… die Fragen werden mich nicht loslassen. Ich kann nicht länger hier sitzen und darauf hoffen, dass sich alles von selbst auflöst.
Canto schaut mich mit seinem durchdringenden Blick an. In der stillen Sprache zwischen uns sagt er mir längst, was ich tief drin schon beschlossen habe. Ich atme einmal langsam ein und aus, schaue zur verriegelten Tür, dann zurück zu ihm.
„Wir werden es tun, oder?“ sage ich leise. Mein Herz schlägt plötzlich erstaunlich ruhig. In diesem Augenblick fällt alle Ungewissheit von mir ab, und an ihre Stelle tritt ein entschlossener, stiller Frieden.
Canto winselt leise – ein zustimmender Ton, wie ein erleichtertes Ausatmen. Er versteht mich. Vielleicht hat er es schon immer verstanden und nur darauf gewartet, dass ich es endlich begreife.
Ohne ein weiteres Wort stehe ich auf. Meine Beine fühlen sich nun fest an, geerdet. Ein Funke Energie durchzuckt mich.
-8-
Vorbereitung auf die Reise. Wenn wir wirklich aufbrechen wollen, dann am besten jetzt, bei Tagesanbruch. Schnell und leise, bevor mich der Mut wieder verlässt.
Ich ziehe meinen Rucksack unter der Pritsche hervor. Er ist alt, aus kräftigem Segeltuch, mit Lederstreifen so oft geflickt, dass das ursprüngliche Material kaum noch sichtbar ist. Zittrig vor Anspannung beginne ich, alles Nötige zusammenzusuchen. Ich rede nicht, Canto auch nicht – die Stille wird nur vom Rascheln und Klappern meiner Handgriffe erfüllt.
Ich packe Vorräte ein. Das Wenige, was wir haben. Ein halbes Dutzend getrockneter Fleischstreifen, etwas Pemmikan in einem Tontopf, zwei Dosen Bohnen (mein kostbarer Rest, gehütet für einen Notfall – vielleicht ist dieser jetzt gekommen). Eine Flasche sauberes Wasser, eingetauscht vor Monaten im Dorf, gut verpackt in einem dicken Tuch. Dazu meine Feldflasche, frisch gefüllt mit dem Regenwasser von gestern, das ich abgekocht habe.
Meine persönlichen Gegenstände wähle ich mit Bedacht. Zuerst greife ich nach dem Foto von Yvette. Es steckt in einem kleinen Lederumschlag, ganz hinten im Regal zwischen den Büchern versteckt. Vorsichtig ziehe ich das Foto heraus. Das Papier ist vergilbt und an den Ecken eingerissen, doch ihr Lächeln darauf leuchtet mir entgegen wie am ersten Tag. Yvette… aufgenommen an einem Sommertag vor vielen Jahren. Ihre dunklen Locken kleben ihr in Strähnen auf der Stirn, weil wir damals im Sommerregen standen. Sie lacht in die Kamera – in meine Kamera – mit einer Unbekümmertheit, die mir fast das Herz zerreißt, so schön ist sie.
Ich streiche mit dem Daumen behutsam über ihr abgebildetes Gesicht. In meiner Kehle schnürt sich etwas zusammen. Ihr Verlust ist eine nie verheilende Wunde. Das stimmt wohl. Aber die Erinnerungen an sie… sie sind mein Fluchtpunkt, mein Trost, wenn alles dunkel wird. Einen Moment lang vergesse ich die Hütte, den Wolf, den Ruf – ich bin ganz versunken in einem vergangenen Augenblick.
-9-
Es war an einem jener heißen Sommerabende in der alten Welt, als wir jung waren und glaubten, uns gehöre die Zukunft. Eine laue Nacht im Juli, die Straßen leer gefegt nach einem Gewitter. Yvette und ich liefen barfuß im Regen über eine Brücke, die noch warm war vom Tageslicht. Über uns surrten ein paar funzelige Straßenlaternen, ihr gelbes Licht spiegelte sich in den Pfützen auf dem Asphalt. Unsere Schuhe trugen wir in der Hand. Wir waren durchnässt bis auf die Haut, und es war uns egal. Der Sommerregen kühlte unsere glühenden Wangen, und der ferne Donner mischte sich mit unserem Lachen.
Yvette zog mich mitten auf der Brücke unter eine Laterne. Ihr Sommerkleid klebte an ihren Beinen, und ihre nackten Füße hinterließen kleine Wasserflecken auf dem Beton. Ich weiß noch, wie sie sich damals zu mir umdrehte: Ihr Gesicht glänzte vor Nässe, Wassertropfen hingen an ihren Wimpern, und sie hatte dieses unverschämt freie Grinsen, das alle meine Sorgen wegfegte. In diesem Augenblick war sie das schönste Wesen, das ich je gesehen hatte.
Sie hob die Hand und zeigte mir, was sie aus ihrer Tasche gezaubert hatte – einen Schokoriegel, halb geschmolzen.
„Unser Festmahl“, witzelte sie, setzte sich spontan auf das Brückengeländer und biss ein Stück ab. Dann zog sie mich zu sich heran. Ich spürte das Prasseln des Regens auf meinen Schultern und zugleich die Wärme ihres Körpers, als sie mir das restliche Stück Schokolade an die Lippen hielt. Süß und bitter schmeckte es, auf meiner Zunge vermischt mit dem salzigen Regen.
Oder waren es meine eigenen euphorischen Tränen?
In dieser Sekunde wollte ich, dass die Zeit stehen bleibt.
Yvette legte ihren Kopf an meine Schulter. Ich spürte ihr Zittern – ob vor Kälte oder vor Gefühl, wusste ich nicht.
Also hielt ich sie fest. Über uns summte die Laterne und zog Motten an, die im Licht tanzten, genau wie wir es hätten tun können. Aber ich stand nur da, die Arme um sie gelegt, und mein Herz schlug bis zum Hals vor lauter Liebe und Angst.
Angst, weil ich mir dieses Glück kaum eingestehen mochte. Selbst an diesem perfekten Abend arbeitete es in mir: die Zweifel, die Fragen.
Wie lange würde dieses Glück halten?
Verdiente ich es überhaupt?
Ich dachte zu viel – das wusste ich, doch ich konnte es nicht abstellen. Meine Gedanken waren schon immer mein größter Feind.
Vielleicht spürte sie genau in diesem Moment meinen inneren Aufruhr. Denn Yvette löste sich leicht aus meiner Umarmung, gerade so viel, dass sie mir in die Augen sehen konnte. Ihre Finger strichen über meine Wange, die Tropfen wegwischend. Dann lachte sie leise, fast mitleidig, und sagte mit sanfter Stimme:
„Du denkst zu viel, Max.“
Ich weiß noch, wie ich schlucken musste. Meine Proteste blieben mir im Hals stecken, weil sie natürlich recht hatte. Sie hatte immer recht damit.
„Manchmal musst du einfach fühlen“, flüsterte sie und legte eine Hand auf meine Brust, direkt über mein rasendes Herz.
„Hier. Vertrau darauf. Denk nicht immer an das Morgen, denk an jetzt.“
„Jetzt…?“ wiederholte ich unsicher. Das Wort zerfloss mir fast auf der Zunge, weil genau in diesem Jetzt all meine Sinne überflutet wurden. Vom Geruch des nassen Asphalts, vom Donnergrollen über uns, vom Geschmack der Schokolade und vor allem von ihrer Nähe.
Yvette nickte und lächelte.
„Jetzt“, bestätigte sie. Ihre Augen blitzten im Laternenlicht. Und dann küsste sie mich, unvermittelt, lachend, mit Regen auf unseren Lippen. Ich verlor mich in diesem Kuss, in diesem Augenblick, als gäbe es keine Vergangenheit, keine Zukunft, nur uns beide im Sommerregen. Mein Kopf wurde endlich still. Kein Gedanke, nur Gefühl – Wärme, Liebe, Lebendigkeit.
Dieser Kuss auf der Brücke hat sich mir eingebrannt. Es war der Moment, in dem ich wusste, dass ich mein Leben mit dieser Frau teilen wollte, komme was wolle.
Zärtlichkeit unter flackernden Lichtern, mitten in einer kalten Welt, die uns egal war, solange wir zusammen barfuß durch Pfützen springen konnten. Ihr Lachen hallte noch in meinen Ohren, als wir später Arm in Arm nach Hause gingen, die nassen Schuhe immer noch in unseren Händen. Und ich erinnere mich, dass ich damals schwor, sie niemals loszulassen.
-10-
Die Erinnerung verblasst. Ich sitze wieder in der düsteren Hütte, in den Trümmern der Gegenwart, das Foto in der Hand. Meine Wimpern sind feucht – ich merke erst jetzt, dass mir Tränen über die Wangen laufen. Schnell wische ich sie mit dem Handrücken fort. Kein Kitsch, denke ich bei mir. Gefühle, ja, aber keine Illusionen.
Die alte Welt ist tot, und mit ihr all die warmen Sommernächte.
Ich habe Yvette seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, seit jener Flut nach dem großen Knall, die uns auseinandergerissen hat.
Ob sie noch lebt? Ich erlaube mir kaum, es zu hoffen. Ich gebe mich da keiner Illusion hin, hatte ich mir immer gesagt. Und doch… jeden Abend halte ich dieses Foto, als könnte ich sie damit in die Wirklichkeit zurückwünschen.
„Du denkst zu viel, Max.“ Ihr liebevolles Schelten klingt in mir nach wie ein ferner Glockenton. Ich lächle bitter. Ja, mein Schatz. Ich denke zu viel. Schon immer.
Vielleicht hast du recht: Ich sollte endlich fühlen und handeln, statt alles totzugrübeln.
Mit neuer Entschlossenheit stecke ich das Foto zurück in den Lederumschlag und lege es behutsam oben in den Rucksack. Yvette kommt mit – zumindest in Form dieses Bildes und der Erinnerung, die es in mir trägt.
Als Nächstes nehme ich meinen kleinen Glücksstein aus der Tasche. Es ist ein abgerundeter, weißgrauer Kiesel, unscheinbar und doch bedeutsam, weil ich ihn am Tag nach Yvettes Verschwinden fand. Seither begleitet er mich. Ein Aberglaube vielleicht, aber er hat mir in manch dunkler Stunde Halt gegeben.
Ich küsse den kühlen Stein kurz – ein stummer Wunsch an das Schicksal – und verstaue ihn sorgsam in einem Seitenfach des Rucksacks, wo er sicher ist.
Mein Blick schweift durchs Regal mit den Büchern. Ich kann nicht alle mitnehmen; sie sind zu schwer. Seufzend lasse ich die Finger über die Buchrücken wandern: ein zerfledderter Gedichtband, ein Fachbuch über alte Astronomie, ein Romanfragment. Am Ende wähle ich ein einzelnes Buch, das mir am meisten bedeutet – das Buch, aus dem ich so oft vorgelesen habe, still für mich selbst oder manchmal für Canto.
Es enthält Geschichten von Mut und Menschlichkeit aus der alten Zeit. Dieses Buch ist mein Erinnerungsanker an die Kultur, die wir verloren haben. Ich stecke es ein. Alle anderen lasse ich schweren Herzens zurück, in der Hoffnung, sie hier irgendwann wiederzusehen… oder dass ein anderer Überlebender sie findet und daraus Trost schöpft.
Nun noch Kleidung. Ich rolle ein frisches Hemd, eine Ersatzhose und ein Paar Wollsocken zusammen. Mein wetterfester Mantel kommt obenauf – er ist abgewetzt, aber hält immerhin etwas Regen ab.
Dann meine Waffe. Ein einfaches Jagdmesser in einer Lederscheide, das ich mir an den Gürtel binde. Mehr habe ich nicht; Schusswaffen und Munition sind ein Luxus, der uns hier schon lange abhandengekommen ist. Vielleicht besser so – keine Wundertechnik, hatte ich mir immer gesagt, wir machen es auf die altmodische Tour. Der Bogen, den ich einst gebastelt habe, ist leider vor kurzem gebrochen, also müssen das Messer und Canto’s Zähne genügen.
Schließlich werfe ich noch eine Rolle Verbandszeug und zwei kleine Gläser mit Salbe und Jod in den Rucksack – meine ganze Apotheke. Verletzungen unterwegs könnten sonst schnell tödlich werden.
Der Rucksack ist nun schwer, aber ich habe schon Schlimmeres geschleppt. Ich ziehe die Riemen fest und stelle ihn neben die Tür. Meine Hände zittern nicht mehr. Jeder Handgriff eben war wie ein Abschiedsritual.
Langsam richte ich mich auf und lasse den Blick ein letztes Mal durch die Hütte schweifen. Abschied. Diese einfachen Wände aus Brettern und Lehm waren jahrelang meine Zuflucht, mein Zuhause in einer Welt, die kein Zuhause mehr kennt.
Dort, an der Tür, habe ich mir immer gewünscht, dass Yvette einfach hereinkommt – ich sehe es vor mir, auch wenn es nie passiert ist. In jener Ecke hätte ihr Rucksack gelegen, den sie damals mitnahm, als sie in die Ebene hinabstieg, um was zu essen zu holen. Wünsche, die niemals in Erfüllung gegangen sind.
Die Narben dieses Ortes erzählen Geschichten von Einsamkeit, Angst und kleinen Freuden. Der Strich an der Wand, mit dem ich jeden überlebten Winter markiert habe (es sind neun Striche). Die Kerben im Türrahmen, wo Canto als Welpe daran geknabbert hat. Die rußgeschwärzte Decke über der Feuerstelle. Der wackelige Tisch, an dem wir so oft wortlos gegessen haben. Alles Zeugnisse meines Daseins hier.
Hier habe ich überlebt – aber wenn ich jetzt nicht gehe, werde ich hier vielleicht sterben, ohne je wirklich wieder gelebt zu haben.
Eine leise Stimme in mir flüstert genau das. Wenn ich jetzt nicht gehe…
Dann werde ich für immer ein Gefangener meiner Angst bleiben.
Dann werde ich nie erfahren, ob jenseits des Hügels noch etwas auf mich wartet – Antworten, Hoffnung, vielleicht sogar Yvette oder zumindest ein Grab, das ich besuchen kann.
Ich schultere den Rucksack. Das Gewicht zieht an meinem Rücken, doch es fühlt sich seltsam richtig an.
Canto steht bereits an der Tür, als wüsste er genau, dass es nun soweit ist. Er hechelt leise, aufgeregt, und blickt mich an.
Einen letzten Moment zögere ich. Meine Hand ruht auf dem hölzernen Riegel der Tür. Hinter mir liegt alles Vertraute. Vor mir… ich werfe einen Blick zu Canto. Er wippt ungeduldig von einer Pfote auf die andere. In seinem dritten Auge spiegelt sich ein Schimmer des beginnenden Tages. Ich erinnere mich an etwas, das Yvette mir an jenem Sommerabend sagte:
„Vertrau deinem Herzen.“
Und auch an ihre neckenden Worte denke ich:
„Du denkst zu viel, Max.“
„Nicht mehr“, murmele ich kaum hörbar zu mir selbst. Dann schiebe ich den Riegel zurück. Mit einem leisen Knarren gibt die Tür nach, und ein Schwall kalter Morgenluft strömt herein.
Ich trete hinaus ins Freie. Der Wind fährt mir sofort ins Gesicht – schneidend und wach.
Es hat aufgehört zu nieseln; die Wolkendecke hängt jedoch schwer und bleiern am Himmel. Wehmut überfällt mich, als ich mich noch einmal umdrehe und die Hütte betrachte. Ein kleiner, schiefer Bau auf dem Hügelkamm, von Moos überwuchert und vom Schicksal geprüft.
Mein sicherer Hafen in stürmischer See. Es fühlt sich an, als würde ich einen alten Freund im Stich lassen.
„Leb wohl“, flüstere ich. Es ist kein dramatischer Abschied, eher ein leises Versprechen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht auch nicht.
In meinen Gedanken flackert die Angst auf, doch gleichzeitig spüre ich etwas anderes in mir aufsteigen – Neugier. So vieles liegt unbekannt da draußen.
Die Welt mag zerbrochen sein, aber sie ist noch da.
Was mag uns erwarten auf dem Weg nach Süden?
Finden wir die Quelle des Lichts, den Ursprung des Rufes? Oder zumindest Antworten auf all die Fragen, die mich seit Jahren umtreiben?
Was ist aus dieser Welt geworden… und was ist aus mir geworden?
Canto hat bereits ein paar Schritte den Pfad hinab gemacht. Jetzt hält er inne und dreht sich zu mir um, als wolle er sicherstellen, dass ich ihm folge. Ich ziehe die Tür der Hütte ins Schloss und schiebe symbolisch einen Stein davor, auch wenn niemand hier ist, der etwas stehlen könnte. Vielleicht will ich nur nicht, dass der Wind alles verweht. Ein Teil von mir hofft, diesen Ort eines Tages wiederzusehen – verändert, genau wie ich mich gerade ändere.
Ich gehe los. Der erste Schritt fällt schwer, fast wie gegen einen unsichtbaren Widerstand. Doch dann setzt sich mein Körper wie von selbst in Bewegung.
-11-
Schritt für Schritt entferne ich mich von der Hütte, vom Alten, vom Bekannten.
Wir steigen den Hügel hinab, gen Süden. Der Weg ist kaum mehr als ein erodierter Trampelpfad zwischen verkümmerten Büschen und abgestorbenen Bäumen.
Ich kenne ihn gut – normalerweise führt er mich zu einer nahen Quelle oder zu den Überresten eines Dorfs im Tal. Doch heute wird er uns viel weiter führen. Mein Herz klopft schneller, aber es fühlt sich nicht mehr nur nach Angst an. Es ist auch Vorfreude darin.
Ich bleibe kurz stehen und schaue über meine Schulter zurück. Oben auf dem Hügel hebt sich die Kontur meiner Hütte gegen den grauen Himmel ab, klein und verletzlich. Mein Brustkorb zieht sich zusammen. Vielleicht zum letzten Mal sehe ich diesen Anblick.
Die Heimat, die ich mir eigenhändig geschaffen habe. Ein Leben in Trümmern, aber mein Leben.
Dort oben blieb ein Stück von mir zurück, das hier Wurzeln geschlagen hatte aus Bequemlichkeit und Furcht.
Es schmerzt, diesen Teil auszureißen. Wehmut – ja, die verspüre ich jetzt mit jeder Faser. Aber zugleich ist da auch Neugier und eine leise Hoffnung, die mit jedem Schritt wächst, so vorsichtig wie eine Pflanze, die aus Asche sprießt.
Ich atme tief ein und wende mich endgültig ab. Canto wartet unten am Ende des Pfads auf mich. Ich ziehe den Kragen meines Mantels hoch und marschiere weiter. Mit jedem Meter, den wir zurücklegen, wird mein Blick fester nach vorn gerichtet. Der Wind treibt vereinzelte Schneeflocken über den Weg, als wollte er uns prüfen. Doch wir halten Kurs. Vor uns erstreckt sich die weite, offene Landschaft des Südens – unbekannt, verheißungsvoll, gefährlich. Über toten Wipfeln und zerstörten Dächern einer fernen Ruine blitzt ein schwacher heller Schein durch die Wolken. Vielleicht nur eine Laune des Wetters… oder ein erstes Zeichen jenes Lichts, das ich gesehen habe.
Canto hebt die Schnauze und stößt einen langen, melodiösen Laut aus – kein Warnheulen, eher ein Ruf voller Entschlossenheit. Es klingt fast wie Abschied und Begrüßung zugleich, als verabschiede er sich von diesem Landstrich und begrüße die Reise.
Sein drittes Auge wirkt wach und fast als würde es selbst sanft leuchten. Ich kann nicht anders als zu lächeln.
„Führ uns, mein Freund“, murmele ich. Canto wirft mir einen kurzen Blick zu – in seinen Augen ein Funkeln, das ich als Zuversicht deute – dann setzt er sich in Bewegung. Sein graubraunes Fell verschmilzt beinahe mit den winterkahlen Sträuchern, doch ich halte ihn stets im Blick. Er trottet nicht ziellos; nein, er führt tatsächlich.
Sein Gang ist zielstrebig, die Ohren nach vorn gerichtet, die Nase dicht am Boden, als folge er einer unsichtbaren Fährte. Dem Ruf vielleicht. Oder einfach seinem Instinkt. In diesem Moment spielt es keine Rolle – ich vertraue ihm mehr als mir selbst.
So beginne ich zu folgen.
Schritt um Schritt, der Dreiäugige Wolf immer ein paar Meter voran. Wir beide ziehen südwärts. In meinem Inneren tobt kein Kampf mehr, nur eine merkwürdige Mischung aus Trauer und Zuversicht. Die Wehmut über das Verlassene sitzt mir im Nacken wie ein dunkler Schatten, doch vor mir, in jeder neuen Fußspur, glitzert eine Spur von Hoffnung. Sehnsucht treibt mich an – Sehnsucht nach Antworten, nach Licht, nach einem neuen Sinn. Vielleicht.
Ein letztes Mal halte ich inne. Ich blicke nicht zurück; das habe ich bereits getan. Stattdessen schaue ich nach vorn, in das diffuse Grau des frühen Tages. Irgendwo dort, weiter als mein Auge reicht, liegt das, was uns gerufen hat. Vielleicht ist es ein Ort. Vielleicht eine Person. Vielleicht nur die Idee von all dem. Ich weiß es nicht.
Canto bleibt ebenfalls stehen und wartet auf mich. Ich ziehe meine Schultern gerade, atme die kalte Luft tief ein und trete an seine Seite. Er stupst meine Hand und sieht mich an, als wollte er sagen: Bereit?
Ich nicke knapp. Bereit. So bereit man eben sein kann, wenn man das Vertraute hinter sich lässt und ins Ungewisse geht.
Gemeinsam setzen wir uns wieder in Bewegung. Meine Schritte fühlen sich mit jedem Tritt sicherer an. Die Müdigkeit der Nacht fällt von mir ab, ersetzt durch eine leise Spannung. Ich höre das Knirschen des gefrorenen Bodens unter meinen Stiefeln, das Schnaufen meines Atems in der stillen Morgenluft.
Neben mir trabt Canto nahezu geräuschlos, ein Schatten mit drei wachsamen Augen. Vor uns erstrecken sich trostlose Felder und Wälder, doch irgendwo dahinter wartet etwas. Ich spüre es wieder leise im Brustkorb vibrieren – wie einen entfernten Herzschlag, der nicht meiner ist. Komm, klingt es in meiner Erinnerung nach. Und nun folge ich diesem Ruf endlich.
Die ersten Strahlen der verborgenen Sonne kämpfen sich durch das dichte Wolkenband und malen einen bleichen Schein an den südlichen Horizont.
Vielleicht ist es nur Einbildung, aber mir scheint, als würde der Himmel dort in der Ferne einen Hauch heller. Ich kneife die Augen zusammen. Ein schmaler Lichtstreif bricht durch die Wolkenlücke und taucht die Trümmerlandschaft vor uns in graues, mildes Licht. Für einen flüchtigen Moment fühlt es sich an, als läge wirklich ein Versprechen darin – ein Licht im Dunkel, zaghaft, aber unaufhaltsam. So wie die Sonne gestern den Mond verdrängte, so will nun etwas Neues die Dunkelheit in mir vertreiben.
Ich werfe einen Blick zu Canto. Er hat den Kopf gehoben und scheint den Lichtstreif ebenfalls zu betrachten. Seine Ohren sind entspannt, und in seinem typischen schiefen Wolfsgrinsen meine ich sowas wie Hoffnung zu erkennen. Ich muss lächeln.
Ohne weiteres Zögern schreite ich voran. An der Seite meines treuen Begleiters verlasse ich endgültig die vertrauten Hügel. Der Aufbruch. Ohne dramatischen Knall, keine Trompeten, lediglich meine Schritte und Cantos Pfoten, die im Wechsel die Erde berühren, vorwärts, immer vorwärts. Hinter uns verblasst das vergangene Leben, vor uns liegt der Weg.
Ich fühle, wie Wehmut und Neugier in meiner Brust miteinander ringen, doch es ist ein gutes Ringen.
Beides gehört zu mir. Das Trauern um das Verlorene und das Sehnen nach dem Unbekannten.
Vielleicht ist genau das Menschlichkeit – weiterzugehen trotz der Angst, mit der Erinnerung im Herzen und dem Blick nach vorn.
Ein kalter Windstoß kommt von hinten und schiebt uns beinahe an. Ich ziehe den Rucksack fester. Canto gibt ein kurzes, helles Heulen von sich – es klingt wie ein Jubeln im Aufbruchsschmerz. Ich antworte nicht mit Worten, sondern mit einem entschlossenen Schritt über die unsichtbare Grenze zwischen gestern und morgen.
So ziehen wir gen Süden davon. Canto führt, und ich folge ihm in das bleiche Morgenlicht – hinein in eine neue, ungewisse Dämmerung der Hoffnung. Wir haben nichts als uns selbst, einen Ruf in unseren Herzen und die endlose Straße vor uns. Doch in diesem Augenblick spüre ich, dass dies richtig ist.
Und was immer uns dort draußen erwartet, sei es Freund oder Feind, Sinn oder Scheitern – wir werden ihm entgegengehen, Schritt für Schritt.
Denn wenn ich eines gelernt habe, dann das: Manchmal muss man einfach fühlen.
Ich fühle den Ruf immer noch in mir nachhallen, leise aber beharrlich. Also gehe ich weiter, ohne mich noch einmal umzublicken. Jeder Schritt fort von der Hütte ist ein Schritt ins Licht – oder zumindest in die Richtung, wo ich es vermute.
Canto und ich verschwinden im fahlen Horizont.
Er führt. Ich folge.
Komm!, pocht es in meinem Herzen. Und endlich habe ich geantwortet.
IV. Die Reise
-1-
Der Morgen ist kalt und still, als Canto und ich die vertrauten Hügel endgültig hinter uns lassen. Unsere Atemwolken stehen in der frostigen Luft. Unter meinen Stiefeln knirscht gefrorener Boden, der einst Ackerland war. Vor uns liegen verlassene Felder, brach und von dünnem Raureif überzogen, in denen kein Leben mehr keimt. Am Horizont ragen die schwarzen Gerippe toter Wälder in den grauen Himmel, ihre Äste wie klagende Arme. Dazwischen erkenne ich die Umrisse verkohlter Maschinen – ein verrosteter Traktor auf einem Feldrand, die Karosserie von Moos und Flechten überwuchert. Die Welt um uns ist eine stumme Kulisse aus Ruinen und Asche, und nur der Wind erfüllt sie mit leisem Leben, wenn er über das verbrannte Gras streicht.
Wir wandern stundenlang, ohne einem einzigen Menschen zu begegnen. Nur einmal sehe ich in der Ferne einen Hirsch über ein Feld hinken, bevor er im toten Wald verschwindet – zu weit weg und zu krankhaft dünn, um Jagd auf ihn zu machen. Der Himmel bleibt bedeckt, das Licht fahl. Es könnte früher Vormittag sein oder schon Mittag; die Sonne bleibt hinter dichten Wolken verborgen und Zeit verliert an Bedeutung.
Als wir eine verlassene Landstraße kreuzen, halte ich kurz inne. Ein geborstenes Asphaltband zieht sich über die Ebene und verschwindet zwischen den Hügeln im Norden. Daneben ragt schief ein altes Straßenschild aus dem Boden. Ich trete näher und wische mit dem Handschuh den Schmutz von der verblichenen Oberfläche. Die Aufschrift ist kaum noch zu entziffern – ein paar Buchstaben, eine halbe Ortsangabe, mehr nicht. „...dorf“ lese ich leise flüsternd, doch der Rest fehlt.
Früher hätte dieses Schild Reisenden den Weg gewiesen; jetzt steht es hier als einsames Mahnmal in der Ödnis. Ein Wegweiser ohne Ziel. Ich spüre einen Anflug von Wehmut, denke an all die Ziele, die es einmal gab. Wie viele Menschen mögen diesem Pfeil einst gefolgt sein, voller Hoffnung auf Ankunft?
Heute gibt es für uns nur eine Richtung: Süden. Einen Ort, den kein Schild beschreibt.
Am Straßenrand, an dem überwucherten Fundament einer Bushaltestelle, flattert etwas im Wind. Ein zerrissenes Werbeplakat hängt dort, halb gelöst von der Wand, doch die Farben darauf leuchten erstaunlich lebendig in all dem Grau. Neugierig gehe ich darauf zu. Die Ränder des Papiers sind ausgefranst und von Flechten gesprenkelt. Ich erkenne darauf das verblasste Bild eines strahlend blauen Meeres unter Palmen. Ein lächelndes Gesicht, Sonnenbrille im Haar, daneben in dicken Buchstaben das Wort „Paradies“. Ich muss schlucken.
„Urlaub im Paradies – jetzt buchen!“ steht da, als höre ich einen längst verklungenen Radiospot dazu. Mein Mund fühlt sich plötzlich trocken an. Paradies.
Das Wort wirkt wie aus einem Märchen in dieser Welt aus Kälte und Trümmern. Ich reiße unbewusst ein Stück des Plakats ab und betrachte es.
Ein Gefühl, halb Sehnsucht, halb bitterer Spott, steigt in mir auf. Yvette hatte immer vom Meer geträumt.
„Eines Tages werden wir am Strand sitzen, Max“, hatte sie gesagt, während wir nach dem großen Knall eng umschlungen in einem Keller ausharrten. Ihre Stimme zitterte damals, doch in ihren Augen lag dieser Funke Trotz.
„Wir werden die Füße ins warme Wasser tauchen. Irgendwo, wo es wieder Leben gibt.“ Ich blinzle, und die Erinnerung verblasst zusammen mit dem verknitterten Fetzen Papier in meiner Hand. Das Plakat segelt im nächsten Windstoß davon, trudelt über die Straße und verschwindet im Feld. Das Paradies ist davon geweht, denke ich, und eine merkwürdige Traurigkeit bleibt zurück.
Canto stupst mich sanft mit der Nase, drängt mich weiterzugehen. Er hat die Rastlosigkeit im Blut; stehenzubleiben macht ihn nervös. Ich zwinge meine Beine in Bewegung und wir setzen unseren Weg fort.