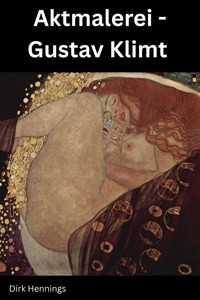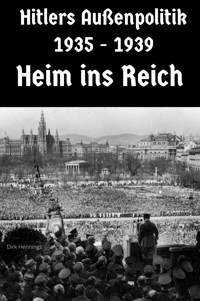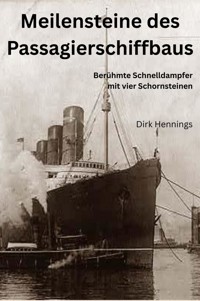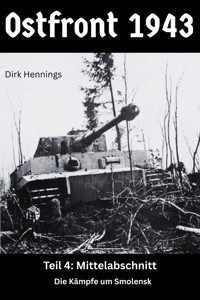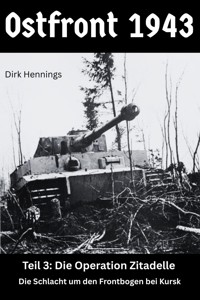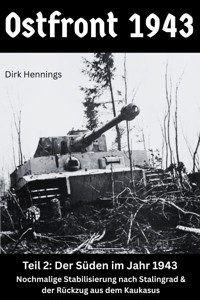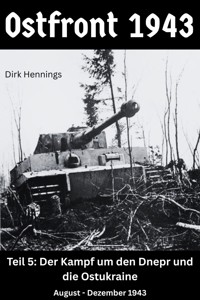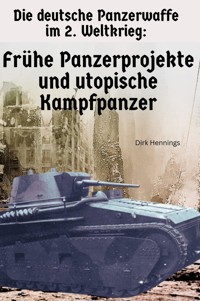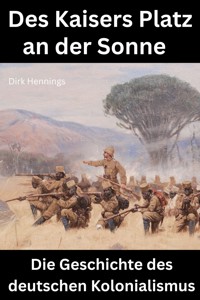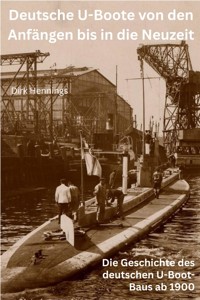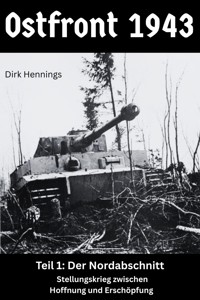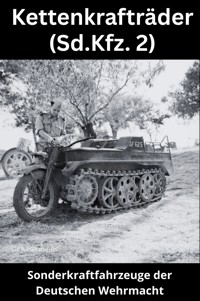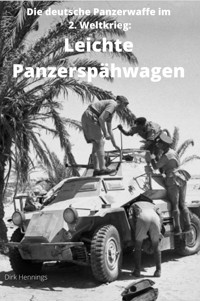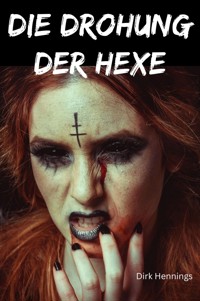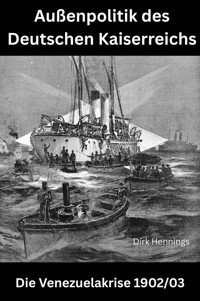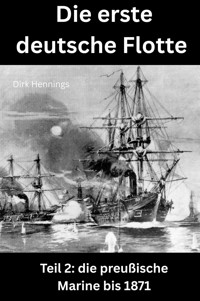Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
OSTFRONT 1942 Teil 1: Die Stabilisierung der Ostfront – Abwehrkämpfe im Norden und in der Mitte Während sich das operative Schwergewicht der Wehrmacht im Sommer 1942 auf den Südabschnitt der Ostfront verlagerte, standen die Heeresgruppen Nord und Mitte vor der Herausforderung, ihre Frontlinien unter zunehmendem gegnerischen Druck zu konsolidieren und zu halten. In diesem Kontext kam es im Norden und in der Mitte zu zahlreichen Abwehr- und Rückzugsgefechten, deren Ziel primär die Stabilisierung der bestehenden Frontverläufe war. Dieses Werk analysiert die militärischen Operationen am Nord- und Mittelabschnitt der Ostfront im Jahr 1942. Schwerpunkte sind unter anderem: die Kesselschlachten von Demjansk und Cholm, die verlustreichen Gefechte bei Rschew, der Versuch einer strategischen Entlastung durch lokale Gegenstöße sowie die zunehmende Bedeutung verteidigungstechnischer Maßnahmen (z. B. Ausbau von Frontstellungen, logistische Umstellungen, Wintervorbereitungen). Detaillierte Beschreibungen, umfangreiches zeitgenössisches Bild- und Kartenmaterial zeichnen ein eindringliches Bild der militärischen Realität an der nördlichen und mittleren Ostfront im Jahr 1942.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ostfront 1942
Teil 1: Die Stabilisierung der Ostfront – Abwehrkämpfe im Norden und in der Mitte
IMPRESSUM:
Dirk Hennings
c/o IP-Management #4887
Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg
Ausgangssituation
Die Ostfront im Jahr 1942 war nach dem harten Winter 1941/42 keineswegs stabilisiert. Insbesondere die Lage vor Leningrad und im Mittelabschnitt vor Moskau war von strategischer Bedeutung, sowohl für die Wehrmacht als auch für die Rote Armee. An dieser Stelle ist es wichtig, die Entwicklungen der beiden Frontabschnitte und die von der Wehrmacht ergriffenen taktischen Maßnahmen zu untersuchen, um die Kontrolle über diese Gebiete zu sichern und zu stabilisieren.
Die Ostfront vom Dezember 1941 bis zum Mai 1942
Diese Karte zeigt, wie weit die Wehrmacht nach dem fehlgeschlagenen Angriff auf Moskau wieder zurückgedrängt wurde.
Die Situation vor Leningrad im Jahr 1942
Leningrad, das heutige Sankt Petersburg, war ein wichtiges politisches, industrielles und kulturelles Zentrum der Sowjetunion. Die Belagerung von Leningrad war eines der größten militärischen Unterfangen der Wehrmacht im Osten, und sie dauerte vom 8. September 1941 bis zum 27. Januar 1944 an. Im Jahr 1942 war die Lage in dieser Region von besonderer Bedeutung, sowohl aus militärischer als auch aus logistisch-strategischer Sicht.
Von Bundesarchiv, Bild 101I-287-0872-04 / Koll / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5476858
Die Wehrmacht hatte im Jahr 1941 bei der Offensive „Barbarossa“ die Stadt Leningrad bereits fast vollständig eingeschlossen. Das Ziel der deutschen Führung war es, die Stadt einzunehmen, um die Versorgung der Roten Armee mit Ressourcen zu unterbrechen und die gesamte Region in Zusammenarbeit mit den verbündeten Finnen zu stabilisieren. Bis zum Winter 1941 war die Wehrmacht jedoch nicht in der Lage gewesen, die Stadt vollständig zu erobern. Anfang 1942 konzentrierten sich die Wehrmachtseinheiten weiterhin auf die Blockade und Belagerung der Stadt.
Die deutsche Heeresgruppe Nord unter Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb hatte Leningrad faktisch von der Außenwelt abgeschnitten, doch trotz der harten Belagerung konnte die Stadt über die sogenannte „Straße des Lebens“ (über den Ladoga – See) mit der restlichen Sowjetunion verbunden werden. Es gelang der Roten Armee, diese Lebensader über eine Eisstraße im Winter und über Binnenschiffe im Sommer für die Bevölkerung und die Soldaten in Leningrad aufrechtzuerhalten, was den Belagerungsring auf Dauer zu einem nahezu unüberwindlichen Hindernis für die Wehrmacht machte.
Im Jahr 1942 versuchte die Wehrmacht, die Stadt weiterhin durch Luftangriffe und Artilleriebeschuss zu schwächen. Während die deutschen Truppen versuchten, eine vollständige Blockade aufrechtzuerhalten, hatte die Wehrmacht allerdings mit sowjetischen Gegenoffensiven und den harten Winterbedingungen zu kämpfen. Diese Situation führte dazu, dass die Wehrmacht ihre Taktiken mehr und mehr anpassen musste.
- Luftwaffe: Eine der wichtigsten taktischen Maßnahmen der Wehrmacht war der Versuch, Leningrad durch Luftangriffe zu zermürben. Die Luftwaffe versuchte, die Stadt zu bombardieren und die Versorgungslinien der Roten Armee zu unterbrechen. Trotz wiederholter Angriffe überstand Leningrad jedoch diese Bombardierungen, und die sowjetische Luftabwehr erwies sich als ungewöhnlich robust.
- Artillerie und Belagerungswaffen: Eine andere Maßnahme war der Einsatz von schweren Belagerungswaffen. Die Wehrmacht setzte speziell entwickelte Großkaliberkanonen wie die „Dora“-Kanone ein, um die Stadt zu bombardieren. Diese Waffen hatten eine enorme Reichweite und konnten die Verteidigungsstellungen der Roten Armee in der Umgebung von Leningrad treffen.
- Verstärkung der Blockade: Im Winter 1942 wurde die Blockade von Leningrad noch weiter verstärkt. Die deutsche Wehrmacht versuchte, die sowjetischen Versorgungslinien zu unterbrechen, indem sie den Verkehr auf den wenigen noch offenen Wegen blockierte. Diese Blockade führte zu massiven Hungersnöten in Leningrad, aber die Bevölkerung und die militärische Führung der Stadt hielten stand.
Eine militärische Einheit marschiert zur Front entlang des Moskau Prospekts in Leningrad. Dezember 1941.Von RIA Novosti archive, image #178610 / Boris Kudoyarov / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15579775
Doch auch wenn es im Jahr 1942 nur zu einigen wenigen größeren Offensivaktionen im Nordabschnitt kam, so gab es doch beständige Kämpfe mit der Roten Armee, die zu einer gewissen Abnutzung an Personal und an Waffensystemen beitrugen. Zudem band die Belagerung von Leningrad enorme Kräfte der Deutschen Wehrmacht, die bald an anderen Stellen der Ostfront viel nötiger gewesen wären.
Die Situation im Mittelabschnitt vor Moskau
Der Mittelabschnitt der Ostfront, der von den deutschen Truppen mit der Heeresgruppe Mitte verteidigt wurde, war 1941 bis 1942 von entscheidender Bedeutung für den Ausgang des gesamten Krieges. Moskau, die Hauptstadt der Sowjetunion, war nicht nur ein symbolisches, sondern auch ein strategisches Ziel. Die Eroberung Moskaus wäre ein verheerender Schlag für die sowjetische Kriegsführung gewesen, da sie die politische Führung der UdSSR destabilisieren und ein wichtiges Versorgungszentrum für die Rote Armee ausschalten würde. Die Wehrmacht hatte bereits im Oktober 1941 die erste Offensive auf Moskau gestartet, die jedoch im Rahmen der sowjetischen Gegenoffensive von Dezember 1941 bis Januar 1942 weitgehend gescheitert war. Diese sowjetische Gegenoffensive drängte die Wehrmacht von den Toren Moskaus zurück und zeigte der Wehrmacht, dass die ursprüngliche Annahme, Moskau schnell zu erobern, eine Fehleinschätzung gewesen war. Nachdem die erste Offensive auf Moskau gescheitert war, versuchte die Wehrmacht, ihre Frontlinie zu stabilisieren und eine defensive Haltung einzunehmen. Das bedeutete, dass die Heeresgruppe Mitte versuchte, die eroberten Gebiete rund um Moskau zu halten und aus diesen Positionen weiter Druck auf die Rote Armee auszuüben. Die deutschen Truppen versuchten, ihre Stellung entlang der wichtigsten Straßen und Eisenbahnlinien zu verstärken.
Die sowjetische Armee hatte jedoch auf die deutsche Offensive mit einer Reihe von Gegenangriffen reagiert, die zunehmend effektiver wurden. Nach den gescheiterten deutschen Angriffen im Winter 1941 und den frühen 1942 intensiven sowjetischen Gegenoffensiven, gewannen die Roten Armee zunächst die Oberhand. Die sowjetischen Strategen nutzten die deutschen Fehler aus. Die Wehrmacht hatte ihre Offensiven in die Länge gezogen und ihre Ressourcen aufgebraucht, während die sowjetischen Kräfte den Winter als Vorteil nutzen konnten. Die überlegenen Zahlen der Roten Armee und die verstärkten sowjetischen Verteidigungspositionen machten es der Wehrmacht zunehmend schwerer, in den Frühling 1942 hinein Erfolge zu erzielen. Die sowjetische Armee baute ihre Widerstandsfähigkeit aus, während die Wehrmacht begann, an die Grenzen ihrer logistischen Kapazitäten zu stoßen. Das von Hitler erzwungene Halten der Frontlinie und die dauerhafte deutsche Blockade von Leningrad erforderten von der Wehrmacht einen enormen Einsatz von Ressourcen, der schließlich nicht mehr aufrechtzuerhalten war.
Fazit Nord – und Mittelabschnitt der Ostfront
Die Situation an der Ostfront im Jahr 1942 war durch einen ständigen Abnutzungskrieg geprägt. Die Wehrmacht konnte aber immerhin mit einiger Kraftanstrengung ihre Positionen vor Leningrad und im Mittelabschnitt vor Moskau durch schwerwiegende taktische Maßnahmen stabilisieren.
”Beginn eines Angriffs an der Leningrader Front”
Von RIA Novosti archive, image #633054 / Vsevolod Tarasevich / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15579574
Doch der zunehmende Widerstand der Roten Armee und die Schwierigkeiten, die durch den russischen Winter und das raue Terrain verursacht wurden, erschwerten diese Bestrebungen erheblich. Trotz aller Anstrengungen blieb die Frontlinie jedoch trotzdem instabil, und die sowjetische Fähigkeit, die Kontrolle zu behalten und zu expandieren, wuchs von Monat zu Monat.
Auch wenn die Wehrmacht im Nord und im Mittelabschnitt eine defensive Strategie wählte, um neue Offensiven im Süden durchzuführen, war es in diesen Frontabschnitten alles andere als ruhig. In einer Reihe von blutigen Schlachten versuchte die Rote Armee die Wehrmacht weiter zurückzudrängen, was ihr allerdings nicht gelang. Auch wenn die Offensivaktionen der Sowjets größtenteils erfolglos blieben, so hatte es doch den Effekt, dass die Wehrmacht insbesondere im Herbst und Winter 1942 bei den Kämpfen um Stalingrad nicht in der Lage war, nennenswerte Verstärkungen in den Süden zu verlegen.
Die Kesselschlacht von Demjansk
Die Kesselschlacht von Demjansk fand Anfang 1942 während des Zweiten Weltkrieges an der deutsch-sowjetischen Front südöstlich des Ilmensees statt. Bis zum 8. Februar konnte die Rote Armee um die Stadt Demjansk sechs deutsche Divisionen einkreisen. Diese hielten den Kessel dank massiver Versorgung aus der Luft, bis deutsche Truppen am 21. April durch einen Entsatzangriff wieder Verbindung mit der Besatzung aufnehmen konnten. Diese gelungene Luftversorgung sollte später auch Einfluss auf die Schlacht von Stalingrad haben. Bis zur endgültigen Räumung des Gebietes durch die deutschen Truppen verging jedoch noch fast ein Jahr. Erst im März 1943 zogen dort die letzten deutschen Truppen ab.
Lage des Kessels von Demjansk in Nordwestrussland
Die Kesselbildung
Am 8. Januar 1942 eröffneten die Truppen der sowjetischen Nordwestfront (Generalleutnant Pawel Alexejewitsch Kurotschkin) zwischen dem Ilmensee und dem Seligersee den Angriff auf die Stellungen des X. Armeekorps (General der Artillerie Christian Hansen) und des II. Armeekorps (General der Infanterie Walter Graf von Brockdorff-Ahlefeldt) der 16. Armee (Generaloberst Ernst Busch) der Heeresgruppe Nord (Generalfeldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb). Die sowjetische 11. Armee (Generalleutnant Wassili Iwanowitsch Morosow) durchbrach am südlichen Ufer des Ilmensees die Stellungen der 290. Infanterie-Division und stand bereits am 9. Januar vor Staraja Russa. Doch trotz ununterbrochener Angriffe konnte diese strategisch wichtige Stadt von den deutschen Truppen gehalten werden.
Bei einem Besuch im Führerhauptquartier am 12. Januar 1942 beantragte der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Nord, Generalfeldmarschall Ritter von Leeb, die Stellungen der deutschen Truppen auf den Fluss Lowat zurückzunehmen, bei gleichzeitigen Gegenangriffen zum Entsatz. Hitler nahm jedoch die Einkesselung bewusst in Kauf, lehnte den Vorschlag ab und befahl stattdessen dem II. Armeekorps, Demjansk um jeden Preis zu halten, auch wenn die Verbindung zum X. Armeekorps bei Staraja Russa abreißen sollte. Deshalb bat von Leeb um seine Entlassung. Hitler gab dem Gesuch statt und berief Generaloberst Georg von Küchler, den Oberbefehlshaber der 18. Armee, zu von Leebs Nachfolger. Hitler wollte durch seine Entscheidung starke Feindkräfte binden und Demjansk als Ausgangsbasis für spätere Angriffsoperationen halten, zu denen es aber aus Kräftemangel nicht mehr kommen sollte.
Ab Ende Januar schwenkte das durch den Einbruchsraum der sowjetischen 11. Armee nachgeführte sowjetische I. Garde-Schützenkorps (Brigadegeneral Afanassi Sergejewitsch Grjasnow) von Staraja Russa nach Südosten in den Rücken des X. und des II. Armeekorps ein und stieß der nach Nordwesten vorgehenden sowjetischen 3. Stoßarmee (Generalleutnant Maxim Alexejewitsch Purkajew) entgegen, die am 9. Januar die Stellungen der 123. Infanterie-Division westlich des Seligersees durchbrochen hatte.
Offensive der Roten Armee südlich des Ilmensees, 7. Januar – 21. Februar 1942
Von Memnon335bc - Own work by uploader, based on different sources, mainly David M. Glantz: The history of Soviet airborne forces, Cass Publ., London 1994, S.233. ISBN 0-7146-3483-2, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5793590
Trotz des erbitterten Widerstandes der deutschen Truppen vereinigten sich die Spitzen der sowjetischen Truppen nach Mitte Februar im Bereich des Ortes Salutschje, nachdem bereits am 8. Februar die letzte Nachschubstraße und alle Fernsprechkabel in den Kessel durchtrennt worden waren.
Der zwischen der sowjetischen 11. Armee und der 3. Stoßarmee stehenden sowjetischen 34. Armee (Generalleutnant Nikolai Erastowitsch Bersarin) gelang es in den ersten Angriffstagen, in die Naht zwischen der 290. und 30. Infanterie-Division einzubrechen und das Gebiet südlich des Bahnhofes Beglowo zu nehmen. Alle weiteren Angriffe dieser Armee auf die Kesselfront konnten jedoch von der Wehrmacht bis zur Räumung des Kessels abgewiesen werden. Die vor der Südfront des Kessels liegenden Einheiten der sowjetischen 3. Stoßarmee und der 34. Armee wurden schließlich im Mai 1942 als 53. Armee (Generalleutnant Alexander Sergejewitsch Ksenofontow) zusammengefasst.
Entladung von Ju 52 bei Demjansk
Von Bundesarchiv, Bild 101I-003-3446-16 / Ulrich / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5475220
Kämpfe um den Kessel
In einem Kesselgebiet von zirka 3000 Quadratkilometern mit einem Frontumfang von etwa 300 Kilometern um die Stadt Demjansk, 75 km südöstlich des Ilmensees, waren sechs Divisionen mit etwa 95.000 Soldaten und 20.000 Pferden eingeschlossen. Dazu gehörte auch die SS-Division Totenkopf unter SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Theodor Eicke. Nur 35 Kilometer trennten das Einschlussgebiet von der Hauptkampflinie um Staraja Russa. Da Adolf Hitler darauf bestand, den Kessel für spätere Operationen zu halten, wurde beschlossen, die Versorgung der eingeschlossenen Truppen aus der Luft vorzunehmen. Zu diesem Zweck war bereits gegen Ende Januar im Kessel mit dem Bau zweier behelfsmäßiger Feldflugplätze östlich von Demjansk (Saoserje und Pjesti) begonnen worden. Schon am 18. Februar 1942 erhielt der Einsatzstab des LTF (Lufttransportführer) Ost, Oberst (später Generalmajor) Fritz Morzik den Befehl zum Einsatz, wofür Transportfliegerkräfte von mehreren Kampfgruppen zur besonderen Verwendung (K.Gr. z .b. V.), mit ihren Transportflugzeugen vom Typ Junkers Ju 52, auf verschiedene Absprunghäfen konzentriert wurden. Sie wurden später durch weitere abgezogene Kapazitäten der Luftflotte 4 aus dem Südabschnitt der Ostfront und durch neu aufgestellte Verbände ergänzt. Als Absprunghäfen wurden alle in Reichweite befindlichen Feldflughäfen eingesetzt:
Pleskau-Süd, Pleskau-West,
Korowje-Selo, Ostrow-Süd,
Tuleblja, Riga,
Riga-Nord, Dünaburg.
Entladung von Ju 52 bei Demjansk
Von Bundesarchiv, Bild 101I-003-3445-33 / Ullrich / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5408129
Bis Anfang März 1942 wurden für den Einsatz ca. 220 Flugzeuge zusammengezogen, von denen aber nur 30 % einsatzbereit waren. Die von Morzik angeforderten zusätzlichen 300 Transportflugzeuge wurden nur zu einem geringen Teil zur Verfügung gestellt. Besondere Probleme bereitete dabei die Wartung und Reparatur der Flugzeuge. Im Einsatz selbst waren die Flugzeuge vor allem durch Flugabwehrfeuer gefährdet. Angriffe durch feindliche Jäger kamen auf Grund der seinerzeitigen Schwäche der sowjetischen Luftwaffe nur relativ selten vor. Für Generalmajor Morzik war aber genau diese Schwäche eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg der Versorgung.
Um die Kampfkraft der eingeschlossenen Truppen aufrechtzuerhalten, forderte das Heer anfangs die Zufuhr von täglich mindestens 300 Tonnen an Versorgungsgütern. Diese Menge wurde allerdings nur an wenigen Tagen erreicht. Für die Zeit vom 19. Februar bis zum 18. Mai 1942 wurden 24.303 t an transportierten Gütern gemeldet, ein Tagesdurchschnitt von 273 t. Diese Zahl ist wahrscheinlich nicht absolut zutreffend, da sie aus der Zahl der eingesetzten Flugzeuge multipliziert mit der Ladekapazität der Flugzeuge errechnet wurde. 22.093 Verwundete wurden ausgeflogen. Morzik beurteilte diese erste Kesselversorgung später aufgrund der Verluste als „negative[n] Erfolg“. In der obersten deutschen Führung kam man jedoch zu dem Schluss, dass sich eine solche Luftversorgung auch an anderer Stelle wiederholen ließe.
Beschädigte Ju 52 der 2. Staffel des Kampfgeschwaders z.b.V. 1 (Geschwaderkennung 1Z+NK) bei Demjansk
Folgende Divisionen waren im Kessel eingeschlossen: (Die Reihenfolge der Nennung entspricht der Aufstellung der Divisionen vom Ilmensee bis zum Seligersee vor Beginn des sowjetischen Angriffs am 8. Januar 1942.)
X. Armeekorps
290. Infanterie-Division (Generalleutnant Theodor Freiherr von Wrede)
30. Infanterie-Division (Generalleutnant Kurt von Tippelskirch)
SS-Division Totenkopf (Obergruppenführer Theodor Eicke)
II. Armeekorps
12. Infanterie-Division (Oberst Karl Hernekamp)
32. Infanterie-Division (Generalmajor Wilhelm Bohnstedt)
123. Infanterie-Division (Generalmajor Erwin Rauch)
Das Generalkommando des X. Armeekorps (General der Artillerie Christian Hansen) zog sich Ende Januar aus dem sich bildenden Kessel auf Staraja Russa zurück und übernahm dort den Befehl über die Truppen zur Verteidigung der Hauptkampflinie vom Ilmensee über Staraja Russa bis südwestlich der Stadt. Es waren dies folgende Truppen:
18. Infanterie-Division (mot.),
81. Infanterie-Division,
Luftwaffen-Division Meindl,
verstärktes Infanterie-Regiment 368 (später in Grenadier-Regiment 368 umbenannt),
Polizeiregiment Nord,
Sicherungsregiment Mayer
mehrere Kampfgruppen der SS-Division Totenkopf.
In der ersten Februarwoche trafen die ersten Einheiten der 5. leichten Infanterie-Division aus Frankreich ein. Die drei eingeschlossenen Divisionen des X. Armeekorps wurden am 18. Februar dem im Kessel verbliebenen Generalkommando des II. Armeekorps unterstellt.
Von Ruffneck'88 - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, coloriert von Original: Bundesarchiv, Bild 101I-004-3641-13 / Muck, Richard / CC-BY-SA 3.0https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55500576