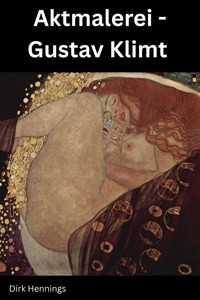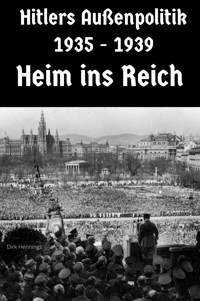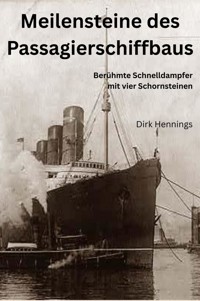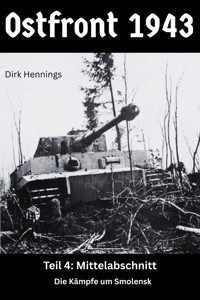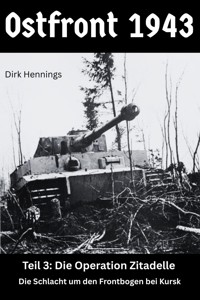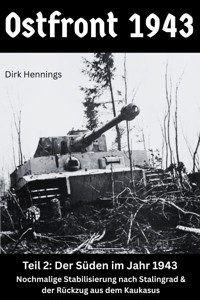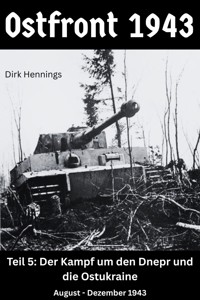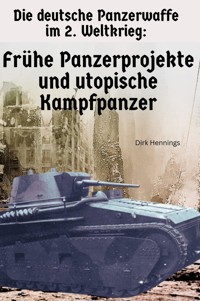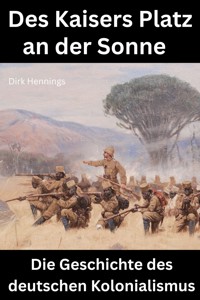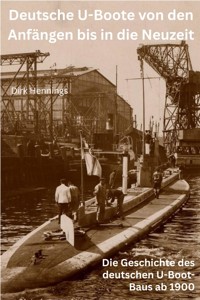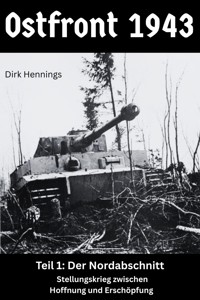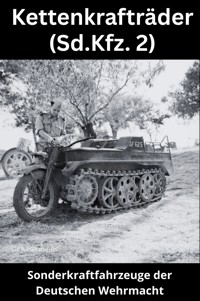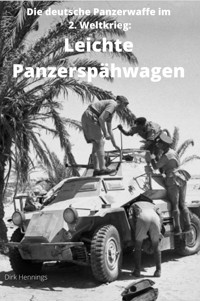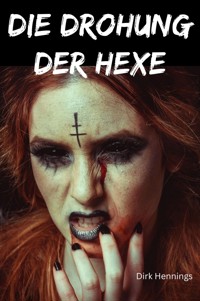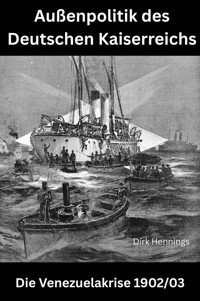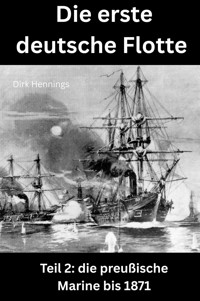Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
OSTFRONT 1942 Teil 3: Der Fall Blau – Vorstoß in den Kaukasus Im Sommer 1942 sollte sich der operative Schwerpunkt der Wehrmacht auf den Südabschnitt der Ostfront verlagern. Fall Blau war der Deckname für den am 28. Juni 1942 beginnenden ersten Teil der Sommeroffensive der Wehrmacht. Die Operation wurde zunächst auf Woronesch angesetzt, dann über den Sewerski Donez zum Don-Bogen weitergeführt und erreichte Mitte September mit dem deutschen Vorstoß im Kaukasus und an die untere Wolga ihren Höhepunkt. In der Weisung Nr. 45 für die Kriegführung änderte Adolf Hitler die Ziele des ursprünglichen Falls Blau. Ziel war nun der gleichzeitige Vormarsch der deutschen Truppen sowohl in Richtung Kaukasus (Unternehmen Edelweiß) als auch in Richtung Stalingrad (Unternehmen Fischreiher). Hitler hatte für sein Beharren kriegswirtschaftliche Gründe wie Eroberung der kaukasischen Ölquellen und Abschneiden sowjetischer Gütertransporte über den Verkehrsknoten Stalingrad geltend gemacht. Dieses Werk analysiert die militärischen Operationen beim Kampf um den Kaukasus im Jahr 1942. Detaillierte Beschreibungen, umfangreiches zeitgenössisches Bild- und Kartenmaterial zeichnen ein eindringliches Bild der militärischen Realität an der südlichen Ostfront in der zweiten Jahreshälfte 1942. Umfang: 108 Seiten
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 72
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ostfront 1942
Teil 3: Der Fall Blau – Vorstoß in den Kaukasus
IMPRESSUM:
Dirk Hennings
c/o IP-Management #4887
Ludwig-Erhard-Str. 1820459 Hamburg
Der Fall Blau – Vorstoß zum Kaukasus
Fall Blau oder Unternehmen Blau war der Deckname für den am 28. Juni 1942 beginnenden ersten Teil der Sommeroffensive der Wehrmacht während des Deutsch-Sowjetischen Krieges. Diese Offensive wurde zunächst auf Woronesch angesetzt, dann über den Sewerski Donez zum Don-Bogen weitergeführt und erreichte Mitte September mit dem deutschen Vorstoß im Kaukasus und an die untere Wolga ihren Höhepunkt.
Deutsche Panzer II in der Kalmückensteppe
Von Bundesarchiv, Bild 169-0283 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5420254
Das Oberkommando des Heeres (OKH) gab der geplanten Sommeroffensive am 5. März 1942 zunächst den Tarnnamen Siegfried, der am 7. April 1942 in Blau und schließlich am 30. Juni 1942 in Braunschweig geändert wurde. Die Folgeplanung unter den Namen Blau II und Blau III erhielt die Decknamen Unternehmen Clausewitz und Unternehmen Dampfhammer.
In der Weisung Nr. 45 für die Kriegführung (Fortsetzung der Operation „Braunschweig“) vom 23. Juli 1942 änderte Adolf Hitler die Ziele des ursprünglichen Falls Blau. Ziel war nun der gleichzeitige Vormarsch der deutschen Truppen sowohl in Richtung Kaukasus (Unternehmen Edelweiß) als auch in Richtung Stalingrad (Unternehmen Fischreiher).
Hitler hatte persönlich in die Planung des Unternehmens eingegriffen und eine Aufteilung der Heeresgruppe Süd befohlen. Diese Zersplitterung der Kräfte – vor der Hitler von seiner Generalität mehrfach gewarnt worden war – gilt heute allgemein als wesentliche Ursache für den Untergang der 6. Armee in Stalingrad. Hitler hatte für sein Beharren kriegswirtschaftliche Gründe wie Eroberung der kaukasischen Ölquellen und Abschneiden sowjetischer Gütertransporte über den Verkehrsknoten Stalingrad geltend gemacht.
Vorgeschichte
Nachdem der Überfall auf die Sowjetunion 1941 nicht zum erwarteten Zusammenbruch der Sowjetunion geführt hatte und die deutschen Angriffskeile vor Leningrad, Moskau und Sewastopol zum Stehen gekommen waren, sah sich die Wehrmacht im Winter 1941/42 mit der Winteroffensive der Roten Armee konfrontiert. Als Reaktion darauf ernannte Hitler sich im Dezember 1941 selbst zum Oberbefehlshaber des Heeres und gab den Befehl zum Halten der Frontlinie, was zwar größere Gebietsverluste verhinderte, jedoch auch wichtige Ressourcen aufbrauchte, die für die nächsten Unternehmen dringend benötigt worden wären.
Deutsche Infanterie auf Schützenpanzerwagen im Sommer 1942 in Süd-Russland
Von Bundesarchiv, Bild 101I-217-0494-34 / Geller / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5410436
Dennoch wollte Hitler im Sommer 1942, wie schon in der Augustkrise ein Jahr zuvor, eine Offensive am südlichen Frontabschnitt starten, um Deutschland die kriegswichtigen Ölfelder von Maikop, Grosny und Baku zu sichern. Gleichzeitig sollte die Sowjetunion von dieser lebenswichtigen Ressource abgeschnitten und so ein Zusammenbruch herbeigeführt werden. Ähnliche Gedanken waren bereits 1940 vom britischen und französischen Generalstab angestellt worden, die mit der in der Operation Pike geplanten Bombardierung der sowjetischen Erdölfelder einen „völligen Zusammenbruch“ der damals noch mit Deutschland verbündeten Sowjetunion herbeiführen wollten.
Der Chef des OKW Wilhelm Keitel äußerte auf einer Lagebesprechung im Mai 1942 gegenüber Georg Thomas, „daß die Operationen des Jahres 1942 uns an das Öl bringen müssen. Wenn dies nicht gelingt, können wir im nächsten Jahr keine Operationen führen“.
Operationskarte Fall Blau: Vorstoß in den Kaukasus
Von Mil.ru, CC BY 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126608516
Die Seekriegsleitung hielt die Eroberung von Maikop für notwendig, da die dünne Treibstoffdecke für die Kriegsmarine bis zum Zerreißen gespannt war, denn das Unternehmen Barbarossa verschlang das für sie vorgesehene rumänische Öl. Im April 1942 waren ihre Reservebestände fast völlig aufgebraucht und Erich Raeder musste an Hitler melden, dass sämtliche heizölverbrauchenden leichten und schweren Schiffe nur noch Notoperationen unter Rückgriff auf den Noteinsatzbestand durchführen können. Nur die U-Boote erfuhren keine Einschränkung.
Mit diesem Entschluss legte Hitler den Schwerpunkt auf den östlichen Kriegsschauplatz und suchte wie im Jahr 1941 die strategische Entscheidung im Osten. „Krieg wird im Osten entschieden“ notierte Generalstabschef Halder am 28. März 1942 in seinem Kriegstagebuch. Entsprechend legte Hitlers Befehl für die „Rüstung 1942“ vom 10. Januar 1942 den Rüstungsschwerpunkt eindeutig auf das Heer. Damit war nach Dietrich Eichholtz das Göring-Programm zum Kampf gegen die Westmächte „begraben“. Das Göring-Programm (auch: erweitertes Luftwaffenprogramm) war ein gescheiterter deutscher Plan im Zweiten Weltkrieg vom 23. Juni 1941 zur Vervierfachung der deutschen Luftwaffe innerhalb von zwei bis zweieinhalb Jahren zum Kampf gegen die Westmächte gewesen. Er basierte auf einer geplanten Verlagerung des Rüstungsschwerpunktes vom Heer auf die Luftwaffe und Marine.
Dem stand entgegen, dass die Teile des deutschen Heeres, die gegen die Sowjetunion eingesetzt wurden, vom 22. Juni 1941 (Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion) bis Frühjahr 1942 bereits über 35 Prozent ihrer durchschnittlichen Gesamtstärke von 3,2 Millionen Mann als Verluste (Gefallene, Verwundete, Vermisste) eingebüßt hatten. Der infanteristische Kampfkraftverlust wurde auf 50 % bei der Heeresgruppe Süd und 65 % bei den anderen beiden Heeresgruppen beziffert.
Sowjetische Artilleristen unterstützen die angreifende Infanterie. Die Nordkaukasus-Front. Juli 1942.
Für den Fall, dass die sowjetische Seite der deutschen Sommeroffensive nicht standhalten würde, plante Franklin D. Roosevelt mit der Operation Sledgehammer eine Landung in Europa im Herbst 1942 zur Unterstützung. Diese Operation (deutsch Operation Vorschlaghammer) war ein von den USA in der Frühphase des Zweiten Weltkriegs favorisiertes Unternehmen zur Invasion in Westeuropa. Es war lediglich für den Fall vorgesehen, dass der sowjetische Widerstand gegen die nach Osten vordringende Wehrmacht zusammenbrechen oder entscheidend geschwächt werden sollte.
Der amerikanische Planungsstab, von Dwight D. Eisenhower zur Planausarbeitung eingesetzt, ging von einer möglichen Landung im Sommer 1942 aus. Sie sollte zunächst von britischen Einheiten ausgeführt werden; Verstärkung durch die US Army sollte ihnen folgen. Eine Anzahl US-Divisionen befanden sich im Rahmen der Operation Bolero bereits auf dem Weg ins Vereinigte Königreich. Als Angriffstag (D-Day) wurde ein Datum zwischen dem 15. Juli und dem 1. August 1942 angenommen. Der Operation sollten fünfzehntägige Luftangriffe vorausgehen, die zum Abzug deutscher Flugzeuge von der Ostfront führen sollten. Der Luftraum über dem Ärmelkanal und an der Côte d’Opale – die Küste Frankreichs zwischen Dünkirchen und Abbeville – war als alliierter Kontrollraum vorgesehen. Weitere Luftangriffe sollten auf die Küsten der Niederlande, Belgiens und der Normandie geflogen werden. 30 Tage danach war der Landungsangriff der Haupttruppe vorgesehen, die das Gebiet nördlich der Seine und Oise zu kontrollieren hatte.
Eine wenig später erarbeitete Revision zur Operation Sledgehammer bestand nach den US-Plänen aus einer sechs Divisionen starken Landungstruppe, die den Ärmelkanal nach Cherbourg überqueren sollte. Cherbourg liegt an der Nordseite der Halbinsel Cotentin. Der dann zu bildende Brückenkopf hätte die Hauptaufgabe gehabt, auf Nachschublieferungen aus Großbritannien zu warten und ein umfangreiches Waffendepot für einen späteren Vorstoß ins französische Landesinnere aufzubauen. Laut Warren F. Kimball beweisen Roosevelts Pläne, dass er den Kampf der Roten Armee als unabdingbar für den Sieg über Deutschland ansah, obwohl er dies nicht öffentlich äußerte. Bereits Mitte 1941 hatte der amerikanische Generalstab darauf hingewiesen, dass ein deutscher Sieg über Russland dieses „praktisch unverwundbar“ machen würde.
Sowjetischer Spähtrupp überwindet ein Wasserhindernis. Gebiet Krasnodar.
Einschätzung des Gegners
Erst nach Abflauen der sowjetischen Winteroffensiven wurden erstmals systematische Versuche unternommen, die sowjetische Mannstärke zu bestimmen. Man kam zu dem Schluss, dass der Gegner so umfangreiche Reserven wie im Winter 1941 nicht mehr in die Entscheidung werfen könne. Insgesamt unterschätzte die deutsche Generalität den Gegner damit nach wie vor erheblich.
Generalstabschef Franz Halder berichtete in einem Vortrag Mitte 1942 über die Rüstungskapazitäten der Feindstaaten, in dem er für die UdSSR die monatliche Produktion von 1.200 Panzern angab, woraufhin sich Hitler wütend zeigte, dass Deutschland als größter Industriestaat mit der größten Industrieorganisation der Welt nur 600 Panzer je Monat produziere und es unmöglich sei, dass ein anderes Land mehr schaffe. Das Wehrwirtschafts- und Rüstungsamt im OKW schätzte die sowjetische Panzerproduktion für das Jahr 1942 auf 6.000 und die Abteilung Fremde Heere Ost auf 11.000. Tatsächlich lag sie bei 24.690. An Geschützen wurde mit einer Produktion von höchstens 7.800 Geschützen über 7,6 cm Kaliber, einschließlich PaK (Panzerabwehrkanonen) und Flak, gerechnet, tatsächlich waren es 33.000. Die sowjetische Flugzeugproduktion erreichte mit 25.000 Stück das dreifache der deutschen Prognose.
Diese unrealistischen Einschätzungen prägten nach Bernd Wegner in hohem Maße das Meinungsbild des „Führers und seiner militärischen Umgebung“ über die zu erwartende Widerstandskraft der Sowjetunion und trugen zu einem Optimismus bei, dessen Brüchigkeit sich erst auf den Schlachtfeldern erweisen sollte. Adam Tooze sieht ein echtes »Rüstungswunder« für 1942 nicht in Deutschland, sondern in den Rüstungsfabriken im Ural. Obwohl das Land schwer umkämpft war und es große Zerstörungen und Territorialverluste erlitten hatte, konnte die Sowjetunion in fast jeder Waffengattung die Rüstungsproduktion des „Dritten Reiches“ bei Weitem übertreffen. Diese industrielle Überlegenheit ermöglichte ihr die zweite deutsche Großoffensive abzuwehren und im November zu vernichtenden Gegenoffensiven überzugehen.
Halder behauptete in seiner 1949 erschienenen Studie Hitler als Feldherr, der Generalstab des Heeres habe „angesichts der personellen und materiellen Quellen Rußlands“ und des deutschen Kräftemangels Hitler widersprochen und die strategische Defensive befürwortet. Wegner nannte dies eine von Halder geschaffene und in die Nachkriegsliteratur eingegangene Legende ohne Rückhalt in den Akten.
Planung