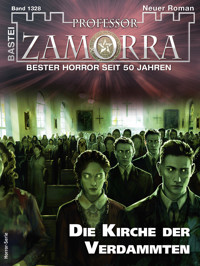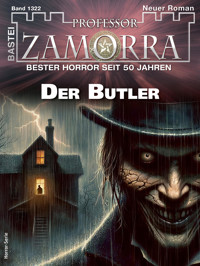1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrhunderten wurde das namenlose Dorf unterhalb des Schlosses nicht mehr von ihm heimgesucht, doch noch immer spukt er in den Legenden und Überlieferungen der Alten herum: der kalte Tod. Schnee und Eis überziehen das Dorf, dazu gesellen sich fürchterliche Albträume, die die Bewohner plagen. Noch sind es nur Vorboten, doch bald erkennt Zamorra: Der schreckliche Dämon ist wieder erwacht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Der kalte Tod
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Kiselev Andrey Valerevich / shutterstock
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-7347-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Der kalte Tod
von Veronique Wille
Der Tod kam auf leisen Sohlen. Fast fröhlich tanzten die Schneeflocken durch die Winterluft und brachten die Kinder zum Jauchzen und Hüpfen. Manche von ihnen hatten noch niemals einen weißen Winter erlebt. Am nächsten Morgen hatte sich eine feste Schneedecke über das kleine Dorf gelegt.Schnell, schnell, beeilt euch, Kinder, und holt eure Schlitten heraus,schienen die Flocken zu flüstern.Bevor er wieder schmilzt.Doch er schmolz nicht, der Schnee, im Gegenteil, mit jedem Tag, mit jeder Nacht umklammerte er das Dorf ein wenig fester mit seinen eisigen Fingern.
Dann kam der Sturm hinzu.
Und dann der Tod.
Der kalte Tod, wie er sich selbst nannte.
Courmarin, Frankreich, 1949
Aber lasst uns von vorn beginnen. An dem Punkt unserer Geschichte, wo der Tod nur mehr ein ferner Zuschauer war und die Menschen in einem anderen Dorf zu einer anderen Zeit ihr Ende noch nicht einmal erahnten.
Als Charlotte Darrieux an diesem Morgen erwachte, war ihr kalt. Eiskalt. Der Ofen war ausgegangen, und aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte sich eine Pfütze um ihn herum gebildet.
Seufzend stand Charlotte auf, um nach dem Rechten zu sehen. Seit dem Tode ihres Mannes lag es allein an ihr, den kleinen Bauernhof zu bewirtschaften. Und in Momenten wie diesem vermisste sie Eric ganz besonders. Ein Hof wie ihrer war ohne einen Mann im Haus kaum zu bewirtschaften. So wie eine Gemeinde dem Pfarrer zwar einiges an Arbeit abnehmen konnte, aber ohne ihn auf Dauer nicht überlebensfähig war.
Oh ja, es gab einen Mann auf dem Hof, Antonin. Der Knecht bemühte sich nach Kräften, aber er ging mittlerweile auf die Achtzig zu, und er wäre längst in Rente gegangen, wenn Eric nicht vor zwei Jahren gestorben wäre. Manchmal tat es Charlotte leid, Antonin bei der Arbeit zu beobachten, zu sehen, wie er sich quälte, nur um ihr zu beweisen, dass sie nicht allein war.
Natürlich gab es Männer, die ihr auch auf andere Art den Hof machten. Nach der angemessenen Trauerzeit hätte es sie eher erstaunt, wenn es nicht so gewesen wäre. Wenn sie sich im Spiegel betrachtete, so war sie immer noch, obwohl sie die Dreißig längst überschritten und in ihrem ganzen Leben hart gearbeitet hatte, eine begehrenswerte Frau mit üppigen Rundungen, wie die Männer sie mochten. Sie war keine Schönheit, nie eine gewesen, und doch hatte sie eine gewisse Anmut, die sich mit den Jahren eher entfaltet als abgenommen hatte.
Noch war sie selbst nicht so weit, einem anderen ihre Gunst zu gewähren, aber es würde der Tag – oder die Nacht – kommen, an dem sie ihre Gefühle würde über Bord werfen müssen, an dem sie es sich nicht mehr erlauben konnte, allzu wählerisch zu sein. Der Sommer war heiß gewesen und hatte das Korn auf dem Feld verdorren lassen. Und immer öfter waren die Wölfe über ihren kleinen Hof gekommen. Vorletzte Nacht erst hatten sie eine trächtige Kuh gerissen. Und bis auf zwei Hühner hatten sie auch ihr Federvieh gerissen. Der Winter, das ahnte sie jetzt schon, würde hart werden. Vielleicht würde sie selbst den treuen Antonin nicht mehr bezahlen können, obwohl sie auf seine helfenden Hände mehr denn je angewiesen sein würde.
Seufzend schlüpfte sie in die Pantoffeln und besah sich das Malheur rund um den Ofen. Woher kam die Pfütze, woher …?
Sie wurde abgelenkt, als sie den seltsamen Ton von draußen vernahm. Nicht dass sie ihn nicht zu deuten wusste, aber er passte in diese Landschaft so wenig wie …
… der Schnee!
Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass das seltsame Zwielicht, das das kleine Zimmer, das gleichzeitig Küche und ihre Schlafstatt beherbergte, seinen Ursprung nicht in der frühen Morgenstunde hatte, sondern darin, dass es schneite!
Und zugleich kam ihr siedend heiß die Erkenntnis, dass sie verschlafen hatte!
Zum ersten Mal, zwar nicht in ihrem Leben, aber seit sie allein den Hof bewirtschaftete. Sie stand buchstäblich mit den Hühnern auf, in der Regel sogar noch früher, doch seit auch der Hahn von den Wölfen gefressen worden war, ertönte kein Hahnenschrei mehr.
Verwirrt öffnete sie das Fenster. Kalte Winterluft schlug ihr entgegen.
Und wieder fiel ihr der ungewohnte Ton auf, der zu ihr herüberwehte.
Glöckchen! Das Gebimmel von Glöckchen!
Dann vernahm sie den freudigen Ausruf. Denis! An ihn hatte sie gar nicht gedacht! Was, war er denn schon erwacht? Heute war Sonntag und damit schulfrei! Normalerweise pflegte ihr achtjähriger Sohn, der seinem Vater mit jedem Jahr mehr wie aus dem Gesicht geschnitten schien, an solchen Tagen bis in die Puppen zu schlafen. Meistens bekam sie ihn noch nicht einmal pünktlich zum Gottesdienst wach.
Sie lehnte sich weiter aus dem Fenster und spürte die Schneeflocken, die aus einem dunkelgrauen Himmel herabfielen und ihr Haupt und ihr Gesicht benetzten.
Das alles war so ungewöhnlich, dass sie sich noch immer in einem Traum wähnte. Aber Denis’ Stimme war real, kein Traum, und jetzt ging sie in ein freudiges Lachen über. Und auch Antonin lachte. Und über allem schwebte das Gebimmel der Glöckchen, das immer näher zu kommen schien.
Kurzentschlossen warf sie das Fenster wieder zu und zog sich hastig etwas über. Dann stürmte sie hinaus. Irgendetwas geschah dort draußen, nichts Beunruhigendes, nichts, worüber sie sich Sorgen machen musste, im Gegenteil, etwas Wunderbares war im Gange …
Und dennoch fuhr sie zusammen, als ein trompetenartiges Gebrüll wie aus allernächster Nähe die Luft zerriss.
Dann hörte sie die Stimmen, nicht die Stimmen von Denis und Antoine. Männerstimmen. Raue, befehlsgewohnte Männerstimmen.
Als sie nach draußen stürmte, sah sie den riesigen Schatten, grau und urweltlich wälzte er sich durch die Schneeflocken. Ein Ungetüm, wie sie es bisher nur auf Bildern gesehen hatte.
Es war ein Elefant. Und er war nicht allein. Er befand sich in einem Tross von bunten Wagen, die von Treckern und Automobilen gezogen wurden, und Kutschen, mit Pferdegespannen davor. Es waren mindestens zehn der bunten Wagen, aber Charlotte hatte nach wie vor nur Augen für den Elefanten, der in ihrer kleinen Welt, auf ihrem Hof, so fremd schien wie … wie – nein, sie hatte einfach keinen Vergleich dafür.
Fast zuckte sie zusammen, als Denis auf sie zugelaufen kam. »Maman, Maman!«, rief er aufgeregt. »Ein Jahrmarkt! Ein richtiger Jahrmarkt in unserem Dorf!«
Der Schnee und die Kälte waren vergessen. Alles war plötzlich vergessen. Auch Antonin kam nun auf sie zugehumpelt. Normalerweise bemühte er sich darum, sich seine Behinderung nicht anmerken zu lassen, aber nun schien auch er derart aufgeregt, dass er es vergaß.
»Was ist hier eigentlich los, Antonin?«, stellte Charlotte den Knecht zur Rede. »Was – was hat das alles zu bedeuten?« Sie wies auf den Tross an Wagen und Pferden – und auf den Elefanten.
Antonin zuckte nur mit den Schultern. »Ich weiß es nicht, Madame. Denis hat es zuerst gehört. Er war schon draußen, als ich kam, und …«
Ein Ruf ertönte, und die gesamte Kolonne hielt an. Von einem der vorderen Wagen sprang ein schlanker, hochgewachsener Mann herunter. Er trug einen Fellmantel, der ihm bis zu den Waden ging. Seine schwarzen, fast bläulich glänzenden Haare waren lang und fielen ihm auf die Schultern. Das markante Gesicht strahlte Härte, aber auch eine gewisse Sanftheit aus. Es hatte, so fand Charlotte, etwas Keltisches an sich. Auf keinen Fall kam er aus der Gegend.
Der Mann kam auf sie zugeschritten, mit leichtem, federnden Gang. Als er vor ihr stand, verbeugte er sich höflich und fragte: »Sind Sie die Herrin des Hauses?«
»Die bin ich«, antwortete Charlotte und hatte Mühe, sich dem musternden Blick seiner grünen Augen zu entziehen. Siedend heiß wurde ihr bewusst, dass sie nur einen Morgenmantel über dem Nachthemd trug.
»Und der Herr des Hauses, ist er auch in der Nähe? Kann ich ihn sprechen?«
»Es gibt keinen Herrn des Hauses mehr«, antwortete Charlotte kühl. Sie hatte sich wieder gefasst. »Sie müssen schon mit mir vorliebnehmen.«
Denis war an ihre Seite gekommen und hatte ihre Hand ergriffen. Sie fühlte sich warm und wirklich an, während sie die fremden Leute noch immer als Teil eines seltsamen Traumes verdächtigte.
»Mein Name ist Breandan. Ich und meine Leute suchen Schutz vor dem Schnee.«
»Damit kann ich Ihnen nicht dienen.« Charlotte wies auf die zwei Scheunen und das kleine Haus. »Darin finden Sie wohl kaum alle Platz. Außerdem sind es nur ein paar Schneeflocken, die …«
Mit einer Handbewegung schnitt er ihr das Wort ab. »Ich meine nicht diesen Schnee, Madame. Ich meinte den, der kommen wird.«
Charlotte zog amüsiert die Mundwinkel nach oben. »Oh, sind Sie ein Wetterprophet?«
Er ging nicht darauf ein, sondern sagte: »Verzeihen Sie, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt: Wir suchen ein Winterquartier, und keine Angst, wir haben unsere eigenen Wagen und Zelte dabei. Selbst für Oscar brauchen wir keinen überdachten Stall. Er hat seinen eigenen Wagen.«
»Oscar? Sie meinen den Elefanten?«
»So ist es.«
Charlotte verschränkte die Arme vor der Brust. »Das ist – unmöglich«, sagte sie, vielleicht etwas brüsker, als sie es beabsichtigte. Aber allein der Gedanke, ein Elefant würde auf ihrem kleinen Hof überwintern und sich am Ende vielleicht doch die Scheune mit den Hühnern teilen, war einfach grotesk. Mehr noch, er machte ihr auf eine nicht fassbare Weise Angst. So als würde etwas Fremdes in ihre Welt einbrechen.
»Was ist schon unmöglich?«, antwortete ihr Gegenüber. Erneut fing er ihren Blick, und sie machte den Fehler, zu lange in diese faszinierend grünen Augen zu schauen.
»Es ist für uns so schon schwer genug, über den Winter zu kommen«, sagte sie und wünschte sich, er würde gehen und sie nicht auf diese Weise anblicken.
»Wir wollen keine Almosen, Madame …«
»Darrieux. Charlotte Darrieux«, hörte sie sich sagen.
»Im Gegenteil, Madame Darrieux, wir sorgen für uns selbst, wir brauchen nur einen Ort, wo wir zur Ruhe kommen und uns gegen den Winter wappnen können. Und außerdem zahlen wir gut.«
Er nannte ihr eine Summe, die ihr schier die Röte ins Gesicht trieb.
»Das … das ist zu viel«, stammelte sie, während sie gleichzeitig überschlug, was es bedeuten würde, so viel Geld zu besitzen.
Sie würde sich keine Sorgen mehr machen müssen, wie sie den Hof über den Winter rettete. Sie würde Antonin weiter beschäftigen können, Denis endlich neue warme Kleidung kaufen können, denn aus den letztjährigen war er schon wieder rausgewachsen. Auch sich selbst würde sie vielleicht ein neues Kleid gönnen. Es gab so vieles, was anlag. Notwendiges wie der Kauf neuer Kühe und lang Entbehrtes wie endlich einmal wieder so auszusehen wie früher …
An all das dachte sie nicht nur, sie sah es vor sich – als würde der Fremde all die Dinge vor ihren Augen entstehen lassen. Und doch war da etwas, das ihr nach wie vor nicht behagte, ihr regelrecht Angst bereitete, aber dieses Gefühl war vage und ließ sich nicht in Worte oder gar Bilder fassen.
Es war nicht ganz sie selbst, die schließlich nickte und sagte: »Meinetwegen, Monsieur Breandan. Sie können sich auf dem Feld hinter der Scheune einrichten. Aber ich verlange, dass niemand unser Heim betritt. Mit allem anderen kann ich aushelfen, wenn Sie es benötigen.«
Ich komme ins Plappern! Wann hatte sie das letzte Mal mehr als zwei Sätze hintereinander von sich gegeben? Seit Erics Tod war es nicht nur einsam um sie herum geworden, sie war auch schweigsam geworden. Mit Erics Tod war auch die Stille eingekehrt auf dem Hof.
»Ich versichere, Ihnen, Madame, dass wir Ihnen keinerlei Schwierigkeiten bereiten werden und alle Ihre Befehle befolgen.«
»Ich will nur keine Scherereien«, sagte sie.
»Die wünschen wir uns alle nicht«, antwortete er lächelnd und zeigte zum ersten Mal die blitzweißen Zähne, die spitz zugefeilt waren und Charlotte an winzige Eiszapfen erinnerten.
In diesem Moment begriff sie, dass sie einen Fehler gemacht hatte.
Aber es war zu spät, ihn zu korrigieren.
***
In dem Dorf unterhalb Château Montagne,Gegenwart
Es war ein besonderer Abend, aber es war ja auch eine besondere Zeit. So stimmungsvoll ging es in der Kneipe »Zum Teufel« nur ein einziges Mal im Jahr zu. Wenn Mostache, der Wirt, seine Stammgäste zur Adventsfeier lud. Nach dem obligatorischen Adventsgebäck und Kaffee und Kuchen wurde gemeinsam gesungen. Alle bekannten und unbekannten Advents- und Weihnachtslieder erschollen und ließen so manchen ob der Feierlichkeit heimlich eine Träne verdrücken.
Zu vorgerückter Stunde schenkte Mostache auch alkoholische Getränke aus, und die Stimmung stieg in der rappelvollen Gaststätte weiter an. Dicht gedrängt standen die Gäste aus dem Dorf und unterhielten sich lautstark. Auch an den Tischen wurde heftig debattiert.
»Der Sommer war so trocken, dass selbst Mostache kein Wasser mehr hatte, um seinen Schnaps zu strecken«, behauptete Malteser-Joe.
»Viel schlimmer war, dass die Mostache’sche Seenplatte vor dem Eingang ausgetrocknet war«, blies Charles, der Dorfschmied, in das gleiche Horn. »Es ist mir ein paarmal passiert, dass ich nicht hierhergefunden habe, weil das markanteste Hinweiszeichen dieses Lokals einfach verschwunden war.« Die Mostache’sche Seenplatte, wie sie genannt wurde, war die riesige Pfütze, die sich bei jedem starken Regenguss auf dem holprigen Boden bildete und die Gäste zu wahren akrobatischen Einlagen zwang, wollten sie das Lokal betreten.
»Ich habe gehört, dass es nicht nur dir so ergangen ist«, sagte Malteser-Joe. »An manchen Tagen soll niemand hierhergefunden haben, sodass Mostache schon fast Insolvenz anmelden musste. Bis seine holde Gattin auf die rettende Idee kam, die Seenplatte jeden Morgen mittels einer gut gefüllten Gießkanne künstlich zu bewässern.«
»Was ist mit dir, Nicole?«, fragte der Schmied. »Ich habe gehört, dass ihr oben auf euerm Schloss nicht mehr genügend Wasser für euren Pool hattet …«
»Das ist zwar nur ein Gerücht, aber im nächsten Dürresommer klopfe ich bei dir an, sollten meine morgendlichen Schwimmrunden ernsthaft gefährdet sein«, sagte Nicole und erhob ihr Weinglas. »À votre santé«
»Mein Haus steht dir jederzeit offen. Allerdings kann ich dir nur meine Badewanne anbieten. Die aber mit Herzen!«
Seinem Gesicht war anzusehen, dass er sich für einen Moment vorstellte, die bildhübsche Frau tatsächlich nackt in seiner Wanne zu sehen.
»Komm ja nicht auf dumme Gedanken«, sagte Zamorra, der diesen Gesichtsausdruck nur zu gut kannte, wenn Männer seine Partnerin auf eine gewisse Weise betrachteten. »Ich werde schon dafür sorgen, dass der Pool immer gefüllt bleibt.«
Nicole schmiegte sich an ihn. »Du weißt wirklich, was sich Frauen wünschen, chéri.«
Alle in der Runde brachen in Gelächter aus. Mostache kam herangeeilt und fragte nach ihren weiteren Getränkewünschen.
»Wie wär’s mit einer Lokalrunde aufs Haus?«, schlug Malteser-Joe vor.
Mostache sah ihn streng an. Er hatte durchaus mitbekommen, was dieser zuvor behauptet hatte. »Und ich dachte schon, dir schmeckt mein angeblich gepanschter Fusel nicht. Ich habe übrigens von gewissen Leuten gehört, die sich den ganzen Sommer nicht gewaschen haben und auch dafür die Trockenheit verantwortlich machten. Malteser-Joe roch schlimmer als jede Ziege am Hintern, habt ihr das nicht mitgekriegt?«
Malteser-Joe verzog zornig das Gesicht. Damit kein ernsthafter Streit ausbrach und die Stimmung gar kippte, fragte Zamorra: »Ja, dieser verflucht trockene Sommer. Pater, stimmt es eigentlich, dass dir sogar das Weihwasser ausgegangen ist und deshalb der Teufel um die Kirche schlich?«
»Spotte nicht, Zamorra«, ermahnte ihn Pater Ralph. »Du weißt besser als wir alle, dass mit dem Teufel nicht zu spaßen ist.«
»Das stimmt allerdings«, musste Zamorra gestehen.
Sie bestellten die nächsten Getränke, während einige Gäste erneut ein Weihnachtslied anstimmten, und die Runde an Zamorras Tisch beim Refrain lautstark mit einstimmte:
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel …
Einige Gäste ließen es sich nicht nehmen, den Gesang zusätzlich zu begleiten, indem sie mit Löffeln, Gabeln und Messern die Gläser im Takt erklingen ließen.
Doch plötzlich wurde die Tür aufgeworfen. Ein eiskalter Hauch fuhr durch den warmen Raum, aber was noch viel erstaunlicher war: Schneeflocken tanzten herein wie Dutzende kleiner schwebender Engel.
Und mit ihm platzte Posthalter Jean-Claude Trenet in die Stube, auf dem Gesicht ein kindlicher Ausdruck reinster Freude: »Heute bringe ich euch nicht die Post, meine Freunde, heute lasse ich es schneien!«
Das letzte Wort schrie er geradezu heraus und riss jubelnd die Arme hoch.
Der Gesang war längst verstummt, aber nun drängte es alle hinaus, um den ersten Schnee dieses Winters mit eigenen Augen zu sehen.
»Komisch, auf den Wetterbericht ist auch immer weniger Verlass«, sagte Nicole und runzelte die schöne Stirn.
»Stimmt«, pflichtete ihr Zamorra bei. »Von Schnee war keine Rede. Lass uns trotzdem mit den anderen rausgehen.«
»Und ob, chéri«, sagte Nicole, und auch in ihren Augen war plötzlich diese kindliche Freude zu erkennen, die sich in ihrem Fall darin äußerte, dass in ihnen goldene Tüpfelchen tanzten.
Auch sie und Zamorra gesellten sich zu den anderen. Noch war die Schneedecke so dünn, dass darunter der Boden zu erkennen war. Nicole schmiegte sich an Zamorra und meinte: »Jetzt müssten nur noch die Elfen mit ihren Glöckchen bimmeln, und ich würde tatsächlich glauben, dass Père Noël auf seinem Schlitten zu uns unterwegs ist.«
In diesem Moment ertönten aus der Ferne tatsächlich leise Glockentöne.
»Spinn ich jetzt, Zamorra, oder hörst du das auch?«, fragte Nicole erstaunt.
»Das zweite ist eindeutig der Fall, chérie, keine Sorge, du bist nicht verrückt. Vielleicht hat Mostache ja noch eine Überraschung für uns alle vorbereitet …«
»Noch eine?«
»Ja, du hast ja recht, das wäre ungewöhnlich.« Der Wirt, gradlinig und geradeaus, war nicht gerade dafür bekannt, seine Gäste großartig zu überraschen.
Auch die anderen hörten nun die Laute, die so recht zu dem Schnee und der besinnlichen Adventsstimmung passten.
Als hätte jemand nur auf den rechten Moment gewartet, um sich unsere Stimmung zunutze zu machen, dachte Zamorra, verwarf den Gedanken aber sofort wieder, weil er ihm zu dumm erschien.