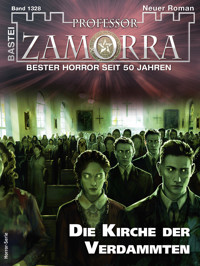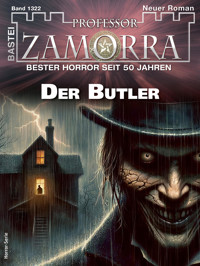1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Halloween! Die Nacht der Geister, Untoten und Dämonen. Auch in Saint-Cyriac feiert man Allerheiligen. Während die Erwachsenen an diesem Feiertag den Friedhof besuchen, um der Verstorbenen zu gedenken, gehen die Kinder von Tür zu Tür, bitten um Süßigkeiten - oder spielen Streiche.
An diesem Halloween sind einige der Streiche besonders teuflisch.
Steckt dahinter die hübsche, junge Wahrsagerin, die kurz vor Halloween plötzlich im Zum Teufel auftaucht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Der Teufel kommt an Halloween
Leserseite
Vorschau
Impressum
Der Teufel kommtan Halloween
von Veronique Wille
»Was ... zum Teufel!« Entsetzt sah Malteser-Joe auf seine Hand. Darin lag ein winziger schwarzer Zettel. Und der brannte wie verrückt. Er versuchte ihn abzuziehen, aber er klebte fest.
Im nächsten Augenblick war er verschwunden. Hatte sich einfach in Luft aufgelöst.
»He, was sollte das?«
Die Alte kicherte. »Schmerz muss sein, danach ist alles rein. Sei auf der Hut, Malteser-Joe!« Sie wandte sich nun den anderen zu. »Und ihr alle auch. Das Böse ist in euer Dorf eingezogen. Hütet euch, ihm blindlings in die Falle zu gehen!«
24. Oktober. Noch sieben Tage bis Halloween.
Kneipe Zum Teufel, Saint-Cyriac, Frankreich.
»Bonjour, Monsieur, darf ich die Handzettel hier vielleicht bei Ihnen auslegen?«
Mostache, glücklich verheirateter Wirt und seines Zeichens der Patron der besten, weil einzigen Gaststätte in Saint-Cyriac, starrte die Frau, die soeben seine Kneipe betreten hatte, mit offenem Mund an. Es war nicht so, dass er ein Frauenheld war, ganz und gar nicht. Allenfalls flirtete er ab und zu mit einer Gästin, ohne es ernst zu meinen. Das gehörte zu seinem Job.
Aber angesichts des Weltwunders, das in persona vor ihm stand, wünschte er sich insgeheim, dreißig Jahre jünger zu sein.
Die Gesichtszüge der Frau erinnerten ihn an eine leider ermordete Filmschauspielerin, die er in seiner Jugend angebetet hatte. Wie hieß sie noch gleich? Sharon Tate, genau. Aber ein wenig sah sie auch seiner Mutter ähnlich, die ebenfalls schon längst nicht mehr unter den Lebenden weilte. Und seiner allerersten Freundin. Mostache hatte den Eindruck, dass das Gesicht der Frau sämtliche Frauen widerspiegelte, die ihm im Leben etwas bedeutet hatten. Er versank geradezu in dem Minenspiel.
»Monsieur?« Ihre sanfte Stimme riss ihn aus seiner Faszination zurück ins Hier und Jetzt.
»Ja bitte, Mademoiselle?«
Sie wedelte mit einem Papierstoß in der Hand. »Die Flyer, Monsieur, darf ich Sie bei Ihnen auslegen?« Dabei schenkte sie ihm ein Lächeln wie die Mona Lisa.
»Natürlich, natürlich!«, beeilte er sich zu versichern. »Legen Sie die Dinger auf die Theke. Oder besser noch, wir verteilen gleich ein paar. Was halten Sie davon?«
»Das wäre sehr, sehr nett!«
Das Zum Teufel war an diesem Donnerstagabend gerappelt voll. Auch wenn der morgige Freitag noch ein Arbeitstag war, läuteten die Bewohner des kleinen Dorfes gerne schon mal frühzeitig das Wochenende ein.
Es war still geworden im Lokal. Sämtliche Gäste starrten die Frau an und hatten das kurze Gespräch mitbekommen.
Mostache führte die junge Frau zum ersten Tisch, an dem Charles mit einigen anderen Zechern saß. Der stämmige Mann war gleichzeitig Dorfschmied und Kfz-Mechaniker und roch immer ein wenig nach Benzin und Motoröl. Seine Pranken waren nie ganz sauber, und auch jetzt waren seine Fingernägel schwarz.
Mostache glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als sich der ansonsten nicht gerade als Vorbild der Höflichkeit bekannte Charles von seinem Stuhl erhob, sich leicht verbeugte und – sämtlichen Anwesenden verschlug es die Sprache – die Hand der Frau nahm und einen Kuss darauf hauchte.
Sie ließ es lächelnd geschehen.
»Ich nehme gerne einen Flyer, Mademoiselle«, tönte Charles.
»Nicht Mademoiselle. Nennen Sie mich einfach Constanza.«
»Ein wunderschöner Name, Madem... äh, Constanza.« Noch immer hatte er ihre Hand nicht losgelassen.
Die Frau, die sich Constanza nannte, drehte nun ihrerseits seine Hand so, dass der Handteller offen vor ihr lag.
»Oh, Sie haben eine sehr ausgeprägte Lebenslinie, Monsieur. Sie sind sehr, sehr stark. In jeder Hinsicht. Oh, und ich sehe da ...« Sie stockte unvermittelt.
»Was? Was sehen Sie?«, fragte Charles aufgeregt.
»Es ... es ist wieder fort. Es war nur ein Gedanke.« Sie schenkte ihm ein bezauberndes Lächeln. »Vielleicht besuchen Sie mich ja morgen in meinem Wohnmobil, dann kann ich Ihnen mehr sagen.«
»In ... Ihrem Wohnmobil?«
»Gleich auf dem Parkplatz beim Friedhof.« Sie ließ seine Hand los und reichte ihm einen Flyer.
»Mademoiselle! Ich meine Constanza! Würden Sie mir auch aus der Hand lesen?« Es war Gerard Fronton, von allen nur Malteser-Joe genannt, der sich vor sie drängte. »Ich glaube, ich habe auch eine sehr starke Lebenslinie. Sehen Sie!«
»Ich bin etwas erschöpft. Ich habe eine sehr lange Fahrt hinter mir. Aber wie wär's, wenn wir uns morgen ausführlich unterhalten?«
Auch ihm drückte sie einen Flyer in die Hand.
Jeder wollte nun einen haben. Constanza brauchte sich nicht von Tisch zu Tisch bewegen. Alle kamen sie zu ihr und rissen ihr die Flyer aus der Hand.
Nach fünf Minuten war der Spuk vorbei. Constanza war ebenso schnell und lautlos verschwunden, wie sie gekommen war.
»Was steht denn nun auf dem Flyer?«, dröhnte Charles' Stimme durch den Gastraum.
»Lesen hilft!«, spottete Malteser-Joe. »Oder soll ich dir das ABC erst noch beibringen.«
»Schwachkopf. Natürlich kann ich lesen!«
Charles vertiefte sich in den Flyer und rezitierte laut:
Constanza, die reisende Heilerin.
Ruhm, Reichtum, vollkommenes Glück!
Sie sind ängstlich, bedrückt und sorgen sich um die Zukunft?
Ich nehme Sie mit auf eine fantastische Reise durch die spirituelle Welt und offenbare Ihnen, was Sie Wundervolles erwartet.
Darunter befand sich eine hingekritzelte Zeichnung, die wohl eine Glaskugel darstellen sollte. Und auch sonst machte die Aufmachung des Flyers eher einen amateurhaften Eindruck. Aber gerade das wirkte so authentisch, so glaubhaft.
»So, Leute, jetzt beruhigt euch mal wieder«, rief Mostache. »Wer wollte noch mal den Rotwein?« Er selbst war es, der sich zur Ruhe rufen musste. Noch immer hatte er all die Frauen vor Augen, an die ihn ihr Gesicht erinnert hatte.
Niemand ging auf seine Frage ein. Dafür sprach Charles – nachdenklich und ergriffen.
»Wisst ihr, woran sie mich erinnerte: an meine selige Maman!«
Und was niemand je für möglich gehalten hätte: In den Augen des großen, muskelbepackten Mannes standen plötzlich Tränen.
25. Oktober. Noch sechs Tage bis Halloween.
Château Montagne, Bibliothek
»Was ist nun?«, giftete Faolan. »Packst du mit an, oder soll ich die ganze Arbeit etwa alleine erledigen?«
Faolan war einer der beiden auf Château Montagne arbeitenden Archivare. Der ehemalige höllische Archivar erinnerte an einen aufrecht gehenden Wolf. Im Gegensatz zu seinem menschlichen Kollegen Pascal Lafitte lebte er im Schloss, während Pascal unten im Dorf mit seiner Familie wohnte und nur tagsüber herauffuhr.
Im Moment waren die beiden damit beschäftigt, mehrere Stapel Bücher einzusortieren, die vor ein paar Tagen auf mehreren Paletten angeliefert worden waren und aus der Bibliothek eines verstorbenen Magiers stammten. Zamorra hatte sie auf einer Auktion ersteigert.
Faolan stand auf der Leiter und wartete auf das nächste Buch, das ihm Pascal anreichen sollte. Doch der war heute nicht recht bei der Sache.
Als er noch immer nicht reagierte, platzte Faolan der Kragen: »Am besten meldest du dich krank. Dann sehe ich dich wenigstens ein paar Tage nicht.«
Normalerweise vertrugen die beiden sich. Aber zuweilen waren sie auch wie Katz und Maus. Vor allen Dingen, wenn die Debatte losging, wer von ihnen denn nun der bessere Archivar war.
Erst jetzt erwachte Pascal aus seiner Lethargie.
»Was? Krank? Nein, ich bin nicht krank. Aber das ist eine gute Idee. Ich müsste nämlich was unten im Dorf erledigen.«
»Das kannst du auch in deiner Mittagspause. Was gibt es denn so Wichtiges?« Faolans notorische Neugierde war geweckt.
»Ich will mir die Zukunft weissagen lassen.«
»Das ist doch totaler Hokuspokus, das weißt du, oder? Es sei denn, du würdest Zamorras Zeitringe benutzen.«
Wenngleich auch das nicht ganz korrekt war. Mit Hilfe des blauen Zeitrings vermochte sich Zamorra zwar in die Zukunft zu beamen, aber nicht, sich selbst dabei zu begegnen. Denn das würde ein Zeitparadoxon mit ungeahnten Auswirkungen zur Folge haben.
»Nein, mein Lieber, das ist kein Hokuspokus. Ich vertraue der Frau!«
»Frau? Welcher Frau?«
»Sie heißt Constanza und hat gestern Abend im Zum Teufel ihre Flyer verteilt. Und auf uns alle einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck gemacht, sage ich dir. Eigentlich wollte ich gleich heute Morgen zu ihr, aber die Tür zu ihrem Wohnwagen war noch verschlossen.«
Faolan schlug sich mit der krallenbewehrten Pfote gegen die Stirn.
»Ich fasse es nicht! Und deshalb bist du heute neben der Spur? Wegen einer Hochstaplerin?«
»Constanza ist keine Hochstaplerin!«
Faolans Augen wurden groß. »Jetzt kapier' ich: Du hast dich in sie verguckt!«
»Hab ich nicht!« Pascal wurde tatsächlich rot. »Es ist nur ... sie erinnert mich an meine Mutter. Und, äh, noch an ein paar andere Frauen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben.«
»Erinnert sie dich auch an deine eigene Frau?«, fragte Faolan spitz.
Pascal dachte einen Augenblick ernsthaft nach. »Nein, jetzt wo du danach fragst. Seltsamerweise nicht. Kein bisschen tatsächlich.«
Der Regen setzte just in dem Moment ein, als Henry mit seinem neuen Mofa Saint-Cyriac erreichte. Eigentlich hatte der Fünfzehnjährige nur eine Runde durchs Dorf drehen wollen, um dann wieder hoch ins Schloss zu fahren und sich in seine Studien zu vertiefen. Im Moment beschäftigte er sich unter anderem mit den Theorien des verstorbenen Astrophysikers Stephen Hawking, insbesondere mit dessen Arbeiten zur Schwarzkörper-Thermodynamik. Dabei hatte er bereits etliche Fehler entdeckt und stellte eigene Berechnungen auf.
Henry war ein Wunderkind. Er besaß drei Gehirne, die ihn pausenlos mit komplizierten Aufgaben beschäftigten. Dabei lief das Ganze im Hintergrund ab – wie bei einem Computer, der pausenlos mit kryptischen Codereihen programmiert wird.
Daneben war der Fünfzehnjährige aber auch ein ganz normaler Jugendlicher, der sich nicht nur für Mädchen zu interessieren begann, sondern neuerdings auch für sein Mofa. Er hatte es so frisiert, dass es nicht nur innerhalb von Sekunden auf unerlaubte achtzig Stundenkilometer beschleunigte, sondern dabei auch nur einen Bruchteil des üblichen Treibstoffs verbrauchte.
Der Regen wurde rasch stärker, sodass Henry wahrscheinlich völlig durchnässt zu Hause ankommen würde. Einen natürlichen Schutz gegen Regen hatte er noch nicht erfunden. Da tauchte vor ihm Madame Boulez' Krämerladen auf. Augenblicklich traf er eine Entscheidung.
Er stellte das Mofa davor ab und hastete hinein.
Marie-Claire Boulez sah ihm lächelnd entgegen.
»Ah, der junge Sir Henry. Was darf's sein? Wieder eine Tüte meiner persönlich zusammengestellten Nussmischung?«
Henry wurde rot. Neuerdings machte sich Marie-Claire einen Spaß daraus, ihn mit Sir anzureden. Es war ihm peinlich. Noch dazu, wo er bemerkte, dass er nicht der einzige Kunde war.
Das Mädchen mit den feinen rotblonden Haaren war ihm schon des Öfteren im Dorf aufgefallen. Natürlich hatte er nicht gewagt, es anzusprechen. Er schätzte, dass es in seinem Alter war. Das Mädchen trug einen modischen Anorak und Skinny-Jeans. Offensichtlich hatte es ebenfalls in erster Linie vor dem Regen hier Schutz gesucht, denn es blätterte gelangweilt in der neuesten Ausgabe der Vogue.
»Äh ... ja«, brachte er heraus.
»Dann muss ich mal hinten ins Lager gehen. Du kannst dich ja währenddessen mit Mathilda unterhalten.«
Das fehlte ihm noch!
Als sich Marie-Claire entfernte, wäre er ihr am liebsten nachgelaufen. Mit Mädchen hatte Henry kaum Erfahrung. Abgesehen von seiner Freundin Brittany im fernen England. Aber die sah er nur in den Ferien, und außerdem war sie eher ein Kumpel.
So recht wusste er nicht, wo er mit den Händen hinsollte. Vielleicht sollte er sich einfach auch eine Zeitung nehmen und so tun, als würde sie ihn interessieren?
»Du bist ein Sir?« Das Mädchen namens Mathilda sah ihn über das Magazin hinweg neugierig an.
»Nicht wirklich. Sie nennt mich bloß so«, sagte er mit belegter Stimme. »Eigentlich bin ich nur Henry.«
»Ich weiß. Du wohnst oben im Schloss, oder?«
»Ja, bei Nicole und Zamorra. Seit drei Jahren schon.«
Sie legte die Vogue beiseite. »Ist das nicht voll öde? Ich meine, man sieht dich so gut wie nie hier im Dorf, und in die Schule scheinst du auch nicht zu gehen.«
»Na ja, ich ... äh, betreibe meine Studien privat.«
»Studien? Bist du ein Genie?« Mathilda verdrehte die Augen. »Ich wollte, ich wäre eins. In Mathe bin ich eine völlige Niete.«
Henrys Augen leuchteten. »Echt? Mathe ist doch kinderleicht! Sozusagen mein Spezialgebiet.«
»Du kannst mir ja mal auf die Sprünge helfen.«
Henry spürte, dass sein Herz schneller schlug. »Gerne, wo wohnst du denn?«
Sie sagte es ihm. »Wenn du Zeit hast, kannst du mir gleich heute bei den Hausaufgaben helfen. Die kapiere ich nämlich nicht.«
»Gerne. Ich müsste nur vorher mal telefonieren. Meine Leute machen sich sonst Sorgen.« Seine Leute, das klang cool, wie er fand. Normalerweise hätte er sich gewählter ausgedrückt, aber es konnte nicht schaden, sich ihrem Jargon anzupassen.
»Klaro, ruf sie einfach an.«
»Ich weiß nur nicht wie.«
Sie sah ihn an wie das achte Weltwunder.
»Du hast echt kein Handy?«
»Ich halte Handys für eine der größten Lebenszeitverschwender der Menschheitsgeschichte. Neben Fernseher natürlich.«
»Ah ja. Und du glaubst, du verschwendest keine Lebenszeit, wenn du jetzt hoch in dein Schloss düst und Bescheid gibst, anstatt mal kurz anzurufen?«
Das war ein Argument, zu dem ihm im Moment nichts einfiel.
»Hier, du kannst mein Handy haben.« Mathilda zog es aus ihrer Hosentasche.
Henry nahm es zögernd entgegen.
Bevor er jedoch die Nummer eintippen konnte, kam Marie-Claire schon wieder zurück.
»So, hier habe ich deine Nussmischung à la Marie-Claire. Aber regnen tut's noch immer in Strömen. Also bleibt ruhig noch ein wenig.« Die Ladenbesitzerin seufzte. »Heute war eh noch kaum Kundschaft da. Diese Wahrsagerin hat allen den Kopf verdreht.«
»Ja, meine Mum wollte auch heute bei ihr vorbeischauen«, erzählte Mathilda. »Ich halte das für Quatsch.«
»Ist es auch«, pflichtete Henry ihr bei und begann zu dozieren: »Die sogenannte Wahrsagerei basiert auf der Annahme, dass alles, was über fünfzig Prozent eintritt, auf der Vorhersage beruht. Dabei bedienen sich die Scharlatane allgemeiner Floskeln und Themen, selten aber ganz speziellen.«
»Was wäre denn was Spezielles?«, unterbrach ihn Mathilda.
»Na ja, zum Beispiel der Zeitpunkt deines Todes. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihn dir jemand voraussagt, beträgt eins zu fünfzehn Milliarden, sechshundertdreißig Millionen, siebenhunderdreizehn Tausend und vierhundertsiebzehn.«
»Find' ich jetzt aber voll makaber.«
»Was ist daran makaber? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle einmal sterben werden, beträgt im Übrigen eins zu null. Von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen.«
»Du meinst Nicole und Zamorra?«
Das war ein heikles Thema, über das sich Henry lieber nicht äußern wollte. Dass die beiden nicht alterten, lag an der Quelle des Lebens. Natürlich wussten die allermeisten im Dorf über die Tatsache Bescheid, aber wundern tat sich schon lange niemand mehr darüber. Man nahm es einfach als gegeben hin.
Zu seinem Glück wurde Henry einer Antwort enthoben, weil plötzlich noch eine weitere Person den kleinen Laden betrat.
Es war Constanza. In der Hand trug sie einen durchnässten Stapel Zettel. Wundersamerweise war sie selbst völlig trocken.
»Hallo, zusammen«, grüßte sie freundlich, wandte sich aber sogleich an Marie-Claire. »Dürfte ich wohl meine Flyer bei Ihnen auslegen?«
Marie-Claire sah die Frau nicht gerade freundlich an.
»Sie müssen diese Wahrsagerin sein. Habe ich recht?«
»Ich bin Constanza und ja, ich sehe in die Zukunft, um die Menschen glücklich zu machen.« Sie strahlte.
Marie-Claire stemmte die Arme in beide Hüften.
»Meine Liebe, mit Verlaub, aber das halte ich für naiv. Die Zukunft macht nun mal, was sie will, Und schon gar nicht alle Menschen glücklich. Das schafft ja noch nicht mal die Gegenwart.«