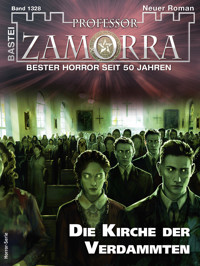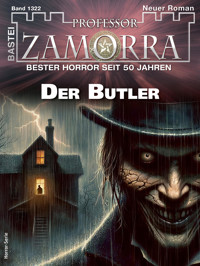1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Eine Klingel gab es nicht. Also klopfte Nicole kurzerhand an die Haustür. Als sich nichts tat, schaute sie noch einmal über die Straße hinweg hoch zur Kirche, deren Turm sich wie ein mahnender Zeigefinger vor dem Himmel abhob. Von Zamorra war nichts mehr zu sehen. Er musste bereits hineingegangen sein.
Der Gedanke, dass er jetzt ohne sie dort drinnen war und womöglich wirklich auf den widerwärtigen Alten stieß, der sie vor der Seebrücke angesprochen hatte, gefiel ihr immer weniger.
Wir hätten uns nicht trennen sollen.
Aber jetzt war es zu spät ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Svantevits Erben
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Captblack76/shutterstock
Datenkonvertierung eBook: César Satz & Grafik GmbH, Köln
ISBN 978-3-7517-0124-2
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
www.bastei.de
Svantevits Erben
von Veronique Wille
Mittlerweile spürte Zamorra die Einschläge am ganzen Körper. Es kostete Merlins Stern enorme Kraft, die gegnerischen Blitze zu absorbieren. Kraft, die das Amulett Zamorra entzog.
Sein Gegner war nur noch wenige Schritte von ihm entfernt. Die Fratze verzog sich zu einem siegessicheren Grinsen.
Das war’s wohl, dachte Zamorra. Er hatte schon oft mit dem Leben abgeschlossen, aber diesmal wurmte es ihn besonders. Er würde sterben, ohne auch nur die Oberfläche dessen anzukratzen, was ihm letztlich den Tod bescheren würde …
Der Meister: Einst waren sie eins.
Der Adept: Wie Yin und Yang, oh Herr?
Der Meister: Yin und Yang – wie vorlaut er doch ist! Nein, ich spreche von Göttern!
Der Adept: Wie der Gehörnte Gott und die Dreifaltige Göttin?
Der Meister: Da kommen wir der Sache schon näher. Wie die Gottheit der Wicca, so waren auch Svantevit und Svantavita eine duale Gottheit. Gott und Göttin, Herr und Herrin in einem …«
Der Adept: Sie waren es, oh Herr?
Der Meister: Eine lange Geschichte, die er sich hinter die Ohren schreiben möge …
(Aus dem Buch der Weisheit)
Einst herrschten sie über die Welt. Fälschlicherweise hieß es, dass sie sich selbst erschaffen hätten, als die Erde noch nackt und dunkel war. So harrten sie dort, äonenlang und sich ihrer selbst genug.
Doch sie waren eine Maschine, was sie selbst nicht wussten, und das ferne Sternenvolk, das sie gebaut hatte, existierte schon lange nicht mehr.
Die Zeit der Stasis endete, als Svantavita erwachte und einen Kometen in der Finsternis erblickte. Sie fand ihn so berauschend schön, dass sie Svantevit überredete, die Finsternis zu illuminieren.
Sie wusste nicht, dass es allein ihre innere Programmierung gewesen war, die sie hatte erwachen lassen. Und auch die folgenden Taten erzwang allein der programmierte Code und nicht etwa, wie sie selbst glaubte, ihre göttliche Intuition.
Also schufen sie zunächst das Himmelszelt und die vielen Tausend Sterne darin.
Als sie sich daran sattgesehen hatten, wollten sie mehr. Da sie in acht Richtungen zu sehen vermochten, erschufen sie die acht Himmelsrichtungen: Norden, Sweden, Westen, Raden, Süden, Chrachen, Osten und Leden.
Doch in nichts unterschieden sie sich, da die Erde, zwar jetzt erhellt vom Sternenzelt, noch immer leer war. Ja, es erschien ihnen so, als würde das bleiche Licht die Trostlosigkeit nur noch mehr hervorheben.
Es war nicht das, was sie sich vorgestellt hatten.
Und so entwarfen sie eine Welt nach ihren Vorstellungen, ließen Gräser und Bäume sprießen, ganze Urwälder die vormals trostlose Einöde bedecken und labten sich daran.
Doch auch das wurde ihnen mit der Zeit zu eintönig. Sie erzeugten den Wind, fügten Wetter hinzu, Donner, Blitz und Regen, sodass alles in ständiger Bewegung war.
Aber auch das genügte ihnen nach einer Weile nicht mehr.
Sie erschufen die Lebewesen, und Svantavita befahl ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch!
Riesige Kreaturen bevölkerten nun das Land, und die Maschinen-Gottheit hatte Lust daran, ihnen zuzusehen.
»Sie sind so langweilig«, sagte Svantavita eines Tages. Sie war die Aktivere, vielleicht auch die Getriebenere. »Ihr einziges Begehren ist es zu fressen und sich zu vermehren.«
»So erzeugen wir weitere Varianten«, schlug Svantevit vor, und er hatte auch gleich eine Idee: Er ließ das Land schrumpfen, teilte es in Kontinente und ließ dazwischen riesige Wasserflächen, die er Meere und Ozeane nannte, entstehen. Diese bevölkerte er mit allerlei Lebewesen, die sich auf mannigfaltige Weise von denen an Land unterschieden.
Nun wollte auch Svantavita nicht untätig sein und erdachte die Vögel, Flugechsen, Mücken und alles andere, was Flügel hat. Denn:
»Wenn die Tiere gehen können und schwimmen, warum soll es nicht auch welche geben, die zu fliegen vermögen?«
Manche dieser Flugwesen waren so riesig, dass sie die Sterne verdunkelten. Auch vermochten sie große Entfernungen zurückzulegen, hin zu fernen Welten. Und da die Gottheit durch ihre Augen sah, erblickten sie nun die wundersamsten Planeten mitsamt ihren Kreaturen.
So vergingen Millionen von Jahre, ohne dass sich die Gottheit erneut langweilte. Denn ebenso gab es unter den Lebewesen solche, die in der Zeit reisen konnten, sodass der Gottheit Vergangenheit und Zukunft offenstanden.
So sahen sie eines Tages durch die tausend Augen eines Flugdrachens einen Planeten, der dem ihren aufs Haar glich. Darauf lebte eine seltsame Spezies. Sie selbst nannte sich –
Mensch!
☆☆☆
Diese Menschen waren es, die sie fortan am meisten faszinierten. Sie ergötzten sich daran und konnten sich gar nicht satt an ihnen sehen.
Im Gegensatz zu den einfältigen Lebewesen, die sie bisher erschaffen hatten, waren die Menschen weit interessanter. Sie verfügten über etwas, das sie Intelligenz nannten. Diese Intelligenz ließ sie himmelhohe Türme bauen und tausenderlei Dinge erfinden, die ihnen das Leben erleichterten. Ebenso aber unterjochten sie mithilfe der Intelligenz all die anderen Lebewesen. Auch stritten sie untereinander auf grausame Weise. Sie nannten es Krieg.
Ja, ihre Gier schien unersättlich, und Svantevit und Svantavita fühlten Neid in sich aufsteigen. Neid, dass sie auf all das nicht selbst gekommen waren. Wie viel konnten sie doch von den Menschen lernen!
Sie wollten nun selbst Menschen machen, doch das erwies sich als schwieriger als alles andere zuvor. Allein die äußere Form wollte ihnen kaum gelingen. So gab es Menschen ohne Kopf, ohne Arme, ohne Beine. Menschen, die nur aus einem einzigen in die Länge gezogenen Etwas bestanden. Menschen, die so winzig waren, dass eine Ameise sie zerquetschte. Menschen platt wie eine Flunder. Menschen, die humpelten, hüpften, rollten oder sich, wie die Gottheit selbst, gar nicht von der Stelle bewegen konnten.
Nach Zehntausenden von Jahren vergeblicher Bemühungen, einen auch nur ansatzweise perfekten Menschen zu erschaffen, erfasste Wut die Gottheit.
»Die Menschen sind nicht einmal dem niedersten Gewürm ebenbürtig!«, zürnte Svantevit.
»Und doch wissen wir, dass es sie anderswo in Perfektion gibt«, erwiderte Svantavita. In ihren Gedanken lag ein versteckter Vorwurf Svantevit gegenüber.
Das wiederum machte ihn noch wütender, sodass er mit einem einzigen Gedankenbefehl die von ihnen geschaffenen »Menschen« zu Staub zerfallen ließ.
»Vielleicht sollten wir noch einmal von vorn anfangen«, schlug Svantavita am Ende versöhnlich vor.
»Wie weit am Anfang?«
»Nun, ich meine ganz am Anfang.«
☆☆☆
Am Anfang schuf die Gottheit den Himmel und die Sterne, die die wüste Erde illuminierten. Sie teilten die Zeit in Tag und Abend, und es wurde Morgen. Und auch in der Folge machten Svantevit und Svantavita alles so wie zuvor. Bis auf eine Ausnahme: Sie pflanzten den Garten Eden.
Dann versanken sie wieder in Stasis, während sie ihre Gedanken auf die Reise schickten, zu dem Planeten, auf denen die Spezies namens Mensch sich inzwischen noch weiterentwickelt hatte. Es gab eine Rasse, die sich Römer nannte. Sie breiteten sich über einen ganzen Kontinent aus, eroberten die anderen Völker und beglückten sie mit ihrer Kultur.
Die Gottheit verstreute ihre Gedanken wie Samen, die in die Gene der Menschheit verankert wurden.
Als sie erneut erwachten, hatten die Menschen nicht nur die Luft erobert, sondern längst auch den Weltraum. Sie flogen in Schiffen dahin, die schneller als das Licht waren. Ihre Kriegslust war potentiell zu ihrem Fortschritt gestiegen: Nun führten sie ihre Kriege auf anderen Planeten, unterjochten außerirdische Völker oder löschten sie aus, wenn sie sich ihnen nicht unterwarfen.
Die Gottheit wartete geduldig in der Gewissheit, dass eines fernen Tages …
… das Beiboot mit den beiden Menschen, ein Mann und eine Frau, an Bord strandete. Das von Maschinen gelenkte Mutterschiff hatte eine Havarie erlitten und würde sie nie wieder zu ihrem Heimatplaneten zurücktransportieren können.
Als die beiden Menschen in ihren silbernen Anzügen ausstiegen, staunten sie, denn was sie erblickten, glich der Fauna auf ihrem eigenen Planeten – so wie er vor vielen Tausenden Jahren ausgesehen haben musste.
Noch mehr staunten sie aber, als sie erkannten, dass ihre Instrumente sie tatsächlich nicht getäuscht hatten: Es gab Sauerstoff, und zwar in einer Reinheit, wie es sie bei ihnen infolge der Luftverschmutzung schon seit Jahrhunderten nicht mehr gab.
Die beiden ließen sich nieder und richteten sich ein. Sie nannten den Planeten Eden, da es auf ihrer Welt eine verworrene Schöpfungsgeschichte gab, in der dieses Eden eine Rolle gespielt hatte.
So lebten sie denn einigermaßen zufrieden und ernährten sich von den mannigfachen Früchten und schmackhaften Wurzeln, die sie in Eden zuhauf fanden. Eine andere Möglichkeit blieb ihnen sowieso nicht, als sich damit abzufinden, bis ans Ende ihres Lebens in Eden zu bleiben.
Svantevit und Svantavita erfreuten sich an den in ihren Augen perfekten Menschen. Sie sahen ihrem alltäglichen Treiben zu und hatten Spaß daran. Doch schon nach einigen Monaten langweilten sie sie.
»Die beiden sind so öde«, beklagte sich Svantavita, »Wir haben andere Menschen gesehen. Menschen, die sich entwickelten, die Erfindungen auf den Weg brachten, die sich bekriegten …«
»So helfen wir doch etwas nach«, schlug Svantevit vor.
Und so infiltrierten sie die Gedanken von Adam und Eva, wie die zwei sich nun nannten. Bald schon gerieten die beiden Menschen in Streit. Bei einem dieser gewaltsamen Auseinandersetzungen erschlug Adam seine Eva.
Erst nachdem sie tot vor ihm am Boden lag, begriff er die Schwere seiner Tat.
Und auch die Gottheit begriff, dass die Idee vielleicht nicht so gut gewesen war und das Ende der Menschheit auf ihrem Planeten bedeuten mochte.
Adam aber kniete nieder und flehte einen der Gottheit unbekannten, anderen Gott um Vergebung an und darum, ihm seine Eva wiederzugeben.
»Erfüllen wir ihm doch seinen Wunsch«, schlug Svantavita vor. Wäre sie ein Mensch gewesen, so hätte sie ihre Worte mit einem kalten, grausamen Lächeln begleitet.
So erweckten sie Eva, ließen sie von den Toten auferstehen, doch war sie nur eine Marionette, die zwar äußerlich fast wie ehedem wirkte, doch ihr Inneres war erloschen.
Adam bereute sein Tun zutiefst, und sie ließen Eva ihm rasch verzeihen. Doch schon am nächsten Tag wurde offenbar, dass auch die Gottheit nicht allmächtig war. Evas Körper zeigte erste Anzeichen von Verwesung. Die Leichenflecken ließen sich nur mit allen Kräften zurückdrängen.
»Wir müssen rasch handeln«, drängte Svantavita. »Bevor sie uns verfault.«
Also konzentrierte sich Svantavita auf Eva, regenerierte ihren Körper, sodass er lebendiger und verführerischer wirkte denn ehedem, während Svantevit dafür sorgte, dass Adams Leidenschaft für sie entflammte wie niemals zuvor.
Sie liebten sich drei Tage und drei Nächte lang, und als die Sonne am vierten Tag aufging, hielt Adam ein lebloses stinkendes Bündel umfasst. Schreiend kroch er von seiner Geliebten fort, erkannte zu spät, dass er sich sogar in einer Toten ergossen hatte.
Er vergrub ihre Überreste, doch sein Geist war fortan zerrüttet. Er verließ Eden, irrte ziellos umher auf der vermeintlichen Suche nach seiner Eva.
Der Gottheit war es egal, sie bedurfte seiner Dienste nicht mehr. Umso intensiver kümmerte sie sich nun um Eva. Oder vielmehr um den Samen, den sie empfangen hatte und um die Früchte, die fortan in dem toten Leib heranwuchsen.
Nach neun Monaten gruben sich die zwei Neugeborenen aus der Erde. Sie waren hungrig und fielen übereinander her, hatten sie sich doch bisher von dem verfaulten Fleisch ihrer Mutter ernährt und waren menschliche Nahrung gewohnt.
Die Gottheit hieß sie innezuhalten, denn sie hatte noch viel mit ihnen vor.
Den Jungen nannten sie Kain, und das Mädchen Abel.
»Pflanzet euch fort und mehret euch!«, trug die Gottheit den beiden auf, und siehe: Sie taten es!
Bald gab es Dutzende und Aberdutzende ihresgleichen auf der Welt. Es hätten noch viel mehr sein können. Doch ihr Hunger nach Menschenfleisch war ein genetischer Defekt, den selbst die Gottheit nicht beseitigen konnte (abgesehen davon, dass manches abartige Schauspiel sie durchaus ergötzte).
So wuchs die Menschheit heran, doch es zeigte sich immer mehr, dass sie nicht dem Ideal entsprach, das die Gottheit auf der Erde entdeckt hatte. Im Grunde waren sie wie Tiere, ohne jegliche Zielstrebigkeit, ohne Visionen, ohne Führung, allein dazu erschaffen, sich zu vermehren, um sich gegenseitig aufzufressen, wann immer sich eine Gelegenheit dazu ergab.
Dabei kristallisierte sich immer mehr heraus, dass sich die Kains und die Abels (wie die Gottheit sie nannte) sich zwar zur Fortpflanzung zusammentaten, ansonsten aber keinerlei Zuneigung empfanden. Sie schienen überhaupt keinerlei Gefühle zu haben.
Nicht selten passierte es, dass die Mutter über ihr eigenes Neugeborene herfiel, wenn es denn ein Kain war, während die ausgewachsenen Kains Abelfleisch bevorzugten.
Die Menschenfresserei nahm dermaßen zu, dass die Population stagnierte.
»Wir müssen etwas tun!«, erkannte Svantavita, die sich zwar nach wie vor an den blutigen Schauspielen erfreute, aber Sorge trug, dass ihr eigenes Volk sich auslöschte.
»Trennen wir sie doch voneinander«, schlug Svantevit vor, »und lassen sie nur zur Vermehrung miteinander verkehren.«
»Aber wie wollen wir das anstellen?«
»Wir teilen sie auf. Und wir teilen uns auf.«
Dies war eine solch ungeheure Vorstellung, dass es Svantavita die Gedanken verschlug und selbst Svantevit ob seiner eigenen Worte entsetzt war.
Beide konnten sie nicht wissen, dass auch dies vor langer Zeit derjenige, der sie erschaffen hatte, so programmiert hatte.
Der Vollzug der Teilung war ein schmerzhafter Prozess, fühlten sie sich doch als Einheit. Doch es gelang, es musste gelingen.
Svantavita bezog den Norden, Sweden, Westen und Raden, Svantevit den Süden, Chrachen, Osten und Leden. Zweimal im Jahr ließen sie die geschlechtsreifen Menschen zusammenkommen, um sich zu vereinen, und bald schon trug ihre Teilung Früchte. Die beiden Völker der Adams und Kains wuchsen und wuchsen, auch wenn es während der Vereinigungsfeiern immer wieder zu Exzessen von Menschenfresserei kam.
Nach und nach entsagten aber beide Völker weitgehend dem Kannibalismus und gewöhnten sich an andere Nahrungsquellen, so den von der Gottheit inzwischen erschaffenen Tieren.
Nach jeweils neun Monaten übergaben die Abels die männlichen Neugeborenen den Kains, die diese weiter heran- und großzogen.
So hätte es jahrtausendelang weitergehen können, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes passiert wäre.
Es ist nicht bekannt, ob ein genetischer Effekt vorlag oder die Programmierung von Anfang an dieses Ereignis angestrebt hatte.
Die Menschen auf der Erde hatten es Liebe genannt.
☆☆☆
Na endlich, dachte Lya, als sich Finns Arm wie zufällig um ihre Hüfte legte. Die ganze Zeit schon hatte sie gespürt, dass er sie angestarrt hatte. Vermutlich war er zu schüchtern gewesen, sich ihr schon früher zu nähern. Aber wahrscheinlich hatte der Alkohol seine Schüchternheit abgebaut.
Sie spürte Lennards eifersüchtigen, ja, fast hasserfüllten Blick über die Flammen des Lagerfeuers hinweg auf der sonnengebräunten Haut brennen und war froh, seinen Nachstellungen zumindest für den heutigen Abend zu entkommen.
Hoffentlich!
»Guckt euch mal das Wasser an!«, rief plötzlich Marja und wies auf das aufbrodelnde Boddengewässer.
Unter der vormals glatten schwarzen Oberfläche war ein flirrendes Leuchten zu sehen …
»Vielleicht ein russisches U-Boot, das sich hierher verirrt hat«, sagte Lennard.
»Erstens ist der kalte Krieg schon länger vorbei, als wir geboren worden sind, und zweitens …«, begann Marja.
»Und zweitens hast du keine Ahnung!«, brauste Lennard auf. »Der kalte Krieg ist wieder voll im Gang, ey. Guckt euch mal im Internet um. Da stehen ständig neue Beweise, dass …«
»Oh, Lennard, halt endlich den Rand!« Als seine ältere Cousine konnte sie sich den Ton herausnehmen, von anderen hätte sich Lennard eine derartige Zurechtweisung nicht bieten lassen. Auch wenn er allen aus der Clique mit seinen ewigen Verschwörungstheorien auf die Nerven ging.
Lya drückte sich enger an Finn. Obwohl es eine laue Sommernacht war, fröstelte sie nun.