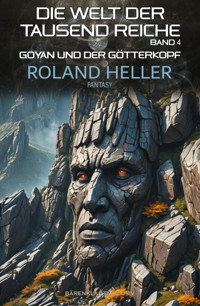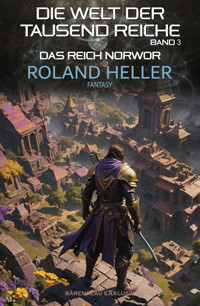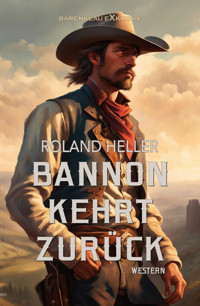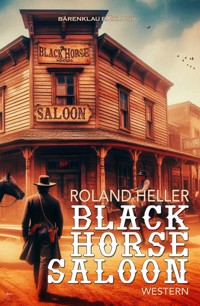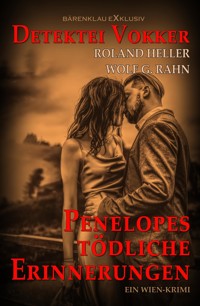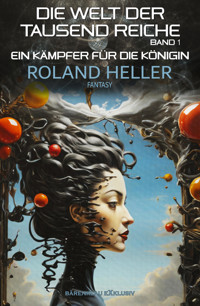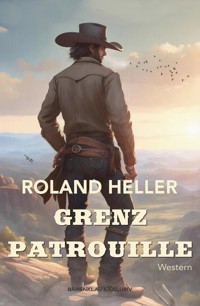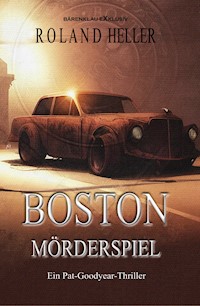3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wien 1956: Der Tod einer Zirkusartistin während der Vorstellung stellt Polizeimajor Wilhelm Chmel nur anfangs vor ein Rätsel. Die Frage ›Unfall oder Mord‹ kann er schnell klären. Bald beginnt er die Hintergründe zu erahnen – doch wie kann er den Mord beweisen?
Um diesen Beweis zu finden, muss er sich in die Denkweise der Zirkusleute einfühlen. Die Artisten stammen aus allen Gebieten der ehemaligen Monarchie – und dazu gesellt sich Fahrendes Volk – die Hilfskräfte, die unabdingbar notwendig sind, damit ein Zirkus funktioniert. Wo in diesem Wirrwarr findet sich der schlüssige Beweis?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Roland Heller
Tod in der Manege
Ein Wien-Krimi
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Roman nach Motiven von Walter K.
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Sandra Vierbein
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Namen, Personen und Taten, Firmen und Unternehmen, sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären also rein zufällig.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Tod in der Manege
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Das Buch
Wien 1956: Der Tod einer Zirkusartistin während der Vorstellung stellt Polizeimajor Wilhelm Chmel nur anfangs vor ein Rätsel. Die Frage ›Unfall oder Mord‹ kann er schnell klären. Bald beginnt er die Hintergründe zu erahnen – doch wie kann er den Mord beweisen?
Um diesen Beweis zu finden, muss er sich in die Denkweise der Zirkusleute einfühlen. Die Artisten stammen aus allen Gebieten der ehemaligen Monarchie – und dazu gesellt sich Fahrendes Volk – die Hilfskräfte, die unabdingbar notwendig sind, damit ein Zirkus funktioniert. Wo in diesem Wirrwarr findet sich der schlüssige Beweis?
***
Tod in der Manege
Ein Wien-Krimi
von Roland Heller
1. Kapitel
Die Bevölkerung lechzte regelrecht nach Unterhaltung.
Ich schloss mich davon gar nicht aus. Ich war ja ein Kind dieser Zeit, alt – oder eigentlich jung genug, um der Faszination eines Zirkus zu erliegen. Mit meinen vierundzwanzig Jahren hatte ich es geschafft, meine Polizeiausbildung zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzen abzuschließen. Ich wurde als Gehilfe, sozusagen als Aspirant, Polizeimajor Chmel zugeteilt. Von ihm sollte ich lernen. Ich hätte mir keinen besseren Chef wünschen können, denn Major Chmel genoss den besten Ruf. Und gleich mein erster Fall führte mich in das Zirkusmilieu. Ich konnte mein Glück kaum fassen.
Aber ich will schön der Reihe nach den vollständigen Fall darlegen Und damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, muss ich mich natürlich auch vorstellen. Ich heiße Ludwig Keller und komme direkt von der Polizeischule. Ich muss mir meine ersten Sporen erst verdienen. Da ist es natürlich klar, dass ich zuerst als Gehilfe einem erfahrenen Kollegen – einem zukünftigen – zugeteilt werde. An den Krieg hatte ich als Jugendlicher, eigentlich als Kind, nur eine undeutliche Erinnerung, mehr eingeprägt haben sich jedoch die Jahre des Hungers danach. Die Entbehrungen hatten einen ganz bestimmten Menschentypus geprägt. Wir strebten nach Sicherheit.
Polizeimajor Chmel kannte ich natürlich wie jeder Aspirant vom Hörensagen – und ich beglückwünschte mich dazu, ihm zugeteilt worden zu sein. Er besaß einen ausgezeichneten Ruf. Dass sein Ruf nicht von ungefähr kam, sollte ich bald bemerken. Chmel besaß einen messerscharfen Verstand und eine Kombinationsgabe, die ihresgleichen suchte. Selten davor hatte ich ein Gehirn mit so ausgeprägten Analysefähigkeiten kennengelernt – auch nicht in der Polizeischule.
Ein Vorbild, dem nachzueifern, sich lohnte.
Das Jahr 1956 war erst wenige Monate alt. Man genoss die ersten Frühlingstage und suchte nach jedem bisschen Glück, das man irgendwie ergattern konnte. Die Zeiten waren nicht mehr so schlecht wie vor einigen Jahren, es ging aufwärts. Besonders hier im ehemaligen Ostsektor, der unter russischer Verwaltung gestanden hatte. Die Hauptstadt Wien unterstand ja allen vier Besatzungsmächten, so waren die Auswirkungen hier nicht ganz so gravierend.
Seit die Besatzungstruppen abgezogen waren und Österreich sich zur immerwährenden Neutralität verpflichtet hatte, schien so etwas wie eine Aufbruchsstimmung durch das gesamte Land gegangen zu sein. Die ersten zaghaften Pflänzchen eines Wohlstandes zeigten sich. Als Bürger konnte man wieder ein wenig Erspartes für einen Luxus ausgeben, den man sich ohne schlechtes Gewissen leisten konnte.
Eine Eintrittskarte in den Zirkus zum Beispiel.
In Wien gedachte man zudem gerne der grandiosen Zirkustradition vergangener Zeiten, schwelgte in Erinnerung an die großen Namen berühmter Artistenfamilien und auch der Zirkusgewaltigen, die es zu Ruhm und Ansehen geschafft hatten.
Der Zirkus Weber gehörte dazu. Bis zurück in die Zeit der K. u. K. Monarchie reichte die Geschichte dieses Unternehmens – und wie damals kamen auch heute die Artisten aus allen ehemaligen Staaten der Donaumonarchie. Heute war es sozusagen ein internationales Künstlerensemble, welches das Publikum in Atem hielt.
Das Publikum kam in Scharen in den Zirkus gestürmt. Nicht nur die Kinder, für die er ein unvergessliches Erlebnis darstellte. Und nicht wenige dieser Knirpse fassten während den Vorstellungen den Wunsch, dazuzugehören zu dieser fantastischen Welt der Künstler.
Der Zirkus Weber konnte darüber hinaus mit einer Reihe von Berühmtheiten aufwarten, deren Ruf bereits dem ersten Auftritt des Zirkusensembles vorausgeeilt waren. Tagelang vor der ersten Vorstellung berichteten die Zeitungen und machten ihren Lesern den Mund wässrig, welche Wunder und Attraktionen der Zirkus bereithielt.
Die Artisten waren Könner ihres Faches.
Allen voran wurde Lara La Grande genannt. Was sie an Kunststücken zeigte, am Hochseil, am Trapez, überstieg das Vorstellungsvermögen der meisten Menschen, die nie geglaubt hatten, dass so etwas überhaupt möglich war.
Ihr Ehemann Raik Orlow stand ihr hier nicht viel nach.
Als der Zirkus in Wien einfuhr – der Weg vom Bahnhof zum Pratergarten gestaltete sich zu einer Prozession – und auf seinen Standplatz in der Nähe der Praterwiese zurollte, standen die beiden in einem offenen Wagen an der Spitze der Kolonne und winkten den zahlreich erschienen Zusehern zu, die den Einzug mit Jubel und Klatschen der Hände begleiteten. Sie spendeten sozusagen vorab bereits Applaus.
Die Kinder vor allem säumten in den nächsten Stunden das Gelände und mussten manchmal mit Mühe ferngehalten werden, denn es konnte für sie gefährlich werden, wenn sie zwischen den Beinen der Arbeiter herumliefen. Ein Trupp Fahrender war es, der sich als Hilfskraft im Zirkus verdingte. Angehörige der Sinti vor allem, auch zahlreiche Jenische reisten mit. Unter ihnen die Familie Jandrasits, deren Oberhaupt Luca als Magier als der heimliche Chef aller Fahrenden galt. Er war gleichzeitig Akteur. Er leitete die große Zauberschau, er war der Magier, der das Publikum bei jeder Vorstellung verblüffte und mit staunenden Gedanken zurückließ.
Für einen Außenstehenden hatte es den Eindruck, als herrschte auf dem Gelände ein einziges Chaos. Scheinbar planlos liefen die Männer in der Gegend herum. Aber sie schleppten jedes Mal eine schwere Last – und irgendwann stand dann – plötzlich wie es schien – das Gerippe des großen Zirkuszeltes. Als nächster Schritt bekam das Zelt dann jenes Aussehen, das vor allem die Kinder zu sehen erwarteten. Die bunten Planen mit den aufgemalten Pferden, die in eleganter Haltung einen majestätischen Eindruck hinterließen, die in der Luft wirbelnden Körper, die scheinbar keinen festen Boden brauchten, um ihre Kunststücke vorzuführen, all das weckte die Vorfreude.
Mit großen Augen hingen die Kinder an dem Zaun, der bald rund um den Zirkus jenen Raum abgrenzte, den sie ohne Eintrittskarte nicht mehr betreten durften, zumindest nicht offiziell. In jeden Winkel spähten sie. Vielleicht erhaschten sie sogar einen Blick auf die wilden Tiere, deren Besuch in der Tierschau sie herbeifieberten.
Diese Faszination schlug auch auf die Erwachsenen über.
*
Es war an einem Freitag, am 13. des Monats. Gegen die Fensterscheiben des Büros von Polizeimajor Chmel am Schottenring prasselte der Aprilregen. Frühzeitige Dunkelheit füllte das getäfelte Zimmer am Nordende der zweiten Etage der Polizeidirektion. Eine Lampe mit grünem Schirm warf einen Lichtkreis auf den Arbeitstisch, an dem Polizeimajor Wilhelm Chmel mit der Durchsicht seines Vortrags für den Bürgermeister beschäftigt war.
Es war gegen halb vier, als an die Tür geklopft wurde und der Beamte vom Dienst, Inspektor Norbert Deutsch, mir eine Karte überreichte, auf der in erhabener Goldschrift stand: Oberst Rudolf Raab, Besitzer und Direktor der vereinigten Zirkusunternehmen Raab, Vidal und Wolf – Zirkus Weber.
Als ich Wilhelm Chmel die Karte hinschob, funkelten seine dunklen Augen vergnügt.
»Rudolf Raab«, rief er. »Im Prater ist ja heute Abend Eröffnungsvorstellung! Lassen Sie ihn doch eintreten!«
Der Major schob den Bericht beiseite. Mir war bekannt, dass sein besonderes Interesse neben dem Unterstützungsverein für Polizeibeamte der Artistenvereinigung galt. Wenn er es eben möglich machen konnte, nahm er an dem großen Frühstück des Wiener Zweigvereins teil, das jeden Monat im Hotel Sacher stattfand. Der Major lächelte dem berühmten Zirkusbesitzer, der jetzt durch die Tür des Vorzimmers auf ihn zukam, freundlich entgegen.
Oberst Rudolf Raab war ein stattlicher, sonnenverbrannter Mann mit silberweißem Haar, dem keines der sogenannten unvorhergesehenen Ereignisse wie Überschwemmung, Feuer, Panik und Tod wertvoller Tiere fremd war. Er war der Typ des Zirkusbesitzers, dem jede Arbeit in seinem Unternehmen vertraut war, von der Dressur der Tiere bis zur Reparatur der Lichtanlage. Während seiner aktiven Zeit als Offizier waren seine vielfältigen Fähigkeiten stets geschätzt worden. Seine Liebe gehörte jedoch nicht der Armee, sondern dem Zirkus. Bald nach Kriegsende hatte er seine Karriere im Heer beendet. Was er aus dieser Zeit behielt, war sein militärischer Rang, den er seinem Namen bei jeder Vorstellung noch immer voransetzte. Warum, wusste eigentlich niemand.
Die beiden Herren schienen sich zu kennen. Chmel bestätigte mir dies auch später. Man konnte sie nicht als Freunde bezeichnen, dazu kannten sie sich nicht gut genug. Sie hatten sich im Verlauf der letzten Jahre einige Male privat getroffen, unter anderem auch bei dem Frühstücktreffen der Artistenvereinigung.
Lachend reichte er dem Major die Hand, setzte sich auf den Tisch, biss von seinem Kautabak ein Stück ab und sagte: »Ja, Herr Major, ich werde allein nicht mehr fertig. Sie müssen mir helfen.«
Chmel stopfte seine Pfeife mit seiner besonderen Mischung, einem penetrant riechenden Kraut, das aber seltsamerweise eine angenehme Duftnote hinterließ, nachdem es einmal durch die Hitze der Glut umgewandelt worden war.
Wir alle warteten in Ruhe, bis der Polizeimajor endlich seinen ersten Zug aus der Pfeife genießen konnte. Da dieses Ritual allgemein bekannt war, brachte jedermann die Geduld auf, darauf zu warten, bis zu endlich seinen Mund öffnete und sprach: »Gern, wenn ich kann.«
»Darf ich Ihnen kurz berichten, worum es sich handelt?«
»Gewiss. Ich bitte sogar darum.«
Zirkusdirektor Oberst Raab erzählte, dass er für den Prater engagiert worden war, weil in diesem Jahr die Gebrüder Ringer, die üblicherweise um diese Zeit in Wien Station machten, eine Tournee durch Nord-Europa machten und daher unabkömmlich waren. Für ihn, den letzten großen unabhängigen Zirkusbesitzer, bedeutete das eine sich nie wieder bietende Gelegenheit. Er erzählte vom Ankauf und der Dressur neuer Tiere, der Anschaffung neuer Wagen, Uniformen, Kostüme und von seinen Künstlern.
»Und dann, Major Chmel«, fuhr er fort, »passierten allerlei seltsame Dinge.«
»Wieso?«
»Ja, in meinem Zirkus ist nicht alles, wie es sein sollte, und ich glaube, dass die Vorgänge, die ich zuerst für eine Reihe von Unglücksfällen hielt, die Polizei wohl interessieren könnten. Als wir Italien verließen, fing es an. Bei drei Unglücksfällen verloren drei meiner Leute das Leben. Kaum hatten wir unser Winterquartier in Kärnten verlassen, als in der Nähe von Graz bei einem Eisenbahnunfall zwei unserer Prunkwagen und ein anderer Wagen mit allerlei Gerät in die Brüche gingen. Dann wurden, bis auf drei Bullen, die Elefanten krank. Auf der Fahrt von Graz nach Wien krepierte unser bester Löwe. Und als wäre das noch nicht genug, brach sich unser dressierter Maulesel, eine wertvolle Attraktion, auf der Endstation in Wien beim Ausladen die Beine und musste erschossen werden. Was das für Verluste sind …«
Raabs Bericht machte auf Chmel keinen besonders tiefen Eindruck.
»Sie vermuten doch nicht, dass jemand hinter diesen Unglücksfällen steckt?«, fragte er.
Oberst Raab fuhr sich mit der Hand durch das silberweiße Haar und sah den Polizeimajor an.
»Ich habe Ihnen noch nicht alles erzählt«, fuhr er fort. »Hören Sie, was sich seitdem weiter ereignet hat. Meine Stars haben durch die Post Drohbriefe erhalten.«
»Drohbriefe?«
»In denen sie aufgefordert werden, während des Aufenthalts in Wien ihre Hauptkunststücke nicht auszuführen, wenn ihnen ihr Leben lieb ist.«
Wilhelm Chmels Gesicht, das einen Augenblick düster gewesen war, hellte sich auf. Er lehnte sich in seinen Sessel zurück.
»Hoffentlich teilen Sie den Zeitungen mit, dass Ihre Künstler trotzdem auftreten.«
»Lassen Sie das Scherzen, es handelt sich nicht um einen Reklametrick
»Wer von Ihren Leuten hat denn einen Drohbrief erhalten?«, unterbrach ihn Chmel.
Raab nannte mehrere Namen, die ich sofort notierte.
»Raik, der junge Trapezkünstler, und seine Frau, die La Grande.«
»Die bekannte Lara La Grande?«
»Ja. Sie ist eine ganz große Nummer. Noch nie hat eine Artistin eine höhere Gage bezogen als sie.«
»Wer sonst noch?«
»Simon, der ›König der Lüfte‹, und Murillo, der bekannte Seiltänzer.«
Der Zirkusdirektor erhob sich und fuhr einen Augenblick später fort: »Und dazu kommt noch etwas. Heute, am Freitag, dem Dreizehnten des Monats, will keiner dieser Leute auftreten. Am liebsten sagte ich die Vorstellung ab, aber mein Geldgeber, der Industrielle Vidal, will nichts davon wissen. Unsere Unkosten belaufen sich auf zirka 55 000 Schilling pro Tag und dazu die Verluste! Er droht, seinen Anteil für ein Butterbrot loszuschlagen. Es bleibt mir einfach nichts anderes übrig, als heute Abend trotz Freitag und Dreizehntem zu eröffnen. Es wäre auch schade, wenn ich es nicht täte«, fügte er dann hinzu, »die Vorstellung ist meine beste Einnahmequelle. Wir machen immer blendende Geschäfte. Wenn nur diese verdammten Unfälle nicht wären.«
Er schnäuzte sich in ein seidenes Taschentuch und sah nachdenklich vor sich hin.
»Gewiss, unsere Arbeit ist nicht ungefährlich. Aber drei Tote auf einmal! Ich kann mir nicht helfen, das geht nicht mit rechten Dingen zu und jetzt auch noch die Drohbriefe! Ich frage mich oft, warum ich den ganzen Kram nicht schon längst aufgegeben habe. Vor nicht gar zu langer Zeit wäre ich mit einem anständigen Gewinn aus der Sache herausgekommen. Außer Vidal hat kein Mensch Geld in dem Unternehmen. Ja, was habe ich davon? Sorgen, nichts als Sorgen!«
Chmel stand auf und lächelte höflich.
»Einer meiner Beamten soll sich mit der Sache näher befassen.«
»Ich hoffte, Sie selbst würden sich dazu entschließen.«
Noch ehe Chmel Raabs ernstgemeinte Bitte ablehnen konnte, wurde die Tür geöffnet, und Inspektor Deutsch blickte ins Zimmer.
»Verzeihung, Major«, entschuldigte er sich. »Im Prater hat sich ein Unfall ereignet. Oberst Raab wird am Telefon verlangt.«
Einen Augenblick lang herrschte drückendes Schweigen.
»Lassen Sie sofort hierher umstellen«, befahl Wilhelm Chmel, und der Zirkusdirektor griff nach dem Hörer. Bald darauf hörten wir seine laute, aufgeregte Stimme. Dann legte Oberst Raab auf. Sein Gesicht war finster.
»Mein Obermechaniker ist tödlich verunglückt. Ich muss sofort hin.«
Chmel klopfte die Asche aus seiner Pfeife, er runzelte die Stirn.
»Ich werde die Untersuchung selbst leiten«, bestimmte er plötzlich. »Um sieben Uhr treffen wir uns in ihrem Direktionswagen. Sorgen Sie dafür, dass ich die Leute, die Drohbriefe erhielten, sprechen kann.«
»Vielen Dank«, murmelte Oberst Raab. Er reichte dem Polizeimajor die Hand und verließ wie betäubt das Polizeipräsidium.
*
»So etwas ist schon öfters vorgekommen«, sagte Chmel, als wir allein waren.
»Dann legen Sie den Drohbriefen doch größeren Wert bei?«, fragte ich. Ich war nach wie vor der Ansicht, dass es sich um den Reklametrick eines findigen Geschäftsmannes handelte. Die vorgefallenen Ereignisse mochten tragisch sein, ich konnte jedoch beim besten Willen keinen Zusammenhang erkennen.
Wilhelm Chmel griff nach Hut und Handschuhen.
»Wir können die Drohbriefe gar nicht ernst genug nehmen«, antwortete er. »Meistens ist einer der Empfänger auch der Schreiber.«
»Der Mörder warnt seine Opfer vorher?«
»Gewiss, aus Eitelkeit! Schon mehr als ein gerissener Verbrecher ist ihr zum Opfer gefallen. Deshalb hoffe ich auch, noch heute Abend den Schreiber der Briefe zu entdecken.«
»Durch Vergleichen von Handschriften?«
»Nein. Ich bin der Überzeugung, dass sich Menschen mit Mordabsichten dem scharfen Beobachter immer selbst verraten. Deshalb will ich die Empfänger der Drohbriefe beobachten und versuchen, den Schuldigen zu finden und seine Schuld zu beweisen.«
»Noch vor der Eröffnung der Vorstellung? Das wird nicht so einfach sein«, prophezeite ich.
»Und stellt große Anforderungen an das Geschick eines Detektivs«, fügte Chmel hinzu, dessen Gesicht sich etwas aufhellte. »Haben Sie sich für heute Abend schon verabredet?«
»Nur mit Elisabeth, meiner künftigen Frau.«
»Heute haben Sie Gelegenheit, etwas dazu zu lernen. Bringen Sie Ihre künftige Gattin auf alle Fälle mit. Ich habe sie schon wochenlang nicht gesehen. Wir wollen versuchen, Vergnügen und Arbeit miteinander zu verbinden.«
Es war jetzt ein Viertel nach vier. In einer Viertelstunde musste der Major im Rathaus erscheinen, wo der Bürgermeister zwanzig Polizeibeamten in Anerkennung ihres Mutes bei der Erfüllung ihrer schweren Pflicht eine Auszeichnung überreichte.
»Bitten Sie doch Staatsanwalt Dobler, uns zu begleiten«, schlug der Polizeimajor vor, der aus dem Krug auf dem Tisch eine Gardenie nahm. Sorgfältig steckte er die weiße Blume ins Knopfloch.
»Inspektor Finn«, fuhr er dann fort, »soll unterdessen über die Unfälle, von denen Oberst Raab uns erzählte, Näheres festzustellen versuchen. Über den Unfall am Bahnhof und den Beinbruch des Maultiers, kann die Eisenbahndirektion wohl Auskunft geben. Über Martin Vidal, den durch diese Unfälle mit betroffenen Millionär, findet er sicher etwas in unserem Archiv. Vidal ist ja hier ansässig. Mit zwei bis drei zuverlässigen Beamten soll er dann die näheren Umstände, die zum Tode des Mechanikers führten, feststellen. Kann er außerdem über den einen oder anderen der Zirkuskünstler etwas erfahren, umso besser. Versäumen Sie nicht, ihre holde Zukünftige, Elisabeth, darauf vorzubereiten, dass sie eventuell allein nach Hause gehen muss. Vergessen Sie Ihren Revolver nicht.«
Die Tür schloss sich hinter dem Major.
2. Kapitel
Kurz vor sieben Uhr betraten Elisabeth und ich an jenem Aprilabend das Areal des Zirkus Weber, dessen Türen gerade geöffnet wurden. In dichten Reihen drängten sich Männer und Frauen und natürlich auch zahlreiche Kinder an den verschiedenen Kassen; durch die Nacht gellten die Rufe der Süßwaren und Wurstverkäufer.
Polizeimajor Wilhelm Chmel hatte genügend Polizisten in das Gelände gerufen und an die sechs Haupt und fünf Nebeneingänge postiert. Aber diese uniformierten Männer hatten nur für Ordnung in der erwartungsvollen Menge zu sorgen, während die wichtigere Arbeit von ausgesuchten Beamten in Zivil geleistet wurde, die mit dem Falkenauge des Gesetzes alle betrachteten, die durch die Drehkreuze gingen.
Im Strom der Zuschauer entdeckte ich bald den wohlbeleibten Staatsanwalt Michael Dobler. An jeder Hand hielt er einen kleinen Jungen. Er stand vor einem bunten Plakat. Dobler war groß und dick, er hatte krauses, leicht rötliches Haar und vorstehende Kiefer; er war ein Mensch voll Lebendigkeit und Unruhe. Als ich ihm auf die Schulter klopfte, drehte er sich unbeholfen um. Zirkusfreude leuchtete aus seinen Augen.
»Na, Sie beiden Verliebten!«, rief er und warf meiner Verlobten einen ehrlich bewundernden Blick zu. »Sie werden jeden Tag schöner, Elisabeth. Ich meine es ernst. Es ist nicht nur ein so leicht dahingesagtes Kompliment. Wäre ich jünger, ich würde Ludwig doch tatsächlich Konkurrenz machen.« Er deutete auf die beiden Jungen an seinem Händen. »Ich habe meine Neffen Albert und Jürgen mitgebracht.«
Wir begrüßten die beiden Buben, die das verkleinerte Ebenbild ihres Onkels waren.
»Hat Wilhelm Chmel hier denn was zu tun?«, fragte Dobler sofort. »Mein sechster Sinn sagt mir, heute Nachmittag hätte sich hier ein verdächtiger Unfall zugetragen, der Major veranlasst, nach dem Rechten zu sehen.«
Dobler schwieg, als sich jetzt Oberst Rudolf Raab zu uns gesellte. Hier in dem ihm vertrauten Milieu wirkte der Zirkusbesitzer viel imposanter als vorhin im Polizeipräsidium. Er trug einen tadellosen Abendanzug, kaute dabei aber Tabak. Er machte einen sehr sorgenvollen Eindruck. Ich stellte ihn vor und fragte dann mit ganz gleichgültig klingender Stimme, ob alles in Ordnung wäre.
»Wir eröffnen die Vorstellung unter allen Umständen um acht Uhr«, lautete die Antwort Raabs, »wenn auch die Schwierigkeiten immer größer werden. Auf meinem Weg nach hier erfuhr ich von einem Streit mit den Fahrenden Volk. Hoffentlich leidet unsere Vorstellung nicht darunter.«
»Fahrende? Roma und Sinti?«, wiederholte Elisabeth erstaunt.
»Die Frauen mit den bunten Kleidern und dem ständig klimpernden Schmuck?«, ergänzte ich die Feststellung meiner künftigen Frau und deutete auf eine Ansammlung von Frauen, die sich neben einem Eingang um die Besucher kümmerten.
Raab warf nur einen kurzen Blick zu ihnen und nickte dann.
»Es sind eher die Männer und ihre wahnhaften Vorstellungen, die in das Reich der Zauberer und Hexen gehören«, sagte Oberst Raab dann.
Der Zirkusdirektor lächelte liebenswürdig. »Die Männer beherrschen einige Kunststücke. Sie treten jetzt in der zweiten Saison bei mir auf. Sie haben bereits ein verständliches Deutsch gelernt, können sich mit den meisten Artisten aus dem Osten unterhalten und machen sich jetzt mausig. Aber heute Abend gingen sie wirklich zu weit. Als Lara La Grande – von der haben Sie doch sicher schon gehört – vorhin in ihre Garderobe kam, fand sie dort zwei Jenische vor. Sie wollten ihr nicht sagen, wie sie dort hinkamen und was sie dort wollten.«
»Stehlen?«, meinte Dobler.
»Vielleicht. Jedenfalls verlor La Grande wieder einmal die Geduld und warf die beiden Frauen lautstark aus ihrem Wagen.« Oberst Raab runzelte die Stirn. »Die gesamte Sippschaft der Fahrenden ist manchmal wütend auf die La Grande, so wie jetzt. Sie beratschlagen augenblicklich in ihrem Wohnwagen. Wie das noch enden soll, mag der Teufel wissen.« Der Oberst zögerte einen Augenblick und sagte dann: »Mit diesem Fahrenden Volk ist nicht gut Kirschen essen. Ich habe oft geradezu Angst vor ihnen. Sie treiben es mit ihrem Hokuspokus manchmal wirklich zu weit. Sie wissen über Pflanzengifte mehr als alle unsere Universitätsprofessoren. Und damit drohen sie manchmal. Das macht meinen Leuten natürlich Angst. In ihrer Heimat gelten sie angeblich als große Zauberer. Auf weite Entfernungen hin sollen sie angeblich einen Feind durch Zauberei töten können.«
Während Oberst Raab dies erzählte, trat Wilhelm Chmel plötzlich zu uns. Es war Punkt sieben, als der Major, mit der unvermeidlichen Gardenie im Knopfloch, aus der Menge auftauchte.
Die Männer begrüßten sich eher nachlässig, lediglich Elisabeth schien die volle Aufmerksamkeit aller zu genießen.
Dann zog Wilhelm Chmel den Oberst beiseite und sagte leise zu ihm: »Über den Tod Ihres Obermechanikers habe ich eben einen Teilbericht erhalten. Punkt drei Uhr heute Nachmittag stand er auf der festen Plattform, die einer ihrer Akrobaten, Raik, bei seinem Trapezakt benutzt. Für seinen Sturz gibt es nach Lage der Dinge nur eine Erklärung: Schwindelanfall. Aber die Autopsie ist noch nicht beendet.«
»Er hat nie vorher Schwindelanfälle gehabt«, versicherte der Oberst bestimmt.
»Dann müsste also jemand seinen Tod verursacht haben?«, fragte Chmel. »Zu dieser Zeit probten außer der Kapelle eine ganze Reihe Ihrer Künstler. Wir haben festgestellt, dass sich niemand ihm näherte, soweit das bei der nur teilweise eingeschalteten Beleuchtung mit Sicherheit behauptet werden kann.«
»Wieder einer dieser seltsamen Unfälle«, meinte Oberst Raab. »Dieser Zirkus ist verhext. Meinen Leuten geht das auf die Nerven. Der Seiltänzer Murillo, der auch einen Drohbrief erhielt, hat einfach seinen Kontrakt gebrochen und ist seit einer Stunde spurlos verschwunden. Vielleicht folgen ihm andere noch vor Beginn der Vorstellung.«
»Sagten Sie nicht, der Akrobat Raik habe auch einen Drohbrief erhalten?«
»Ja, Raik auch.«
»Von Raiks Plattform stürzte der Mechaniker ab?«
»Ja.«
»War Raik zu der fraglichen Zeit im Zelt?«
»Nein, er ist eben erst vom Flugplatz gekommen, er war im Ausland.«
»Und Murillo ist verschwunden?«
»Ja, aber ich weiß, wo er ist. Andererseits …«
Wilhelm Chmel unterbrach den Oberst und bat ihn, uns durch den ganzen Zirkus zu führen. Wir folgten ihm durch verschiedene Türen, über eine Flucht von ausgelegten Bretterwegen und befanden uns bald in dem zweiten Zelt hinter der Arena des Zirkuszeltes, in dem die Tierkäfige und das bunte Allerlei der Zirkusrequisiten untergebracht waren.
Elisabeth wandte sich mit einem Lächeln voll weiblicher Klugheit an mich.
»Wenn Herr Dobler damit einverstanden ist, kümmere ich mich um seine Neffen und zeige ihnen hier alles Sehenswerte. Wir treffen uns dann nachher in unserer Loge.«
Sie nahm die Jungen bei der Hand und ging, während Chmel seinen Freund Dobler über das informierte, was uns hierhergeführt hatte.
»Weiter nichts als ein zufälliges Zusammentreffen«, sagte Dobler nach Chmels Bericht.
Chmel zündete sich eine Zigarette an.
»Das alles lässt sich nicht mit einer Handbewegung abtun«, entgegnete er. »Vier Mann sind tot. Der Oberst hat schon Grund zu der Annahme, dass jemand ihn ruinieren will. Natürlich kann es sich um eine Reihe von Unfällen handeln, andererseits aber können wir es auch mit einem sehr gefährlichen Feind zu tun haben, einem Irren zum Beispiel, der von dem Drang nach Rache besessen ist, dabei aber vor jedem seine Geisteskrankheit verbirgt. Doch wir wollen nicht stehenbleiben.«
»Bitte hier an den Käfigen der Raubtiere vorbei«, sagte Oberst Raab höflich und lüftete dabei den Zylinder. Der weißhaarige Direktor war stolz auf seine wilden Tiere. Trotz aller bisherigen Aufregung machte es ihm Freude, uns sein gutes Tiermaterial, wie er sich ausdrückte, vor allem die Leoparden, zu zeigen. »Eines Tages«, meinte er begeistert, »habe ich den größten Zirkus der Welt, dessen Darbietungen niemand wird übertreffen können. Das ist mein großer Ehrgeiz. Und bleibt mir mein Finanzier treu, wird mir das auch bald gelingen.«
Oberst Raab wurde ganz lyrisch, wenn er von seinem Zirkus sprach. Er erzählte, wie die Großkatzen gefangen werden, sprach von Fallen und Gruben und berichtete dann lang und breit von einer neuen Methode, nach der man die Tiere durch Gaspatronen betäubt, wobei eine Verletzung ganz ausgeschlossen ist. Als wäre nichts passiert, sprach er über die Dressur der Raubtiere, über die Ernährung der Seeelefanten, erzählte, dass der Löwe beim Brüllen den buschigen Kopf zur Erde neigt, damit seine Beute nicht merkt, aus welcher Richtung das Gebrüll kommt, und dass die Eisbären zum Schutz gegen Ausgleiten Haare an den Fußsohlen haben. In seiner Begeisterung schien er ganz zu vergessen, weshalb wir hier waren. Aber Chmel drängte weiter. Mit nur scheinbarem Interesse hatte er dem Gerede Raabs zugehört, während seine Augen ganz woanders waren. Sie beobachteten unaufhörlich die an uns vorbeikommenden Wärter und Stallburschen, als wollte er ihre Gesichter nie wieder vergessen.
»Warum gehen wir nicht gleich nach hinten?«, fragte mich Dobler, der jetzt neben mir ging.
»Soviel ich weiß, will der Polizeimajor hier erst alles besichtigen.«
»Aber wozu?«
Ich schüttelte den Kopf; ich wusste es nicht. Wir standen jetzt vor den Wagen der Fahrenden. Die Roma, Sinti und Jenischen besaßen jeweils einen eigenen Wagen. Es waren insgesamt fünf Frauen und vier Männer. Noch nie hatte ich mit Menschen dieses Volkes in dieser Nähe zu tun gehabt. Man erzählte sich, dass die Angehörigen von Indien bis Osteuropa heimisch waren, sich aber auch immer weiter in den Westen des Kontinents ausbreiteten. Mit ihren bunten Trachten und ihrer ungezwungenen Lebensweise unterschieden sie sich doch wesentlich von den irgendwie ernsteren Europäern. Vielleicht lag ein Grund auch darin, dass sie es scheinbar nie lange an einem Ort aushielten und ständig in Bewegung sein mussten.