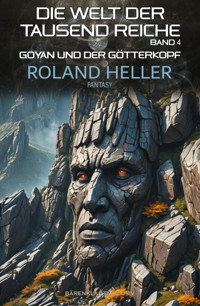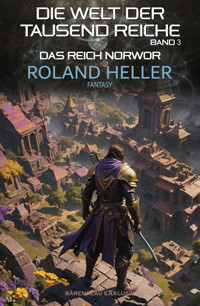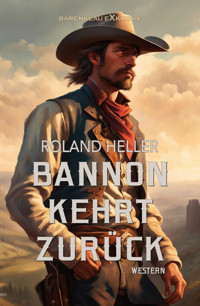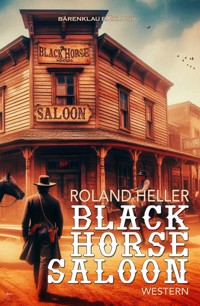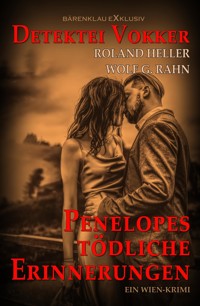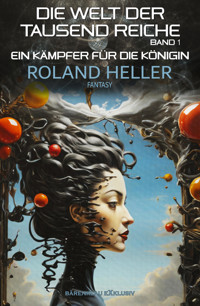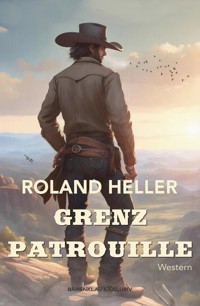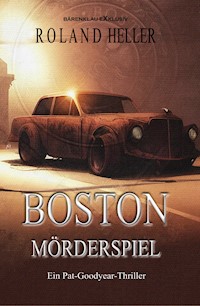3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Vorarlberg, Sommer 2080.
Das Rheintal ist zu einer gewaltigen STADT zusammengewachsen. Weit über eine Million Menschen bevölkern diesen politischen Bezirk. Das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen erinnert eher an einen Hexenkessel als an ein friedliches Miteinander. Die Gewalt in der STADT nimmt immer mehr überhand. Aber es sind nicht die Verbrecher im klassischen Sinn, die Sorgen bereiten, sondern die politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen, die glauben, sie müssen unbedingt den Kampf aufnehmen, um die alten Verhältnisse wieder herstellen zu können.
Mitten in all die Kämpfe platzt ein Erpresser, der droht, das Grundwasser der STADT zu vergiften, wenn seinen Forderungen nicht nachgekommen wird.
Die Veränderungen der Umwelt haben dafür gesorgt, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Die steigenden Temperaturen und vor allen der gestiegene Wasserspiegel haben dazu geführt, dass ehemals fruchtbare Landstriche verödeten. Irgendwo müssen die Menschenmassen leben. So ist es zu der gewaltigsten Völkerwanderung, welche die Welt je erlebte, gekommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Roland Heller
In der Gluthitze der STADT
Science-Fiction
Impressum
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Claudia Müller
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Alle Namen, Personen und Taten, Firmen und Unternehmen, sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären also rein zufällig.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
In der Gluthitze der STADT
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Das Buch
Vorarlberg, Sommer 2080.
Das Rheintal ist zu einer gewaltigen STADT zusammengewachsen. Weit über eine Million Menschen bevölkern diesen politischen Bezirk. Das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen erinnert eher an einen Hexenkessel als an ein friedliches Miteinander. Die Gewalt in der STADT nimmt immer mehr überhand. Aber es sind nicht die Verbrecher im klassischen Sinn, die Sorgen bereiten, sondern die politischen und gesellschaftlichen Gruppierungen, die glauben, sie müssen unbedingt den Kampf aufnehmen, um die alten Verhältnisse wieder herstellen zu können.
Mitten in all die Kämpfe platzt ein Erpresser, der droht, das Grundwasser der STADT zu vergiften, wenn seinen Forderungen nicht nachgekommen wird.
Die Veränderungen der Umwelt haben dafür gesorgt, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Die steigenden Temperaturen und vor allen der gestiegene Wasserspiegel haben dazu geführt, dass ehemals fruchtbare Landstriche verödeten. Irgendwo müssen die Menschenmassen leben. So ist es zu der gewaltigsten Völkerwanderung, welche die Welt je erlebte, gekommen.
***
In der Gluthitze der STADT
Ein Science-Fiction-Roman
von Roland Heller
1. Kapitel
Seine erste Tätigkeit in der Früh, noch bevor er sich zum Frühstück setzte, war die Kontrolle der Wasserfallen.
Er hatte die Fallen rund um das Haus aufgestellt. Die Wasserfallen waren nichts anderes als gespannte Kunststoffnetze, die trichterförmig angeordnet waren und über einem Gefäß endeten, das die Tautropfen auffangen konnten. Die Nachtfeuchtigkeit verdichtete sich an den Kunststoffsträngen und rann, der Schwerkraft folgend, an den Netzen entlang zum tiefsten Punkt.
Hubert Rösch befand sich in der glücklichen Lage, über einen eigenen Garten zu verfügen. Das heißt, einen Garten, dem Namen nach, hatte das Grundstück einst besessen, als seine Eltern das Haus bewohnt hatten und die klimatischen Bedingungen noch so erträglich waren, dass man das Grundstück zur Erholung nutzen konnte. Heute konnte man das, was hier wuchs, nicht mehr mit diesem Namen bezeichnen, obwohl er sich redlich bemühte, so etwas wie Natur in seinen unmittelbaren Lebensbereich zu bringen. Es wuchs und gedieh nur mehr das, was man täglich pflegte und vor den Fingern der diebischen Nachbarn schützte. Und das war nicht allzu viel. Noch nicht. Er benützte viel Raum für seine Wasserspeicher. Auf den gut zweihundert Quadratmeter unverbautem Grund, der sein altes Einfamilienhaus umgab, hatte er Platz für fünf Wasserspeicher geschaffen. An guten Tagen sammelte er bis zu einem Liter, an schlechten Tagen immerhin einen halben Liter – pro Falle. Den Rest der Fläche versuchte er irgendwie als Garten zu nutzen.
Diese Menge Wasser blieb selbst seinen weiter entfernt wohnenden Nachbarn nicht verborgen. Mit den unmittelbaren Nachbaren hatte er ohnehin eine Übereinkunft geschlossen, so dass ein Diebstahl von dieser Seite aus nicht zu befürchten war. Anders stand es mit weiter entfernt Wohnenden oder gar Fremden.
Da musste er höllisch aufpassen.
Hubert Rösch musste seinen Rundgang zur rechten Zeit tätigen und die Behälter leeren, bevor Fremde auf sein Grundstück drangen und die Gefäße für ihre eigenen Bedürfnisse missbrauchten.
Der Boden, über den er schritt, bestand zur Hauptsache aus Schutt, aus alten Mauersteinen und anderen Hinterlassenschaften, die man einst in einem Garten als Dekoration zur Schau gestellt hatte. Doch nun verstellten die eisernen Tierfiguren, die zerborstenen Blumentröge und ähnlicher Unrat ihm nur den Platz. Es waren alles Andenken, die ihm seine Eltern hinterlassen hatten. Deshalb wollte er sie auch nicht einfach auf der nächsten Müllhalde entsorgen. Einst hatten sich geschwungene Wege durch den Garten geschlängelt. Wege, die sein Vater in liebevoller Arbeit angelegt hatte – zwischen den Blumenbeeten und den wie Inseln gesetzten Grasflächen, die zumindest einen Eindruck von dem vermittelten, wie ein Garten ausgeschaut haben könnte. Den neuen Garten musste er erst wieder anlegen. Seine Frau hatte sich früher darum gekümmert. Jetzt war fast ein Jahr lang nichts geschehen und die Gewächse waren verkümmert oder gar abgestorben.
Im Osten stahlen sich die ersten Lichtstrahlen über den Horizont, ließen den Blick auf den massiven Zaun zu, der das Grundstück umgab. In drei Schichten war der Zaun angelegt. Außen, zu der Straße hin, befand sich ein gewöhnlicher Maschendrahtzaun, den auf seinen obersten Reihen Stacheldrahtrollen verstärkten. Dahinter folgte erneut ein Stacheldrahtzaun, doppelt so dick und straff gespannt und mit einer elektrischen Alarmanlage versehen, sollte jemand so vermessen sein, mit einer Drahtzange dem Zaun zu Leibe zu rücken. Auf der Innenseite, jener Seite, welche die Familie ständig sah, hatte er einen dichtwachsenden Eiben Zaun gepflanzt.
Er kontrollierte das erste Sammelbecken und tat die gesammelte Flüssigkeit in eine Gießkanne. Es war nicht viel. Die Nacht war ungewöhnlich warm gewesen.
Schließlich sammelte er jedoch eine beachtliche Menge und brachte sie zu dem Hochbeet, das er dicht neben dem Haus, gleich neben der Terrassentür errichtet hatte, damit er im Fall des Falles gleich aus dem Haus stürmen und den Diebstahl verhindern konnte.
Im Beet zog er leicht zu pflegende Pflanzen, welche die Hitze vertrugen. Kartoffeln, Brokkoli, Zucchini, Karotten und verschiedene Kräuter. Für mehr fehlte ihm der Platz. Er hätte gerne mehr Pflanzen gezüchtet, doch es war mühsam, gesunden Humus zu organisieren. Er verarbeitete seine biologischen Abfälle zwar selbst, aber es dauerte Zeit, bis er ein zweites Beet so anlegen konnte, dass es auch unter den neuen Bedingungen Ertrag abwarf.
Es ging bereits auf halb fünf zu. Durch die Fensterscheibe konnte er seine Tochter sehen. Sie stand bereits in der Küche und richtete sich ihr Frühstück her. Seit seine Frau den Freitod gewählt hatte, musste sie selbst dafür sorgen, dass zumindest sie und ihr Bruder nicht mit leerem Magen das Haus verließen. Seltsamerweise machte sie sich absolut keine Gedanken darüber, ob ihr Vater ebenfalls ein Frühstück wollte.
Aber sie kannte ihn. Sie wusste, dass er seit Jahren außer mehreren Tassen Kaffee nichts zu sich nahm in der Früh.
Sie hieß Lana und war vierzehn Jahre alt.
Hubert Rösch verteilte die gewonnene Flüssigkeit gleichmäßig auf seine Pflanzen im Hochbeet. Wenn die Ausbeute an Flüssigkeit hoch genug war, bekam noch jede der Pflanzen, die in der kargen Erde außerhalb des Beetes wuchsen, etwas ab. Anschließend ging er gewohnheitsmäßig noch einmal um das Haus herum, prüfte mit seinen Augen den Zaun, ob er hier eine Unregelmäßigkeit entdecken konnte.
Danach ging er ebenfalls in die Küche.
»Morgen«, empfing ihn Lana.
Er erwiderte den Gruß und gab eine genau abgemessene Menge Wasser in die Kaffeemaschine. Erst danach fütterte er mit einem Messbecher den Kaffeeautomaten mit den Bohnen. Hubert Rösch war sich bewusst, dass es purer Luxus war, den er sich jeden Morgen hier gönnte.
»Hast du Chris geweckt?«, erkundigte er sich, während seine Aufmerksamkeit eigentlich dem Mahlgeräusch der Kaffeemaschine galt. Das Gerät war recht betagt, aber noch funktionierte es tadellos. Hubert wartete allerdings auf den Tag, an dem das Gerät seinen Geist aufgab. Es hatte die prognostizierte Lebensdauer schon längst überschritten.
»Er will nicht mehr in die Schule gehen, also sieht er keinen Sinn darin, aufzustehen«, sagte Lana unberührt.
»Verflixter Kerl!«, schimpfte Hubert. »Dem mache ich Beine!«
»Wozu denn!«, klang da die dünne Stimme von Chris zu ihm. Die Stimme klang genauso verschlafen, wie ihr Besitzer verschlafenen aussah. Chris war für sein Alter klein gewachsen. Hauptsächlich sah man von ihm seinen Strubbelkopf. »Kannst du mir erklären, weshalb ich etwas lernen sollte, das ich nie mehr gebrauchen kann? Die Welt geht den Bach runter, also wozu noch anstrengen …«
»Hör zu, Chris«, versuchte es Hubert mit Güte, »wir versuchen doch, in geregelten Bahnen unser Leben zu meistern, und dazu gehört nun mal die Schule. Die Schule bildet dich zu einer Persönlichkeit. Das Fachwissen bekommst du sozusagen nebenher mitgeliefert. Es schadet nie …«
»Hör auf, Papa! Das hast du mir schon hundert Mal erklärt. Das Problem liegt doch ganz woanders. Schau zum Fenster hinaus.«
»Es wird ein schöner Tag«, warf Lana ein. »Er wird heiß wie immer und wenn es zehn Uhr ist, müssen wir uns beeilen, dass wir von der Schule nach Hause kommen, bevor die Sonne unsere Haut verbrennt.« Triumphierend blickte Lana in die Runde. Bekamen die beiden mit, dass sie ihre Worte als Provokation gedacht hatte?
Ihr Vater blickte zumindest so, als hätte er den Einwand verstanden, die nächsten Worte von Chris bewiesen allerdings, dass er in der Früh auf solche Feinheiten noch nicht achtete.
»Fall mir nicht in den Rücken, Lana«, schimpfte Chris und blickte seine Schwester böse an.
»Bleib auf dem Teppich! Wir leben nun einmal in dieser Zeit und müssen das Beste daraus machen. Den Kopf in den Sand zu stecken und einfach aufzugeben, das geht nun wirklich nicht. Im Übrigen wissen wir alle, dass die Welt vor dem Abgrund steht, aber es liegt an uns, ob wir das zulassen wollen oder nicht.«
»In einem hat sie Recht, Papa. Wir leben hier und heute. Was ich meine, ist doch nur, wenn du aus dem Fenster blickst, siehst du nur einen Zaun.«
»Der Zaun schützt uns. Außerdem, Chris, wer hat dir diese Flausen in den Kopf gesetzt. Du bist erst zwölf …«
»Aber ich kann denken. Papa, du weißt es, dass wir Jungen immer schneller erwachsen werden. Seit die elektronischen Medien uns zu einem guten Teil erziehen …«
»Das Problem sind nicht die Medien …«
»Das Problem bist du und deine Generation und jene deines Vaters. Ihr seid sehenden Auges auf den Kollaps zumarschiert. Die Erde ist kaputt. Mama hat ganz Recht gehabt. Sie ist gegangen.«
»Sie hat uns verlassen, sie hat sich vor der Verantwortung gedrückt!«, hielt ihm Lana entgegen.
»Hört auf zu streiten, Kinder!«, fuhr Hubert dazwischen, denn er wusste, was sich entwickelte, wenn er nicht eingriff und ihr Streitgespräch beendete. Verdammt Lilly! Warum hast du mich allein gelassen?
Er war sich immer noch nicht sicher, was letztendlich der Grund für ihren Selbstmord gewesen war. Es musste aber tief in ihr rumort haben. Wenn man seine Kinder einfach zurückließ, konnte das kein plötzlich gefasster Entschluss gewesen sein.
Er tat sein Bestes. Er hatte sich beurlauben lassen, um zumindest in den ersten Monaten ganz für seine Kinder da zu sein, aber irgendwie spürte er, dass ihm der häusliche Frieden langsam entglitt.
Und wenn er ehrlich war, musste er zugeben, dass die Kritik seiner Kinder nicht ganz unberechtigt war, allerdings neigte Chris dazu, das Problem sehr einseitig zu betrachten. –Seine Jugend war schuld daran.
Während die beiden Kinder weiter heftig diskutierten, übernahm Hubert es, ihr Jausenbrot herzurichten. Chris saß im Nachtgewand am Tisch, während Lana bereits fertig für die Schule angezogen war.
»Die Schule ruft!«, erinnerte Hubert seinen Sohn rechtzeitig. »Ich schreibe dir keine Entschuldigung, wenn du darauf hoffst. Also mach dich fertig!«
»Ganz der treue, gesetzeshörige Bulle!«, schimpfte Chris, stand aber auf und warf seinem Vater einen möglichst unbeteiligt wirkenden Blick zu. Die Zeit des aktiven Widerstandes rückte näher, noch war es allerdings nicht so weit. Er war sich nicht ganz sicher, wie sein Vater reagieren würde, wenn er seinen Protest tatsächlich durchzog. Aber bis dahin war es wohl besser, wenn er sich fügsam zeigte.
Schließlich gab Chris auch an diesem Tag nach und drei Minuten, bevor die Zeit gekommen war, kam er aus seinem Zimmer, fertig gewaschen und gekleidet.
Es war 5:30 Uhr.
Hubert brachte seine Kinder bis an das Gartentor.
Da Lana und Chris in dieser Straße die einzigen Schulkinder waren, holte sie der Schulbus direkt vor ihrem Haus ab. Am Morgen wurden die Kinder mit einem alten Elektrobus eingesammelt und zur Ausbildungsstätte gebracht. Nach Schulende mussten sie allerdings selbst sehen, wie sie nach Hause kamen. Weil die Schule unverhältnismäßig weit entfernt lag, machte sich Hubert täglich die Mühe, die beiden von der Schule abzuholen, manchmal zu Fuß, manchmal mit dem Fahrrad, das einen Anhänger nach sich zog, der zumindest ihre Schulsachen aufnehmen konnte. Meistens übernahm auf dem Rückweg Chris ab der Hälfte des Weges das Rad und fuhr voraus, denn gerade er hielt es nicht aus, das Haus für längere Zeit unbewacht zu lassen. Das machte ihn unruhig. Zu viele Geschichten waren im Umlauf, die davon erzählten, wie die Plünderer vorgingen.
Der Bus kam pünktlich. Begleitet wurde er von zwei bewaffneten Militärfahrzeugen, die auf ihrer Ladefläche mit Schnellfeuergewehren ausgestattet waren. Die Soldaten, welche die Geschütze bedienten, trugen dicke, kugelsichere Westen. Ihr Job war schweißtreibend, denn die Jacken hielten sowohl die Körperhitze wie auch später dann, wenn die Sonne aufgegangen war, die wärmenden Strahlen, die den Stoff zusätzlich aufheizten. Aber sie schützen gegen Kugeln aus dem Hinterhalt.
Mit den steigenden Temperaturen stieg auch die Zahl der Verrückten, die glaubten, mit gewalttätigen Einzelaktionen etwas gegen den zunehmenden Zerfall der Zivilisation unternehmen zu können.
So seltsam es auch anmutete, Schulbusse waren beliebte Ziele für Überfälle, denn die Kinder eigneten sich hervorragend als Druckmittel, wenn sie erst einmal in die Hände der Revolutionäre gefallen waren. Wer sich in dieser Zeit Kinder leisten konnte – und ihnen eine Schulbildung ermöglichen konnte –, gehörte gesellschaftlich gesehen der reichen Oberklasse an. Also lohnte sich ein Überfall. Lösegeldforderungen stellten nach einem Überfall das geringste Problem dar, denn eine solche erfolgte kaum einmal. An Geld waren die Revolutionäre nicht interessiert. Davon besaßen sie anscheinend genug. Die Eltern der entführten Kinder fürchteten mehr die Gehirnwäsche, die an ihrem Nachwuchs vorgenommen wurde.
Chris stieg wortlos in den Bus. Lana lächelte ihren Vater zuversichtlich an. »Wird schon gutgehen«, meinte sie. »Willst du nicht wieder in deinen Job einsteigen? Wir kommen schon alleine zurecht. Ich sehe ja, wie du allein zuhause versauerst. Das ist nichts für dich. Denk darüber nach«, ließ sie ihm noch etwas zum Nachdenken da, ehe auch sie das Fahrzeug bestieg.
Einer der Soldaten auf der Ladefläche winkte ihm zu. Automatisch winkte Hubert Rösch zurück. Dann entfernte sich der Bus.
Es war 5:32 Uhr. Temperatur: 28 Grad Celsius.
Hubert sah dem Bus nach, bis er in die nächste Seitenstraße abbog. Auch dort wohnten Kinder, denen es vermutlich blieb, die Lösung für das Überleben ihrer Zivilisation zu finden.
Der Bus hatte zumindest ein Geräusch in die Straße gebracht. Jetzt senkte sich wieder Stille über die Straße. Hubert blickte die Straße hinauf und hinab. Wie ausgestorben lag sie da. Wenn er nicht gewusst hätte, wie viele Leute hier tatsächlich wohnten, er hätte glauben können, dass die STADT ausgestorben war. Aus Erfahrung wusste er, dass schlagartig um sechs Uhr sich die Straßen füllten. Um diese Zeit begann das geschäftliche Leben, öffneten kurz danach die Geschäfte und Büros. Früher war es nicht möglich, denn elektrischer Strom war rar und teuer, der für künstliches Licht sorgen konnte. So hatte man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Die Wintermonate verschlangen genügend Strom, der musste in den Sommermonaten eingespart werden bzw. in die Industrie umgelenkt werden, denn bei allem Fortschritt blieb die Energiespeicherung weit hinter den Erwartungen zurück.
Mit dem offiziellen Geschäftsöffnungszeiten begann allerdings auch die Zeit der Nichtstuer. Die Zeit, in der das Heer der Arbeitslosen durch die Straßen der STADT strich und auf irgendeine Gelegenheit wartete: egal ob eine Arbeitsmöglichkeit sich auftat oder ein leerstehendes Gebäude zum Einbruch lockte.
Das Militär war ständig präsent. Es verstärkte die Polizeistreifen, denn der Job des Polizisten zählte nicht mehr zu jenen sozial angesehenen Stellen, die Scharen von Männern und Frauen anzogen. Es gab viel zu wenig Polizisten, um die anstehenden Arbeiten zu erledigen. Das Heer half zwar aus, doch die Soldaten leisteten nur gezwungenermaßen ihren zweijährigen Dienst ab und die meisten von ihnen rissen sich dabei kein Bein aus. Niemand wusste zudem, wie die Soldaten privat dachten, mit welcher Seite sie sympathisierten und ob sie im Ernstfall tatsächlich zur Waffe greifen würden.
Aber immerhin genügte in den meisten Fällen bereits ihre Präsenz, damit die Lage nicht eskalierte.
Es sah überall auf der Welt so aus, nicht nur in der STADT, in der Hubert Rösch mit seiner Familie lebte.
Er kehrte in das Haus zurück.
Die Hausarbeit war in etwas mehr als einer Stunde erledigt.
Danach widmete er sich ausgiebig den neuesten Nachrichten, die er über den Bildschirm in seinem privaten Zimmer, das ihm als Arbeitszimmer diente, abrufen konnte.
Bevor er sich der weiteren Niederschrift seiner Lebenserinnerungen widmen konnte, riss ihn die Kommunikationsanlage aus seinen Gedanken.
Das Geräusch klang schrill und laut. Der laute und schrille Ton kennzeichnete den Anruf als wichtig.
Hubert war einen Blick auf den Bildschirm.
Peter Wolf.
Nur dieser Name prangte auf der Sichtscheibe. Wenn er mit solcher Intensität anrief, musste etwas Gravierendes los sein. Peter Wolf war der Chef der Polizei.
Er spürte die Erregung, die ihn ergriffen hatte, als er auf die Kommunikationswand zuschritt. Er hatte sich entschlossen, den Anruf anzunehmen.
»Hallo, Chef«, meldete er sich.
Der Bildschirm zeigte gestochen scharf das Gesicht eines etwa siebzigjährigen Mannes, der keine Sekunde stillhalten konnte. Ständig huschten seine Augen von einer Seite zur anderen, und auch der Kopf schien die Bewegung mitzumachen, nur in der entgegengesetzten Richtung. Wenn Hubert ihm länger zusah, machte ihn das nervös. Er hatte es sich angewöhnt, starr in die Mitte seiner Augen zu blicken. Dort traf sich ihr Blick zumindest immer wieder.
»Gut, dass du das Gespräch annimmst«, sagte Peter Wolf. »Das erspart es mir, dir eine Streife zu schicken.«
»Klingt so, als brennt es irgendwo«, sagte Hubert, noch um einen lässigen Tonfall bemüht.
»Es brennt nicht, es explodiert!«, donnerte Wolf und schaffte es tatsächlich, Hubert einmal für zehn Sekunden mit seinen Augen zu fixieren. »Du hast deine Kinder versorgt«, stellte Wolf sachlich fest, »dann hindert dich nichts mehr daran, augenblicklich in der Zentrale aufzukreuzen!«
»Moment `mal«, bremste Hubert, »so schnell geht es nicht. Ich habe noch nicht einmal das Haus gesichert und …«
»In fünf Minuten ist eine Beamtin bei dir, die übernimmt dein Haus. Und deine Kinder holt sie von der Schule ab und geht mit ihnen einkaufen und kocht für sie und sorgt für sie, solange du beschäftigt bist. Ich gebe dir ihre Personalnummer durch.«
»Ich habe noch nicht ja gesagt«, sagte Hubert verdutzt. In diesem Moment piepste sein Handkommunikator zum Zeichen, dass die Personalnummer der Kollegin in seinen Dateien gespeichert worden war. Er benötigte die Nummer als Ermächtigungscode für seinen Hauscomputer.
»Das ist auch nicht notwendig. Du hast das Gespräch angenommen und deine Kollegin ist unterwegs. Wenn sie läutet, steigst du in den Wagen, mit dem sie gekommen ist. Ich will dich in zehn Minuten in meinem Büro sehen! Die gesamte Crew ist versammelt.«
»Was ist geschehen?«
»Gedulde dich noch ein paar Minuten. Die STADT ist in Gefahr.«
»Revolutionäre?«, wollte Hubert fragen, aber da wurde der Bildschirm bereits dunkel.
In Gedanken fluchte Hubert Rösch. Das Nichtstun war ihm bereits auf den Wecker gegangen, aber dass er es so abrupt beenden musste, ging ihm doch gegen den Strich. Er seufzte ergeben und nahm seine Dienstmarke und die Waffe zu sich. Eine Uniform, sollte er eine benötigen, würde er in der Zentrale erhalten. Der Ersatz ließ ihm garantiert keine Zeit, sich in aller Ruhe umzuziehen. Wenn Peter Wolf persönlich anrief, war es dringend.
Und tatsächlich, da schrillte bereits die Glocke der Haustür.
Der Bildschirm neben der Haustür zeigte das Gesicht einer Frau in mittleren Jahren und in Uniform. Er war geneigt, der Ablösung zu vertrauen. Der Anruf des Chefs war doch so überraschend gekommen, dass kein Gegner in den wenigen Minuten, die seit dem Anruf vergangen war, eine Aktion gestartet haben können, die ihn überrumpelte.
»Identifikation!«, verlangte Hubert Rösch dennoch. Es gehörte zu den eisernen Vorsichtsmaßnahmen, keinem Unbekannten Zutritt auf das eigene Grundstück zu gewähren.
Die Beamtin tippte ihre Personalnummer in das Nummernfeld, das neben der Eingangstür angebracht war. Huberts Handkommunikator summte Übereinstimmung.
Die Frau hieß Gloria Feuerstein.
»Ich speise Ihre Nummer in mein System ein!«, gab Hubert durch.
Gleich darauf öffnete sich das Gartentor und die Beamtin trat schnell hindurch. Hinter ihr schloss sich das Tor automatisch nach wenigen Sekunden, nachdem die Sensoren ihr Durchschreiten registriert hatten.
Der Rest war flott geklärt. Hubert machte die Beamtin schnell mit den Gepflogenheiten in seinem Haushalt vertraut.
»Informieren Sie Ihre Kinder?«, wollte die Beamtin wissen.
»Natürlich«, sagte Hubert. Das war für ihn so selbstverständlich, dass er die Sache eigentlich nicht zur Sprache bringen musste. Das war allein schon deshalb notwendig, damit sie ihn nicht unerwartet anriefen, wenn er in einen Einsatz ging. Sie wussten über die Besonderheiten Bescheid, die sie beachten mussten, wenn er im Dienst war. KEIN ANRUF! Das hatte er ihnen eingebläut, seit sie über eigene Kommunikatoren verfügten. Seither begnügten sie sich mit Textnachtrichten.
»Wie lange rechnen Sie, dass Sie mich ersetzen müssen?«, fragte Hubert, während er einen schnellen Rundgang mit ihr durch das gesamte Haus absolvierte.
»Ich bin auf mehrere Tage eingestellt. Muss ich etwas beachten?«
»Lana weiß über alles Bescheid«, sagte Hubert. »Chris ist ein kleiner Revolutionär. Es schadet nichts, des Nachts öfters die Absperrung zu kontrollieren. Immer vorausgesetzt, ich bin während der Nacht nicht hier und muss vertreten werden.«
»Wolf wartet«, sagte die Beamtin anschließend anstelle einer Antwort.
Hubert kam sich irgendwie vor, als werfe sie ihn aus seinem eigenen Haus hinaus. Er warf ihr noch einen abschätzenden Blick zu. Die Frau besaß eine stämmige Figur und wirkte in den wenigen Sekunden, die er sie bereits kannte, so, als könnte sie sich in allen Lebenslagen durchsetzen.
»Meine Personalnummer haben Sie«, sagte er und winkte ihr zu, ehe er die Haustür öffnete. Als er durchschritt, kam es ihm vor, als beginne für ihn ein neuer Lebensabschnitt.
Er war wieder im Dienst.
Irgendwie ein komisches Gefühl. Als er die wenigen Meter zwischen Haustür und Gartentür durchschritt, schien er auch das Gedenken an seine kürzlich aus dem Leben getretene Frau zurückzulassen. Seit ihrem Selbstmord war keine halbe Stunde vergangen, in der er nicht einmal an sie gedacht und sich gefragt hatte, was letztendlich für ihren Suizid verantwortlich war. Die gängigen Erklärungsmodelle befriedigten ihn einfach nicht.
Vor dem Gartentor wartete der Wagen.
Hubert stieg vorne neben den Fahrer ein. Das gab ihm gleich das Gefühl, sich in einem Einsatz zu befinden.
Der Fahrer begrüßte ihn mit einem Kopfnicken, dann schaltete er gleich das Signalhorn ein.
»Morgenverkehr«, sagte der Mann erklärend. »Wolf erwartet Sie.«
»Sie wissen wohl auch nichts Näheres?«, vermutete Hubert Rösch.
»Ich bin Fahrer«, sagte der Polizist mit einem entschuldigenden Lächeln und fädelte sich rücksichtslos in den Verkehr ein.
Es war 5:53 Uhr.
Vor einer halben Stunde hatte sich die Straße noch nahezu leer präsentiert, jetzt machte sie einen verstopften Eindruck. Bis zur Kreuzung stauten sich die Scooter und die erlaubten Elektrofahrzeuge. In dieser Seitenstraße gab es so gut wie keine Klein-LKW, die noch zusätzlich die Straßen verstopften und für Wartezeiten sorgten, wenn sie Waren auslieferten. Wegen mangelnder Parkplätze blieben die Klein-LKW meistens einfach auf der Straße stehen und sorgten so für zusätzlichen Rückstau.
Da die Straße mit Fahrzeugen verstopft war, nutzte auch das Signalhorn des Polizeiwagens nichts. Der Ton war höchstens dazu angetan, den Aggressionspegel mancher Autofahrer in die Höhe zu treiben. Selbst Hubert nervte der Ton.
Als der Fahrer sich in die Hauptverkehrsader eingefädelt hatte, schaltete er den nervtötenden Ton ab.
Zentimeterweise ging es nach vor. Kaum waren sie in die höherrangige Straße eingebogen, als der Fahrer das Signalhorn erneut aktivierte und auf die Expressspur fuhr. Jetzt kam er schneller voran, zumindest so lange, wie kein Bus die Spur blockierte. Die Schulbusse hatten um diese Zeit ihre Fracht bereits abgeladen. Die Zahl der Busse hielt sich deshalb in Grenzen.
Eine Viertelstunde später ließ der Polizeifahrer Hubert vor dem Hauptquartier aussteigen. Er befand sich nahe der Innenstadt von Feldkirch, dem südlichsten Viertel der STADT.
Hier, in der Fidelis Straße, war in den letzten Jahren die modernste Polizeizentrale, die sämtliche Bedürfnisse befriedigte, buchstäblich aus dem Fels gesprengt worden. Am Fuß des Ardetzenberges lag es, dieses Gelände, das sich wie kein anderes dafür eignete, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. In das Berginnere hatte einst ein alter Luftschutzstollen geführt, der sich zum Ausbau regelrecht anbot. Dieser Stollen und die weitere ausgebaute Höhlung diente als Lagerplatz für gefährliches Gut, und in einem anderen Abschnitt, in genügend großer Entfernung, für die Unterbringung der EDV-Anlage, die anschlagssicher eingerichtet werden konnte. Nach menschlichem Ermessen gab es von außen keinen Zugriff auf die Anlage. Inwieweit die verschiedenen Hacker-Kommunen einen direkten Weg zu Daten fanden, blieb abzuwarten.
Das Büro, in dem Hubert Rösch erwartet wurde, lag jedoch oberirdisch, im siebten Stockwerk. Hier thronte Peter Wolf in einem gut dreißig Quadratmeter großen Zimmer. Den Löwenanteil des vorhandenen Platzes nahm sein überdimensional zu nennender Schreibtisch ein. Man brauchte nur einen Blick auf die Schreibfläche des Tisches zu werfen, um zu erkennen, dass er immer noch zu klein war. Die Wand, die in Wolfs Rücken lag, wenn er am Schreibtisch saß, bestand aus drei riesigen Bildschirmen und links und rechts je einer vielseitig einsetzbaren Funktionstafel.
Als Hubert den Raum betrat, empfing ihn Peter Wolf mit einer seiner typischen Gesten.
Er warf einen Blick auf seine Uhr. Nicht zufällig, wie es oft geschah, wenn man einfach wissen wollte, wie spät es war, sondern übertrieben deutlich, damit jeder mitbekam, dass er damit nicht nur seinen Unmut über die Verspätung ausdrücken wollte. Das Ding, das er an seinem Handgelenk trug, zeigte natürlich die Zeit an, das aber nur nebenbei. Er sprach zwar immer von seiner Uhr, aber in Wirklichkeit handelte es sich bei dem Ding um einen vollwertigen Computer. Da die Eingabe seiner Wünsche nur mehr verbal erfolgte, konnte man sich jede andere Eingabeart ersparen. Und das brachte Platz, denn trotz aller Miniaturisierung, die manuelle Eingabe konnte man nicht ins Unendliche verkleinern, denn die Größe der Fingerspitzen sprach dagegen. Den Menschen konnte man nicht verkleinern.
»Der Morgenverkehr wird nicht weniger«, sagte Hubert, weil er wusste, dass Peter Wolf auf irgendeinen Satz von ihm wartete. Das Ding an seinem Handgelenk war auf Spracherkennung geschaltet – Wolf sagte Spracherkennung, gemeint war natürlich Sprechererkennung.
»Person identifiziert. Hubert Rösch«, sagte das Ding an seinem Handgelenk. Seine Aufgabe war vorerst erledigt und so hüllte es sich in Schweigen.
»Du hast dir Zeit gelassen«, eröffnete Peter Wolf das Gespräch.
»Wie gesagt, der Verkehr …«
»Ich spreche nicht vom Morgenverkehr. Ich beziehe mich auf das Datum. Was machst du so lange allein zuhause? Du bist einer der fähigsten Agenten und versauerst in deinen eigenen vier Wänden.«
»Ich habe zwei Kinder im schulpflichtigen Alter zuhause. Die brauchen mich.«
»Papperlapapp! Die sind froh, wenn sie einmal ohne Kontrolle ein paar Stunden Freizeit genießen können. Du brauchst ja nicht gleich nach Südamerika zu emigrieren. Es gibt hier genug zu tun.«
»Jetzt bin ich da. Wenn du es so eilig hast, solltest du zum Kern der Sache kommen.«
»Alles zu seiner Zeit«, bremste Wolf. »Ich warte noch auf deinen Mitarbeiter.«
»Kenn ich ihn?«
»Sie. Es ist eine Sie.«
»Auch das noch.«
»Die KI hat die Erfolgsaussichten um sieben Prozent erhöht, wenn das neue Team gemischtgeschlechtlich gestaltet wird.«
»Was ist mit dem alten Team?«
»Ich kann es dir gleich verraten. Ein Teil davon liegt seit einer Woche auf dem Friedhof, der andere kämpft im Krankenhaus um sein Leben. So sieht es aus.«
Eine der Bildwände im Hintergrund gab ein piepsendes Geräusch von sich und zeigte einen Gang, den eine hochgewachsene, weibliche Gestalt entlangschritt.