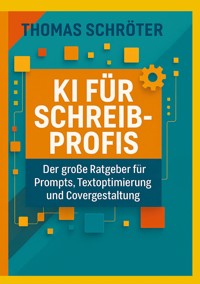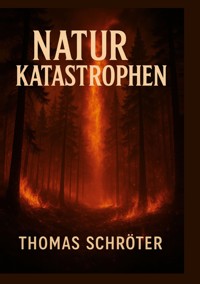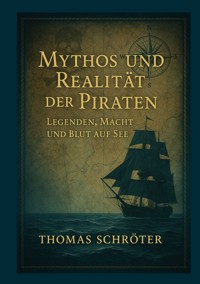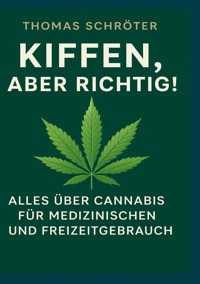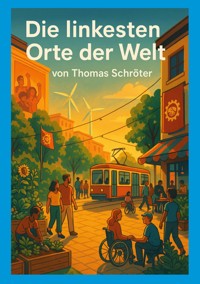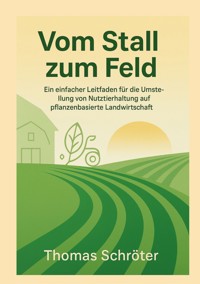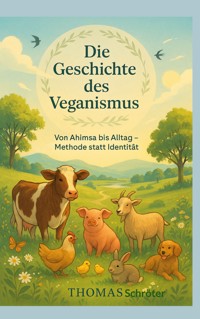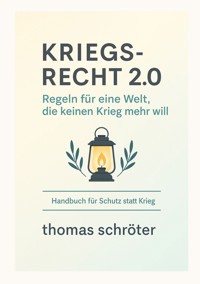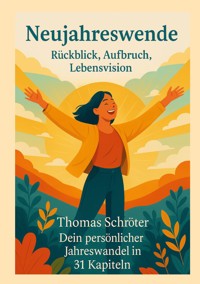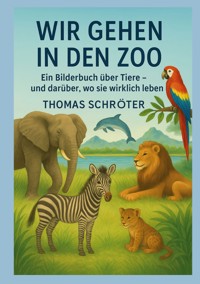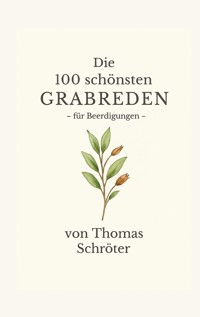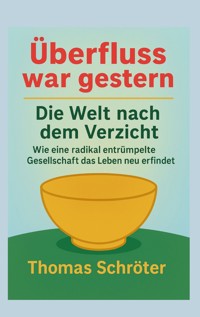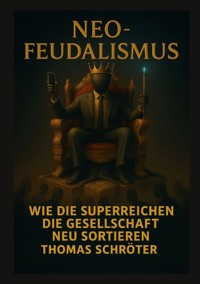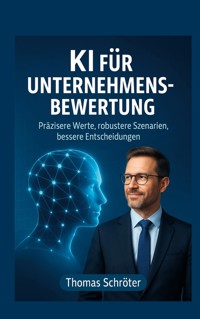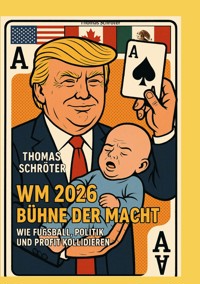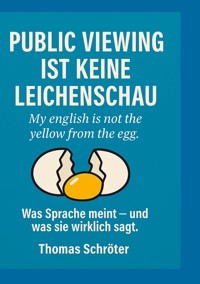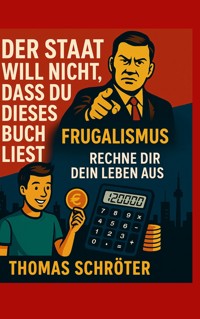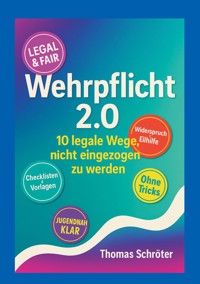
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wehrpflicht 2.0; 10 legale Wege, nicht eingezogen zu werden ist ein klarer, praxisnaher Ratgeber für alle, die wissen wollen, was rechtlich wirklich gilt, wenn Musterung, Einberufung und Neuer Wehrdienst wieder zum Thema werden. Thomas Schröter verbindet persönliche Erfahrung; er wurde im Jahr 2000 mit T5 ausgemustert; mit akribisch geordnetem Wissen: Medizinische Untauglichkeit, Zurückstellung aus gesundheitlichen, familiären und beruflichen Gründen, Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen, Befreiungen, Schwerbehinderung, Aufenthalt im Ausland (Ruhen der Wehrpflicht), laufende Therapie und Reha sowie Widerspruch und Eilrechtsschutz. Das Buch entmythologisiert Ausmustern: Keine Tricks, keine Grauzonen, sondern saubere Verfahren, belastbare Unterlagen und ein Ton, der den Rechtsstaat ernst nimmt. Jedes Kapitel führt vom Was bedeutet das? zum Wie setze ich es um?. Leserinnen und Leser bekommen Checklisten, Mustertexte, Zeitachsen, Anlagenverzeichnisse und komprimierte Leitfäden für ärztliche Stellungnahmen, Bestätigungen von Betrieben, Pflegediensten, Kitas und Hochschulen. Die Argumentation bleibt konsequent funktional: Nicht die Etikette einer Diagnose entscheidet, sondern ihre nachweisbare Auswirkung auf Tauglichkeit, Sicherheit, Teamverantwortung und Zumutbarkeit. Schröter zeigt, wie man Belege sortiert, Fristen hält, Anträge stellt und wenn nötig Widerspruch sowie gerichtlichen Eilrechtsschutz nutzt, ohne sich in Empörung oder Papierfluten zu verlieren. Gleichzeitig ist das Buch ein Plädoyer für Fairness. Es schützt diejenigen, deren Gesundheit, Familie, Ausbildung oder Betrieb durch eine Einberufung unverhältnismäßig belastet würden, und respektiert zugleich all jene, die dienen. Kriegsdienstverweigerung wird als Grundrecht erklärt, nicht als Ausflucht; Zurückstellung als bewegliches Gelenk nicht jetzt statt nie; medizinische Untauglichkeit als ärztliche Feststellung, nicht als Wunschzettel. Wer echte Probleme hat, lernt, sie rechtssicher offenzulegen. Wer nur verunsichert ist, findet eine nüchterne Entscheidungslogik; mit Beispielen für Suchtbehandlung, psychische und somatische Erkrankungen, Alleinerziehung, Pflege, betriebliche Unentbehrlichkeit und Abschlussphasen von Ausbildung und Studium.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 104
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 – Was „Ausmustern“ heute bedeutet
Kapitel 2 – Medizinische Untauglichkeit
Kapitel 3 – Zurückstellung nach § 12 WPflG: Wenn der Zeitpunkt nicht stimmt
Kapitel 4 – Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen
Kapitel 5 – Befreiungen: Wenn das Gesetz selbst „nein“ sagt
Kapitel 6 – Familiäre Härten: Pflege, Alleinerziehung, Unterhalt
Kapitel 7 – Berufliche und ausbildungsbezogene Unentbehrlichkeit
Kapitel 8 – Aufenthalt im Ausland: Wenn die Wehrpflicht ruht
Kapitel 9 – Schwerbehinderung und Gleichstellung: Nachweise, GdB und ihre Rolle für die Tauglichkeit
Kapitel 10 – Laufende Therapie und Reha: Warum Behandlung schützt – und wie man sie dokumentiert
Kapitel 11 – Werkzeuge & Vorlagen: Checklisten, Mustertexte, Anlagen
Kapitel 12 – Widerspruch und Rechtsschutz: ruhig, schnell, strukturiert
Kapitel 13 – Ethik, Gewissen, Gesundheit: Schluss und Kompass
Anhang
Vorwort
Im Jahr 2000 saß ich in einem nüchternen Untersuchungsraum des Karriere-Centers, ein bisschen zu früh da, ein bisschen zu nervös, mit einem Stapel ärztlicher Unterlagen auf dem Schoß. Ich war Anfang zwanzig, stolperte noch zwischen Selbstüberschätzung und Selbstzweifel durchs Leben und wusste doch eines ziemlich klar: Ich hatte bereits negative Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Nicht bloß ein „jugendliches Experiment“, sondern Anzeichen eines Problems, das mich – wenn ich ehrlich zu mir war – schneller und tiefer ziehen konnte, als ich damals ahnte. Ich legte die Befunde auf den Tisch, erzählte ohne Beschönigung. Der Amtsarzt hörte zu, stellte Fragen, blickte länger in die Akte als mir lieb war. Am Ende sagte er einen Satz, der sich mir eingebrannt hat: „Dann bleiben Sie besser Zivilist.“
Dieser Satz war kein Urteil über meinen Wert als Mensch, und er war auch kein spöttischer Abschied aus einer Pflicht. Er war eine nüchterne, verantwortliche Konsequenz aus der medizinischen Lage. Das System tat, was es tun soll: es prüfte, wog Risiken ab und traf eine Entscheidung, die dem Einzelnen und der Truppe diente. Ich wurde als „nicht wehrdienstfähig“ eingestuft – umgangssprachlich T5. Damals empfand ich Erleichterung. Erst später begriff ich, wie viel Verantwortung in dieser nüchternen Entscheidung liegt: Verantwortung mir gegenüber, damit ein latent vorhandenes Problem nicht zum Absturz wird. Verantwortung gegenüber Kameradinnen und Kameraden, die sich aufeinander verlassen müssen. Verantwortung gegenüber einer Institution, die nur so stark ist wie die Gesundheit und Verlässlichkeit ihrer Mitglieder.
Dieses Buch habe ich nicht geschrieben, um das System auszutricksen. Es ist kein Ratgeber für Tricks, keine Einladung zu Täuschung, keine Anleitung zur Selbstschädigung. Es ist der Versuch, Klarheit zu schaffen in einem Feld, in dem Mythen, Halbwissen und Küchenjuristerei allzu oft die Oberhand gewinnen. Wer „T5“ sagt, meint meist „ausmustern“ – doch rechtlich und medizinisch steckt dahinter eine präzise Feststellung, die allein Ärztinnen und Ärzte auf Grundlage dokumentierter Tatsachen treffen. Genauso klar ist: Es gibt neben der medizinischen Untauglichkeit weitere, ausdrücklich legale Wege, nicht eingezogen zu werden – Befreiungen, Zurückstellungen, das Grundrecht der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. All das ist Rechtsstaat in Aktion, nicht Schlupfloch.
Ich schreibe aus der Doppelperspektive: als jemand, der die persönliche Verletzlichkeit kennt, die Sucht und ihre Schatten mit sich bringen; und als Bürger, der Institutionen nur dann stark findet, wenn sie mit Wahrhaftigkeit gefüttert werden. Wer ein reales Gesundheitsproblem hat, soll sich behandeln lassen und die Wahrheit auf den Tisch legen – vollständig, sachlich, belegt. Wer aus Gewissensgründen den Waffendienst nicht leisten kann, darf – muss – das frei sagen und begründen. Wer familiär unentbehrlich ist oder eine Ausbildung in kritischer Phase abschließt, hat ein Recht darauf, dass das gehört und geprüft wird. Und wer all das für „Drückebergerei“ hält, verkennt, dass die Wehrfähigkeit einer Gesellschaft nicht am Kasernentor beginnt, sondern viel früher: bei Selbstkenntnis, Gewissensfreiheit, Gesundheitsschutz und einem System, das diese Werte ernst nimmt.
Die Szene von damals ist mir auch deshalb präsent, weil sie mir die Falle gezeigt hat, die ich hätte zuschnappen lassen können: Hätte ich mein Problem verschwiegen, aus Stolz, Scham oder Angst, „zu versagen“, wäre ich möglicherweise in eine Umgebung geraten, die genau das verschärft, was mich ohnehin bedrohte. Prävention ist kein Feiglingstrick, sondern die reifste Form von Mut. In meinem Fall hieß das: anerkennen, dass Alkohol für mich kein harmloser Begleiter war; akzeptieren, dass Dienstfähigkeit mehr ist als Fitness und Wille; und annehmen, dass eine ärztliche Feststellung mich nicht kleiner, sondern sicherer macht.
Dieses Buch will Orientierung geben – rechtlich, medizinisch, menschlich. Es erklärt die legitimen Wege, nicht eingezogen zu werden, ohne die Grenzen zu verwischen. Es zeigt, welche Unterlagen zählen, wie Verfahren fair ablaufen können, wo die eigenen Rechte liegen und welche Verantwortung damit einhergeht. Es respektiert die, die dienen. Es schützt die, die geschützt werden müssen. Und es ermutigt alle, die vor der Frage stehen, wie sie mit ihrer Wahrheit umgehen: Sagt sie. Legt sie vor. Baut euer Leben nicht auf Verschweigen, sondern auf Klarheit.
Wer in diesen Seiten nach Abkürzungen sucht, wird keine finden. Wer nach sauberem, verantwortlichem Handeln sucht, wird es finden. Wenn am Ende mehr Menschen die richtigen Anträge stellen, die passenden Nachweise sammeln, die nötige Behandlung beginnen – und wenn zugleich diejenigen in Uniform auf Kameraden treffen, auf die sie sich verlassen können –, dann erfüllt dieses Buch seinen Zweck.
Der Satz des Amtsarztes begleitet mich bis heute. Er war knapp und klar, ohne Häme und ohne Pathos. Er sagte nicht: „Sie taugen nichts.“ Er sagte: „Dann bleiben Sie besser Zivilist.“ Manchmal ist das die mutigste, klügste, soldatischste Entscheidung, die ein Staat für einen Bürger und ein Bürger für sich selbst treffen kann.
Thomas Schröter
August 2025
Kapitel 1 – Was „Ausmustern“ heute bedeutet
„Ausmustern“ ist ein hartnäckiges Wort aus der Alltagssprache. Juristisch meint es nichts anderes als eine ärztliche Feststellung: Der Wehrmedizinische Dienst kommt nach Untersuchung und Aktenlage zu dem Ergebnis, dass eine Person nicht wehrdienstfähig ist. Das ist keine Gefälligkeit und kein Antragstitel, sondern das Ende eines geregelten Begutachtungsprozesses, der medizinische Befunde, Funktionsfähigkeit im Dienstalltag und Prognosen zusammenführt. Wer von „T5“ spricht, meint genau diese Konstellation: eine dokumentierte, ärztlich begründete Untauglichkeit. Daneben existieren andere, ebenso legale Wege, die ebenfalls dazu führen können, nicht einberufen zu werden – sie heißen allerdings nicht „T5“, sondern haben ihren eigenen Rechtscharakter. Wer die Begriffe sauber trennt, versteht schneller, welche Spur für die eigene Lebenslage die richtige ist.
Der rechtliche Hintergrund ist zweigeteilt. Einerseits bleibt die allgemeine Wehrpflicht seit 2011 ausgesetzt, das Wehrpflichtgesetz gilt jedoch weiter. Es ruht nicht in der Schublade, sondern bildet weiterhin den Rahmen, in dem Befreiungen, Zurückstellungen, die Tauglichkeitsprüfung und das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung verankert sind. Andererseits wird politisch über einen „Neuen Wehrdienst“ diskutiert, der die Wehrerfassung wiederbeleben und eine bedarfsorientierte Auswahl ermöglichen soll. Solange solche Konzepte nicht in Gesetz gegossen sind, gilt: Maßgeblich ist das, was heute im Gesetz steht. Für Betroffene bedeutet das, sich an verlässlichen Normen zu orientieren statt an Schlagzeilen – und Entscheidungen auf belastbare, nachvollziehbare Gründe zu stützen.
Im Zentrum der Praxis stehen vier Pfeiler. Der erste ist die medizinische Schiene: Die wehrmedizinische Begutachtung folgt klaren, veröffentlichten Regeln. Sie bewertet nicht bloß Etiketten wie „Depression“, „Epilepsie“ oder „Herzfehler“, sondern deren funktionelle Folgen für Ausbildung, Einsatz, Teamverantwortung, Nacht- und Schichtdienst, Stressresistenz und Gefahrenlagen. Deshalb zählen nicht große Worte, sondern saubere Unterlagen: aktuelle Arztbriefe, Diagnosen, Therapie- und Rehaberichte, Messwerte, Bildgebung, Verlauf. Das Ergebnis kann vorübergehende Dienstunfähigkeit mit Nachuntersuchung sein – oder dauerhafte Untauglichkeit. „T5 auf Wunsch“ existiert ebenso wenig wie eine Pflicht zur Stärke um jeden Preis. Es geht um Eignung, Belastbarkeit und Sicherheit – für die Betroffenen und ihre Umgebung.
Der zweite Pfeiler sind Zurückstellungen. Das Gesetz kennt Situationen, in denen eine Einberufung zwar grundsätzlich möglich wäre, im konkreten Zeitpunkt aber unzumutbar ist: laufende Behandlungen und Rehas, schwere familiäre Belastungen, Unentbehrlichkeit in kleinen Betrieben, Abschlussphasen von Ausbildung und Studium. Eine Zurückstellung ist kein Trick, sondern ein Korrektiv, das den Anspruch des Staates und die Zumutbarkeit für den Einzelnen austariert. Sie ist befristet, wird nachgeprüft und verlangt, wie jede Ausnahme, ordentliche Nachweise.
Der dritte Pfeiler sind Befreiungen. Hier geht es um Konstellationen, in denen das Gesetz selbst festlegt, dass bestimmte Personen nicht herangezogen werden. Die Zahl der Fälle ist überschaubar und eng umrissen; es handelt sich nicht um Lücken, sondern um bewusst gesetzte Grenzen staatlicher Pflichtenzuweisung. Auch hier gilt: Entscheidend sind die Tatsachen – und der saubere Nachweis derselben.
Der vierte Pfeiler ist nicht medizinisch, sondern verfassungsrechtlich: die Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Sie ist kein Hintertürchen, sondern Grundrecht. Wer den Dienst an der Waffe mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, beantragt die Anerkennung – und begründet sie persönlich, konkret und plausibel. Das Ergebnis ist nicht „T5“, sondern die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer mit der Folge, dass kein Waffendienst zu leisten ist. Sollte der Gesetzgeber einen Ersatzdienst reaktivieren, wird dorthin zugeordnet. Auch hier führt nur Wahrhaftigkeit zum Ziel; Textbausteine ohne innere Wahrheit tragen selten.
Rings um diese vier Pfeiler verläuft die Debatte über „Wehrgerechtigkeit“. Sie fragt, wie sich eine Pflicht an „alle“ fair gestalten lässt, wenn in der Praxis nur ein Teil eines Jahrgangs tatsächlich einberufen würde. Die Antwort kann nicht in intransparenten Auswahlverfahren liegen, sondern in klaren, gesetzlich definierten Kriterien. Solange eine Neuregelung aussteht, ist der sicherste Kompass der Blick ins geltende Recht und in die amtlichen Verfahren: Was brauche ich für eine Begutachtung? Welche Unterlagen belegen eine Zurückstellung? Wie formuliere ich eine Gewissensentscheidung so, dass sie mich wirklich abbildet? Wie widerspreche ich einem Bescheid, den ich für fehlerhaft halte?
Auch Details, die oft nachrangig erscheinen, gehören zur Klarheit. Die Wehrpflicht beginnt nicht im luftleeren Raum, sondern in gesetzlich definierten Alterskorridoren; für Sonderfälle – etwa im Spannungs- oder Verteidigungsfall – gelten andere Grenzen. Frauen sind von einer Pflicht zum Dienst an der Waffe derzeit verfassungsrechtlich nicht erfasst, der freiwillige Dienst steht offen. Es sind solche scheinbar kleinen Punkte, die im Einzelfall große Wirkung entfalten und die eigene Lage entweder entspannen oder verkomplizieren können. Wer hier sorgfältig liest, vermeidet unnötige Konflikte.
Dieses Buch setzt genau hier an: bei der Entwirrung. Wir werden die medizinische Begutachtung so erklären, dass sie planbar wird; wir zeigen, welche Belege Gewicht haben und wie man sie ordentlich zusammenstellt; wir erläutern die Mechanik von Zurückstellung und Befreiung; wir führen Schritt für Schritt durch das Verfahren der Kriegsdienstverweigerung; und wir beschreiben den Weg des Rechtsschutzes, wenn ein Bescheid nicht trägt. Nicht, um Schlupflöcher aufzutun, sondern um Rechtsstaat praktisch werden zu lassen. Wer echte gesundheitliche Gründe hat, soll sie behandeln lassen und offenlegen. Wer aus Gewissensgründen nicht an der Waffe dienen kann, soll das frei sagen und begründen. Wer in familiärer, betrieblicher oder ausbildungsbezogener Härte steckt, soll sie belegen und Schutz beanspruchen. So entsteht Wehrfähigkeit, die auf Wahrheit ruht – und auf Verfahren, die ihrer würdig sind.
Am Ende ist „Ausmustern“ kein Stigma und „Nicht eingezogen werden“ keine Schande. Beides sind mögliche, rechtlich saubere Ergebnisse in einem System, das Pflicht und Person zusammendenkt. Wer seine Lage kennt, wer die Begriffe trennt, wer früh mit Dokumenten arbeitet und nicht mit Mythen, der handelt nicht nur klug, sondern verantwortungsvoll – sich selbst gegenüber, den eigenen Angehörigen gegenüber und jenen, die dienen und sich auf Verlässlichkeit verlassen. Genau diese Haltung soll dieses Kapitel vorbereiten: nüchtern, klar, menschlich. In den folgenden Kapiteln gehen wir hinein in die Details und machen aus Grundsätzen geordnete Schritte.
Kapitel 2 – Medizinische Untauglichkeit
Wer von Ausmustern spricht, meint im Kern eine medizinische Entscheidung. Am Ende einer Begutachtung steht nicht ein Gefühl, keine spontane Sympathie und auch kein Wunschzettel, sondern eine fachärztlich begründete Feststellung der Wehrdienstfähigkeit. Dieser Prozess folgt Regeln. Er fragt nicht nur nach Diagnosen, sondern vor allem danach, was diese Diagnosen im Alltag eines militärischen Dienstes bedeuten würden. Deshalb ist Kapitel 2 das Herzstück des Buches. Es zeigt, wie eine Begutachtung abläuft, wie man sich seriös vorbereitet, welche Unterlagen Gewicht haben und weshalb Ehrlichkeit nicht nur moralisch geboten ist, sondern auch praktisch schützt.
Der Maßstab der Begutachtung
Die medizinische Beurteilung richtet sich nach Funktionsfähigkeit. Eine Diagnose ist ein Etikett. Entscheidend ist, wie sich eine Störung auf Belastbarkeit, Aufmerksamkeit, Teamfähigkeit, Nachtdiensttauglichkeit, Lärm und Stress, Unfallrisiko, Waffenhandhabung, längere Abwesenheiten von zu Hause sowie körperliche Grundanforderungen auswirkt. Das bedeutet zweierlei. Erstens kann dieselbe Diagnose bei zwei Menschen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, weil Verlauf, Schweregrad und Stabilität verschieden sind. Zweitens zählt die dokumentierte Realität stärker als Selbsteinschätzungen ohne Belege. Wer seine Lage sauber belegt, wird fairer beurteilt als jemand, der vage bleibt.
Von der Einladung bis zum Bescheid