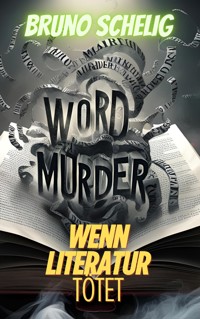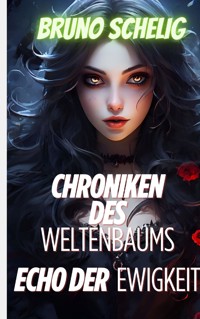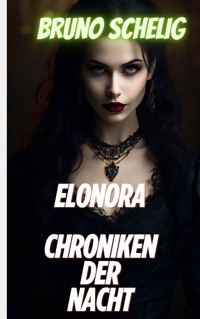1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einblick in den Alltag einer geschlossenen psychiatrischen Station aus der Perspektive eines Pflegers in Weiterbildung. Das Tagebuch dokumentiert authentisch und detailliert die Begegnungen mit Patienten, die an verschiedenen psychischen Erkrankungen leiden (Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depression, Psychose, etc.). Es zeigt die Herausforderungen, Erfolge, Rückschläge und emotionalen Belastungen, die mit dieser Arbeit verbunden sind. Gleichzeitig reflektiert der Autor seine eigene Entwicklung, seine Lernprozesse und die ethischen Dilemmata, mit denen er konfrontiert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 55
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zerbrechliche Seelen:
Tagebuch einer Reise durch die Psychiatrie
by
Bruno Schelig
About
Einblick in den Alltag einer geschlossenen psychiatrischen Station aus der Perspektive eines Pflegers in Weiterbildung. Das Tagebuch dokumentiert authentisch und detailliert die Begegnungen mit Patienten, die an verschiedenen psychischen Erkrankungen leiden (Borderline-Persönlichkeitsstörung, Depression, Psychose, etc.). Es zeigt die Herausforderungen, Erfolge, Rückschläge und emotionalen Belastungen, die mit dieser Arbeit verbunden sind. Gleichzeitig reflektiert der Autor seine eigene Entwicklung, seine Lernprozesse und die ethischen Dilemmata, mit denen er konfrontiert wird.
14. März 2025
Die Tür zum Aufenthaltsraum knallt mit einer Wucht zu, die mich zusammenzucken lässt. Das Geräusch hallt durch den Flur, vermischt sich mit dem gedämpften Gemurmel der anderen Patienten und dem leisen Summen der Neonröhren. Herr K. ist wieder außer sich. Seine Stimme, rau und verzweifelt, dringt durch die geschlossene Tür meines Büros. „Sie wollen mich vergiften!“, schreit er. „Das Essen ist vergiftet! Alles ist manipuliert!“
Ich presse meine Lippen zusammen. Seine paranoiden Schübe sind in den letzten Tagen intensiver geworden, trotz der Erhöhung seiner Medikation. Olanzapin, 20mg. Es sollte ihn eigentlich ruhiger machen, die Wahnvorstellungen dämpfen. Aber die Krankheit ist wie ein unberechenbares Tier, das sich immer wieder neue Wege sucht, sich zu manifestieren.
Hilflosigkeit. Dieses Gefühl kenne ich nur zu gut. Es ist ein ständiger Begleiter in meinem Beruf, ein Schatten, der sich über jede noch so kleine Hoffnung legt. Ich sitze hier, in meinem kleinen Büro, die Wände in einem beruhigenden Blauton gestrichen, ein paar gerahmte Kunstdrucke mit abstrakten Motiven, die ich einmal auf einem Flohmarkt gefunden habe. Es ist mein Versuch, eine Oase der Ruhe zu schaffen, inmitten des Sturms, der hier oft tobt.
Meine Finger krampfen sich um meine Kaffeetasse. Der Kaffee ist längst kalt, aber ich halte mich an der Wärme fest, die noch von der Keramik ausgeht. Ein kleiner Anker in diesem Meer aus Verzweiflung und Wahnsinn. Ich starre auf die Akten vor mir. Herr K.s Akte ist dick, gefüllt mit Berichten, Diagnosen, Therapieplänen. Schizophrenie, paranoid-halluzinatorischer Typ. Ein Leben lang gezeichnet von dieser Krankheit.
Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch. Er war damals noch relativ klar, konnte seine Gedanken ordnen, auch wenn die Angst schon in seinen Augen lauerte. Er erzählte mir von seinem früheren Leben, von seinem Beruf als Ingenieur, von seiner Frau, die ihn verlassen hatte, als die Krankheit immer schlimmer wurde. Er sprach von seinem Wunsch, wieder gesund zu werden, wieder ein normales Leben zu führen. Aber die Krankheit hatte ihn fest im Griff, zog ihn immer tiefer in einen Strudel aus Wahnvorstellungen und Ängsten.
Heute Morgen hatte ich eine Sitzung mit Frau L. Sie sitzt mir gegenüber, auf dem abgenutzten Sessel, der für die Patienten reserviert ist. Ihre Hände liegen regungslos in ihrem Schoß, die Finger ineinander verschränkt, als wollte sie sich selbst festhalten. Sie ist erst 23, aber ihre Augen haben diesen leeren, ausgebrannten Ausdruck, den ich schon so oft gesehen habe. Die schwere Depression hat sie fest im Griff, wie ein unsichtbares Netz, das sie immer tiefer in die Dunkelheit zieht.
„Ich sehe keinen Sinn mehr“, sagt sie leise, ihre Stimme kaum mehr als ein Flüstern. „Alles ist so… schwer.“
Ich nicke langsam, versuche, ihr das Gefühl zu geben, dass ich sie verstehe, dass ich ihre Verzweiflung nachempfinden kann. Aber wie kann ich das wirklich? Ich kann mir nur vorstellen, wie es sich anfühlt, von dieser lähmenden Schwere erdrückt zu werden, von dieser Hoffnungslosigkeit, die jeden Lichtstrahl verschluckt.
Sie erzählt mir von ihrer Kindheit. Von einem Vater, der trank und gewalttätig wurde. Von einer Mutter, die sich in ihre eigene Trauer zurückzog und unfähig war, ihre Tochter zu schützen. Von den ständigen Demütigungen, den Schlägen, den Worten, die sich wie Nadelstiche in ihre Seele bohrten. „Du bist nichts wert“, hatte ihr Vater immer wieder gesagt. „Du wirst nie etwas erreichen.“
Diese Worte hallen in mir nach, lange nachdem Frau L. mein Büro verlassen hat. Sie sind wie Gift, das sich langsam ausbreitet und alles zerstört, was es berührt. Ich versuche, ihr zu helfen, diese negativen Glaubenssätze zu erkennen und zu hinterfragen. Ich gebe ihr kognitive Verhaltenstherapie, erkläre ihr, wie ihre Gedanken ihre Gefühle beeinflussen. Ich ermutige sie, kleine Schritte zu machen, sich Ziele zu setzen, die sie erreichen kann. Aber es ist ein mühsamer Prozess, ein Kampf gegen einen übermächtigen Gegner.
Ich sehe die kleinen Narben an ihren Unterarmen. Selbstverletzendes Verhalten. Ein Ventil für den inneren Schmerz, der zu groß ist, um ihn anders auszudrücken. Ich habe ihr alternative Bewältigungsstrategien vorgeschlagen, Skills, wie wir sie nennen. Ablenkung, Entspannungstechniken, Achtsamkeitsübungen. Aber ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, diese anzuwenden, wenn die Verzweiflung übermächtig wird.
Später, in der Teamsitzung, sitzen wir um den großen Konferenztisch. Dr. Weber, der Chefarzt, leitet die Besprechung. Er ist ein erfahrener Psychiater, ein Mann mit ruhiger Ausstrahlung und gütigen Augen. Neben ihm sitzt Frau Meier, die Oberärztin, eine energische Frau mit einem scharfen Verstand. Dann sind da noch die Assistenzärzte, die Pfleger, die Ergotherapeuten, die Sozialarbeiter. Ein ganzes Team, das sich um das Wohl der Patienten kümmert.
Wir sprechen über Herrn M. Ein junger Mann, 28 Jahre alt, der vor einer Woche mit seiner ersten psychotischen Episode eingeliefert wurde. Er ist verwirrt, desorientiert, hört Stimmen, die ihm Befehle erteilen. Seine Familie ist verzweifelt, steht unter Schock. Sie hatten keine Ahnung, dass er krank war. Er hatte immer als ruhig und unauffällig gegolten, ein guter Schüler, ein erfolgreicher Student.
Dr. Weber zeigt uns die MRT-Aufnahmen seines Gehirns. „Keine Auffälligkeiten“, sagt er. „Keine Tumore, keine Anzeichen für eine organische Ursache.“
Wir diskutieren die Medikation. Risperidon, Quetiapin, Aripiprazol. Die Auswahl ist groß, aber die Wirkung ist oft unvorhersehbar. Wir müssen abwarten, beobachten, wie er darauf reagiert. Wir sprechen über die Therapie. Psychoedukation, Familientherapie, Einzelgespräche. Wir versuchen, ihm zu helfen, seine Krankheit zu verstehen, mit ihr umzugehen. Wir versuchen, seine Familie zu unterstützen, ihnen zu erklären, was mit ihrem Sohn passiert.
Aber die Wahrheit ist, dass wir oft im Dunkeln tappen. Wir wissen nicht genau, was diese Krankheit auslöst, was in seinem Gehirn vorgeht. Wir können nur versuchen, die Symptome zu lindern, die Leiden zu verringern. Wir können nur hoffen, dass er auf die Behandlung anspricht, dass er wieder ein halbwegs normales Leben führen kann.
Ich spüre eine tiefe Müdigkeit in mir aufsteigen. Die Fälle, die Geschichten, die Schicksale, sie zehren an meinen Kräften. Ich frage mich manchmal, ob ich stark genug bin für diesen Job. Ob ich die nötige Distanz wahren kann, um nicht selbst unterzugehen.
Ich erinnere mich an meine eigene Ausbildung, an die Supervisionen, in denen wir lernten, unsere eigenen Gefühle zu reflektieren, unsere Grenzen zu erkennen. Ich erinnere mich an die Worte meines Mentors: „Du kannst nicht jeden retten. Du kannst nur dein Bestes geben.“