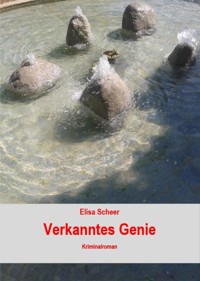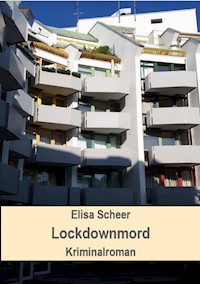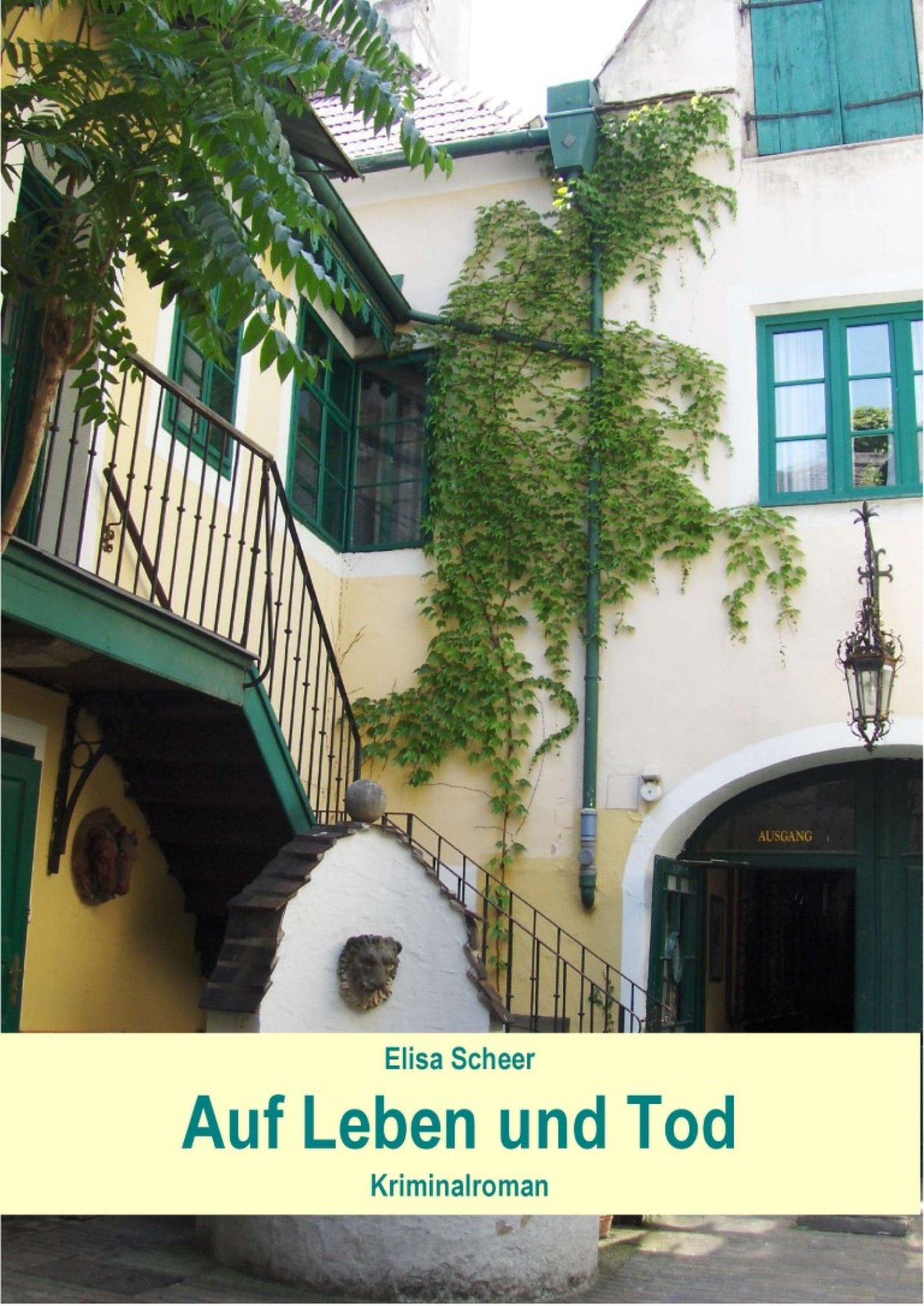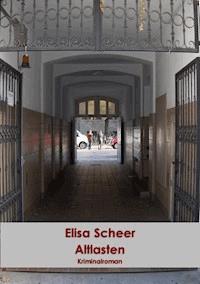Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Mathilde Carin hat zeitlebens unter ihrer Großmutter gelitten, bei der sie aufwachsen musste, weil ihre Eltern sehr früh gestorben waren. Sobald sie konnte, hatte sie das Haus ihrer Großeltern verlassen. Nun aber hat jemand die "alte Hexe" ermordet... Wer kommt als Täter in Frage? Der Großvater? Mathilde selbst? Erboste Nachbarn? Verwandte, die plötzlich aus allen Ecken auftauchen? Die verwirrende Suche nach dem Täter konfrontiert Mathilde mit einer ganz unbekannten Familiengeschichte, merkwürdigsten Leuten, Gefahren und der großen Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Namen, Personen, Ort und Firmen sind frei erfunden. Etwaige Übereinstimmungen mit tatsächlich existierenden Personen usw. sind purer Zufall.
1 MO 16.04.
Das schwarze Ungeheuer kam immer näher, geifernd und röchelnd. Sie rannte, bis sie glaubte, ihre Lunge müsse explodieren, ihr Atem dröhnte ihr in den Ohren – und dennoch holte das Ungeheuer zügig auf. Da – die Rettung! Eine Tür, nein, eine runde Öffnung in der Wand, wie ein Kugelschott. Sie stürzte darauf zu und riss die Abdeckung auf. Ein Bein über die Abtrennung – Scheiße. Sie kam nicht weiter, und das Ungeheuer blies ihr schon fast seinen ekelhaften Atem in den Nacken. Zurück? Zurück ging auch nicht, außerdem wollte sie nicht in die Fänge des Ungeheuers geraten. Und irgendwie schien diese blöde runde Tür auch noch Warntöne auszustoßen, die immer lauter wurden und ihr in den Ohren gellten, schrill und regelmäßig, wie eine Alarmanlage, wie eine Polizeisirene – wie ein Telefon.
Mathilde fuhr hoch.
Blödes Handy, was hatte sie sich denn bei diesem Klingelton gedacht? Hier kommen die Cops? Wach wurde man davon, aber jedes Mal einen Herzinfarkt kriegen – das musste sie bald mal ändern. Saudoof. Sie tastete blind auf dem Tisch neben dem Bett herum und packte endlich das Handy.
Himmlische Ruhe.
Dieser behämmerte Traum kam immer wieder. Mittlerweile seltener, aber gelegentlich steckte sie wieder fest – in einer Tür, in einem Schacht, unter einer Bank. Wer das schwarze Ungeheuer war, war natürlich klar – die Nonna, wer sonst?
Sie drehte sich zur Seite, griff wieder nach dem Handy und starrte stirnrunzelnd darauf. Halb acht? Echt schon halb acht? Dann hatte sie ja über eine Stunde verschlafen – und um halb neun sollte sie doch im Verlag sein, Besprechung wegen dieses vermaledeiten Übungsteils…
Unlustig stand sie auf und tappte ins Bad. Der große Spiegel im Flur warf ihr Bild zurück und sie musterte sich im Vorübergehen interesselos: ziemlich groß, ziemlich dünn, insgesamt auch ziemlich langweilig.
Egal, für wen sollte sie sich denn interessant machen?
Sie reinigte ihr Gesicht, putzte die Zähne, ging auf die Toilette und stieg schließlich unter die Dusche. Das Bad war eigentlich wirklich schön, dachte sie wie nahezu jeden Morgen, während sie sich die Haare einschäumte. Vor allem die Luxusdusche, die Tante Anni noch kurz vor ihrem Tod hatte einbauen lassen, war ein täglicher Genuss.
Ansonsten fühlte sie sich in dieser Wohnung auch nach fast fünf Jahren noch nicht richtig zu Hause. Kein Wunder – wer wusste denn, ob sich die Nonna nicht noch durch die nächste Instanz klagte? Dann müsste Mathilde vielleicht von heute auf morgen diese Wohnung wieder verlassen, also lohnte es sich nicht, etwas zu verändern oder auch nur mehr als das absolut Unverzichtbare auszupacken. Was war eigentlich in den Kisten, die immer noch in der geräumigen Abstellkammer aufgestapelt standen? Bei Gelegenheit sollte sie die mal durchsehen. Und möglichst viel vom Inhalt wegwerfen – so wäre ein neuerlicher Umzug wieder einfacher.
Aber nicht jetzt! Sie wickelte sich in ihr Badetuch – eines ihrer eigenen schäbigen von früher, nicht etwa Tante Annis dicken Frottee, nachher verlangte die Nonna noch Schadensersatz, weil sie die Handtücher abgewohnt hatte – und tappte ins Schlafzimmer. Heute mal – hm… so groß war die Auswahl nicht: die anthrazitfarbenen Jeans, ein hellgraues T-Shirt, der schwarze Blazer. Sie schlüpfte in Unterwäsche und Strümpfe, warf die Wäsche von gestern ins Bad vor die Waschmaschine und hängte den grauen Blazer, den sie gestern getragen hatte, zurück in den Schrank. Ein Abteil hatte sie für sich reserviert, in den anderen lag und hing noch die Kleidung von Tante Anni, lauter tantiges Zeug, das ihr etwas zu weit und viel zu kurz war. Aber wenn sie das entsorgte und die Nonna gewann in der nächsten Instanz…
Vielleicht sollte sie mal ihre Anwältin anrufen, ob sich etwas gerührt hatte – oder müsste eine Klageschrift zuerst ihr selbst zugestellt werden? Wie war das beim letzten Mal eigentlich gewesen?
Die Nonna würde sie noch ihr ganzes Leben lang verfolgen, das war nun mal ihr Schicksal. Unter solch trüben Gedanken hatte sie sich angezogen, ihre noch etwas feuchten Haare ausgekämmt, nach hinten frisiert und mit einer unauffälligen Schildpattspange zusammen geklippt und ihr Gesicht leicht überpudert. Noch etwas Lippenpflegestift und einen Hauch Parfum und sie war fertig.
Frühstück!
Immerhin konnte sie sich im Kühlschrank ausbreiten, nicht einmal die Nonna würde ja wohl erwarten, dass sie Tante Annis seit Jahren abgelaufene Lebensmittel hier pietätvoll aufbewahrte!
Sie schnitt sich eine Scheibe von dem guten, ganz dunklen Vollkornbrot ab, wusch einen Apfel, eine Tomate und eine Mohrrübe und arrangierte alles auf dem kleinen schwarzen Teller, den sie immer für ihr Frühstück verwendete. Dazu brühte sie sich einen Becher grünen Tee auf und stellte dann alles auf das Ende der Arbeitsplatte, wo Tante Anni damals einen Hocker platziert hatte. Seitdem sie hier wohnte, verzehrte sie ihre frugalen Mahlzeiten an exakt dieser Stelle. Tante Annis Essecke wurde lediglich einmal pro Woche sorgfältig abgestaubt.
Gedankenverloren verzehrte sie langsam ihr Frühstück – langsam sättigte besser, das hatte sie gelernt, und sie wollte gerne das Mittagessen einsparen. So toll zahlten die in diesem Verlag nicht, und ihre Ersparnisse waren eher bescheiden. Und ob ihr diese Wohnung nun gehörte, wusste sie schließlich immer noch nicht. Der letzte Prozess hatte vor zweieinhalb Jahren stattgefunden, und beim Rausgehen hatte die Nonna noch gedroht, in die nächste Instanz zu gehen. Aber vor zweieinhalb Jahren…? Konnte man so lange warten? Gab´s da keine Fristen für Einspruch oder so? Sie musste wirklich mal bei Frau Petzl nachfragen…
Immerhin war der Verlag nur einige Ecken weiter, in einem Hintergebäude in der Katharinenstraße, dessen letzte Renovierung bestimmt auch schon wieder dreißig Jahre zurücklag; Mathilde konnte also zu Fuß gehen. Das musste sie auch, denn ein Auto besaß sie nicht und ein Bus fuhr auf diesem Weg auch nicht.
Also, erst Verlag, dann Bibliothek – sie musste endlich fertig promovieren und sich einen anständigen Job suchen. Mit dreißig wollte sie aus diesem kargen Leben heraus sein, also hatte sie noch exakt ein Jahr Zeit.
Heute hatte sie nämlich Geburtstag, denn heute war der sechzehnte April. Aber das interessierte niemanden. Weder im Verlag noch im Kandidatenseminar war es üblich, an solchen Tagen einen auszugeben, die Nonna und der Großvater wären die Letzten, die ihr gratulieren würden, und Freunde hatte sie nicht.
War das ein Defizit?
Nein, so wie es war, war alles in Ordnung.
Natürlich, wenn die Nonna nicht weiter klagen würde, das hätte etwas Beruhigendes. Dann wäre alles so richtig in Ordnung. Dann könnte sie diese Wohnung so gestalten, wie es ihr gefiel – nichts mehr mit Tante Annis gesammeltem Schnickschnack, der alles so unglaublich überladen wirken ließ.
Und dass sie keine Freunde hatte, stimmte so auch nicht, überlegte sie, als sie in die Katharinenstraße einbog. Die Leute im Verlag waren doch ganz nett zu ihr, und an der Uni – Bea und Traudl im Oberseminar… und früher mal Irina, noch zu Schulzeiten.
Was Irina jetzt wohl trieb? Vielleicht sollte sie das heute Abend mal eruieren, wenn ihr ihre Doktorarbeit auf die Nerven ging?
Sie stieß die Glastür auf, durchquerte die wie immer ungeputzte Eingangshalle und stieg die Treppen in den zweiten Stock hinauf.
2 MO 16.04.
Spanischbücher waren allmählich keine Nischenprodukte mehr, überlegte Ludwig Wintersteiner, als er die Redaktionsrunde musterte, die sich um den Konferenztisch versammelt hatte. Je mehr Spanisch in den Rang einer regulären Fremdsprache an den bayerischen Gymnasien rückte – völlig zu Recht, fand er -, desto stärker interessierten sich die Multis dafür, die drei, vier Großverlage, die das Schulbuchgeschäft nahezu unter sich aufgeteilt hatten. So würde Si, hablo español irgendwann sicher vom Markt gedrängt werden.
Er merkte, dass er das laut gesagt hatte, als die etwas dröge Carin sich meldete.
„Ja, Frau Carin?“
„Erschließt das für uns nicht auch neue Nischen – Übungshefte, Nachhilfematerial, Lektüren und Ähnliches?“
„Da könnten Sie Recht haben – wenn uns dieser Markt nicht von Stark und Anders weggeschnappt wird.“
„Dann müssen wir eben besser sein“, beharrte die Carin auf ihrem Optimismus. Er lächelte ihr kurz zu und sie begannen, alle Teile des Spanischlehrbuchs durchzugehen – was war fertig, was musste ein zweites Mal lektoriert werden, wo fehlten Abbildungen, wo war das Layout suboptimal, welche Termine mussten mit der hauseigenen Druckerei vereinbart werden, wer musste alles ein Prüfexemplar erhalten, um die begehrte Genehmigung für die Lehrmittelfreiheit zu erhalten?
Gut zweieinhalb Stunden berieten und debattierten sie, dann war alles geschafft. Wieder einmal war Wintersteiner aufgefallen, dass die Carin weder Kaffee noch Wasser annahm. Die Göttin der Askese… irgendwie war die Frau merkwürdig. Nicht uninteressant, aber schon ein bisschen seltsam. Immer in Grau oder Schwarz gekleidet, die Haare straff im Nacken zusammen gehalten, kein Make-up, selten ein Lächeln. Aber eine exzellente Mitarbeiterin.
Im allgemeinen Aufbruch und Zusammenräumen der Unterlagen fragte er sie: „Frau Carin, Sie promovieren doch?“
„Ja. Warum fragen Sie, Herr Wintersteiner?“
„Wenn Sie fertig sind, würde ich Sie gerne fest anstellen. Vollzeit. Zu einem deutlich besseren Gehalt natürlich. Interessiert?“
Jetzt lächelte sie tatsächlich eines ihrer seltenen Lächeln. „Aber natürlich. Sogar sehr! Ich werde im Oktober abgeben, denke ich, dann müssten die Prüfungen im Januar nächsten Jahres sein. Ist das zügig genug?“
„Auf jeden Fall. Aber wenn Sie vorher schon die eine oder andere Stunde mehr bei uns aushelfen könnten… Ihr Fachwissen ist wirklich beeindruckend.“
Er lächelte versuchsweise, sie erwiderte das Lächeln einen Moment lang, und bedankte sich mit einem Nicken.
„Gerne“, antwortete sie dann, „ich denke, einen Nachmittag mehr könnte ich jetzt auch schon einrichten. Den Donnerstag vielleicht?“
„Gleich diesen Donnerstag? Wunderbar!“
Frau Carin zog sich an ihren Schreibtisch zurück und überarbeitete einige Punkte im Übungsteil; erst gegen vier Uhr nachmittags verabschiedete sie sich, höflich wie immer.
Wintersteiner trat ans Fenster und sah ihr nach, wie sie die Straße in Richtung Uni davoneilte. Wirklich eine merkwürdige Person. Aber klug und höflich. Für eine Angestellte reichte das ja wohl.
Jetzt stoppte sie und sprach mit einem Mann. Wer das wohl war? Und was ging ihn das an? Ach, jetzt deutete sie in seine Richtung und ging weiter. Wohl nur ein Ortsfremder.
3 MO 16.04.
Eine Festanstellung im Lingua-Verlag… das wäre toll, freute Mathilde sich auf dem Weg in die Uni, kurz unterbrochen von einem recht schnöseligen jungen Mann, der aussah wie ein Juradrittsemester, aber nicht wusste, in welcher Richtung die Altstadt lag. Sie zeigte etwas uninteressiert in südliche Richtung und eilte dann weiter, um pünktlich im Kandidatenseminar zu erscheinen.
Sehr spannend war es dort nicht, zwei Teilnehmer stellten ihre Arbeiten vor und baten um konstruktive Kritik, es wurde etwas lahm diskutiert, die beiden bekamen einige Tipps, die nicht allzu originell waren, und schließlich beendete der Professor die Sitzung. Zwanzig vor sieben, stellte Mathilde fest. Das ging ja noch, da konnte sie noch etwas an ihrer Dissertation feilen.
Sie besorgte sich unterwegs noch eine Vollkornsemmel und aß zu Hause dann diese Semmel und einen Apfel, dazu ein hartes Ei. Das genügte, fand sie, besonders viel Hunger hatte sie eigentlich nie.
Seltsam, wenn man es recht bedachte, überlegte sie, als sie den Teller abspülte und wieder auf das Trockengestell legte. Als sie an ihrem achtzehnten Geburtstag das Haus ihrer Großeltern verlassen durfte, war sie noch furchtbar dick gewesen, bestimmt hatte sie fast doppelt so viel gewogen wie jetzt.
Hatte sie früher in Henting mehr Appetit gehabt?
Hatte es ihr dort besser geschmeckt?
Also, das schon mal ganz bestimmt nicht. Die Haushälterinnen hatten durch die Bank abscheulich gekocht und die Nonna hatte sie auch nie dazu animiert, ordentlich zuzugreifen. Eher hatte man das Gefühl, dass sie ihrer einzigen Enkelin das Essen nicht gönnte.
Warum hatte sie dann dort mehr gegessen?
Sie konnte sich erinnern, dass sie in ihren Teeniejahren fast täglich auf dem Weg nach Hause beim Discounter eine Riesentüte Kartoffelchips mit Paprikageschmack (Sonderpreis, 79 Pf.) gekauft hatte. Die wurde dann nach dem schrecklichen Mittagessen (fettige Bratkartoffeln ohne Fleisch, Arme Ritter, Milchreis mit zerlassener Butter) in ihrem Zimmer verspeist. Angst, erwischt zu werden, musste sie nicht haben – die Nonna betrat ihr Zimmer eigentlich nie, und der Großvater schon gar nicht.
Täglich rund 200 Gramm billigste Chips… kein Wunder, dass sie völlig aus dem Leim gegangen war! Den Fraß, der als Mahlzeiten serviert wurde, musste sie ja schließlich obendrein vorher auch noch herunterwürgen: „Du bist recht undankbar, wenn du nicht aufisst, schließlich geben wir dir ein Heim und füttern dich hier durch!“ Eigentlich total unlogisch…
Warum diese Chips so tröstlich gewesen waren, konnte sie heute gar nicht mehr nachvollziehen; als sie an ihrem 18. Geburtstag ihre kläglichen Ersparnisse genommen hatte und ausgezogen war, hatte das Verlangen nach Fett, Kohlehydraten und künstlichen Aromastoffen in knisternden Superriesenfamilienpartypackungen schlagartig nachgelassen. Und damit waren die Pfunde stetig dahingeschmolzen; nach etwa eineinhalb Jahren war sie auf sechzig Kilo herunter gewesen.
Nicht, dass dies der Nonna irgendein Wort der Anerkennung entlockt hätte! Außer verächtlichen Blicken und bestenfalls noch der Bemerkung, dass sie als Versagerin aus der Gosse sich wohl nicht einmal vernünftiges Essen leisten könne, war nichts gekommen, wenn man sich vor Gericht begegnet war. Der Großvater hatte genauso angewidert geschnauft wie früher, als sie noch fett gewesen war.
Ja, und dann war ja der Supergau geschehen: Tante Anni war vor gut viereinhalb Jahren gestorben und hatte die fünf neuen und gut vermieteten Eigentumswohnungen in Mönchberg ihrer Schwester hinterlassen und – Sakrileg! – ihre eigene, etwas ältere und extrem vollgestopfte Wohnung im Waldburgviertel ihrer Großnichte Mathilde – damit das Kind ein ordentliches Zuhause hat.
Sofort hatte die Nonna dagegen geklagt – durch zwei Instanzen, und jedes Mal verloren. Beide Male hatten die Richter mit deutlichem Befremden darauf reagiert, dass sie ihrer einzigen Enkelin ein Erbe nicht gönnte, das nur ein Fünftel ihres eigenen Anteils ausmachte. Sie konnte ja keine vernünftige Begründung anführen, schwadronierte nur immer, Mathilde sei „unwürdig“ und habe Anni unzulässig beeinflusst, verstummte aber ärgerlich, wenn der Richter sie aufforderte, dies doch bitte zu präzisieren und vor allem auch zu belegen. Mathilde selbst hatte überhaupt nicht ausgesagt, sondern alles Ulli Petzl, ihrer Anwältin, überlassen.
Nach der zweiten Niederlage hatte die Nonna im Hinausrauschen verkündet, sie werde weiter klagen, denn Mathilde stehe überhaupt kein Cent vom Familienvermögen zu. „Du wirst das noch bereuen, pass nur auf!“, hatte sie gezischt, Mathilde aus dem Weg geschubst und das Gerichtsgebäude verlassen. Mathilde und Ulli hatten ihr kopfschüttelnd nachgesehen.
Seitdem war aber nichts mehr passiert; trotzdem traute Mathilde dem Frieden nicht. Am liebsten wäre sie in eine kleine Mietwohnung gezogen, aber sie hätte die Dreieinhalbzimmerwohnung im Rembrandtweg ja trotzdem sauber halten und heizen müssen. Und das Wohngeld bezahlen. Zwei Wohnungen konnte sie sich mit dem, was sie bei Lingua und mit gelegentlichen Nachhilfestunden verdiente, nicht leisten.
Der Schwebezustand ging ihr aber allmählich auf die Nerven.
Immer noch waren Schränke und Kommoden mit Tante Annis Besitztümern gefüllt, während Mathilde selbst ihr absolut Unverzichtbares in ein einziges Schrankfach und ebenso in ein einziges Regalfach gepackt hatte und alles andere in Umzugskisten in der Abstellkammer und im Flur aufbewahrte. Allmählich konnte sie deren Inhalt wohl unbesehen wegwerfen… was man fast fünf Jahre nicht gebraucht hatte, brauchte man wohl generell nicht mehr.
Wie wohnten wohl andere Leute? Sie kannte eigentlich nur das Haus ihrer Großeltern, groß, düster, prunkvoll im Geschmack der vorletzten Jahrhundertwende und immer schlecht geheizt.
Gut, ab und zu war sie als Kind bei Nachbarn gewesen, Keppels, und hatte mit Sandra gespielt, die Barbies Traumhaus besaß und eine Riesenkiste echter Barbiekleider. Die Nonna hätte nicht im Traum daran gedacht, ihr so etwas zu schenken. Mathilde bekam pro Woche fünf Mark Taschengeld, bis sie achtzehn war, und davon hätte sie sich ja solchen Unsinn kaufen können, hatte die Nonna verkündet. Zu Geburtstag und Weihnachten gab es Wäsche und Kleidung – natürlich auch keine Jeans, sondern graue Kleider mit Spitzenkragen, Faltenröcke und brave Pullover in gedeckten Farben. Zeug, das die Nonna auch selbst angezogen hätte.
Im Nachhinein fragte Mathilde sich, wo sie diesen tantigen Kram bloß in Kindergrößen aufgetrieben hatte – dass es ihr die viele Zeit wert gewesen war, bloß, um ihr die Kindheit zu versauen?
Das hatte übrigens nicht funktioniert – die Nonna war ein, zweimal in der Schule aufgetaucht und hatte Mathildes Klassenkameraden in Angst und Schrecken versetzt. Niemand dachte daran, sie wegen ihrer furchtbaren Klamotten oder der Tatsache, dass sie nie mit ins Kino durfte, zu mobben, alle bedauerten sie und waren extra nett zu ihr. Das nervte irgendwann zwar auch, aber Mathilde wusste natürlich, dass sie dafür dankbar sein konnte.
Sie schüttelte den Kopf. Statt hier düsteren Kindheitserinnerungen nachzuhängen und dabei vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen, sollte sie lieber ihre Dissertation zum x-ten Mal durchlesen und sich notieren, was sie eventuell noch einmal nachschlagen musste.
Sie sah etwa zwanzig Seiten durch und fand noch einige Schwachstellen, dann schweiften ihre Gedanken wieder zurück zu Barbies Traumhaus. Sandra hatte irgendwann das Interesse an ihr verloren, weil Mathilde kein Barbie-Equipment mitbringen und auch keine Gegeneinladungen bieten konnte. Dabei hätte sich ihr riesiges Zimmer gut dafür geeignet, Barbies sämtlichen Krempel auf einmal aufzubauen.
Riesig, kalt und halb leer, erinnerte sich Mathilde. Riesig wohl auch nur deshalb, weil es in der Hentinger Villa einfach keine kleinen Zimmer gab. Unter vierzig Quadratmeter war da nichts zu finden. Ihre frühere Wohnung – im Legohaus – war insgesamt kaum halb so groß, aber geschickt eingerichtet. Eigentlich hatte es ihr dort ganz gut gefallen…
Sie seufzte und arbeitete weiter. Was brachte es schließlich, über die Vergangenheit nachzudenken?
4 FR 20.04.
Bis Freitag hatte sie ihre Arbeit zum gefühlt zwanzigsten Mal durchgesehen und einige ertragreiche Stunden in der Unibibliothek und der Bibliothek des Romanistischen Instituts zugebracht und war jetzt davon überzeugt, dass sie alles, was es über einige weniger bekannte deutsche Autoren und ihre Flucht über die Pyrenäen nach Spanien zu wissen gab, herausgefunden und griffig und perfekt belegt dargestellt hatte. Bis zum Herbst würde sie allerdings die Arbeit noch einige Male durchfieseln müssen, das war ihr auch klar.
Im Verlag war sie gut zurechtgekommen und Wintersteiner hatte ihr neben der Arbeit an diesem Schulbuch und dem dazu passenden Übungsheft auch noch die Übersetzung eines spanischen Kriminalromans angeboten.
Das erste Kapitel hatte sie schon fertig, also konnte sie eigentlich recht zufrieden mit sich sein.
Nun sah sie sich etwas unschlüssig in der Wohnung um: Gab es nicht doch eine Möglichkeit, sie etwas bewohnbarer zu machen – ohne sich an Dingen zu vergreifen, für die die Nonna dann womöglich einen astronomischen Schadenersatz verlangen würde?
Im Schlafzimmer fiel ihr nichts ein – es sei denn, sie kaufte haufenweise Umzugskisten, um Tante Annis Garderobe darin zu verstauen – aber dann standen überall die Kisten herum, und das nur, um ihre wenigen eigenen Klamotten zu verstauen? Das eine Schrankabteil reichte doch wirklich aus! Der Kram in den beiden Nachtkästchen gehörte auch Tante Anni, aber obendrauf lag ihr Handy und manchmal noch ein Buch (aus Tante Annis Regalen). Auch das reichte ihr.
Am ehesten nutzte sie noch das Arbeitszimmer. Sie hatte sich erlaubt, Tante Annis Schreibtischgarnitur sorgfältig zu verpacken und in einen Schrank zu stopfen, so dass nun ihr etwas ältlicher Laptop auf der Platte Platz fand. Und auf einer vollgepackten Kiste neben dem Schreibtisch hatte sie ihre eigenen paar Bücher untergebracht; das große dicionario hatte einen Ehrenplatz auf dem Schreibtisch erhalten.
Die übervollen Regale entlockten ihr einen leisen Seufzer – was Tante Anni hier alles gesammelt hatte! Wenn es nach ihr ginge, würde das zu fünfundneunzig Prozent im Altpapiercontainer landen. Na gut, oder im Wertstoffhof. Oder in der Lesefabrik in der Graf-Tassilo-Straße – aber die würden diesen Kram wohl auch nicht mehr haben wollen.
Eher noch den Edelkitsch, der die Regale im Wohnzimmer verstopfte. Oben Regale, darunter Schränke voller Porzellan, Silber und allerlei Schnickschnack.
Weiteres Porzellan füllte die Oberschränke in der Küche; sie selbst besaß gerade einen Satz schwarze Teller, Besteck für sechs und zwei Kaffeebecher. Und das wohnte alles auf dem Trockengestell. Ach ja, und sechs Saftgläser gab es auch noch.
Diese Askese wurde nur dadurch gestört, dass sie im Zweifelsfall Tante Annis Brotmesser und Tante Annis Gurkenhobel zu verwenden pflegte; immerhin spülte sie sie hinterher aber auf das Gründlichste ab.
Frustriert wandte sie sich den Kisten in der Abstellkammer zu und zerrte sie in den Flur: Vielleicht konnte man tatsächlich etwas daraus loswerden? Vielleicht sogar aus drei Kisten zwei machen?
In der ersten Kiste fand sie ihre Winterjacke, die sie eindeutig noch brauchte, ihre Winterstiefel, ordentlich geputzt und in einen halben Meter Küchenkrepp eingeschlagen, Schal und Handschuhe aus dunkelgrauem Fleece und zwei recht ordentliche Halstücher. Sie entfaltete sie: gar nicht so schlecht! Das eine hatte sie schon fast zehn Jahre, sie hatte es auf einem Jahrmarkt gewonnen. Baumwolle, dunkelrot mit weißen Pünktchen und Streifen. Das konnte vielleicht ganz gut zu ihren grauen Sachen passen…
Das andere sah recht edel aus, bedruckt mit Pferdeköpfen und Hufeisen – aber es war aus 100 % Polyester. Nein, das kam weg. Auf dem Grund der Kiste entdeckte sie noch einen Umschlag mit einigen Fotos, zwei Bücher aus ihrer Teeniezeit und ein krumm und schief besticktes Leinendeckchen. Sie nahm die letzten Fundstücke heraus und packte ihre Winterausrüstung wieder zurück in die Kiste, dann setzte sie sich mit ihrer Ausbeute wieder an den Schreibtisch.
Das Deckchen hatte sie mal im Handarbeitsunterricht verbrochen – mit etwa zehn Jahren - und voller Optimismus der Nonna zu Weihnachten geschenkt. Der Versuch, den Drachen milde zu stimmen, war aber gescheitert, die Nonna fand das Deckchen hässlich und schlecht gestickt und verweigerte die Annahme.
Deprimierend… aber wenn sie sich heute so ihr Meisterwerk ansah: So ganz unrecht hatte die Nonna nicht gehabt, wenn sie auch ruhig ein Minimum an Takt hätte zeigen können. Nein, das Deckchen kam weg, was sollte sie noch mit Erinnerungen an die Herzlosigkeit der Nonna? Die konnte sie sich auch so gut genug merken.
Die Bücher aus der Teeniezeit würde sie ebenfalls entsorgen – da hegte sie auch keine besonders nostalgischen Gefühle.
Oder doch? Sie ließ die zerlesenen Bücher (treues Pony, erste Liebe…) sinken und horchte in sich hinein. In Henting war sie lange nicht mehr gewesen… wie wäre es, morgen dort spazieren zu gehen und das Gefühl zu genießen, an der Horrorvilla einfach vorbeizugehen? Es auszukosten, dass sie hinterher ganz lässig in den Bus steigen und nach Hause fahren konnte?
Gute Idee.
Sie gähnte und öffnete den Umschlag mit den Fotos.
Ach ja, Klassenfotos!
Da, die achte Klasse. Sie selbst war total dick und hatte sich halb hinter Sandra versteckt, die vergnügt in die Kamera grinste. Eigentlich strahlten alle (war das nicht ganz kurz vor den Sommerferien gewesen? Kein Wunder!), nur Mathilde nicht, die schaute ernst und gefasst in die Kamera: Das Leben ist hart und grausam…
Und die fünfte Klasse: Sie war der Moppel in der ersten Reihe. Gut, dass sie auf dem Boden saß, so fiel die Fülle nicht gar so sehr auf. Wie ein kleiner Kartoffelsack. Aber es gab damals noch einige andere Babyspeckträger in der Klasse.
Bei den anderen hatte sich das in der Mittelstufe verwachsen, bei ihr erst kurz vor dem Abitur.
Wo war hier denn Sandra? Ach ja, dahinten, neben dem süßen Leon, der in der Mittelstufe so schwere Akne bekommen hatte. In Leon hatten sich in der fünften Klasse alle Mädchen verliebt – er aber spielte immer noch mit Matchboxautos, Dragon Cards und seinem vorsintflutlichen Computer.
Mathilde ließ die Fotos auf die Tischplatte sinken. Henting in den mittleren Achtzigern… da gab es ja noch Telefonzellen! Und Briefkästen! Allein deshalb sollte sie morgen in der alten Heimat vorbei schauen, vielleicht hatte die Neuzeit auch dort endlich Einzug gehalten?
Nicht, solange die Nonna noch etwas zu sagen hatte, vermutete sie, steckte die Fotos zurück in den Umschlag und legte den Umschlag quer auf ihre eigenen Bücher. Dann ging sie ins Bett.
Wenn sie ihre Lieber-nichts-anfassen-Haltung richtig durchziehen würde, müsste sie auf dem Sofa im Arbeitszimmer nächtigen, überlegte sie beim Einschlafen, aber dazu war ihr ihr Rücken dann doch zu schade. Immerhin benutzte sie ihr eigenes altes Bettzeug aus Selling und hatte Tante Annis Luxus-Ausstattung nach einer gründlichen Reinigung im Schrank verstaut.
5 SA 21.04.
Sie liebte Wochenenden – aber wer tat das nicht? Für diese entspannten Tage hatte sie noch ganz alte verwaschene Jeans und einen Pullover, den sie sich vor bestimmt zehn Jahren einmal gestrickt hatte – nicht gerade gekonnt, aber das war am Wochenende ja nun wirklich egal, da sah sie schließlich niemand.
Sie frühstückte ausgiebiger als sonst, was bedeutete, dass sie sich mehr Zeit ließ und währenddessen ein Buch las, nicht etwa, dass sie wirklich mehr aß. Seit Jahren aß sie immer das Gleiche, ausgewogen und gesund. Ein bisschen langweilig, überlegte sie und erschrak über diesen direkt ketzerischen Gedanken.
Sollte sie einmal etwas anderes frühstücken als Vollkornbrot, Ei und eine Auswahl an Obst und Gemüse? Aber was? Käse und Wurst mochte sie nicht besonders, Weißbrot war blanker Müll, Müsli war auch nicht so gesund, wie man gemeinhin glaubte.
Vielleicht mal ein Spiegelei?
Zu mühsam.
Sie mümmelte ihre Mohrrübe und überlegte weiter, aber Alternativen fielen ihr nicht ein. Marmeladenbrot? Iih… Sie schnitt den Apfel in mundgerechte Stücke und kaute langsam und genüsslich. Joghurt? Sie mochte keine Milchprodukte.
Himmel, was mochte sie denn?
Vollkornbrot, Ei und Gemüse. Basta. Sie aß ja auch keine Ostereier – außer den hart gekochten – und keine Weihnachtsplätzchen, auf das süß-fettige Zeug wurde ihr nur schlecht.
Mal eine schöne Suppe… ja, gut, aber doch nicht zum Frühstück! Aber vielleicht heute Mittag. Natürlich aus der Dose. Und wenn sie in Henting nicht nur bummelte, sondern mal nachsah, ob der kleine Supermarkt Kant-/Ecke Fichtestraße noch existierte? Der würde ja wohl eine anständige Dose Gulaschsuppe haben.
Oder so eine richtig dicke Pilzcreme… das klang verlockend, auch wenn da garantiert wieder Geschmacksverstärker drin waren. Egal, darüber mussten sich jawohl eher Leute mit Gewichtsproblemen Gedanken machen, und sie war eher etwas zu dünn.
Oder Minestrone?
Ja, vielleicht.
Mittags mal Nudeln? Oder Reis? Aber das machte so müde… Dazu hatte sie im Allgemeinen zu viel zu tun. Gut, am Wochenende war das nicht so tragisch - aber wozu dann das halbe Wochenende verschlafen?
Nein, das war alles Blödsinn. Sie würde jetzt schön nach Henting fahren, mit dem Bus natürlich, so wie früher, und dort ausgiebig spazieren gehen. Und dann würde sie zur Uni fahren und sich bei Salads&More einen richtig großen leckeren Salatteller gönnen.
Genau.
Der Bus war ziemlich leer, kein Wunder - die Hentinger fuhren nicht Bus, die besaßen Autos. Und wenn sie schon fuhren, dann am Samstagvormittag doch eher in die andere Richtung.
Auch gut! Mathilde setzte sich an das sauberste Fenster und schaute wie eine Touristin aus dem Fenster. Wie würde sie Leisenberg und Henting wohl wahrnehmen, wenn sie tatsächlich zum ersten Mal hier wäre? Schwer nachzuvollziehen.
Am Herzog-Roderich-Platz hatten sie ein Eckhaus abgerissen und hoben eine Baugrube aus. Was da wohl hinkam? An der nächsten Haltestelle hatte eine Filiale einer allseits bekannten Einrichtungskette aufgemacht, die vor allem überflüssigen und witzig sein wollenden Schnickschnack führte. Total uninteressant.
Noch zwei Stationen.
Seit wann gab es denn kurz vor Henting einen Erotikshop? Dass die Nonna das nicht verhindert hatte? War sie vielleicht doch nicht so allmächtig, wie alle – nicht zuletzt sie selbst – immer geglaubt hatten? Da musste man ja fast grinsen…
Am Fichteplatz stieg sie aus und sah sich um, dann atmete sie tief ein. Die Luft hier war ja schon gut, das ließ sich nicht bestreiten. Keine Spur von Moder und Gruft, reine Natur und ein Hauch von Frühling. Das waren wahrscheinlich die Kirschbäume da drüben, die gerade am Abblühen waren.
Sie wanderte langsam die Fichtestraße entlang und musterte die großen alten Häuser hinter den bemoosten Steinmauern. Manche waren vom Architektonischen eigentlich schon schön – aber doch etwas düster, man konnte sich gar nicht vorstellen, dass dort glückliche Familien lebten. Oder lag das an ihr selbst, die überall unglückliche kleine Mädchen mit lieblosen Großeltern witterte und so alle Häuser mit der Gruft in der Schellingstraße 17 gleichsetzte?
Immerhin hatte man das kleine Schlösschen Ecke Fichte- und Kantstraße neu gestrichen. Etwas arg quietschrosa, fand sie, aber es sah unbestreitbar fröhlich aus. Hatte die Nonna da nichts zu meckern gehabt?
Jammerschade, dass sie keinen Spion hier hatte… ja, wenn Manuel Keppel noch hier wohnen würde – aber der war bestimmt längst irgendwohin gezogen, wo es geringfügig aufregender zuging. Und Sandra hatte bestimmt längst geheiratet und lebte ein glückliches Leben wie in der IKEA-Werbung.
Was machte sie hier eigentlich?
Warum sollte sich nicht Sandra in der Weltgeschichte herumtreiben und aufregende Projekte durchziehen – und Manuel versorgte die Kinder, während seine Frau einen Vollzeitjob hatte? Woher kamen bloß diese unemanzipierten Denkansätze?
Das konnte sie nicht einmal der Nonna in die Schuhe schieben. Mit Heimchen am Herd hatte sie es gar nicht, kein Wunder, wenn man bedachte, welche Bissgur´n sie selbst war.
Huch, was war denn da passiert?
Gegenüber der zuckrigen Fassade in knallrosa, weiß und silber hatte man anscheinend eine der uralten Villen abgerissen. Hatten da nicht früher mal die Schmitzkes gewohnt, diese merkwürdigen alten Leute mit dem Hund, der immerzu geifernd am Zaun hing? Es hatte länger gedauert, bis Mathilde klar wurde, dass der grässliche Köter nicht über den hohen Zaun springen und kleine Mädchen fressen konnte – aber die ganze zweite Klasse hindurch hatte sie lieber einen größeren Umweg zur Bushaltestelle gemacht.
Jetzt war das Untier natürlich lange tot – und dass dieses Horrorhaus nicht mehr existierte, freute Mathilde direkt. Die kunterbunten Reihenhäuser, die jetzt dort standen, sahen viel netter aus. Und die Vorgärten voller Bobbycars, Fahrräder, Roller und Sandspielzeug zeigten, wie viele Kinder hier wohnten und hoffentlich so viel Krach machten, dass die Nonna langsam wahnsinnig wurde.
Sie musterte die Reihenhäuser beifällig und schlenderte weiter. Die Reihenhausanlage reichte bis zur Ecke Schellingstraße. Sie trat auf die Fahrbahn, um die Straße zu überqueren, und sprang entsetzt zurück, als ein feuerroter Kleinwagen vorbeischoss.
„Was zum Henker…?“, keuchte sie erschrocken. Hier war doch Tempo dreißig, immer schon gewesen? Seitdem es das gab, wenigstens. Wie konnte man hier so rasen und harmlose Fußgänger gefährden?
Okay, sie bildete sich ein, ein junges erschrockenes Gesicht hinter dem Steuer gesehen zu haben. Eine Frau. Führerscheinneuling, gerade dem begleitenden Fahren entronnen.
Und hier war dermaßen tote Hose, dass man wohl Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht so eng sah. Absolut niemand auf der Straße.
Nicht einmal eine Mama oder ein Papa auf dem Fahrrad mit Kinderanhänger auf dem Weg zum Wertstoffhof.
Nicht einmal kichernde Teenies auf dem Weg zum Bus, um am Markt ein bisschen zu shoppen, angesagte T-Shirts oder Schuhe.
Nicht einmal Väter auf dem Weg zum Elektronikmarkt oder zum Baumarkt. Oder machten so was hier draußen ohnehin die Hausmeister?
Der Großvater hatte nie etwas am Haus gerichtet, dafür bestellte die Haushälterin dann Handwerker – aber waren die Sitten immer noch so?
Jedenfalls war die Gegend total ausgestorben. Mathilde atmete tief durch, presste kurz die Hand auf ihr wild pochendes Herz, sah sich gründlich um und überquerte dann doch die Straße.
Die Schellingstraße war genauso menschenleer. Nicht einmal Laub lag auf den Bürgersteigen! Anscheinend hatte man schon die dienstbaren Geister mit dem Besen nach draußen geschickt.
Hier standen noch alle Häuser von früher, aber sie wirkten etwas kleiner und weniger gut in Schuss, kein Wunder. So billig war es nicht, diese uralten Riesenhütten instand zu halten. Mathilde wechselte auf die andere Straßenseite, um nicht etwa von der Nonna oder dem Großvater gesehen zu werden. Außerdem sah man von dort das Haus in seiner Gesamtheit besser.
Nummer siebzehn sah aus wie immer. Einen frischen Anstrich hätte es zwar vertragen können, aber davon abgesehen wirkte es noch einigermaßen gepflegt. Zu sehen war freilich niemand, aber die Nonna und der Großvater waren noch nie große Fans ihres eigenen Gartens gewesen, egal ob Gartenarbeit oder Abhängen im Liegestuhl. Hinter einem Schreibtisch oder in der Küche wichtig tun – ohne wirklich selbst zu arbeiten – das lag beiden deutlich mehr.
Auf der Straße vor dem Haus stand nur ein Wagen, ein dunkelblauer Polo ohne nähere Typenbezeichnung. Der war dann wohl für die Haushälterin gedacht. Hatten die beiden eine neue? Warum parkte die nicht drinnen?
Mathilde überlegte, aber sie konnte sich nicht erinnern, dass Frau Deinlein einen Wagen gehabt hatte. Konnte die überhaupt Auto fahren? War sie nicht immer mit dem Fahrrad losgezogen? Zu den Läden vorne am Schopenhauerplatz? Wie alt war sie heute wohl? Als Mathilde das Haus verlassen hatte, war Frau Deinlein schätzungsweise Anfang fünfzig gewesen… dann war sie jetzt ja wohl allmählich reif für die Rente. Ob die Nonna ihr irgendwas zahlen würde?
Das Haus sah wirklich tot aus, aber das war ja eigentlich nichts Neues. Sie wandte sich ab und ging weiter. Ein Mann kam ihr entgegen, Jeans, Walkjanker, kariertes Hemd – aber für irgendwelche Volksfeste war doch eigentlich gar nicht Saison?
Als der Mann auf Mathildes Höhe ankam, warf er einen giftigen Blick auf Nummer 17 und zischte: „Alte Hexe!“
Mathilde unterdrückte ein Glucksen und ging ohne Kommentar weiter. Die Nonna hatte also wirklich Feinde? Das geschah ihr Recht!
Und am Schopenhauerplatz hatte sich das Ladenangebot ziemlich verändert. Hier war sie wirklich elf Jahre lang nicht mehr gewesen, und damals hatte es einen kleinen, teuren Supermarkt, eine etwas altmodische Drogerie, eine Apotheke und eine Reinigung gegeben. Ja, und den Zeitungskiosk, bei dem man auch am Wochenende Chips kaufen konnte, wenn der Leidensdruck zu groß war.
Halb deprimiert, halb schadenfroh sah Mathilde sich um: Ein Pizzadienst, die Apotheke (Apotheken starben nicht), ein leerer Laden (ZU VERMIETEN), ein Laden für orthopädische Waren – war die Klientel jetzt schon so alt, dass sich ein Rollator-Shop rentierte? Und der Kiosk war verschwunden, an der Stelle stand nun eine Werbetafel. Geworben wurde für ein Musical in Hamburg.
Deprimierend, wirklich. Aber der Nonna war´s zu gönnen.
Mathilde drehte eine Runde um den Platz, strafte die Straßen, die zum Leiß-Hochufer führten, mit Nichtachtung und schlenderte auf Umwegen zum Fichteplatz zurück, wo sie auf den Bus wartete.
Henting konnte man wirklich abhaken, fand sie, als sie nach Hause kam. Öde wie immer. Nein, noch öder. Und die Nonna oder den Großvater besuchen? Kam ja gar nicht in Frage, sie war bloß froh, dass sie da raus war.
Und als Samstagsspaziergang hatte das Ganze seinen Zweck sehr zufrieden stellend erfüllt.
Sie setzte sich wieder an ihre Dissertation und las sie erneut Korrektur, machte sich Notizen, straffte gelegentlich den Satzbau, strich wieder einige Füllwörter (warum fand man immer wieder welche, egal, wie oft man den Text schon gelesen hatte?), entdeckte zwei Stellen, an denen ein Beleg etwas unklar klang, und schrak hoch, als es an der Tür klingelte.
6 SA 21.04.
War das, seitdem sie hier wohnte – naja, hauste – jemals vorgekommen? Doch, einige Drücker, die Zeugen Jehovas, eine Nachbarin, um ein Paket abzuholen. Sonst niemand – wer denn auch?
Sie legte die Kette vor und äugte misstrauisch durch den Türspalt.
Zwei grüne Ausweise mit dem Leisenberger Stadtwappen wurden ihr entgegen gehalten. Huch – Polizei?
Verblüfft löste sie die Kette und öffnete.
„Frau Carin? Mathilde Carin?“
„Ja, die bin ich“, entgegnete Mathilde langsam, „worum geht es denn? Ist hier im Haus etwas passiert?“
„Dürfen wir hereinkommen?“
„Entschuldigung, natürlich. Bitte hier entlang. Möchten Sie einen Kaffee?“
Beide lehnten ab. Mathilde lotste die Frau, vor der sie instinktiv etwas Angst hatte, und den jungen Mann, der sehr viel netter wirkte, ins Wohnzimmer, wo sie sich sofort schämte, als die beiden sich eindeutig irritiert umsahen.
Immerhin hatte sie erst gestern die Sofas abgestaubt.
„Gemütlich“, sagte die Frau dann ausgesprochen unaufrichtig.
Mathilde lächelte schwach. „Ist das Ironie? Ich kann´s verstehen, das Zimmer ist ziemlich scheußlich, aber das kann ich leider nicht ändern.“
„Ach“, mischte sich der junge Mann ein, „warum denn nicht?“
Mathilde winkte ab. „Das ist eine lange, alte Geschichte. Was kann ich denn für Sie tun?“
„Ihre Großeltern wohnen in Henting, Schellingstraße 17?“
„Ja, das stimmt – warum?“
„Wann waren Sie zum letzten Mal dort?“
„Hm“, machte Mathilde, „meinen Sie, bei den beiden im Haus oder einfach in der Gegend?“
„Ist das nicht das Gleiche?“
„Nein, absolut nicht. In der Gegend war ich erst heute Mittag, ein kleiner nostalgischer Spaziergang. Und bei meinen Großeltern war ich zum letzten Mal am 16. April 1997.“
„Das wissen Sie noch so genau?“
„Ja, Frau - ?“
„Malzahn. Wie der Drache bei Jim Knopf.“
Mathilde kicherte pflichtschuldig, dann wurde sie wieder ernst. „Am 16. April 1997 war mein 18. Geburtstag, ab diesem Tag konnte ich das Haus in Henting legal verlassen.“
„Sie mochten Ihre Großeltern nicht?“
„Ich kann sie nicht leiden. Auch heute noch, aus der Ferne. Deshalb hatte ich auch nie das Bedürfnis, sie jemals wieder zu sehen. Das dürfte aber auf Gegenseitigkeit beruhen. Die beiden haben mich gehasst, seitdem ich bei Ihnen leben musste.“
„Warum mussten Sie das denn?“ Der junge Mann schien sich mehr für das Zwischenmenschliche zu interessieren.
„Ich denke, weil meine Eltern tot waren. Aber Einzelheiten weiß ich nicht, wenn ich gefragt habe, wurde ich angeschnauzt. Ich bin zu meinen Großeltern gekommen… äh. Erinnern kann ich mich daran nicht, ich glaube, ich muss so etwa ein halbes Jahr alt gewesen sein. Mein Vater hieß Walter, das weiß ich. Meine Mutter… da hat die Nonna nur gesagt, sie ist froh, dass die Göre weg ist. Aber was das nun genau heißen sollte – da müssen Sie schon die Nonna fragen. Ihnen sagt sie´s ja vielleicht, mir auf keinen Fall. Aber eigentlich ist es mir mittlerweile auch egal“, fügte Mathilde trotzig hinzu.
„Das dürfte schwierig werden“, murmelte der junge Mann.
„Joe!“, mahnte die Beamtin Malzahn. War sie nun eine Kommissarin? Durfte man das fragen? Und jetzt trat sie ihrem Kollegen auch noch ans Schienbein!
„Kann ich mir vorstellen“, schmunzelte Mathilde, um die Lage zu entspannen. „Die Nonna hat ziemlich Haare auf den Zähnen – um es mal freundlich auszudrücken.“
„Wieso eigentlich Nonna?“, wollte die Malzahn nun wissen. „Sie war doch keine Italienerin?“
„Weiß ich auch nicht so genau“, musste Mathilde zugeben. „Vielleicht fand sie ja, so was wie „Oma“ wäre zu nahe… sie wollte schon eine gewisse Distanz zu mir aufrechterhalten. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht mochte sie mich einfach- hoppla, haben Sie vorhin gesagt, sie war Italienerin? Besser gesagt, nicht? Äh - wieso war? Ist ihr was passiert?“
„Ja“, antwortete die Malzahn langsam, „sie ist tot.“
„Hui“, machte Mathilde beeindruckt. „Die Nonna – tot? Ehrlich gesagt hab ich sie für mehr oder weniger unsterblich gehalten… Die Nonna… und vermutlich ist sie nicht an Altersschwäche dahingeschieden, sonst wären Sie ja wohl nicht hier… was ist passiert?“
„Sehr traurig wirken Sie ja nicht gerade“, bemängelte dieser Joe.
„Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass ich sie nicht leiden konnte, Herr -?“
„Schönberger. Stimmt. Und wo waren Sie zur Tatzeit?“
„Joe!“ Die Malzahn verdrehte gut sichtbar die Augen.
Mathilde lächelte vorsichtig. „Das sage ich Ihnen gerne, sobald Sie mir sagen, was die Tatzeit ist.“
„Lieber noch nicht.“ Die Warnung hatte anscheinend ihren Empfänger erreicht. Mathilde überlegte kurz, ob dieser Schönberger vielleicht ein kleines bisschen – na, sagen wir - simpel gestrickt war.
„Nun gut, aber einen ungefähren Zeitraum müssen Sie mir schon angeben. Sonst erzähle ich Ihnen alles, was mir seit 1997 passiert ist, und das könnte etwas dauern – halt, nein! Ich hab die Nonna ja zum letzten Mal vor zweieinhalb Jahren gesehen. Irgendwann im Oktober 2004 – soll ich da anfangen?“
Bei der Malzahn zuckte ein Mundwinkel, und Schönberger ärgerte sich.
Kurzes Schweigen.
„Wieso vor zweieinhalb Jahren?“, wollte Schönberger dann wissen.
„Da war der letzte Prozess“, gab sich Mathilde wortkarg.
„Welcher Prozess?“
„Na, um diese Wohnung hier. Die Nonna war sauer, dass die Tante Anni mir eine ihrer sechs Wohnungen vermacht hat, und hat mich verklagt. Ungebührliche Einflussnahme oder wie das genannt wurde.“
„Und?“ Die Malzahn wirkte nun auch neugierig.
„Na, ich bin immer noch hier, nicht? Bis jetzt hat sie zweimal verloren. Ich hab immer noch darauf gewartet, dass sie wieder in Revision geht.“
„Wer hat die anderen fünf Wohnungen geerbt?“
„Die Nonna selbst, sie war ja Tante Annis Schwester. Die anderen fünf sind ziemlich neu und gut vermietet, die hier ist älter und vollgestopft, weil ja die Tante Anni hier gelebt hat.“
„Und warum haben Sie sie nicht entrümpelt?“
Mathilde sah Schönberger entgeistert an. „Ich bin doch nicht lebensmüde! Nachher gewinnt die Nonna den nächsten Prozess und ich muss hier raus, und die Nonna verklagt mich auf Schadensersatz, wenn auch nur eine alte Zeitschrift von der Tante Anni fehlt. Oder ich irgendein Handtuch abgenutzt habe.“
„Dann ist es ja günstig, dass Ihre Großmutter jetzt tot ist“, stellte die Malzahn fest. Das klang irgendwie lauernd, fand Mathilde. Sie überlegte. „Ja, vielleicht. Obwohl – vielleicht macht der Großvater jetzt weiter? Der hätte diese Wohnung bestimmt auch gerne.“
„Er hat fünf Wohnungen von seiner Frau geerbt und diese Riesenscheune in Henting!“ Schönberger war entrüstet.
„Ja und? Noch eine Wohnung mehr wäre doch noch besser, oder?“
„Was würden Sie machen, wenn Ihr Großvater Sie hier herausklagt?“, fragte die Malzahn.
Mathilde zuckte die Achseln. „Ich weiß nicht. Wieder dahin ziehen, wo ich vorher gewohnt habe, vermutlich. Ins Legohaus. Oder sonst in einen Appartementkomplex, weiter draußen. So viel verdiene ich schon, dass es für ein Dach über dem Kopf reicht.“
„Was machen Sie denn beruflich?“
„Neben dem Studium? Ich jobbe im Lingua-Verlag. Im Moment arbeite ich an einem Spanisch-Lehrbuch mit und manchmal kann ich auch was übersetzen. Und wenn es gar nicht anders geht, gebe ich ein bisschen Spanisch-Nachhilfe. Am Leo gibt´s ja Spanisch als dritte Fremdsprache. Und Latein hätte ich auch noch im Angebot. Außerdem hab ich meine Dissertation so gut wie fertig, und dann kann ich Vollzeit bei Lingua anfangen. Sie sehen, ich komme schon zurecht. Auf meine Großeltern kann ich ganz gut verzichten.“
„Aber vielleicht erben Sie ja was…“ Schönberger sah regelrecht diabolisch drein. Na, daran sollte er aber noch etwas arbeiten.
„Unwahrscheinlich. Ich denke doch, dass alles der Großvater kriegt und ich enterbt bin. Macht mir nichts. Und mehr Verwandte gibt es meines Wissens nicht.“
„Ja, gut… und, wo waren Sie jetzt – sagen wir, heute tagsüber?“
„Huch, ist es erst heute passiert?“
Mathilde dachte scharf nach, um nichts zu vergessen und erzählte dann, dass sie nach dem Frühstück in Henting spazieren gegangen war, aus einer eher unerklärlichen Anwandlung von Nostalgie heraus.
„Dabei sehne ich mich wirklich nicht dorthin zurück! Ob das eine Art Vorahnung war? Egal, jedenfalls bin ich danach – schätzungsweise so gegen zwölf – ins Salads gegangen, auf einen schönen großen Mittagssalat, und dann hier her zurück. Und ab an den Schreibtisch.“
„Am Samstag?“ Schönberger war schon wieder entrüstet.
„Ja und? Sie arbeiten doch auch am Samstag! Was sollte ich denn sonst machen? Spazieren war ich schon, gegessen hatte ich auch schon, und die Diss ist noch nicht fertig. Wenn ich damit durch bin, kann ich ja später ein gutes Buch lesen, um den Feiertag zu ehren.“
„Freunde treffen?“
„Was?“ Mathilde runzelte die Stirn, und Schönberger vertiefte das Thema nicht weiter.
„Ein besonderes Alibi ist das nicht“, tadelte die Malzahn.
„Ja, tut mir Leid. Ich wusste nicht, dass ich eins brauche. Wollen Sie mich verhaften? Das wäre natürlich ärgerlich, gerade wo mir Wintersteiner den Vollzeitjob angeboten hat…“
„So schnell sind wir auch wieder nicht. Aber Sie halten sich zur Verfügung!“
„Natürlich“, antwortete Mathilde leicht erstaunt. „Ich bin immer entweder hier oder bei Lingua oder in der Uni. Oder vielleicht mal kurz was einkaufen. Ich schreibe Ihnen schnell alle Nummern auf.“
Sie notierte Handy, Festnetz und Lingua auf einem Post-it-Blöckchen, das sie rasch aus dem Arbeitszimmer geholt hatte, und überreichte die Haftnotiz der Malzahn, die sie sorgfältig in ihr Notizbuch klebte.
Dann begleitete sie die beiden zur Tür, wobei Schönberger sich noch an den Umzugskisten das Schienbein anstieß.
„Was ist das denn?“, murrte er, während er sich das Bein rieb. „Haben Sie da den Kram von Ihrer Tante drin?“
„Natürlich nicht“, verwahrte sich Mathilde dagegen. „Meinen eigenen! Ich kann doch die Sachen von Tante Anni nicht einfach wegräumen – was, wenn die Nonna den nächsten Prozess gewinnt und ich hier raus muss? Sie weiß doch, wo alles war, ich müsste mir das ja alles notieren, eine irre Arbeit! Sonst würde sie mir die Hölle heiß machen und jedes Teil auf Schäden untersuchen… obwohl, das würde sie wahrscheinlich auch so… ob ich nicht etwa frecherweise etwas benutzt habe, worauf sie einen Anspruch hat…“ Sie verstummte verzagt.
„Ihre Großmutter ist tot“, erinnerte die Malzahn etwas irritiert.
„Ja, aber das weiß ich doch erst seit zehn Minuten. Bis ich das verinnerlicht habe, dauert es sicher noch. Und außerdem nützt es doch auch nichts, ich weiß ja nicht, ob der Großvater mich nicht noch verklagt. Der erbt doch alles, wissen Sie doch!“
„Nein, wissen wir nicht. Wir haben das Testament noch nicht gesehen. Wann war doch der letzte Prozess gleich wieder?“
„Im Oktober 2004, warum?“
„Und seitdem ist niemand in Revision gegangen?“
„Nein… das heißt, ich weiß es natürlich nicht. Aber wenn die Nonna schon weitergemacht hätte, hätte ich das ja wohl mitkriegen müssen, oder?“
„Sollte man meinen“, knurrte die Malzahn. „Frau Carin, hatten Sie denn keine Anwältin?“
„Oder einen Anwalt?“, mischte Schönberger sich ein.
„Ja doch! Frau Carin?“
„Doch, natürlich. Muss man doch, oder? Warum fragen Sie?“
„Haben Sie in den letzten zwei Jahren und noch was mal von dieser Anwältin gehört?“
„Seit der Rechnung nicht mehr“, antwortete Mathilde leicht verblüfft.
„Ich denke, dann sind alle Revisionsfristen reichlich vorbei. Sie können aufatmen.“
„Ehrlich? Sie meinen, der Großvater könnte mich jetzt nicht mehr so leicht aus der Wohnung klagen?“
„Ich würde sagen: gar nicht mehr. Aber fragen Sie doch bitte nochmal ihre Anwältin!“
„Ja, danke“, antwortete Mathilde leicht verwirrt und öffnete die Wohnungstür.
7 SA 21.04.
„Merkwürdige Frau“, fand Anne draußen.
„Verdächtig“, setzte Joe noch einen drauf. „Kann jemand wirklich so kleinlaut sein? Und wie furchtbar war wohl ihre Kindheit?“
„Wir haben ja vorhin auch den Großvater kennen gelernt. Unangenehmer alter Zausel. Muss aber früher mal ganz gut ausgesehen haben.“
„Verdammt viel früher“, antwortete Joe und öffnete die Beifahrertür.
„Ja, aber wenn man an die Leiche denkt, diese hakennasige alte Hexe, die war doch bestimmt nie besonders attraktiv…“, überlegte Anne. „Warum hat er die wohl geheiratet?“
„Weil du wieder denkst, dass Männer besser gucken als denken können“, spottete Joe.
„Stimmt ja auch!“
„Nee, stimmt eben nicht. Lass den Alten vernünftig gedacht haben, dass die Alte Geld hat oder Einfluss oder Beziehungen. Oder dass sie energisch genug ist, um ihn in die Gänge zu kriegen – er hat ja etwas entschlusslos gewirkt, findest du nicht?“
Anne warf Joe einen Blick von der Seite zu, während sie auf eine rote Ampel zurollte. „Ich bin direkt beeindruckt! Und ich glaube, ich muss dir Recht geben. Naja, vielleicht steht er ja auch auf böse Weiber.“
„Was haben die eigentlich beruflich gemacht?“
„Läden“, überlegte Anne. „Möbel oder so. Ich müsste nachsehen. Ach, egal, wir fahren doch eh ins Präsidium, dann können wir ja in Ruhe recherchieren.“
„Toller Samstag, wirklich. Und der Chef?“
„Hat immer noch den anderen Fall. Stößt zu uns, sobald dieser reiche Sack gestanden hat, der vielleicht seine Exfrau umgelegt hat.“
„Ach ja, ich erinnere mich. Mist, dann sind wir nur zu zweit…“
„Reiche ich dir nicht?“, grinste Anne ihn von der Seite an.
„Nein, so meine ich das doch nicht – ach, du verarschst mich doch bloß wieder.“
„Messerscharf beobachtet.“
„Ich dachte bloß –zu dritt hätte jeder einzelne weniger Arbeit. Na, vielleicht ist der Fall ja schnell gelöst. Vielleicht war´s diese verdruckste Enkelin.“
„Vielleicht“, antwortete Anne etwas abgelenkt, weil die lieben Kollegen wieder einmal wie die Wildsäue auf dem Parkplatz des Präsidiums geparkt hatten. „Ich dachte, Bullen könnten wenigstens korrekt parken… Sag mal, das da, das ist doch der Wagen von Annika und Mick, oder?“
Joe reckte sich. „Stimmt. Haben heute wohl keinen Dienst…“
„Aber dann müssen sie sich nicht so hinstellen, dass man kaum noch durchkommt“, schimpfte Anne, während sie scharf einschlug und sich zu ihrem Parkplatz durchschlängelte.
„Was hast du gemeint? Die Enkelin?“, fragte sie, als sie später, als sie die Treppen des Präsidiums hinaufeilten. „Wie kommst du darauf?“
„Weil die einen an der Waffel hat, findest du nicht? Haust da in den Überresten ihrer toten Tante…“
„Ja gut, die ist schon ein bisschen traumatisiert – aber das muss noch kein Mordmotiv sein. Nein, Joe, sorry, das geht mir zu rasch. Die alte Carin war doch wohl eine rechte Hexe, die hatte bestimmt noch andere Feinde. Komm, wir sichten erst mal, was wir schon haben. Und wenn wir Glück haben, gibt es schon einen Obduktionsbericht.“
Den gab es zwar noch nicht, aber sie machten sich einträchtig über ihre schöne neue Pinnwand her, auf der man die Ergebnisse auf der einen Seite sogar digitalisiert anzeigen konnte. Leider hatte man die dazu nötige Software noch nicht installiert – genau genommen noch nicht einmal gekauft. Anscheinend war das Budget für dieses Jahr schon ausgereizt.
Also hefteten sie Kärtchen an die andere Seite der Wand, wie im 20. Jahrhundert. Eine für Maria Carin,(*1929, + 21.04.2007), eine für Viktor Carin (*1925), eine für Mathilde Carin * 16.04.1978. Danach sahen sie sich ratlos an.
„Da muss es doch wirklich noch mehr Leute geben, verflixt?“
„Zumindest fehlt da eine ganze Generation“, bestätigte Joe. „Hat die Carin nicht gesagt, ihre Eltern sind tot?“
„Eher, dass sie keine Ahnung hat. Alles schon sehr merkwürdig! Komm, wir surfen mal ein bisschen…“
Sie klickten sich durch diverse Suchmaschinen, Regionallexika und Pressedienste. Viel fanden sie nicht, aber einen Artikel vom Februar 1978 aus dem Leisenberger Boten, den es schon lange nicht mehr gab.
Tragischer Verlust
Leisenberg (Eigener Bericht)
Viktor Carin, der Inhaber mehrerer Dekorationsgeschäfte in unserer schönen Stadt, ist mit seiner Frau Maria Luise von einem herben Schicksalsschlag betroffen worden: Am letzten Freitag, Mariae Lichtmeß, verunglückte sein einziger Sohn Walter tödlich auf der vereisten Leichinger Landstraße. Dessen junge Frau Anette, die neben ihm saß und in zwei Monaten ihr erstes Kind erwartet, blieb wie durch ein Wunder unverletzt, was der Familie immerhin ein Trost ist, wie Viktor Carin unserem Reporter bestätigte, während seine Frau noch nicht ansprechbar war.
Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt, denn Walter Carin galt trotz seiner Jugend als besonnener Fahrer und das junge Paar hatte in dem Kleinwagen der jungen Frau gesessen, der bei dem Unfall fast vollständig zertrümmert worden war. Andere Fahrzeuge scheinen an dem tragischen Vorfall nicht beteiligt gewesen zu sein.
Die Hochzeit Walter Carins mit der blutjungen Anette Morolt im letzten Jahr war die Sensation der gesellschaftlichen Saison, vor allem, da sie trotz einer Erkrankung von Maria Luise Carin nicht verschoben worden war. Nun sollte die Liebe der beiden jungen Leute durch das erste Kind gekrönt werden – einen Erben für die Firma Carin? Daß Walter Carin seinen Sohn nie in den Armen halten wird, ist vielleicht das Traurigste an diesem Unfall.“
„Ganz schöner Kitsch“, ärgerte sich Anne. „Und wieso überhaupt Sohn? Blödes Klischee!“
„Gut, aber jetzt können wir den Vater wenigstens abhaken“, besänftigte Joe. Er bekritzelte eine weitere Karte und hängte sie an der richtigen Stelle auf. Immerhin bemängelte Anne, die konzentriert auf ihren Bildschirm starrte, dieses Mal nicht seine scheußliche Handschrift.
„Wo ist diese Mutter denn hingeraten?“, schimpfte Anne schließlich. „Es gibt keine Hinweise auf einen Tod… Anette Carin, geborene Morolt. 1956 geboren, die ist doch jetzt erst – Moment – einundfünfzig. Ich glaube nicht, dass die wirklich schon tot ist.“
„Morgen fragen wir diesen komischen Alten“, antwortete Joe und notierte sich das.
„Ja, machen wir. Okay, den Alten nochmal. War dieser Walter wirklich das einzige Kind?“
„Stand das nicht in dem Presseartikel? Wäre das nicht aufgefallen, wenn es eine Lüge gewesen wäre?“
„Sollte man meinen, aber wer weiß…“ Anne klickte weiter. „Moment mal, hier… da gibt es noch eine Carin… Gesine… geboren 29.07.1957, noch nicht mal fünfzig… hm… könnte vielleicht eine Tochter sein? Früh verstorben vielleicht? Aber wieso finde ich dann hier nichts? Saublöd, das alles.“
„Sie ist nicht in Leisenberg gemeldet?“
Anne klickte weiter. „Nein… ich finde bundesweit nichts, aber auch keine Sterbeurkunde. Aktenkundig ist sie auch nicht, aber das habe ich ja auch nicht wirklich erwartet…“
„Und wenn du sie einfach mal googelst?“
Anne maß ihn verächtlich. „Du glaubst, Google kann mehr als die offiziellen Programme?“
Joe grinste. „Google hat mit Datenschutz nicht viel am Hut, da kann man schon mal das eine oder andere finden. Ob es freilich immer stimmt? Schau halt mal, vielleicht bringst es was. Ich male schon mal eine Karte für sie.“
„Aber nicht wieder so krakelig“, mahnte Anne prompt und klickte weiter. „Ha, es geschehen noch Zeichen und Wunder – du hast tatsächlich Recht. In – wo ist das? Ravenna? Was hat sie denn dahin verschlagen?“ Sie notierte sich die Adresse des Souvenirshops, in dem diese Gesine arbeitete, und beschloss, dort gleich morgen mal anzurufen.
„Morgen ist Sonntag“, erinnerte Joe sie.
Anne grinste. „Na und? In einem Souvenirshop? Wahrscheinlich verkauft sie T-Shirts mit Theoderich drauf oder so. So ein Laden hat sonntags garantiert nicht zu.“
Joe brummte. Nie konnte er gegen Anne punkten! Aber so schlimm wie am Anfang war es wenigstens nicht mehr.
Er hängte die Gesine-Karte an die richtige Stelle.
„Vielleicht ist diese Gesine ja gar nicht in Ravenna“, schlug er dann vor.
„Wo sonst? Ach – du meinst, hier? Und kragelt ihre Mutter ab? Wenn die alte Carin ihre Mutter ist, heißt das.“
„Nehmen wir es doch einfach mal an. Oder wir fragen morgen die junge Carin noch mal.“
„Schreib´s auf die Liste – aber die weiß offenbar praktisch nichts über ihre eigene Familie. So, und ich werde jetzt nochmal nach dieser Mutter suchen!“
Sie googelte Anette Carin – nichts Neues.
Anette Morolt – gar nichts.
„Wahrscheinlich hat die lange vor der Erfindung des Internets wieder geheiratet“, wollte Joe behilflich sein und erntete einen giftigen Blick.
„Vielen Dank auch! Und wie heißt sie dann jetzt?“
„Kann ich hellsehen?“
Anne knurrte, zog einen Stoß rosa Karten aus der Schublade und bekritzelte einige, dann heftete sie sie an die Wand: Anette? Nachbarn? Freunde?
„Wir sind doof“, meinte Joe dann.
„Sprich nur für dich selbst. Wieso sind wir doof?“
„Wir hätten diese Mathilde fragen sollen, ob sie jemanden gesehen hat, wenn sie sich schon zur Tatzeit in Henting herumgetrieben hat.“
„Stimmt.“ Sie notierte sich das. „Morgen gehen wir ganz früh hin, vielleicht bringt sie das aus dem Konzept.“
8 SO 22.04.
Mathilde hatte sich gegen sieben Uhr, nach dem Duschen, wieder an den Schreibtisch gesetzt und versucht, weiter an ihrer Dissertation zu feilen, aber ihre Gedanken irrten immer wieder ab.
Blöde Nonna, sogar im Tod störte sie sie noch bei der Arbeit! Und dann behaupten, Mathilde bekäme sowieso nichts auf die Reihe…
Unsinn, sie war ja tot.
Tot.
Ernsthaft tot. Kaum vorstellbar: Die Hexe war doch unsterblich gewesen!
Ob es wohl stimmte, dass der Großvater sie jetzt nicht mehr aus der Wohnung klagen konnte? Sie hatte sich so daran gewohnt, die Großeltern für allmächtig und über dem Gesetz stehend zu halten (kein Wunder nach dieser Kindheit), dass sie wohl bis an ihr Lebensende mit eingezogenem Kopf auf unausgepackten Kisten gesessen hätte.
Nachher würde sie mal Ulli Petzl anrufen, ihre Anwältin von damals. Aber nicht morgens um halb acht. Und jetzt wurde weitergearbeitet!
Sie schaffte zwei Seiten, dann ließ sie den Stift wieder sinken und seufzte.
Jemand hatte die Nonna umgebracht – wie eigentlich? Das würden die von der Kripo ihr natürlich nicht verraten, die waren ja auch nicht doof. Täterwissen nannte man so was wohl, wenigstens im Fernsehen.
Die Nonna hatte zu den Leuten gehört, bei denen man das Mundwerk extra erschlagen musste, so eine giftige Zunge hatte sie gehabt.
Und Mathilde hatte nie gewusst, warum sie sie nicht leiden konnte – ihre eigene Enkelin? Da zu Beginn noch kein Jahr alt gewesen war?
Und wenn sie sie schon nicht gemocht hatte, warum hatte sie sie dann aufgenommen? Warum nicht das erstbeste Waisenhaus? Vielleicht wäre es dort direkt netter gewesen. Auf jeden Fall hätte sie dort andere Kinder gehabt und vielleicht nicht so sehr das Gefühl, den Erwachsenen allein und hilflos ausgeliefert zu sein…
Egal, das war alles vorbei. Weiter im Text!
Sie präzisierte die Angaben in Fußnote 231, strich auf der entsprechenden Seite zwei überflüssige „auch“ und schaute aus dem Fenster, soweit die blöden Spitzengardinen es zuließen. Tante Annis Geschmack war doch nicht so ganz ihr eigener, aber da konnte man nichts machen.
Immerhin nett, dass sie ihr diese Wohnung vermacht hatte – warum eigentlich? Sie hatte Tante Anni gar nicht so gut gekannt, sie vielleicht ein, zweimal pro Jahr hier besucht. Keinesfalls hatte sie sich bei ihr eingeschleimt, wie die Nonna es natürlich prompt bei Gericht behauptet hatte. Und Tante Anni hatte vielleicht Mitleid mit dem erst dicken, dann mageren unglücklichen Stiefkind gehabt. Eins wusste Mathilde nämlich auf jeden Fall: Tante Anni hatte die Nonna, ihre eigene Schwester, nicht besonders leiden können. Aber enterben konnte sie sie wohl auch nicht. Vielleicht hatte sie gedacht, ein Verhältnis von eins zu fünf würde die Nonna besänftigen – leider falsch gedacht.
Neun Uhr – ob sie Ulli Petzl schon anrufen konnte? Lieber erst um zehn, immerhin war ja Sonntag.
Prompt klingelte es. Mathilde linste durch den Spion und öffnete dann den beiden Kripobeamten.
Sie steuerten wieder das hässliche Wohnzimmer an, wollten keinen Kaffee, auch kein Wasser, und zogen ihre Notizen aus der Tasche.
„Kommen wir zunächst noch einmal auf die Zeiten zurück“, begann die Malzahn dann. Mathilde sah sie aufmerksam an. „Sie wollen wissen, wo ich zur Tatzeit genau war, oder? Hatten wir das gestern nicht schon geklärt?“
„Nicht genau genug.“
„Ich fürchte, genauer weiß ich es auch nicht mehr. Man schaut ja normalerweise nicht dauernd auf die Uhr. Aus dem Bus gestiegen bin ich um fünf nach zehn, das weiß ich noch genau, weil der Bus natürlich Verspätung hatte und ich noch überlegt habe, ob ich mich aufregen soll.“
„Weiter! Wo sind Sie denn ausgestiegen?“
„Am Fichteplatz.“
Sie griff nach einem Zettel und malte ihnen die Route ihres Spaziergangs auf.
„Ja, und so gegen zwölf war ich wieder weg. Um Viertel nach, glaube ich, war ich im Salads. Hilft Ihnen das weiter?“
„Gesehen hat Sie niemand?“
Mathilde überlegte und schüttelte dann betrübt den Kopf. „Die Tussi in dem roten Kleinwagen bestimmt nicht, die hätte mich fast überfahren, als ich über die Kantstraße wollte. So ein Hühnchen, das sich selbst wohl am meisten erschrocken hat. Ich hab mir noch gedacht, Führerscheinneuling. Aber leider weiß ich weder Kennzeichen noch Autotyp, dazu ist das alles zu schnell gegangen.“
„Und sonst niemand?“
„Nein, nicht dass ich – halt, doch. Ein Mann. Aber das nützt Ihnen doch nichts, ich kannte den nicht. Er ist mir auf der Schellingstraße entgegengekommen. Ungefähr auf der Höhe meiner Großeltern. Und dann hat er gesagt Alte Hexe."
„Meinen Sie, er hat Ihre Großmutter gemeint?“
„Wäre denkbar. Zumindest hat er auf das Haus geschaut, als er das gesagt hat. Und mich kannte er schließlich nicht. Und so alt bin ich wohl auch noch nicht – also glaube ich nicht, dass er mich gemeint hat.“
„Und Sie kannten diesen Mann gar nicht?“
„Nein. Vielleicht ein Nachbar, mit dem die Nonna Krach hatte. Als ich noch da gewohnt habe, hat sie immer höllisch aufgepasst, wer was macht, wer verbotenerweise einen Baum fällt oder seine Kinder im Garten spielen lässt, so dass man Gott behüte vielleicht ein Geräusch hören könnte. Und wenn etwas Neues gebaut werden sollte, hat sie gerne versucht, es zu verhindern.“
„Mit Erfolg?“
„Ach wo. Im Nachhinein betrachtet, hat sie nie was erreicht, die anderen hatten immer das Recht auf ihrer Seite. Aber ich habe sie trotzdem für allmächtig gehalten.“ Mathilde lächelte bei der Erinnerung.
„Und Ihr Großvater?“
„Der hat mehr oder weniger gekuscht. Die Nonna hatte Haare auf den Zähnen. Und sie hatte das Geld.“
„Ach ja? Das hat uns Ihr Großvater nicht erzählt.“
„Kein Wunder. Aber ich glaube, er kann nichts dafür, er belügt sich gewohnheitsmäßig selbst. Soweit ich ihn mit siebzehn durchschauen konnte, heißt das natürlich. Ich habe aber mal einen Streit gehört, kurz bevor ich achtzehn wurde und dort raus konnte, und da hat die Nonna ihm vorgeworfen, dass das Kapital für die Läden von ihr stammte. Die Tante Anni war ja auch ziemlich wohlhabend. Vielleicht hat die Nonna sich damals ein hübsches Bürschlein gekauft… sorry, aber da muss ich jetzt doch direkt grinsen.“
„Nichts ist schöner, als Peinlichkeiten über Leute zu erfahren, die man nicht leiden kann?“, feixte die Malzahn.
„Ganz genau. Mehr weiß ich aber leider auch nicht. So was wie Nonna, erzähl doch mal von früher hat bei ihr absolut nicht geklappt. Dann hieß es nur Was geht dich das an?