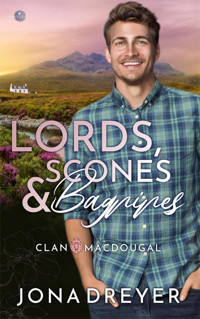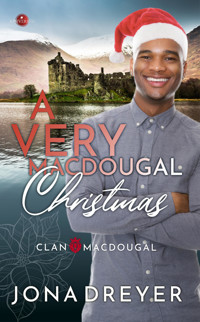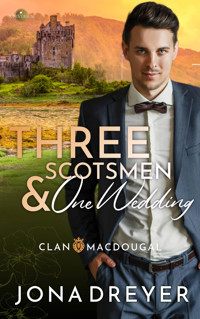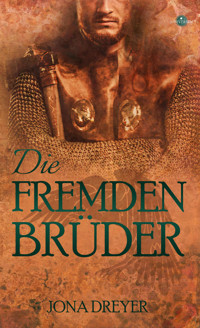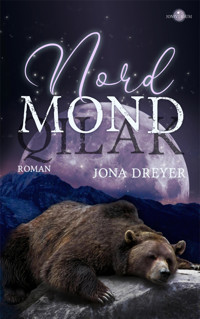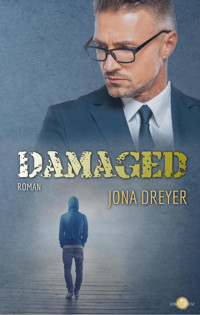5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tschök & Tschök GbR
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich lasse einen Mann nicht hungrig ins Bett gehen. Ich bin Koch, das liegt in meiner Natur.« HIGHLANDS. HERZSCHMERZ. RAUE KLIPPEN. Nach einem dramatischen Vorfall wird Rupert Hargreave, Viscount of Bainbridge, von seiner Familie auf deren schottischen Landsitz geschickt, um dem drohenden Medienrummel zu entkommen. Nur widerwillig reist der freudlose Rupert, von der Presse wegen seines miesepetrigen Verhaltens nur Pisscount genannt, mit seinem Kater Monty auf die Insel Skye, wo er dem fröhlichen, lebenslustigen Koch Cameron MacGregor begegnet. Cameron ist auf Cairnroch Estate für das leibliche Wohl zuständig. Diese Aufgabe nimmt er sich ganz besonders zu Herzen, als er dem Viscount mit den müden Augen begegnet. Gemeinsam mit seinen schrulligen Freunden aus dem Pub schafft er es, etwas Sinn und Freude in das Leben seines Dienstherrn zurückzubringen und ihm dabei zu helfen, besser mit seinen Problemen zurechtzukommen. Doch die Gefühle, die Rupert und Cameron füreinander entwickeln, bringen neue Schwierigkeiten. Denn die Gesellschaft, aus der Rupert kommt, würde eine Beziehung wie ihre niemals akzeptieren ... Eine Geschichte mit viel Tiefgang und einer guten Prise Humor im wunderschönen Setting der schottischen Insel Skye.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
An deinen rauen Klippen
Gay Romance
© Urheberrecht 2022 Jona Dreyer
Impressum:
Tschök & Tschök GbR
Alexander-Lincke-Straße 2c
08412 Werdau
Text: Jona Dreyer
Coverdesign: Jona Dreyer
Coverbilder: depositphotos.com
Lektorat/Korrektorat: Kristina Arnold, Kelly Krause, Shannon O’Neall & Sandra Schmitt
Kurzbeschreibung:
»Ich lasse einen Mann nicht hungrig ins Bett gehen. Ich bin Koch, das liegt in meiner Natur.«
Nach einem dramatischen Vorfall wird Rupert Hargreave, Viscount of Bainbridge, von seiner Familie auf deren schottischen Landsitz geschickt, um dem drohenden Medienrummel zu entkommen. Nur widerwillig reist der freudlose Rupert, von der Presse wegen seines miesepetrigen Verhaltens nur ›Pisscount‹ genannt, mit seinem Kater Monty auf die Insel Skye, wo er dem fröhlichen, lebenslustigen Koch Cameron MacGregor begegnet.
Cameron ist auf Cairnroch Estate für das leibliche Wohl zuständig. Diese Aufgabe nimmt er sich ganz besonders zu Herzen, als er dem Viscount mit den müden Augen begegnet. Gemeinsam mit seinen schrulligen Freunden aus dem Pub schafft er es, etwas Sinn und Freude in das Leben seines Dienstherrn zurückzubringen und ihm dabei zu helfen, besser mit seinen Problemen zurechtzukommen.
Doch die Gefühle, die Rupert und Cameron füreinander entwickeln, bringen neue Schwierig-keiten. Denn die Gesellschaft, aus der Rupert kommt, würde eine Beziehung wie ihre niemals akzeptieren ...
Über die Autorin
»Fantasie ist wie ein Buffet. Man muss sich nicht entscheiden – man kann von allem nehmen, was einem schmeckt.«
Getreu diesem Motto ist Jona Dreyer in vielen Bereichen von Drama über Fantasy bis Humor zu Hause. Alle ihre Geschichten haben jedoch eine Gemeinsamkeit: Die Hauptfiguren sind schwul, bi, pan oder trans. Das macht sie zu einer der vielseitigsten Autorinnen des queeren Genres.
VORWORT
Im Grunde genommen ist dieser Roman eine »Own Voice«-Geschichte. Denn sowohl mit Rupert als auch mit Cameron habe ich große Gemeinsamkeiten: Erfahrungen mit Depressionen und mit Bodyshaming. Beides begleitet mich seit dem Grundschulalter.
Allerdings ist diese Geschichte ganz und gar keine, die eine düstere Grundstimmung erzeugen und den Leser herunterziehen will. Im Gegenteil: Sie feiert das Leben, so wie meine Schottlandromane es immer tun. Denn auch als depressiver Mensch ist man nicht immer nur traurig und lebensmüde. Auch unser Leben kann Freude bedeuten.
Dieses Buch ist keine Anleitung, wie man aus Depressionen herauskommt und erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Es erzählt nur eine ganz individuelle Geschichte vom Aufstehen, von Selbstakzeptanz und vom Weitermachen. Vom Freudefinden. Es gibt keinen magischen Schwanz, der alles heilt. Manch einer mag sich darin wiederfinden, manch einer nicht.
Und noch etwas: Ich schreibe über Menschen. Menschen sagen und tun dumme Dinge, treffen unkluge Entscheidungen, verhalten sich nicht immer korrekt und verantwortungsvoll und bereuen das auch nicht immer. Das ist kein Grund, harte und unnachgiebige Urteile über sie zu fällen. Es gehört zum Menschsein dazu.
Viel Spaß bei der Lektüre!
PROLOG
»Können Sie mich hören?«
Durch einen diffusen Klangteppich aus hektischen Geräuschen drang die Stimme in sein Bewusstsein vor. Er versuchte, die Augen zu öffnen, aber das Licht war zu grell, also kniff er sie wieder zusammen. Ein kleines Gewicht hob sich von seinem Gesicht und die Luft wurde dünner.
»Sir, können Sie mich hören?«, wiederholte die Stimme, diesmal drängender.
»... ja«, brachte er mühsam hervor. Es tat weh. Die Wurzel seiner Zunge war verkrampft, die Kehle fühlte sich an, als sei sie mit grobem Schleifpapier bearbeitet worden.
Was ist das hier? Wo bin ich? Das ist auf keinen Fall das Jenseits oder was auch immer einen nach dem Tod erwartet.
Abermals zwang er sich zu einem Versuch, die Augen zu öffnen, aber er blieb fruchtlos.
»Können Sie mir Ihren Namen sagen?«
Ja, kann ich. Aber das Sprechen tut verdammt weh.
»Sir?«
Er sagte seinen Namen. Seine Bürde.
Bitte keine weiteren Fragen mehr.
»Wissen Sie, welcher Tag heute ist?«
Er dachte nach, während eine sachte Schaukelbewegung und ein unterschwelliges Vibrieren seine vernebelten Sinne verwirrten. Aber er kam nicht darauf. Ihm fiel für den Moment nicht einmal mehr ein, wie die Wochentage hießen. »... nein«, krächzte er.
Wenn dieser Typ, wer auch immer er war, doch endlich mit dieser Fragerei aufhören würde! War das hier vielleicht die Hölle? Endlich gelang es ihm, die Augen zu öffnen. Er sah weiß. Lichter. Ein fremdes Gesicht, halb über ihn gebeugt. Keine Hölle. Eher ein Rettungswagen.
Scheiße! Ich sollte hier nicht sein! Ich sollte weg sein! Ich war doch schon weg, oder nicht?
»Können Sie mich sehen?«
»Leider ja.« Es war unhöflich, aber Etikette war gerade sein geringstes Problem. »Lassen ... Sie mich raus.« Er bekam einen Krampf im Hals, jedenfalls fühlte es sich so an. Er stellte sich vor, dass seine Kehle eine Coladose war, die zusammengedrückt wurde. Was es nicht besser machte. »Lassen Sie ... mich hier raus.«
»Das geht nicht. Wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Sie brauchen Hilfe.«
»Nein ...« Wer immer diesen Krankenwagen gerufen hatte, war ihm keine Hilfe gewesen, sondern das genaue Gegenteil.
»Vertrauen Sie uns.«
Ich kenne Sie nicht mal.
Er schloss die Augen wieder, weil das gleißende Licht und die besorgte Miene des Sanitäters die Situation nicht besser machten. Er hatte das Gefühl, sich im freien Fall zu befinden, obwohl er angeschnallt auf einer Pritsche lag. Es war eine ekelhafte Empfindung.
Ich will hier weg. Ich will in kein Krankenhaus. Ich will nicht, dass alle kommen und mich fragen, warum.
Was sollte er darauf denn antworten? Dass es seine Entscheidung gewesen war, die offenbar niemand zu respektieren gedachte – wie üblich? Immer hatten andere alles für ihn entschieden. Jetzt wieder. Ein Albtraum. Und er nahm und nahm einfach kein Ende.
1: DER LORD KOMMT
»Der Lord kommt.« Wie ein Fallbeil war Ellens Stimme auf ihn niedergegangen, messerscharf und tödlich, und genauso ahmte Cameron sie nach, als er den anderen im Trinity Arms von den unheilvollen Neuigkeiten berichtete.
Ein Raunen ging durch alle Anwesenden, an diesem Mittwochabend nur Einheimische, und manch einer griff sich sogar ganz theatralisch an die Stirn.
»Ganz ehrlich«, fuhr Cameron fort und spürte Hitze in seinen Wangen aufsteigen, »ich überlege, ob ich kündige. Also, gleich. Noch bevor er ankommt. Mir steckt noch der Sommer in den Knochen, als die Alten hier waren. Kein Süßwasserfisch, kein Brokkoli, das Sößchen darf nicht mit Butter gebunden werden, das Essen muss warm sein, aber nicht heiß und zu kalt auch nicht, die Lady ekelt sich vor Käse, der Lord muss von Paprika aufstoßen ... ich dachte, ich muss danach direkt in die Klapsmühle wandern!«
»Ein Ale für den armen Jungen!«, rief der alte Jim aus einer Ecke des Pubs. »Ach, am besten für uns alle. Wenn die Avingtons anreisen, hält ja immer das ganze Dorf den Atem an, bis sie wieder abhauen.«
»Was das soll, frag ich mich«, schnarrte Sarah, eine ältliche, magere Dame, die regelmäßig alle Männer von Cairnroch unter den Tisch soff. »Sind nicht unsere Lords und Ladys. Haben nur ein Haus hier. Sind nicht mal Schotten! Was sollen wir vor denen katzbuckeln, he?«
»Na ja, die Lady ist sehr wohl Schottin«, warf Mohamed ein. Er war der Wirt des Pubs, stammte aus Pakistan, aber er war schottischer als die meisten Schotten, die Cameron kannte. Vor allem, was seine Vorliebe für Kilts und seine Kochkünste anging. Was Cameron konnte, hatte er vorwiegend von ihm gelernt, so viel mehr als in seiner eigentlichen Kochausbildung. Und von seiner Mutter, ehe er ihre Stelle im Haushalt der Avingtons übernommen hatte. Sie nannten Mohamed meist nur Moe.
»Hat aber einen Rotrock geheiratet, die Verräterin«, gab Sarah verschnupft zurück und zog ihre faltige Nase kraus, dass sie aussah, als hätte sie eine Ziehharmonika im Gesicht. »Das zählt nicht.«
»Jetzt komm aber«, murrte Jim. »Na ja, aber es stimmt schon. Die Avingtons sind sehr ... englisch. Was der Pisscount wohl hier will? Ausgerechnet jetzt im Winter?«
»Weiß der Geier«, murmelte Moe. »Hauptsache, er hält sich von meinem Pub fern.«
»Na hier wird er wohl kaum reinschneien«, versetzte Sarah. »Kommt mir auch alles komisch vor. Wenn ich wetten müsste, würd’ ich sagen, es gibt da wieder ein kleines Skandälchen zu verbergen. Wer weiß, was der Pisscount sich wieder geleistet hat, dass er sich hier auf Skye verstecken will. Sonst kommt er hier ja nie her, nur seine Eltern.«
»Die Boulevard-Presse wird es uns sicher bald verraten«, gab Moe zurück und Cameron feixte.
Pisscount. Das war der Spitzname, den die Klatschblätter und die Bevölkerung Rupert Hargreave, Viscount of Bainbridge, dem ältesten Sohn und Erben des Earl of Avington, verpasst hatten. Nicht grundlos, denn der Mann leistete sich immer wieder ziemlich unschöne Ausfälle, die meistens Pöbeleien und Alkohol beinhalteten. Der Pisscount hielt sich für etwas Besseres und behandelte die Leute um sich herum auch so. Cameron war ihm bislang allerdings nur einmal begegnet, vor vielen Jahren, als er noch ein Teenager gewesen war und seine Mutter noch für die Avingtons gearbeitet hatte. Gesprochen hatte er natürlich nie mit ihm.
»Ich hab ’ne Liste bekommen mit Dingen, die er nicht isst«, berichtete Cameron weiter.
»Und?«, fragte Moe neugierig.
Cameron zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck von seinem Ale. »Hab noch nicht reingeschaut. Ich will dieses Elend noch so lange wie möglich von mir fernhalten.«
»Also wenn du dich entschließt, zu kündigen, stell ich dich hier gerne ein«, bot Moe an und kratzte sich an seinem kurzen, schwarzen Bart. »Du weißt ja, Sally und ich bekommen in ein paar Monaten unser erstes Kind und sie könnte zu Hause etwas mehr Hilfe von mir gebrauchen.«
Cameron nickte nachdenklich. »Ich behalt’s mir im Hinterkopf.«
Es war nicht so, dass er nicht viel lieber hier im Trinity Arms anstatt für die Avingtons arbeiten würde, nur bot Letzteres einen erheblichen Vorteil: Sie bezahlten relativ gut für – auf das Jahr gesehen – relativ wenig Arbeit. Sie waren nur wenige Wochen im Jahr wirklich hier anwesend und ansonsten kochte Cameron nur für die Angestellten, die das Anwesen instand hielten, zum Beispiel die Haushälterin Ellen, und half bei einigen Arbeiten im Haus mit. Das wäre hier im Pub anders – es gäbe mehr zu tun für weniger Geld, da Moe natürlich nicht das Budget eines Earls hatte.
»Gebt dem Jungen noch ein Ale!«, rief Jim, aber Cameron winkte ab.
»Lasst mal sein. Ich kann morgen nicht verkatert bei der Arbeit erscheinen. Vielleicht ist der Pisscount ja einer, der sich mit gutem Essen besänftigen lässt.«
»Na dann, viel Glück«, murrte Sarah. »Das ausgeschlagene Ale nehm ich dann.«
Cameron lachte und verabschiedete sich von den anderen. Es wurde Zeit, nach Hause zu gehen.
Leise öffnete Cameron die Haustür. Es war noch nicht spät am Abend, aber leise zu sein, die Türen vorsichtig zu öffnen und zu schließen und nur mit gedämpfter Stimme zu sprechen, war im Hause MacGregor Gesetz. Nicht aus irgendeiner Schikane heraus, sondern seiner Schwester zuliebe. Laute Geräusche machten ihr Angst und überforderten sie.
Seine Mutter streckte den Kopf aus der Wohnzimmertür, während Cameron Jacke und Schuhe auszog, und lächelte. »Hallo Cam. Gab es viel zu tun heute?«
»Nae, ich war nur noch kurz im Pub. Es gibt Neuigkeiten.« Er zog eine Grimasse und Ma hob eine Braue. Ihr Gesicht wirkte müde, wie meistens. »Ich erzähl’s dir gleich. Wie geht es Millie heute? Hat sie gegessen?«
Ma schüttelte resigniert den Kopf. »Essenstechnisch ging heute wieder gar nichts. Drei Erbsen, wenn es hochkommt. Alles gute Zureden hat nichts genützt.«
»Soll ich ihr noch mal was machen?«
Sie hob die Hände. »Du kannst es versuchen, von dir nimmt sie es ja meistens. Aber du hast heute doch schon genug gearbeitet.«
»Heute gab es noch kaum was zu tun. Ich mach ihr ein paar Nudeln mit Schinken.«
Cameron ging hinüber in die Küche und Ma folgte ihm.
»Übrigens, Finlay hat angerufen. Du hättest dich heute melden wollen, würdest nicht ans Handy gehen und er macht sich Sorgen.«
»Ach ja.« Cameron fasste sich an die Stirn. »Ich wollte ihn ja noch zurückrufen, aber das ist im Trubel des Tages untergegangen.«
Ma verschränkte die Arme. »Erzählst du mir jetzt endlich von der bahnbrechenden Neuigkeit?«
»Der Pisscount reist an.«
»Cameron!«
»Sorry: Der Viscount reist an. Und zwar schon morgen.«
»Oh.«
»Aye. Oh ist wirklich die gediegenste Reaktion, die ich bis jetzt darauf bekommen habe. Im Pub wurde ich schon bemitleidet.«
Ma schüttelte den Kopf. »Du solltest nicht immer so viel im Pub herumtratschen.«
»Ach, was heißt hier tratschen?« Cameron stieß ein Schnauben aus. »Seine Anreise hätten sie doch eh spätestens morgen mitbekommen. Mehr weiß ich auch noch nicht.«
»Er ist sicher nicht der angenehmste Zeitgenosse, aber du solltest trotzdem nicht so über ihn reden. Die Avingtons sind unsere Arbeitgeber. Ich habe mehrere Jahre für sie gearbeitet und als ich wegen Millie nicht mehr zurückkommen konnte, haben sie dir die Stelle gegeben, anstatt jemanden mit mehr Erfahrung zu suchen. Das rechne ich ihnen hoch an.«
»Mach mir halt ein schlechtes Gewissen.« Kopfschüttelnd sah Cameron sie an und holte eine Packung Nudeln aus dem Schrank. »Du hast heute auch noch nichts gegessen, oder? Wirst immer dünner. Ich koch dir eine Portion mit.«
Ma widersprach ihm nicht, sondern ließ sich auf einen Küchenstuhl sinken. Sie war oft erschöpft und ausgelaugt, weil sie sich Sorgen machte und weil Millie nicht einfach zu händeln war. Camerons Schwester litt unter frühkindlichem Autismus. Sie sprach nicht. Mochte keinen Körperkontakt. Lebte in ihrer eigenen Welt. Sie brauchte eine ganztägige Betreuung und eigentlich wäre es das Beste, sie tagsüber in eine Einrichtung zu geben, die sich auf Probleme wie ihres spezialisiert hatte. Aber eine solche Einrichtung gab es hier nicht. Sie wohnten zu weit weg von großen Städten, weg vom Festland. Es wäre vernünftiger gewesen, von hier fortzugehen und in eine Stadt wie Glasgow, Edinburgh oder Aberdeen zu ziehen. Aber sie hingen so sehr an diesem Fleckchen Erde.
Die Konsequenz war jedoch, dass die ganze Betreuung von Millie an Ma hängen blieb. Millies Vater hatte sich längst wegen Überforderung aus dem Staub gemacht und meldete sich nicht mehr, zahlte nur noch widerwillig Unterhalt. Cameron war also der Mann im Haus. Er brachte das Geld nach Hause, von dem sie lebten, auch wenn Ma etwas Geld vom Staat für Millies Betreuung bekam.
Ma schien zu spüren, was er gerade dachte, denn sie stupste ihn an. Ihr dunkelblondes Haar warf Schatten auf ihr hageres Gesicht. »Es tut mir so leid für dich. Ich wünschte, ich könnte einfach sagen: Wenn der Viscount dir dumm kommt, kündige und fang woanders an. Ich wünschte, wir wären nicht so abhängig von deinem Geld und du müsstest diese Last nicht tragen.«
»Ma, das haben wir doch schon tausendmal durchexerziert«, gab Cameron seufzend zurück und holte ein Stück Schinken aus dem Kühlschrank. »Ich hab mich entschlossen, für euch da zu sein, und das meine ich auch ernst. Ich bereue auch nichts oder so. Ich bin erwachsen und kann schon beurteilen, was für mich passt und was nicht. Mach dir um mich nicht auch noch Sorgen, sonst klappst du mir bald zusammen und dann haben wir echt ein Problem. Wehe, du isst deine Nudeln nicht auf.«
Sie lachte leise und strich ihm über den Arm. Er liebte sie sehr und würde sie niemals so im Stich lassen, wie der Feigling Harry es vor einigen Jahren getan hatte.
Als die Nudeln fertig waren, gingen sie hinüber ins Wohnzimmer, um dort zu essen. Millie saß auf dem Fußboden und ordnete Holzdreiecke nach einem System, das wohl nur sie selbst verstand.
»Millie«, sprach er sie sanft an. »Ich habe Essen.«
Sie hob kurz den Kopf, blickte ihn aber nicht an und fuhr gleich darauf wieder mit ihrem Spiel fort.
»Ich stelle es dir einfach hin, ja?« Cameron stellte den Teller neben Millie auf den Boden und setzte sich dann zu Ma an den Couchtisch.
Es dauerte nicht lange, bis Millie den Teller nahm und zu essen begann. Langwierig, jede Nudel einzeln, aber sie aß fast den ganzen Teller auf. Cameron und Ma beobachteten sie andächtig.
»Ich weiß nicht, wie du das immer machst«, bekannte Ma kopfschüttelnd und fing endlich an, selbst zu essen.
Cameron zuckte mit den Schultern. »Eigentlich mach ich ja nichts. Sie hat halt einfach eine Schwäche für ihren großen Bruder.«
»Was den Viscount wohl hierhertreibt?«, überlegte Ma unvermittelt. »Den habe ich hier zuletzt vor über zehn Jahren gesehen.«
»Sarah denkt ja, dass da wieder irgendein Skandal lauert und die Avingtons ihn von der Bildfläche schaffen wollen, bis sich alles wieder beruhigt hat. Wir sollten in den nächsten Tagen mal genauer in die Zeitung schauen oder ins Internet. Da steht bestimmt was.«
»Wir werden sehen. Aber egal, was es ist: Versprich mir, dass du ihm gegenüber professionell bleibst, ja? Keine blöden Bemerkungen oder so etwas. Mach einfach deine Arbeit. Wir sind den Lordschaften Loyalität schuldig.«
»Wenn Sarah dich hören könnte, die würde dich glatt als Verräterin der schottischen Nation bezeichnen«, versetzte Cameron mit einem Augenzwinkern.
»Ach, Sarah.« Ma winkte ab und schüttelte entnervt den Kopf. »Die sollte mal weniger schwatzen und vor allem weniger trinken.«
»Aye, sollte sie wohl.« Cameron lehnte sich zurück und faltete die Hände auf seinem Bauch, der nicht ganz so flach war, wie ihn manche gerne hätten. Was ihn an etwas erinnerte. »Ich ruf dann mal Finlay an«, verkündete er, »und sag schon mal gute Nacht.«
2: VISCOUNT ZOMBIE
Grimmiger Regen peitschte Cameron ins Gesicht. Er hegte die leise Befürchtung, dass die nächste Sturmböe ihn über das Kliff in das wütende Meer stoßen würde. Die Regenjacke schützte ihn kaum vor den himmlischen Wassermassen; seine Hose war bereits völlig durchtränkt und aus seinen Schuhen schwappte Wasser, weil er einmal zu viel in eine Pfütze getreten war.
Grauenhaft.
Und gar kein schöner Start in den Tag. Er hätte seine Mutter um das Auto bitten sollen, aber als er losgelaufen war, hatte es längst nicht so stark geregnet wie jetzt und er war sicher gewesen, trockenen Fußes auf Cairnroch Estateanzukommen. Dort konnte er wenigstens in seine trockene Kochkleidung schlüpfen, wenn auch ohne Unterhose, denn die fühlte sich auch schon klamm an. Es passte irgendwie zu seiner miesen Stimmung. Das Telefonat gestern mit Finlay war eher anstrengend als aufbauend gewesen; sein Freund hatte ihn mit Vorwürfen überschüttet, weil er sich nicht gemeldet hatte. Zur Wiedergutmachung hatten sie sich heute Abend zum Joggen verabredet, aber heimlich hoffte Cameron, dass das Wetter zu schlecht bleiben würde, um rauszugehen.
Und zur Krönung des Tages reiste der Lord heute an. Deshalb durfte Cameron auf keinen Fall zu spät zur Arbeit kommen. Er legte noch ein wenig an Tempo zu, lief patschend durch Pfützen, denn nasser konnte er sowieso nicht mehr werden, stemmte sich gegen den Wind, fest entschlossen, nicht ins Meer zu purzeln, und kämpfte sich durch die undurchsichtige, stahlgraue Welt. Der Winter war zweifelsohne da, drinnen wurde es gemütlich, draußen zuweilen äußerst ungemütlich. Endlich erreichte er das Anwesen, holte mit kälteklammen Fingern den Schlüssel aus der Tasche und öffnete die Tür.
Kaum, dass er eingetreten war, warf der Wind die Tür wieder ins Schloss. Erschrocken machte Cameron einen kleinen Satz vorwärts, aber dann atmete er auf. Endlich im Warmen, Trockenen. Jetzt hieß es raus aus den nassen Klamotten, rein in die Kochkleidung und dann an die Arbeit. Der Pisscount hatte sich einen wirklich stürmischen Tag ausgesucht, um hier anzureisen, aber andererseits passte das Wetter zu seiner grimmigen Miene.
»Wie siehst du denn aus?« Ellen schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als er die Küche betrat.
»Wetter kaputt«, murmelte er.
»Du hättest doch etwas sagen können, dann hätte Frederick dich bestimmt abgeholt.«
»Ich hab mich verschätzt«, erwiderte Cameron zerknirscht. »Als ich losgelaufen bin, war der Regen noch nicht so schlimm. Außerdem wusste ich gar nicht, dass Fred schon hier ist.«
»Aye, du wohnst ja erst dein ganzes Leben hier, da kann man sich schon mal verschätzen, was Wind und Regenfälle angeht ...« Ellen rollte mit den Augen. »Frederick ist schon seit gestern Abend hier. Ich geh dir ein Handtuch holen.«
Sie verschwand aus der Küche und kehrte kurz darauf mit einem großen Handtuch zurück, das Cameron, der sich inzwischen bis auf die Unterhose ausgezogen hatte, dankbar entgegennahm. Er genierte sich nicht vor Ellen; die robuste, grauhaarige Frau kannte ihn schon seit seiner Kindheit.
»Was zum Geier bewegt unseren Pisscount wohl, zu dieser Jahreszeit hier Urlaub machen zu wollen?«, fragte er, während er sich abfrottierte.
»Brüll halt noch lauter Pisscount, damit’s auch alle hören.« Ellen verdrehte erneut die Augen und wandte sich ab, damit Cameron auch noch seine klamme Unterhose loswerden konnte, ehe er in seine Kochhose schlüpfte. »Um Urlaub geht’s weniger.«
»Dann vermutlich ein neuer Skandal in der Presse?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nae. Er ist krank.«
»Was hat er?«
»Das weiß ich nicht.« Sie drehte sich wieder um und reichte Cameron sein weißes Shirt und seine Kochjacke. »Das hat man uns nicht mitgeteilt. Es hieß nur, er sei krank und müsse sich hier erholen und wir sollen dafür sorgen, dass er Ruhe hat, isst und ab und zu mal vor die Tür geht.«
»Klingt, als wäre er drei Jahre alt und wir seine Nannys«, bemerkte Cameron und rieb sich die immer noch kalten Hände.
»Tja.« Ellen zuckte mit den Schultern. »Ich hoffe, er lässt die Gewitterwolken zu Hause, die immer über seinem erlauchten Haupt schweben. Danach, hier wochenlang einen alten Griesgram zu beherbergen, steht vermutlich niemandem der Sinn.«
»Ich hoffe, er ist nicht so mäkelig wie seine Alten. Beim letzten Mal dachte ich, ich muss dem Earl an die Gurgel springen. Wie kann ein einzelner Mensch nur so unglaublich mäkelig sein?«
»Das ist wohl so, wenn man mit dem goldenen Löffel im Hintern geboren wurde. Hast du noch nicht in die Liste mit den Präferenzen des Viscounts geschaut? Die erscheinen mir im Vergleich zu seinem Vater recht harmlos: kein Dijonsenf, viel Soße und lieber ein süßes Frühstück.«
»Ach, das ist ja wirklich harmlos.« Cameron wandte sich seinen Küchenmessern zu und sortierte sie neu, weil irgendjemand sie falsch eingeräumt hatte. »Wann wird seine Lordschaft erwartet?«
»Aufgrund des Wetters wohl erst gegen Mittag«, gab Ellen zur Auskunft.
»Gut.« Cameron schaute auf die Uhr. Es war kurz nach acht Uhr morgens. »Dann mache ich uns erst mal ein schönes, deftiges Frühstück.«
Das Wetter passte hervorragend zu Ruperts Stimmung. Dunkel, verregnet, sturmgepeitscht. Ein Tag, den niemand haben wollte, weil er alles erschwerte.
Zu seiner Rechten türmten sich felsige Landschaften, links tobte das Meer unter dräuenden Wolken. Er sollte gar nicht hier sein. Aber dieser Ort war vermutlich besser als alle anderen, und letztendlich war er nur eine Zwischenstation. In Schottland würde er Ruhe finden. In irgendeiner Form.
Sie überquerten die Skye Bridge, die die Insel Skye mit dem Festland verband. Das bedeutete, dass sie nur noch etwas mehr als eine Stunde vom Ziel entfernt waren. Es musste mindestens zehn Jahre her sein, dass Rupert zuletzt hiergewesen war, er konnte sich jedenfalls kaum noch an das kleine Anwesen erinnern. Er fühlte sich schläfrig und legte eine Hand auf den Kennel, der neben ihm auf dem Rücksitz stand.
Monty. Mein einziger Trost.
Der flauschige Kater war sein treuester Gefährte und hatte stets ein Gespür dafür, wie es ihm ging. Rupert hatte ihn nicht in seiner Wohnung in London lassen wollen, er musste ihn einfach mitnehmen. Monty kam in die Jahre und dieser Gedanke machte Rupert noch mehr Angst vorm Leben, als er ohnehin schon hatte. Ein Leben ohne Monty war unvorstellbar. Und manchmal in den letzten Tagen, so wie gerade eben, überkamen ihn Gewissensbisse. Monty brauchte ihn. Oder redete er sich das nur ein? Wäre sein Kater ohne ihn vielleicht besser dran? Was hatte er ihm schon zu bieten, außer eine träge, kraulende Hand? Mit einem erschöpften Seufzen sah er auf das schlafende Tier, das sein Maunzkonzert schon vor geraumer Zeit aufgegeben hatte. Rupert war müde und die Fahrt schien endlos. Aber dann fuhren sie doch auf Cairnroch Estate ein.
Jetzt kam auch die Erinnerung wieder, zusammen mit der Feststellung, dass sich hier kaum etwas verändert hatte. Das zweistöckige Gebäude war immer noch weiß gestrichen, hatte ein graues Dach und graue Fensterrahmen. Unter der überdachten Terrasse vor dem Haus waren leere Blumentöpfe vor dem stürmischen Wetter in Sicherheit gebracht worden. Und gleich davor, vielleicht fünfzig Schritte und nur von einer Mauer gezähmt, lag die Meerenge, die Little Minch, die die Insel von den Äußeren Hebriden trennte. Rupert erinnerte sich, dass man manchmal den Rueval auf der Insel Benbecula sehen konnte, wenn man vom Haus über die Meerenge blickte, aber jetzt war alles in undurchdringliches Grau gehüllt. Er verspürte keine Lust, aus dem Auto auszusteigen. Gar keine.
Der Fahrer parkte so nahe wie möglich am Eingang und kämpfte mit der Autotür, die ihm der Wind gleich wieder zuschlagen wollte. Die Haustür wurde geöffnet und zwei Männer traten heraus, begannen geschäftig, das Gepäck aus dem Kofferraum auszuladen. Schließlich öffnete einer Ruperts Tür. Eine feuchte Böe wehte hinein und ließ ihn zurückweichen.
»Willkommen auf Cairnroch Estate, Mylord«, begrüßte er ihn. Es war Frederick, ein Butler, der für seine Familie arbeitete und schon vorher angereist war.
»Ja«, murmelte Rupert. Noch immer verspürte er keinen Drang, auszusteigen. Am liebsten würde er gerade für immer in diesem Auto sitzen bleiben.
»Ich würde Ihnen ja einen Schirm aufspannen, Mylord«, fuhr Frederick fort, »aber ich fürchte, der flöge gleich davon und ich mit ihm.«
»Schon in Ordnung.« Unmotiviert schnallte sich Rupert ab und griff nach dem Kennel mit Monty.
»Soll ich Ihnen das abnehmen, Mylord?«, erkundigte sich der Butler eifrig.
Rupert schüttelte stumm den Kopf, gab sich einen Ruck und stieg aus. Der eisige Regen, der ihm sofort ins Gesicht peitschte, sorgte für die nötige Motivation und er rannte so schnell wie möglich ins Haus. Der Butler und der andere Kerl folgten ihm und schlossen die Tür. Rupert atmete auf. Hier drinnen war es warm und heimelig auf eine etwas altmodische Art, mit niedrigen Decken und dicken, karierten Teppichen, ganz anders als in seiner modernen, Londoner Wohnung, die aus jeder Menge Glas und Edelstahl bestand. Aber es war gut. Jetzt war er erschöpft und wollte sich einfach nur ins Bett legen und schlafen. Leider gab es da etwas, was ihn davon abhielt, genau das sofort zu tun: Die Reihe von Bediensteten, die in der Eingangshalle standen und ihn neugierig beäugten.
»Der Viscount of Bainbridge«, verkündete der Butler ihnen wichtigtuerisch. »Mylord, darf ich Ihnen die guten Geister des Hauses vorstellen?« Er wies auf eine kleine, rundliche Frau mit einer grauen Hochsteckfrisur. »Ellen Jones, die Haushälterin.«
»Willkommen, Mylord«, sagte sie und schenkte Rupert ein mütterliches Lächeln, das ihn irritierte. Es erschien ihm unangemessen.
»William Ross, der Gärtner und Hausmeister.«
Der schnauzbärtige, muffelig wirkende Kerl, der ihm mit dem Gepäck geholfen hatte, nickte ihm unfein zu. »Mylord.«
»Cameron MacGregor, unser Koch.«
Ruperts Blick fiel auf den jungen Mann mit dem haselnussbraunen Lockenkopf und den strahlend grünen Augen. Ihm schien sein eigenes Essen zu schmecken, denn unter seiner Kochjacke wölbte sich ein Bäuchlein. »Hi ... ähm, ich meine, Willkommen, Mylord.«
Von Etikette scheint man hier nichts zu halten.
Einerseits war Rupert etwas brüskiert über dieses eher formlose Verhalten, andererseits waren die steifen Förmlichkeiten doch genau das, dem er entfliehen wollte.
Sein Schädel dröhnte. Er versuchte, die Namen zuzuordnen, aber es gelang ihm schon nicht mehr. Wie konnte etwas so Simples seinen Kopf derart überfordern, dass er das Gefühl hatte, vor Anstrengung gleich ins Koma zu fallen? Er wollte sich nur noch hinlegen und den Rest des Tages verschlafen. Den Rest seines Lebens, verdammt. Mit diesem Kopf war er so völlig unnütz auf dieser Welt.
Stumm nickte er Frederick zu, in der Hoffnung, dass der verstand, was er wollte. Er schaffte es gerade nicht, zu sprechen. Er war sich nicht einmal sicher, ob er es überhaupt schaffte, die Treppe hinauf zu seinen Räumlichkeiten zu gehen, und stellte sich vor, wie er sich einfach hier auf dem dicken Teppichläufer zusammenrollte und schlief.
Glücklicherweise schien Frederick zu verstehen. »Folgen Sie mir, Mylord. Ich zeige Ihnen Ihre Räumlichkeiten.«
Dankbar atmete Rupert auf und zwang seine Füße mit all seiner verbliebenen Kraft, sich vom Fleck zu bewegen. Es gelang. Die Aussicht auf ein warmes Bett und eine von innen verschlossene Zimmertür schenkten ihm etwas Energie.
»Soll ich Ihnen den Katzenkäfig abnehmen?«, fragte Frederick.
»Nein«, flüsterte Rupert. »Den nehme ich selbst.«
3: ERSTER FEHLVERSUCH
»Was war das gerade?« Will sprach die Frage aus, die ihnen wohl allen im Kopf herumging, sobald sie die Küchentür hinter sich geschlossen hatten. Cameron war froh, dass er nicht der Einzige zu sein schien, der von der Ankunft des Lords ziemlich irritiert war. »Er konnte nicht mal Guten Tag sagen. So ein Pisscount!«
Aber das war es nicht, was Cameron so in Aufruhr versetzte. »Das war kein Pisscount«, widersprach er. »Das war kein einfach nur miesgelaunter, unfreundlicher Kerl, so wie man ihn aus den Medien kennt. Das war ... ein Zombie!« Ja, das war der passende Begriff. Ein Untoter.
»Ein Zombie?« Ellen schnaubte. »Was soll das heißen?«
»Habt ihr ihn denn nicht gesehen? Er war wie weggetreten. Seine Bewegungen waren so langsam, als würde er in einer großen Schüssel Gelee stehen. Und seine Augen, die waren ganz rotgerändert. Als hätte er«, etwas schnürte Cameron plötzlich die Kehle zu, »als hätte er geweint. Und gleichzeitig war sein Blick wie erloschen.«
»Der hat vielleicht geweint, weil das Wetter hier so bescheiden ist«, murmelte Will in seinen nichtvorhandenen Bart. »Könnte man ihm nicht verdenken.«
»Vielleicht hat er ja Schmerzen.« Ratlos hob Ellen die Hände. »Oder er muss Medikamente nehmen, die starke Nebenwirkungen haben.«
»Das könnte sein.« Cameron kratzte sich im Nacken. »Er tut mir leid. Und ich bin irgendwie geschockt.«
»Das sind wir alle ein bisschen«, gab Ellen zu verstehen. »So kenne ich ihn auch nicht. Ich hab ihn auch schon ein paar Jahre nicht gesehen und habe ihn als herrisch und unnahbar in Erinnerung. Aber Krankheit kann einen Menschen brechen. Und jetzt macht euch an die Arbeit und kocht ihm was zu essen, satt und glücklich sieht er ja auch nicht gerade aus.«
Das war Camerons Stichwort. Er wollte helfen. Und sein Weg, das zu tun, war das Kochen. Essen war tröstlich, es schenkte das Gefühl von Geborgenheit und er hoffte, dem kranken Lord dieses Gefühl vermitteln zu können.
Er machte sich an die Arbeit, aber seine Gedanken kreisten unaufhörlich um seinen Dienstherrn, diesen großen, schlanken Mann mit der leicht gebückten Haltung, dem akkurat geschnittenen, braunen Haar und diesen furchtbar leeren Augen hinter der eleganten Brille.
Welche Krankheit macht Menschen zu einem Zombie?
Krebs? Gar ein Hirntumor? Wie furchtbar das wäre. So etwas wünschte er seinem schlimmsten Feind nicht. Oder er stand unter starken Medikamenten. Vielleicht sogar Drogen. War er hier zum Entzug? Er war ja immer mal wieder betrunken ausgerastet und die Paparazzi hatten ihn dabei eifrig verfolgt. Aber Cairnroch Estate war keine Entzugsklinik, niemand hier kannte sich mit so etwas aus. Es wäre der blanke Irrsinn. Der Mann, dem er gerade begegnet war, hatte nichts mit dem Bild des Pisscounts zu tun, das er aus den Medien kannte. Angenehm war die Begegnung trotzdem in keiner Weise gewesen. Zum Glück musste er den Lord nur bekochen und konnte sich, im Gegensatz zu Frederick, ansonsten vor ihm verstecken.
Ellen half ihm ein wenig beim Kochen und schnitt ein paar der Zutaten. Sie hatten aufgrund der kurzfristigen Ankündigung keine Zeit gehabt, ausgefallene Lebensmittel zu besorgen, also machten sie das Beste aus dem, was sie zur Verfügung hatten: ein Entrecôte mit blanchiertem Gemüse und Kartoffelgratin. Als sie fertig waren, sah Cameron mit Stolz auf ihr Menü.
»Also wenn der Lord danach nicht aus seiner Lethargie erwacht und ab morgen fröhlich über das Anwesen hüpft, dann weiß ich auch nicht, was wir machen sollen.«
Ellen hob die Schultern. »Na, wir werden ja sehen.« Sie verschwand mit dem Tablett aus der Küche und Cameron ließ sich mit einem Seufzen auf einem Stuhl nieder.
Nur zu gern würde er jetzt Mäuschen spielen und den Viscount beim Essen beobachten, nur um zu sehen, ob und wie gut es ihm schmeckte. Was er zuerst aß und was zuletzt oder ob er einer war, der sich alles bis zum Ende gleichmäßig aufteilte.
Weil es in der Küche ziemlich stickig geworden war, entschloss er sich, trotz des Wetters einen Moment vor die Tür zu gehen und etwas frische Luft zu schnappen. Zumindest hatte es aufgehört, zu regnen. Das neue Jahr war gerade erst angebrochen und bis im Frühling die Natur neu erwachte, mussten sie noch ein wenig Geduld aufbringen. Dennoch mochte Cameron den Januar. Meistens. Er hatte so etwas von Neuanfang in sich. Abgesehen davon, dass seine Diätpläne jedes Mal scheiterten.
»Cam?«
Er drehte sich um. In der Tür stand Ellen und sie wirkte nicht unbedingt fröhlich.
»Was ist los?«, fragte Cameron.
»Komm mal mit in die Küche. Wir haben ein Hühnchen zu rupfen.«
Was hatte sie? Hatte er in ihren Augen mal wieder die Küche nicht ordentlich genug verlassen? Doch als er letztere betrat, sah er das Unglück direkt auf dem Tisch stehen. Der Teller des Lords. Nahezu unangetastet. »Was ist passiert?«
»Der Viscount hat das gesamte Essen zurückgehen lassen.«
»Sogar den Nachtisch?«, fragte er entsetzt.
»Aye, sogar den Nachtisch.«
»Aber ... was ... wieso?« Das konnte doch nicht wahr sein. Er hatte sich so viel Mühe damit gegeben! Was konnte an diesem Menü bitteschön nicht schmecken?
»Ich habe ihm das Essen gebracht und keine fünf Minuten später ließ er mich wieder rufen und sagte, ich solle es wieder mitnehmen. Er wolle dieses Essen nicht.«
»Na und hast du denn nicht gefragt, warum er es nicht will?«
»Doch, aber er hat die Frage nicht beantwortet. Er sagte nur ganz leise: Danke, Ellen.«
»Gah, ich hätte es wissen müssen!« Verärgert nahm Cameron seine Kochschürze ab. »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm! Zum Glück habe ich in meiner unnachahmlich weisen Voraussicht Tupperdosen mitgebracht.«
»Du weißt, dass wir laut Vertrag kein Essen von hier mit nach Hause nehmen dürfen?«
»Aye, ich weiß, aber meine Mutter würde mir was husten, wenn sie erfährt, dass ich ein gutes Entrecôte in die Kloake werfen musste.« Trotzig holte er mehrere Tupperdosen aus seinem Rucksack und füllte sie mit dem verschmähten Essen.
Ellen sah seufzend dabei zu.
»Und jetzt?«, fragte Cameron schließlich. »Was sollen wir machen? Raten, was er gerne mag und wann? Er hätte wenigstens mal was sagen können!«
»Jetzt beruhig dich doch wieder«, beschwichtigte Ellen. »Vielleicht hatte er einfach nur keinen Hunger. Er wirkt sehr mitgenommen und in keinem guten Zustand. Du hattest doch gerade vorhin selbst noch Mitleid mit ihm.«
»Aber das weiß man doch vorher, wenn man keinen Hunger hat, und lässt nicht erst seinen Koch ewig in der Küche stehen«, wandte Cameron ein.
»Vielleicht dachte er, der Appetit kommt noch mit dem Essen. Was weiß denn ich? Lass ihn doch erst mal hier ankommen. Vielleicht war er heute mit deinem Menü einfach überfordert. Er hat auch schon angekündigt, dass er kein Abendessen möchte. Mach ihm morgen zum Frühstück ein paar schöne Scones mit frischer Clotted Cream und die Welt sieht schon ganz anders aus.«
»Wann belieben der Lord denn zu frühstücken?«, erkundigte sich Cameron mit überspitztem Tonfall und kam sich selbst irgendwie unfair vor, denn wahrscheinlich hatte Ellen recht und der kranke Lord war mit einem feinen Menü überfordert. Vermutlich hätte er ihm einfach nur ein Gurkensandwich schmieren sollen. Manche Krankheiten sorgten ja auch dafür, dass man wenig Appetit hatte.
»Wenn ich das wüsste.« Ellen zuckte mit ihren rundlichen Schultern. »Ich werde mich nachher aber bei ihm erkundigen und dir eine Nachricht schreiben. Wenn du willst, kannst du jetzt nach Hause gehen. Sollte der Lord am Nachmittag doch noch einen kleinen Hunger bekommen, kann ich ihm ja ein paar Sandwiches machen.«
»Na schön. Bis morgen, Ellen. Und lass dich nicht ärgern.«
»Als ob ich mich ärgern lasse ...«
Cameron nahm seine Sachen und zog sich um. Sie waren immer noch ein klein wenig klamm, aber es war auszuhalten. Er sah auf die Uhr und überlegte. Er hatte das dringende Bedürfnis, irgendwo seine widersprüchlichen Gefühle aus Frust und Irritation loszuwerden, aber das Trinity Arms öffnete erst in einer Stunde wieder und seine Mutter war eher nicht die richtige Person dafür. Sie hatte genug eigene Sorgen.
Aber Finlay ... Finlay war sein Freund und wozu hatte man eine Beziehung, wenn man sich nicht gegenseitig seine Probleme anvertrauen konnte? Cameron zog sein Handy aus der Hosentasche und schrieb ihm eine Nachricht:
›Hab schon Feierabend. Und Redebedarf ...‹
›Okay? Dann lass uns doch in einer Stunde zum Joggen treffen! Wetter ist ja gerade auch noch ganz gut.‹
Cameron stieß ein leises Grummeln aus. Joggen, auch wenn sie es schon verabredet hatten, war jetzt nicht unbedingt das, worauf er Lust hatte. Aber Finlay versuchte einfach bei jeder Gelegenheit, ihn zum Sporttreiben zu bewegen. Es würde schwierig werden, ihm von seinem seltsamen Tag zu erzählen, wenn er die ganze Zeit nach Luft japsen musste. Aber es war besser, als ganz allein mit seinen Gefühlen und Gedanken zu sein. Warum nahm ihn das nur alles so mit?
Ja, er hatte manchmal ein mentales Problem: Wenn jemand sein Essen ablehnte, fühlte er sich gleich als Mensch abgelehnt. Und dann war es auch gleich noch das allererste Essen gewesen, das der Viscount hatte zurückgehen lassen. Das machte es nicht besser, aber Cameron sollte sich vielleicht wirklich nicht so sehr hineinsteigern. Ellen hatte recht. Morgen sah die Welt sicher schon ganz anders aus. Also hieß es: Arschbacken zusammenkneifen.
4: SKANDAL ODER KEIN SKANDAL
Cameron pfiff auf dem letzten Loch. Die Geräusche, die seinen überforderten Bronchien entströmten, würden als Soundtrack vermutlich einen Titel wie Die schönsten Lieder auf der Motorsäge tragen. Und seine Kleidung war schon wieder klamm, aber nicht, weil es regnete, sondern weil er schwitzte wie ein Iltis auf den Bahamas.
Ich hasse Joggen!
Er hasste es so leidenschaftlich, dass er wütende Schreie ausstoßen würde, wenn er denn noch genug Luft bekäme. Aber Finlay war wieder einmal unerbittlich.
»Pause!«, japste Cameron verzweifelt.
Finlay drehte sich um und wirkte genervt. »Das waren gerade mal zwei Kilometer. Reiß dich zusammen.«
»Ich kann nicht mehr!« Cameron blieb stehen, musste die Hände auf die Oberschenkel stützen und sich nach vorn beugen, um durchatmen zu können.
»Im Ernst?« Finlay seufzte und blieb ebenfalls stehen. »So wird das nie was.«
Er sagte nicht, womit es so nie etwas werden könnte, aber Cameron wusste genau, was er meinte. So wird das nichts mit dem Abnehmen. Er war objektiv gesehen nicht wirklich dick, aber er hatte etwas Bauch. Auf schwulen Datingportalen jedoch waren die Maßstäbe anders. Dort galt er schon als fett, aber um als Bär durchzugehen, war er nicht haarig genug. Dass sich damals so ein hübscher, athletischer Kerl wie Finlay bei ihm gemeldet hatte, grenzte an ein Wunder. Aber Finlay schien es zu seiner persönlichen Lebensaufgabe gemacht zu haben, Cameron zu einer besseren Figur zu verhelfen. Lass uns noch eine Runde laufen gehen und: Willst du das wirklich alles aufessen?, waren seine Lieblingssätze. Sie waren seit einem halben Jahr zusammen. Aber für Finlay war es wohl mehr ein Projekt als eine Beziehung.
»Eigentlich wollte ich reden und nicht joggen«, erklärte Cameron, als er wieder genug Luft bekam.
»Wenn du ein bisschen Kondition hinzugewinnen würdest, könntest du beides gleichzeitig«, versetzte Finlay.
»Vielleicht will ich aber auch gar nicht!«, fuhr Cameron auf. Er war genervt.
»Jetzt herrsch mich nicht so an!« Finlay zog seine hellen Brauen zusammen. »Du tust gerade so, als ob ich dir was Schlechtes will. Mir geht es nur um deine Gesundheit!«
»Ich bin gesund! Ich bin nicht krankhaft übergewichtig, auch wenn du es immer so darstellst.«
»Aye, noch nicht. Aber wenn du so weitermachst ...«
»Weißt du was? Du kannst mich mal!« Schnaubend warf Cameron die Arme in die Luft. »Ich hatte einen absolut beschissenen Tag. Ich bin heute Morgen klitschnass auf der Arbeit angekommen. Der Pisscount ist angereist und hat mein Essen verschmäht. Und jetzt gehst du mir noch auf die Eier mit deinem scheiß Sport!«
»Sport kann helfen, den Frust loszuwerden.«
»Aber mir nicht, verdammt noch mal! Mir hätte es geholfen, wenn du dich einfach mal hingesetzt und mir zugehört hättest. Aber aye, ich weiß, vom Rumsitzen nehme ich ja nichts ab.«
»Sorry, Cam.« Finlay hob die Hände und trat einen Schritt zurück. »Aber wenn du in so einem Ton mit mir redest, ist das Gespräch für mich hier beendet. Meld dich, wenn du bereit bist, an dir zu arbeiten.«
»Wenn ich was bin?«, rief Cameron Finlay hinterher, während der davonjoggte. »Bist du eigentlich mein Freund oder mein Fitnesstrainer?«
Wütend machte er auf dem Absatz kehrt und schlug den Weg in Richtung Pub ein. Dort würde man ihm zuhören. Und ihn nicht zum Dauerlauf zwingen.
»Ich bleibe bei meinem Tipp: Die wollen einen Skandal verbergen.« Sarah klopfte bekräftigend auf den Tisch und prostete den anderen dann mit ihrem Whisky zu.
»Nach Cammys Schilderung tippe ich ja eher auf Alkohol«, erklärte Jim. »Also, dass er ein Alki ist und sich hier vielleicht entwöhnen soll.«
»Und da schicken sie ihn ausgerechnet nach Schottland?«, versetzte Moe und alle lachten.
»Stimmt«, stellte Cameron fest, »du bist ja wirklich der Einzige von uns, der keinen Alkohol trinkt. Was auch das einzig wirklich Unschottische an dir ist.«
»Darfst du eigentlich überhaupt welchen ausschenken?«, fragte Jim und runzelte die Stirn. »Oder versohlt dir dein Allah dafür irgendwann den Hintern?«
Moe verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. »Eigentlich dürfte ich es als nomineller Muslim wohl nicht, aber ich bin nicht religiös. Wir sind nicht alle strenggläubig, weißt du? In Pakistan muss man zwar leider so tun, als ob, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Aber hier in meiner schottischen Heimat kann ich mir das ersparen und bin stolzer Atheist. Ich trinke nur deshalb keinen Alkohol, weil ihr so abschreckende Beispiele seid.« Er grinste und schon wieder lachten alle.
»Krebs«, kam es plötzlich aus der Ecke. Das war Sean MacLeod, der sich nur sehr selten zu Wort meldete, aber heute wohl auch mal etwas zum Gespräch beitragen wollte. »Ich denke, er hat Krebs. Vielleicht müsst ihr Sterbebegleitung für ihn machen.