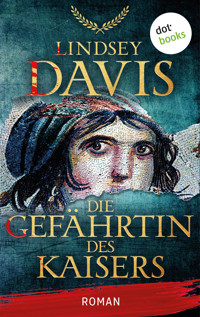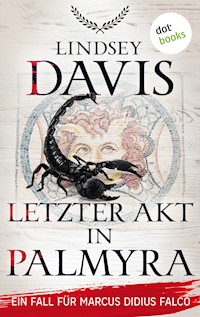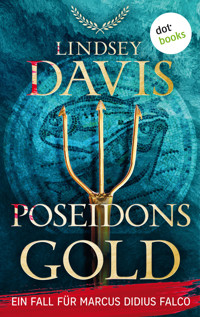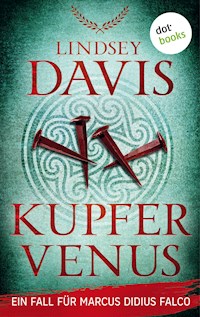6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Kaiser braucht einen neuen Meisterspion: Der historische Kriminalroman »Bronzeschatten« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 71 nach Christus. Marcus Didius Falco, Ex-Legionär und der begabteste Privatermittler im Imperium Romanum, hat es weit gebracht: Seine Klienten wohnen nicht mehr in den düsteren Gassen der Suburra, sondern in Residenzen und Stadthäusern auf dem Palatin. Die Nähe zur Macht hat jedoch einen Preis: Ehe sich Falco versieht, muss er für Kaiser Vespasian jene ebenso delikaten wie gefährlichen Aufgaben übernehmen, die niemals mit dem Namen des Herrschers in Verbindung gebracht werden dürfen. Falco soll drei Senatoren beschatten, die in Verdacht stehen, ein Attentat gegen den Kaiser unterstützt zu haben. Doch als der erste Verschwörer heimtückisch von einem mysteriösen Schattenmann ermordet wird, beginnt für Falco ein Wettlauf gegen die Zeit. Er muss den wahren Strippenzieher ausfindig machen, bevor alle Spuren – und Zeugen – verschwinden … »Ein Hoch auf Lindsey Davis: Fantastische Unterhaltung!« The Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Kriminalroman »Bronzeschatten« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der zweite Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 617
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 71 nach Christus. Marcus Didius Falco, Ex-Legionär und der begabteste Privatermittler im Imperium Romanum, hat es weit gebracht: Seine Klienten wohnen nicht mehr in den düsteren Gassen der Suburra, sondern in Residenzen und Stadthäusern auf dem Palatin. Die Nähe zur Macht hat jedoch einen Preis: Ehe sich Falco versieht, muss er für Kaiser Vespasian jene ebenso delikaten wie gefährlichen Aufgaben übernehmen, die niemals mit dem Namen des Herrschers in Verbindung gebracht werden dürfen. Falco soll drei Senatoren beschatten, die in Verdacht stehen, ein Attentat gegen den Kaiser unterstützt zu haben. Doch als der erste Verschwörer heimtückisch von einem mysteriösen Schattenmann ermordet wird, beginnt für Falco ein Wettlauf gegen die Zeit. Er muss den wahren Strippenzieher ausfindig machen, bevor alle Spuren – und Zeugen – verschwinden …
»Ein Hoch auf Lindsey Davis: Fantastische Unterhaltung!« The Times
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman Silberschweine wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der mittlerweile 20 Bände umfassenden Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »Shadows in Bronze« bei Century, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1990 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1992 Vito von Eichborn GmbH & Co. Verlag KG, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/RInArte, Kolonko, Oleg Senkov
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-744-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Bronzeschatten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Bronzeschatten
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Christa Seibicke
dotbooks.
Zum Gedenken an Margaret Sadler,
eine überaus liebe und treue Freundin
Dramatis Personae
Kaiser Vespasian: Herr der Welt (und knapp bei Kasse)
Seine Söhne:
Titus: (Ein Schatz)
Domitian: (Eine Heimsuchung)
Seine Beamten:
Anacrites: Ein »Sekretär« (Oberspion)
Momus: Ein »Sklavenaufseher« (noch ein Spion)
M. Didius Falco: Ein Privatermittler (kein Spion)
Im Kaiserlichen Palast
Gn. Atius Pertinax: (Verstorben)
Name unbekannt: Eine Leiche in einem Lagerhaus (reichlich verwest)
A. Curtius Longinus: Aus religiösen Gründen fern von Rom
A. Curtius Gordianus: Dito
L. Aufidius Crispus: Macht eine Kreuzfahrt
Das Personal
Barnabas: Lieblings-Freigelassener von Pertinax
Milo: Gordianus’ Verwalter; ein Muskelprotz
»Knirps«: Milos Spezi; ein schmächtiger Typ
Bassus: Crispus’ Bootsmann
Falcos Freunde und Verwandte
Falcos Mutter: Eine, mit der nicht zu spaßen ist
Galla (die Ausgenützte): Eine Schwester, verheiratet mit einem Flußschiffer
Larius: (Ein Romantiker) Sohn von Galla und dem Schiffer
Maia (die Vernünftige): Noch eine Schwester, verheiratet mit:
Famia (ein Viehdoktor): Ein unbeschriebenes Blatt
Mico (der Stukkateur): »Berufen Sie sich ruhig auf mich!«
L. Petronius Longus: Hauptmann der Aventinischen Wache; Falcos bester Freund. Ein netter Mann
Arria Silvia: Petros Frau. Eine tüchtige Person
Petronilla, Silvana, Tadia: Beider Töchter
Ollia: Das Kindermädchen der Töchter
Ein Fischerjunge: Das Anhängsel des Kindermädchens
Lenia: Inhaberin der Wäscherei Adler
Julius Frontinus: Ein Praetorianer, der Falcos Bruder kannte, das aber gern ungeschehen machen würde
Geminus: Ein Auktionator, der Falcos Vater sein könnte, aber hofft, daß er es nicht ist
Glaucus: Falcos Trainer; ansonsten ein vernünftiger Mann
D. Camillus Verus: Ein Senator mit einem Problem
Julia Justa: Seine Frau
Helena Justina: Beider Problem. Ex-Frau von Atius Pertinax (ihr Problem) und Ex-Freundin von Falco (seins)
Name unbekannt: Camillus’ Pförtner (ein Trottel)
Bekanntschaften von einer Dienstreise
Name unbekannt: Ein Priester im Tempel des Herkules Gaditamus auf dem Aventin
Tullia: Eine Kellnerin aus der Transtiberina mit großen Rosinen im Kopf
Laesus: Ein ehrlicher Schiffskapitän aus Tarentum
Ventriculus: Ein Klempner in Pompeji (leidlich ehrlich, für einen Klempner)
Roscius: Ein liebenswerter Gefängniswärter in Herculaneum
S. Aemilius Rufus Clemens: Ein Magistrat in Herculaneum mit sehr eindrucksvoller Ahnentafel (und nicht viel Verstand)
Aemilia Fausta: Seine Schwester, früher verlobt mit Aufidius Crispus
Caprenius Marcellus: Ein betagter Ex-Konsul. Adoptivvater von Atius Pertinax (auch nicht sehr gescheit)
Bryon: Pertinax’ Pferdetrainer auf dem Landgut des Marcellus
Weitere Bekannte
Name unbekannt: Eine geweihte Ziege
Nero (alias Schandfleck): Ein Ochse, der seine Ferien genießt
»Langohr«: Ein ziemlich verdutzter Esel
»Zerberus« (alias Fido): Ein zutraulicher Hofhund
Pertinax’ Vollblüter:
Ferox: Ein Champion
Goldschatz: Eine Witzfigur
Teil I
Ein ganz normaler Tag
Rom, 71 n. Chr. im Spätfrühling
»Sei mit dem Herzen bei der Arbeitund schöpfe Erquickung daraus …«
Marcus Aurelius, Selbstbetrachtungen
Kapitel 1
Kurz vor dem Ende der Gasse fingen die Härchen in meiner Nase an zu jucken. Es war Ende Mai, und in Rom herrschten seit einer Woche sommerliche Temperaturen. Die Sonne knallte tagtäglich mit solcher Kraft aufs Dach des Lagerhauses, daß drinnen sicher der Moder gärte. Da dufteten jetzt wahrscheinlich alle Gewürze des Morgenlandes um die Wette, und in dem Leichnam, den zu bestatten wir gekommen waren, blubberte es wohl schon vor Fäulnisgasen und Verwesung.
Ich hatte vier Freiwillige von der Prätorianergarde bei mir, außerdem einen Hauptmann mit Namen Julius Frontinus, der mit meinem Bruder im Feld gewesen war. Wir beide sprengten mit Brachialgewalt die Sperrketten am Hintereingang und machten anschließend einen Rundgang über den Verladehof, während das Fußvolk sich mit den Riegeln am wuchtigen Innentor abquälte.
Während wir noch warteten, knurrte Frontinus: »Falco, von heute an wollen wir so tun, als wäre ich deinem Bruder nie begegnet. Also stell dich drauf ein: Das hier ist die letzte Drecksarbeit, in die du mich mit reingezogen hast …«
»Kleine Gefälligkeit für den Kaiser, ganz vertraulich … Festus hätte dir sagen können, wie man so was nennt!«
Prompt betitelte Frontinus den Kaiser mit einem Lieblingsausdruck meines Bruders, der leider nicht druckreif ist.
»So ein Caesar hat’s wirklich gut«, sinnierte ich gutgelaunt. »Schicke Garderobe, freies Logis, immer den besten Platz im Circus – und so viele gesüßte Mandeln, wie das Herz begehrt!«
»Warum hat Vespasian ausgerechnet dir diesen Job angehängt?«
»Weil man mich leicht einschüchtern kann. Außerdem brauche ich Geld.«
»Aha, na das ist wenigstens einleuchtend.«
Ich bin Didius Falco, Marcus für meine Freunde. Als sich diese Geschichte zutrug, war ich dreißig Jahre alt und ein freier Bürger Roms. Was im Klartext bedeutet, daß ich in einem Slum zur Welt gekommen, bislang da hängengeblieben war und, von ein paar unvernünftigen Momenten abgesehen, auch damit rechnen mußte, dort zu sterben.
Ich war ein Privatermittler, dessen Dienste gelegentlich vom Palast in Anspruch genommen wurden. Eine verweste Leiche von der Liste des Censors verschwinden zu lassen entsprach ganz den Anforderungen, die man an mich und meine Arbeit stellte. So ein Job war unhygienisch, illegal und raubte mir den Appetit.
Meineidige, kleine Bankrotteure und Betrüger waren meine Kunden. Ich sagte vor Gericht als Zeuge aus, um hochgeborene Senatoren eines so ausschweifenden Lebenswandels zu überführen, daß er sich selbst unter Nero nicht vertuschen ließ. Ich holte reichen Eltern ihre entlaufenen Kinder zurück, die anderswo besser aufgehoben gewesen wären, und führte aussichtslose Prozesse für Witwen ohne Erbschaft, die schon in der Woche darauf ihre windigen Liebhaber heirateten – sowie ich ihnen ein paar Kröten gesichert hatte. Die meisten Männer versuchten, sich vor der Bezahlung zu drücken, während die meisten Frauen mich in Naturalien zu entlohnen trachteten. Was darunter zu verstehen ist, können Sie sich selber ausrechnen; ein knuspriger Kapaun oder ein schöner Fisch wurden mir jedenfalls nie angeboten.
Nach meiner Militärzeit verdiente ich mir so fünf Jahre lang freiberuflich mein Geld. Dann stellte der Kaiser mir in Aussicht, mich, vorausgesetzt, ich würde künftig für ihn arbeiten, in einen höheren Rang zu erheben. Einen solchen sozialen Aufstieg aus eigener Tasche zu finanzieren war so gut wie unmöglich, andererseits würde eine Beförderung meine Familie stolz und meine Freunde neidisch machen und obendrein den übrigen Mittelstand gründlich verärgern. Deshalb redete alle Welt mir ein, daß dieses irre Wagnis schon einen kleinen Verstoß gegen meine republikanischen Prinzipien wert sei. Und so wurde ich kaiserlicher Agent – durchaus kein Honigschlecken. Ich war der Neue, folglich halste man mir die unangenehmsten Jobs auf. Wie diese Leiche zum Beispiel.
Der Gewürzhof, zu dem ich Frontinus geführt hatte, lag im Gewerbegebiet und so nahe beim Forum, daß das emsige Treiben von dort bis zu uns herüberdröhnte. Die Sonne stand hoch; eine Schar Schwalben schraubte sich in den blauen Himmel. Eine magere Katze ohne Sinn für Diskretion spähte durchs offene Tor herein. Von den Nachbargrundstücken drang das Quietschen eines Flaschenzugs herüber, und man hörte einen Arbeiter pfeifen, ansonsten aber schien das Gelände menschenleer, wie üblich bei Lagerhäusern und Holzplätzen, besonders, wenn ich mal jemanden suche, der mir ein Brett billig verkauft.
Endlich war es der Wache gelungen, das Schloß aufzubrechen. Frontinus und ich wickelten uns jeder einen Schal um den Mund, dann stießen wir einen der hohen Türflügel auf. Der dumpfige Gestank, der uns ins Gesicht schlug, ließ uns unwillkürlich zurückweichen; der feuchte Schwall schien einem direkt in die Kleider zu fahren, die im Nu klamm an der Haut klebten. Wir warteten, bis die Luft sich einigermaßen geklärt hatte, und traten ein. Doch schon nach den ersten Schritten stockten wir wieder. Nackte Angst lähmte uns.
Über dem Raum hing eine geradezu unheimliche Stille – bis auf jenen Fleck, wo ein Fliegenschwarm unablässig surrend seine Kreise zog. Im oberen Teil des Speichers, wo durch trübe Fensterritzen spärliches Licht hereinsickerte, flirrten Sonnenstäubchen. Nach unten zu wurde das Licht immer schwächer. Nur undeutlich erkannten wir daher, was dort mitten auf dem Fußboden lag: die Leiche eines Mannes.
Der Verwesungsgeruch ist schwächer, als man denkt, aber trotzdem unverwechselbar.
Im Nähertreten verständigten Frontinus und ich uns mit einem Blick. Unschlüssig blieben wir vor dem Toten stehen. Dann lüpfte ich vorsichtig einen Zipfel der Toga, die ihn bedeckte, ließ das Tuch aber gleich wieder fahren und wich zurück.
Elf Tage hatte der Leichnam hier im Gewürzspeicher gelegen, bevor es einem Intelligenzbolzen im Palast einfiel, daß man ihn wegschaffen sollte. Nach der langen Zeit im warmen Mief zerfiel das Fleisch wie ein gargekochter Fisch.
Wir traten einen Moment beiseite, um uns zu wappnen.
»Hast du den alle gemacht?« würgte Frontinus schließlich hervor.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht.«
»War’s Mord?«
»’ne diskrete Hinrichtung – so vermeidet man einen unangenehmen Prozeß.«
»Und was hatte er verbrochen?«
»Landesverrat. Warum glaubst du wohl, wollte ich die Prätorianer dabeihaben?« Die Prätorianer waren die kaiserliche Leibwache.
»Aber warum dann die Geheimniskrämerei? Wieso hat man an ihm kein Exempel statuiert?«
»Weil unser neuer Kaiser offiziell mit einhelligem Jubel empfangen worden ist, also gibt es keine Verschwörungen gegen Caesar Vespasian!«
Frontinus lachte höhnisch.
In Rom wimmelte es nur so von Leuten, die Komplotte schmiedeten, auch wenn die meisten davon fehlschlugen. Dieser Mann hatte sich bei dem Versuch, dem Schicksal ins Handwerk zu pfuschen, zwar klüger angestellt als die meisten, doch nun lag er mausetot auf dem staubigen Estrich in einer eingetrockneten Lache seines eigenen Blutes. Etliche seiner Mitverschwörer waren aus Rom geflohen, ohne sich auch nur die Zeit zu nehmen, eine Tunika zum Wechseln oder eine Flasche Wein für unterwegs einzupacken. Zumindest einer von ihnen war ebenfalls tot – man fand ihn erdrosselt in seiner Zelle im gefürchteten Mamertinischen Gefängnis. Inzwischen waren Vespasian und seine beiden Söhne mit einmütigem Jubel in Rom empfangen worden und hatten sich daran gemacht, nach zweijährigem erbittertem Bürgerkrieg wieder Ordnung im Reich zu schaffen. Der Kaiser schien ganz Herr der Lage.
Die Verschwörung war niedergeschlagen worden; jetzt galt es nur noch, dieses verfaulende Beweisstück beiseite zu schaffen. Die gewieften Palastsekretäre ahnten, daß sich das unangenehme Geschehen schlecht vertuschen ließe, wenn die Familie des Toten Gelegenheit zu dem üblichen Pompbegräbnis mit Prozession, Flötenspiel und gemieteten Trauergästen bekam. Folglich bekam ein untergeordneter Beamter den Auftrag, einen taktvollen Laufburschen aufzutreiben. Dieser Mann schickte nach mir. Ich hatte eine große Familie zu ernähren und einen cholerischen Hausherrn, dem ich seit etlichen Wochen die Miete schuldete; für Beamte, die eine unorthodoxe Beisetzung arrangieren wollten, war ich also leichte Beute.
»Tja, daß wir hier rumstehn, schafft ihn auch nicht weg …«
Entschlossen schlug ich die Toga zurück und entblößte die Leiche.
Der Tote lag noch genauso da wie vor elf Tagen, und hatte sich doch furchtbar verändert. Wir konnten förmlich sehen, wie die Eingeweide unter dem Gewicht der Maden zusammensackten. Das Gesicht mochte ich gar nicht erst anschauen.
»Beim Jupiter, Falco, der Mistkerl kommt aus ‘ner guten Familie!« Frontinus’ Miene verdüsterte sich. »Du müßtest eigentlich wissen, daß keiner von denen ohne Meldung im Tagesanzeiger dahingeht. Wie sollen die Götter im Hades sonst ahnen, daß der Schatten einer bedeutenden Persönlichkeit den besten Platz auf Charons Fähre beansprucht …?«
Er hatte recht. Falls irgendwo eine Leiche mit den schmalen Purpurstreifen des römischen Adligen auftauchte, würden übereifrige Beamte darauf bestehen zu erfahren, wessen Sohn oder Vater dieser ehrenwerte Herr gewesen sei.
»Hoffentlich ist er nicht allzu prüde«, gab ich zurück. »Wir werden ihn ausziehen müssen …«
Julius Frontinus wiederholte leise den rüden Ausdruck meines Bruders.
Kapitel 2
Wir arbeiteten zügig, obwohl wir ständig gegen ein würgendes Ekelgefühl ankämpfen mußten.
Es galt, den Toten aus zwei Tuniken herauszupellen, die schon bestialisch nach Verwesung stanken. Nur der hartgesottenste Trödler würde diese Lumpen so gründlich durchsehen, daß ihm die gestickten Namensschildchen auffielen, die in den Kragen eingenäht waren. Aber wir mußten auf Nummer Sicher gehen.
Wieder draußen im Hof, sogen wir in gierigen Zügen die frische Luft ein und verbrannten alles, was brennbar war; sogar seine Schuhe und den Gürtel ließen wir verkohlen. Unsere Leiche trug mehrere Ringe. Frontinus zog sie ihm irgendwie ab; den Goldreif, der seinen Stand anzeigte, eine große Smaragd-Kamee, einen Siegelring und noch zwei, von denen einer einen Frauennamen eingraviert hatte. Verkaufen konnte man sie nicht, weil sie womöglich in die falschen Hände geraten wären; ich würde sie später in den Tiber werfen.
Zum Schluß schlangen wir ein Seil um den nun fast nackten Leichnam und wuchteten ihn auf eine Bahre, die wir mitgebracht hatten.
Die stummen Prätorianer sperrten die Gasse ab, bis Frontinus und ich unsere Last in einen Kanalschacht der Cloaca Maxima geworfen hatten. Wir lauschten: Da! Tief unten, nahe den Steinstufen am Einstieg, ein dumpfes Klatschen. Die Ratten würden ihn schnell genug finden. Sobald das nächste Sommergewitter sich über dem Forum entlud, würde das, was noch von ihm übrig war, durch den wuchtigen Bogen unter dem Pons Emilius in den Fluß gespült werden und dann entweder an den Pfeilern hängenbleiben, um vorbeifahrende Schiffer zu erschrecken, oder aber weiterschwimmen, um schließlich in einer Ruhestätte im Meer zu landen, wo gleichgültige Fische sein Skelett vollends blankputzen mochten.
Das Problem war erledigt; Rom würde keinen Gedanken mehr an seinen vermißten Bürger verschwenden.
Wir wanderten zurück, verbrannten die Bahre; wischten den Fußboden im Lagerhaus auf; schrubbten uns Hände, Arme, Beine und Füße sauber. Dann holte ich einen Eimer frisches Wasser, und wir wuschen uns noch einmal gründlich. Ich ging nach draußen, um das Schmutzwasser auf die Straße zu gießen.
Ein Mensch in einem grünen Umhang mit hochgeschlagener Kapuze blieb stehen, als er mich am Tor stehen sah. Ich nickte grüßend, ohne ihm in die Augen zu schauen. Er ging weiter. Ein ehrbarer Bürger, der guten Gewissens seinen Geschäften nachging, ohne etwas von dem schauerlichen Geschehen zu ahnen, das er eben verpaßt hatte.
Es wunderte mich freilich, daß er trotz des herrlichen Wetters so vermummt war; manchmal könnte man meinen, in Rom schlichen dauernd Leute durch finstere Seitengäßchen, die unerkannt bleiben wollten.
Ich sagte, ich würde abschließen.
»Gut, dann rücken wir ab!« Frontinus würde seine Jungs auf einen wohlverdienten Schluck einladen. Mich bat er nicht dazu – was mich nicht überraschte.
»Danke für deine Hilfe. Auf bald, Julius …«
»Nicht, wenn ich es verhindern kann!«
Als sie gegangen waren, blieb ich noch kurz am Tor stehen. Das Herz war mir schwer. Jetzt, da ich allein war, hatte ich Muße, mich umzuschauen … Im Hof fiel mein Blick auf einen interessanten Haufen, der, diskret von einem Stoß alter Felle verdeckt, die Außenmauer stützte. Als Sohn eines Auktionators war ich einfach außerstande, einen herrenlosen Gegenstand, der sich eventuell würde verscherbeln lassen, zu ignorieren, also schlenderte ich darauf zu.
Unter den Fellen steckten ein munteres Spinnenpaar und jede Menge Bleibarren. Die Spinnen waren mir fremd, die Barren dagegen alte Bekannte; die Verschwörer hatten sich den Weg an die Macht mit gestohlenem Silber erkaufen wollen. Später hatten die Prätorianer alle Barren mit Edelmetallgehalt im Tempel des Saturn verwahrt, aber die Diebe, die das ungemünzte Silber aus den britischen Minen schmuggelten, hatten den Verschwörern große Mengen Blei untergejubelt – wertlos für Bestechungen – und so ihre Auftraggeber munter betrogen. Offenbar war das Blei hier für den Abtransport durch einen kaiserlichen Armeezug zurückgelassen und mit militärischer Präzision gestapelt worden, jede Reihe exakt im rechten Winkel zu der darunter. Für einen Mann mit den richtigen Kontakten hatten Bleibarren durchaus einen gewissen Wert … Ich deckte sie wieder zu, wie sich das für einen ehrlichen Staatsdiener gehört.
Ich ließ das Tor offen und ging noch einmal zu dem Kanalschacht über der Cloaca Maxima zurück. Von all den stinkenden Leichen gescheiterter Existenzen, die Rom verschandelten, war dies die letzte, die ich freiwillig so respektlos behandelt hätte. Jeder Verräter hat eine Familie, und seine kannte ich. Sein nächster männlicher Verwandter, der diese Beisetzung von Rechts wegen hätte leiten sollen, war ein Senator, dessen Tochter mir sehr, sehr viel bedeutete. Ein typisches Falco-Dilemma: Weil ich bei einer höchst wichtigen Familie Eindruck schinden wollte, mußte ich meinen guten Charakter dadurch beweisen, daß ich ihren toten Verwandten ohne jede Zeremonie in einer öffentlichen Kloake verschwinden ließ …
Ächzend wuchtete ich den Kanaldeckel wieder hoch, streute hastig eine Handvoll Erde hinunter und murmelte dazu die entsprechenden Worte: »Den Göllern der Schallen empfehle ich diese Seele …«
Ich warf ihm noch eine Kupfermünze für den Fährmann hinunter und hoffte, daß mir Fortuna hold war und ich nie wieder von ihm hören würde.
Aber es sollte nicht sein. Die Schicksalsgöttin schneidet mir höchstens mal eine Grimasse, als hätte sie sich grade ihren heiligen Finger in einer Tür geklemmt.
Zurück im Lagerhof trat ich das Feuer aus und verstreute die Asche. Dann legte ich mir Ketten über die Schulter, mit denen ich das Tor verschließen wollte. Kurz vorm Gehen machte ich noch eine letzte Kontrollrunde; meine Muskeln spannten sich unter der Last der schweren Eisenglieder.
Der ganze Raum roch jetzt nach Zimtrinde. Die rastlosen Fliegen kreisten weiter über dem Fleck am Boden, als geistere die Seele des Toten noch immer dort herum. Säcke, prall gefüllt mit orientalischen Spezereien von unschätzbarem Wert, duckten sich reglos im Schatten der Mauern und verströmten einen herbsüßen Duft, der mir mächtig unter die Haut ging.
Ich wandte mich zum Gehen. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr. Panische Angst überfiel mich – als hätte ich ein Gespenst gesehen. Aber ich glaube nicht an Gespenster. Aus dem staubflimmernden Dämmer stürzte eine vermummte Gestalt auf mich zu.
Es war ein Mensch aus Fleisch und Blut, der eine Faßdaube packte und damit nach meinem Kopf zielte. Obwohl er mit dem Rücken zum Licht stand, kam er mir irgendwie bekannt vor. Es blieb keine Zeit, mich nach seinem Problem zu erkundigen. Ich wirbelte herum und schleuderte mit aller Kraft die Ketten gegen seine Rippen. Dann verlor ich den Halt, das schwere Gewicht riß mich zu Boden, und ich schlug mir den rechten Ellbogen und das rechte Knie auf.
Mit etwas Glück hätte ich ihn schnappen können. Das Glück ist selten mein Bundesgenosse. Während ich mich noch wild rudernd von den Eisenketten befreite, machte der Schurke sich aus dem Staub.
Kapitel 3
Ich war nur für einen Augenblick zum Kanalschacht zurückgekehrt, hätte aber auf so was gefaßt sein müssen. Das war schließlich Rom; hier braucht man eine Schatzkammer bloß drei Sekunden unbewacht zu lassen, und schon macht irgendein Dieb sich das zunutze.
Ich hatte das Gesicht des Mannes nicht gesehen, wurde aber das Gefühl nicht los, ihn wiedererkannt zu haben. Die grüne Kapuze, die er so sorgsam tief in die Stirn gezogen hatte, war unverwechselbar: der Mann, den ich gesehen hatte, als ich vorhin den Wassereimer ausleerte. Ich verfluchte erst ihn, dann mich und humpelte schließlich auf die Gasse hinaus, Blut sickerte an meinem Bein herunter.
Da, wo die Sonne hinschien, strahlten die Mauern wohlige Wärme ab, aber im Schatten fröstelte mich. Der Durchgang hinter dem Lagerhaus war kaum drei Fuß breit und mündete auf der einen Seite in eine unheimliche Halsabschneidergasse. Das andere Ende lag hinter einer buckligen Kurve. Zu beiden Seiten des Weges lagen muffige Höfe, vollgestopft mit ausgedienten Handwagen und Stapeln schwankender Fässer. Fettige Zugseile baumelten in gähnenden Toreinfahrten. Auf Nägel aufgespießte grimmige Verbotstafeln warnten Besucher vor Toren, die aussahen, als hätte sie schon seit zehn Jahren kein Mensch mehr geöffnet. Beim Anblick dieser miesen Gegend schien es unglaublich, daß das bunte, geschäftige Treiben des Forums nur zwei Gehminuten entfernt war – aber das war eben Rom. Wie ich schon sagte.
Keine Menschenseele in Sicht. Nur eine Taube flatterte auf einen Dachfirst und verschwand durch einen geborstenen Ziegel. Einmal knarrte ein Faßlager. Sonst war nichts zu hören. Bis auf mein Herz.
Er konnte praktisch überall sein. Wenn ich ihn hier in einer Richtung suchte, mochte er in eine andere entwischen. Während ich mich auf meine Suche konzentrierte, konnte er oder auch ein anderer Schurke, der vielleicht gar nichts mit ihm zu tun hatte, unversehens auf mich losstürzen und mir den Lockenkopf einschlagen. Und wenn das geschah, oder wenn ich in einem dieser aufgelassenen Speicher durch den morschen Estrich brach, würde mich womöglich tagelang niemand finden.
Ich humpelte zurück. Mit einem alten Nagel öffnete ich das Schloß zum Lager und drehte eine Runde über den sonnendurchglühten Hof. Mit der Militärzange, die Frontinus dagelassen hatte, klemmte ich die Torketten wieder fest, wie sich das für einen verantwortungsbewußten Bürger gehört. Dann ging ich.
Der Leichengestank hatte sich in meinen Kleidern festgesetzt. Der Geruch war unerträglich; ich ging nach Hause, um mich umzuziehen.
Ich wohnte im Dreizehnten Bezirk. Das waren zehn Minuten zu gehen, wenn wenig Verkehr herrschte, aber jetzt um die Zeit brauchte ich dreimal so lange, um mich durch das Gewühl zu drängen. Der Trubel schien ärger denn je. Als ich endlich zu Hause ankam, war ich wie taub und völlig erledigt.
Das Falco-Apartment war das Beste, was ich mir leisten konnte, also eine grausliche Bleibe. Ich wohnte zur Miete in einer miesen Mansarde über der Wäscherei Adler in einer Straße, die hochtrabend Brunnenpromenade hieß (aber niemals einen Brunnen besessen hatte und auch keine Promenade war). Um zu diesem imposanten Domizil zu gelangen, mußte ich von der vergleichsweise luxuriösen, befestigten Via Ostia abbiegen und mich durch eine Reihe von verschlungenen Torwegen zwängen, die immer schmaler und bedrohlicher wurden. Da, wo die Fahrrinne praktisch ins Nichts zusammenschrumpfte, lag die Brunnenpromenade. Ich schlängelte mich zwischen etlichen Wäscheleinen mit feuchten Togen hindurch, die den Eingang zur Wäscherei blokkierten, und stieg dann die sechs steilen Treppen zu der himmelhohen Bruchbude hoch, die mir zugleich als Büro und Wohnung diente.
Oben angekommen klopfte ich, nur so zum Spaß und auch, um etwaiges Getier zu verscheuchen, das sich womöglich während meiner Abwesenheit hier verlustierte. Schließlich bat ich mich einzutreten und entriegelte die Tür.
Ich hatte zwei Zimmer, jedes knapp acht Fuß im Quadrat. Der wackelige Balkon wurde extra berechnet, aber mein Vermieter Smaractus gab mir einen Rabatt in Form von Tageslicht, das durch ein Loch im Dach hereinschien (plus kostenloser Wasserzufuhr, wann immer es regnete). Es gab Multimillionäre in Rom, die ihre Pferde besser unterbrachten, aber andererseits waren Tausende von Unbekannten noch schlechter dran.
Mein Penthouse war die richtige Bleibe für Leute, die oft ausgingen. Dennoch hatte ich mich in diesem erbärmlichen Loch fünf Jahre lang ganz wohl gefühlt. Billig war es nie gewesen; in Rom gab es keine günstigen Wohnungen. Manche meiner Nachbarn waren ziemlich unangenehme Typen, aber vor kurzem hatte sich ein liebenswerter Gecko bei mir einquartiert. Wenn ich die Balkontür offenließ, konnte ich vier Gäste bewirten, und falls ein Mädchen dabei war, das nichts dagegen hatte, auf meinem Schoß zu sitzen, sogar fünf. Ich lebte allein; was anderes war finanziell auch gar nicht drin.
Begierig darauf, endlich aus meiner stinkenden Tunika rauszukommen, durchquerte ich schnell das vordere Zimmer. Hier hatte ich einen Tisch, an dem ich aß, schrieb oder über das Leben nachdachte, außerdem eine Bank, drei Hocker und einen Herd, Marke Eigenbau. Im Schlafzimmer standen mein durchgelegenes Bett, ein Gästesofa, eine Kleidertruhe, die gleichzeitig als Waschtisch diente, und eine Trittleiter, um im Notfall das lecke Dach zu flicken.
Erleichtert stieg ich aus den Kleidern, benutzte den Rest Wasser in einem Krug dazu, mich nochmal gründlich abzuschrubben, und kramte dann eine Tunika heraus, die erst zwei neue Risse aufwies, seit meine Mutter sie das letzte Mal geflickt hatte. Ich kämmte mich flüchtig, rollte meine zweitbeste Toga zusammen für den Fall, daß ich später noch in ein seriöses Lokal einkehren sollte, und stapfte wieder nach unten.
Als ich meine schmutzigen Sachen in der Wäscherei abgab, begrüßte Lenia, die Inhaberin, mich mit heiserer Stimme.
»Falco! Smaractus wartet auf deine Miete!«
»Na so eine Überraschung! Sag ihm, im Leben kriegt man nicht immer alles, was man sich wünscht.«
Lenia saß in dem Winkel, den sie sich als Büro eingerichtet hatte. Da hockte sie in ihren schmierigen Schlappen und schlürfte Pfefferminztee. Bevor diese bedauernswerte Närrin beschloß, in Immobilien zu investieren (und sich ihre Zukunft zu verbauen), indem sie sich unseren Vermieter Smaractus als Ehemann angelte, hatte Lenia zu meinem ärmlichen Freundeskreis gezählt. Sobald ich sie dazu überreden konnte, diesem Scheusal den Laufpaß zu geben, würde sie wieder dazugehören. Lenia war eine aus dem Leim gegangene Schlampe, die fünfmal mehr Kraft hatte als man ihr ansah, und auffallenden, Henna-roten Zotteln, die sich dauernd unter dem Tuch hervorstahlen, das sie um den Kopf geschlungen trug. Sie mußte sich ständig die Strähnen aus der Stirn streichen, um zu sehen, wo sie hintrat.
»Er meint es ernst, Falco!« Sie hatte wäßrige Augen, und ihre Stimme schepperte wie vierzig getrocknete Erbsen in einem Blechnapf.
»Schön. Ich mag Männer, die ihre Ziele ernsthaft verfolgen.«
Unterdessen hatte Lenia nicht mehr meine ungeteilte Aufmerksamkeit, was ihr zweifellos nicht entgangen war. Bei ihr saß nämlich eine Frau, die sie jetzt als Secunda vorstellte, eine Freundin. Die Zeiten, da ich es für nützlich gehalten hatte, mit Lenia zu flirten, waren lange vorbei, und so machte ich nun ihrer Freundin schöne Augen.
»Guten Tag. Ich bin Didius Falco. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen?« Die Dame klingelte mit ihren Armreifen und lächelte vielsagend.
»Vor dem nimm dich in acht!« warnte Lenia.
Secunda war voll erblüht, aber noch nicht überreif; sie war alt genug, um eine interessante Herausforderung darzustellen, und doch so jung, daß diese Herausforderung anzunehmen ein Vergnügen versprach. Sie musterte mich gründlich, ich hielt ihrem Blick stand.
Man bot mir Pfefferminztee an, aber angesichts seiner unappetitlichen grauen Färbung lehnte ich aus gesundheitlichen Gründen ab. Secunda reagierte auf meinen drohenden Abzug mit wohltuendem Bedauern; ich nahm die Miene eines Mannes an, der sich möglicherweise würde aufhalten lassen.
»Irgend so ein Trödler mit ’nem Frettchengesicht hat nach dir gefragt, Falco«, erklärte Lenia mürrisch.
»Ein Klient?«
»Wie soll ich das wissen? Manieren hatte er keine, könnte also dein Typ sein. Ist einfach reingeplatzt und hat deinen Namen genannt.«
»Ja, und dann?«
»Ist er wieder gegangen. War mir auch recht so.«
»Aber«, ergänzte Secunda zuckersüß, »er wartet draußen auf Sie, glaube ich.« Ihr entging nichts – wenn es sich um Männer handelte.
Lenias Kabuff war zur Straße hin offen, abgesehen von den dicht behängten Wäscheleinen. Ich zupfte so lange daran herum, bis ich durch ein Guckloch hinausspähen konnte, ohne selbst gesehen zu werden. Ein grüner Mantel mit hochgeschlagener Kapuze wanderte zwei Häuser weiter vor der offenen Falltür von Cassius’ Brotladen auf und ab.
»Der da in Grün?« Sie nickten. Ich runzelte die Stirn. »Irgendein Schneider hat da scheint’s einen Coup gelandet! Offenbar sind grüne Capes mit spitzen Kapuzen diesen Monat der letzte Schrei …« Ich würde es bald genau wissen; mein ältester Neffe hatte nächsten Donnerstag Geburtstag, und wenn das wirklich die neueste Mode war, würde Larius sich garantiert so einen Kaftan wünschen. »Ist er schon lange da?«
»Er kam gleich nach dir und hat seitdem gewartet.«
Ein mulmiges Gefühl machte sich in meiner Magengegend breit. Ich hatte gehofft, der Bürger in Grün sei nur ein harmloser Dieb, der spitz gekriegt hatte, daß in dem Lagerhaus was im Gange war, und sich ranpirschte, um vielleicht was abzustauben, sobald Frontinus und ich gegangen waren.
Nun, da er mir bis nach Hause gefolgt war, erschien die Sache in einem anderen Licht. Soviel Neugier konnte nicht harmlos sein. Also hatte er sich nicht rein zufällig für dieses Lagerhaus interessiert. Vielmehr mußte er jemand sein, der unbedingt herauskriegen wollte, was sich da tat und wer dort herumstöberte. Das wiederum verhieß Ärger für diejenigen von uns im Palast, die glaubten, wir hätten die Verschwörung gegen den Kaiser endgültig zu Grabe getragen.
Während ich ihn noch beobachtete, verlor der Grüne die Lust am Spionieren und trollte sich Richtung Via Ostia. Ich mußte mehr über ihn herausbekommen. Also hob ich grüßend den Arm vor Lenia, bedachte Secunda mit einem Lächeln, das ihr Blut hoffentlich in Wallung halten würde, und nahm die Verfolgung auf.
Cassius, der Bäcker, der offenbar auch ein Auge auf den Fremden gehabt hatte, schenkte mir im Vorbeigehen einen nachdenklichen Blick und ein altbackenes Brötchen.
Kapitel 4
Beinahe hätte ich ihn auf der Hauptstraße verloren. Mein Blick fiel nämlich flüchtig auf meine Mutter, die an einem Gemüsestand die Zwiebeln begutachtete. Ihrem grimmigen Gesicht nach zu urteilen, genügten die Zwiebeln ihren Ansprüchen ebensowenig wie die meisten meiner Freundinnen. Meine Mutter lebte in dem Wahn, daß mein neuer Job in Diensten des Palastes ein anständiges Gehalt, geregelte Arbeitszeiten und damit saubere Tuniken hieß. Es widerstrebte mir, sie schon nach so kurzer Zeit entdecken zu lassen, daß ich wie gehabt Schurken nachsteigen mußte, die ausgerechnet dann auf der Straße herumspazierten, wenn ich lieber zu Mittag gegessen hätte.
Es bedurfte schon ordentlicher Beinarbeit, ihr auszuweichen, ohne dabei seine Spur zu verlieren. Zum Glück war der Farbton seines Mantels ein Quietschgrün, das zwar den Augen weh tat, dafür aber leicht wiederzufinden war.
Ich folgte ihm hinunter zum Fluß, den er auf der Sublicius-Brücke überquerte; ein zehnminütiger Fußweg fort von der Zivilisation und hin zu den Bruchbuden im Transtiberinischen Bezirk, wo die Straßenhändler unterkriechen, wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit vom Forum verjagt werden. Der Vierzehnte Bezirk gehörte zwar schon seit der Zeit meiner Großeltern zu Rom, aber es trieben sich genug dunkelhäutige Immigranten dort herum, um die Gegend noch heute fremd wirken zu lassen. Nach dem, was ich am Vormittag hatte erledigen müssen, war es mir egal, ob einer von diesen Typen mir sein Messer in den Rücken stieß.
Wenn es einem egal ist, dann versuchen sie’s erst gar nicht.
Wir gingen jetzt im tiefen Schatten enger Straßenschluchten, in die gefährlich baufällige Balkone hineinragten. Magere Hunde streunten durch den Rinnstein. Zerlumpte segelohrige Zigeunerkinder brüllten hinter den verängstigten Kötern her. Wenn ich ehrlich war, so mußte ich mir eingestehen, daß mich der ganze Bezirk ängstigte.
Der grüne Mantel legte ein gleichmäßiges Tempo vor, wie ein braver Bürger, der sich schon aufs Essen freut. Er war von mittlerer Statur, mit schmalen Schultern und jugendlichem Gang. Sein Gesicht hatte ich immer noch nicht gesehen; trotz der Hitze behielt er die Kapuze auf. Er war zu lichtscheu, um ehrlich zu sein, soviel stand fest.
Zwar ließ ich aus Berufsethos ein paar Wasserträger und Pastetenverkäufer zwischen uns gehen, aber nötig war diese Vorsichtsmaßnahme nicht. Er wich niemandem aus und zog nirgends den Kopf ein, obgleich das in dieser miesen Gegend doch sehr angebracht gewesen wäre. Er schaute sich nicht einmal um.
Ich schon. Regelmäßig. Niemand schien mich zu beschatten.
Über unseren Köpfen waren Wäscheleinen gespannt, an denen fadenscheinige Decken zum Lüften hingen, und darunter baumelten an Seilen Körbe, Messinggeräte, billige Fähnchen und löchrige Bettvorleger. Die Afrikaner und Araber, die damit handelten, schienen ihn zu kennen, aber als ich vorbeikam, fielen unflätige Bemerkungen. Na, wer weiß, vielleicht bewunderten sie mich einfach, weil ich ein so hübscher Bursche war. Der Duft von frischem Fladenbrot und süßem, fremdländischen Kuchen stieg mir in die Nase. Hinter halb geöffneten Läden schrien abgearbeitete Frauen mit schrillen Stimmen faulen Männern ihren Frust entgegen. Gelegentlich riß den Männern die Geduld, und sie setzten sich zur Wehr. Ich lauschte voll Mitgefühl und ging schneller. In dieser Gegend gab es Kupfermesserchen mit eingekerbten Zaubersprüchen zu kaufen, aus orientalischen Blumen destillierte Suchtmittel und Kinder, die aussahen wie Engel, obwohl das Geschäft mit dem Laster sie bereits mit heimtückischen Krankheiten verseucht hatte. Hier konnte man für Geld alles bekommen, die Erfüllung eines Herzenswunsches oder einen schäbigen Tod – für jemand anderen oder für einen selbst.
Ich verlor ihn südlich der Via Aurelia, in einer merkwürdig stillen Straße etwa fünf Minuten diesseits der Grenze zum Vierzehnten Bezirk.
Er war in eine schmale Seitengasse eingebogen, und als ich um die Ecke bog, war von ihm nichts mehr zu sehen. Versteckte, dunkle Torwege gähnten alle paar Schritte unheilvoll in den nackten grauen Mauern, auch wenn der Ort vielleicht nicht besonders unheimlich war.
Ich überlegte, was zu tun sei. Kolonnaden, in denen ich mich hätte rumdrücken können, gab es wie gesagt nicht, und die Siesta meines grünen Freundes würde womöglich den ganzen Nachmittag dauern. Ich hatte keine Ahnung, wer er war oder warum wir uns gegenseitig beschatteten, und war mir auch nicht sicher, ob ich das eigentlich noch wissen wollte. Es war hoher Mittag, die heißeste Stunde des Tages, und ich verlor allmählich das Interesse. Falls irgendwer in der Transtiberina mich für einen Spitzel hielt, dann würde man mich morgen mit einem Monogramm eines Verbrechers in der Brust in der Gosse finden.
Ich entdeckte ein Kneipenschild, betrat den kühlen, dämmrigen Raum, und als die bucklige, großbusige Wirtin herangewatschelt kam, bestellte ich gewürzten Wein. Außer mir war kein Gast zu sehen. Der winzige Laden hatte nur einen Tisch. Die Theke war im Dustern kaum zu erkennen. Ich tastete die Bank nach Splittern ab und setzte mich dann vorsichtig. Es war eine von diesen Spelunken, wo man eine Ewigkeit auf sein Getränk warten mußte, weil die alte Fettel es sogar für einen Ausländer jeweils frisch zubereitete. Soviel Gastfreundschaft machte mich leicht verdrießlich und unvorsichtig; beides Empfindungen, die mir nur allzu vertraut waren.
Die Frau trollte sich wieder, und ich blieb mit meinem Becher allein.
Ich faltete die Hände und dachte über das Leben nach. Da ich zu müde war, um das Leben im allgemeinen in Angriff zu nehmen, beschränkte ich mich auf mein eigenes.
Ich war deprimiert. Meine Arbeit war grauenhaft, und das Gehalt spottete jeder Beschreibung. Obendrein stand ich kurz davor, die Affäre mit einer jungen Frau zu beenden, die ich noch kaum kannte und eigentlich nicht verlieren wollte. Sie hieß Helena Justina. Sie war die Tochter eines Senators, und daß sie sich mit mir traf, war nicht direkt verboten, trotzdem hätte es einen schönen Skandal gegeben, wenn ihre Freunde dahintergekommen wären. Es war eine von diesen Katastrophenbeziehungen, die man anfängt mit dem Wissen, daß sie keine Zukunft haben, und dann sofort wieder abbricht, weil eine Fortsetzung noch schmerzhafter ist als die Trennung.
Ich hatte keinen Schimmer, was ich ihr jetzt sagen sollte. Sie war ein wunderbares Mädchen. Ihr unerschütterliches Vertrauen zu mir stürzte mich in Verzweiflung. Trotzdem spürte sie wahrscheinlich, daß ich dabei war, mich von ihr zu lösen. Und die Gewißheit, daß sie die Situation bereits durchschaut hatte, war alles andere als hilfreich beim Verfassen meiner Abschiedsrede …
Ich wollte vergessen, und darum nahm ich einen kräftigen Schluck. Aber als der heiße Zimt meinen Gaumen kitzelte, weckte das die Erinnerung an das Lagerhaus. Plötzlich fühlte meine Zunge sich an wie ein Reibeisen. Ich ließ den Becher stehen, warf ein paar Münzen auf den Teller und rief Adieu. Ich war schon auf dem Weg nach draußen, als eine Stimme hinter mir laut »Danke!« sagte. Nachdem ich mich umgedreht hatte, blieb ich dann allerdings.
»Nicht der Rede wert, Schätzchen! Kann die Frau, die mich zuerst bedient hat, zaubern, oder bist du jemand anders?«
»Ich bin ihre Tochter!« Sie lachte.
Man konnte sehen, daß sie’s war (jedenfalls so ungefähr). In zwanzig Jahren mochte dieser bildschöne, schlanke Körper genauso reizlos aussehen wie der ihrer Mama – aber bis dahin würde sie noch ein paar faszinierende Phasen durchlaufen. Jetzt war sie etwa neunzehn, ein Stadium, das mir besonders gefiel. Die Wirtstochter war größer als ihre Mutter, was ihre Bewegungen anmutiger erscheinen ließ; sie hatte große dunkle Augen und kleine weiße Zähne, einen frischen Teint, trug Glitzerohrringe und jene Miene vollkommener Unschuld, die von schamlosen Verstellungskünsten zeugte.
»Ich bin Tullia«, sagte die Erscheinung.
»Guten Tag, Tullia!«
Tullia lächelte mich an. Sie war ein kuscheliger Armvoll Weiblichkeit und hatte Zeit; ich dagegen war ein Mann, dessen Lebensgeister nach Trost lechzten. Ich lächelte freundlich zurück. Wenn ich schon die Dame meines Herzens verlieren mußte, dann sollten die Frauen mit lockerer Moral ruhig ihre verruchtesten Tricks an mir ausprobieren.
Ein Privatermittler, der sein Geschäft versteht, braucht nicht lange, um sich mit einer Bardame anzufreunden. Ich begann ein harmloses Geplänkel mit Tullia und kam dann ganz zwanglos zum Thema. »Ich suche jemanden. Kann sein, daß du ihn hier schon mal gesehen hast – er trägt oft einen Mantel in einem ziemlich häßlichen Grün.«
Daß die schöne Tullia sich auf Anhieb an meinen Typen erinnerte, wunderte mich nicht. Bestimmt waren die meisten Männer hier in der Gegend ihretwegen erpicht darauf, bei ihrer Mutter Stammgast zu werden. »Er wohnt gleich gegenüber.« Sie kam zur Tür und zeigte mir das quadratische Fensterchen des Zimmers, in dem er sich eingemietet hatte. Ich fing an, ihn zu mögen. Seine Umgebung machte einen recht ungesunden Eindruck. Alles deutete darauf hin, daß der Mann in Grün keinen Deut besser dran war als ich.
»Ob er jetzt wohl zu Hause ist?«
»Ich kann ja mal nachsehen«, erbot sich Tullia.
»Ach, wie denn?«
Sie schaute zur Decke. Die Kneipe hatte die übliche Stiege an der Innenwand, die zu einer Dachkammer hinaufführte, in der die Eigentümer wohnten und schliefen. Wahrscheinlich war ein schmales, längliches Fenster über dem Eingang die einzige Licht- und Luftzufuhr. Eine aufgeweckte junge Dame, die sich für andere Menschen interessierte, würde natürlich ihre Freizeit an diesem Fenster verbringen und sich die Männer anschauen, die draußen vorbeigingen.
Tullia machte kehrt und wollte schon leichtfüßig die Treppe hinaufspringen. Ich hätte mich ihr anschließen können, ahnte aber, daß ihre Mutter oben auf der Lauer liegen würde, und das nahm mir die Lust am Abenteuer.
»Danke, aber im Augenblick möchte ich ihn nicht behelligen.« Wer immer er war und was er auch im Schilde führte, niemand würde mich dafür bezahlen, daß ich ihn beim Essen störte. »Weißt du etwas über ihn?«
Sie sah mich argwöhnisch an, aber ich hatte ungezwungene Manieren und meine Locken waren echt; außerdem hatte ich ihrer Mutter ein anständiges Trinkgeld hingelegt. »Er heißt Barnabas. Vor etwa einer Woche ist er hier aufgekreuzt …« Während sie sprach, machte ich mir so meine Gedanken. Den Namen Barnabas hatte ich doch vor kurzem erst irgendwo gehört. »Er hat drei Monatsmieten im voraus bezahlt – ohne einen Muckser! Und als ich ihn deswegen einen Dummkopf genannt habe, da hat er bloß gelacht und gesagt, er würde eines Tages ein reicher Mann sein …«
Ich grinste. »Möchte wissen, warum er dir das erzählt hat?« Zweifellos aus demselben Grund, der Männer immer dazu bringt, Frauen sagenhafte Reichtümer zu versprechen. »Was hat dieser hoffnungsvolle Unternehmer denn für einen Beruf, Tullia?«
»Gesagt hat er, er sei Getreidehändler. Aber …«
»Aber was?«
»Auch darüber hat er gelacht.«
»Scheint ja ’n richtiger Komiker zu sein!« Daß der Kapuzentyp sich als Kornhändler ausgab, paßte nicht mehr zu dem Barnabas, den ich im Sinn hatte. Der war der freigelassene Haussklave eines Senators und würde Weizen nicht von Hobelspänen unterscheiden können.
»Du stellst aber ’ne Menge Fragen«, bemerkte Tullia listig. »Was bist du eigentlich von Beruf?« Ich drückte mich mit einem vielsagenden Blick um die Antwort herum. »Aha, Geheimnisse! Möchtest du lieber hinten raus?«
Ich kundschafte immer gern einen Ort aus, an den ich vielleicht zurückkehren möchte, und so huschte ich schon bald über einen Hof hinter der Weinschenke, mit entsprechendem Tempo, da der Hof zu einem Privathaus gehörte. Tullia schien sich hier wie daheim zu fühlen; der glückliche Eigentümer hatte zweifellos Sinn für ihre Talente. Sie ließ mich durch eine unverschlossene Pforte hinaus ins Freie.
»Tullia, falls Barnabas mal wieder auf ein Glas bei euch reinschaut, könntest du ihm ausrichten, daß ich nach ihm suche …« Ihn nervös zu machen konnte nichts schaden. In meinem Job gewinnt man keinen Lorbeerkranz, wenn man Fremden gegenüber schüchtern ist, die einen auf dem Heimweg beschatten. »Und sag ihm, wenn er zu dem Haus auf dem Quirinal kommt – ich glaube, er weiß, welches gemeint ist –, dann hätte ich eine Erbschaft für ihn. Aber er muß sich vor Zeugen ausweisen.«
»Wird er denn wissen, wer du bist?«
»Beschreib ihm einfach meine feingeschnittene, klassische Nase! Und sag ihm, Falco hätte nach ihm gefragt. Willst du das für mich tun?«
»Nur, wenn du mich recht schön drum bittest!«
Dieses Lächeln hatte schon hundert Männern vor mir ihre Gunst verheißen. Hundert und einer von uns müssen entschieden haben, daß wir großzügig über die Konkurrenz hinwegsehen könnten. Ich unterdrückte ein Schuldgefühl wegen einer gewissen Senatorentochter und bat Tullia auf die netteste Art, die mir zu Gebote stand. Es schien zu funktionieren.
»Das machst du nicht zum erstenmal.« Sie kicherte, als ich sie losließ.
»Tja, wer eine klassische Nase hat, riskiert, daß er von schönen Frauen geküßt wird. Und du hast das auch schon vorher getan – wie ist deine Entschuldigung?«
Wirtstöchter brauchen selten eine Entschuldigung. Sie kicherte aufs neue. »Komm bald wieder. Ich warte auf dich, Falco.«
»Ich komme. Verlaß dich drauf, Prinzessin!«
Vermutlich Lügen. Auf beiden Seiten. Aber in der Transtiberina, wo das Leben noch härter ist als auf dem Aventin, müssen sich die Menschen von der Hoffnung nähren.
Die Sonne schien noch, als ich über die Tiber-Insel in die Stadt zurückwanderte. Auf der ersten Brücke, dem Pons Cestius, blieb ich stehen und holte die Ringe des Toten vom Lagerhaus aus meiner Tunikatasche.
Die Smaragd-Kamee fehlte; ich mußte sie unterwegs verloren haben.
Flüchtig kam mir der Gedanke, daß die Wirtstochter sie gestohlen haben könnte, aber dann sagte ich mir, daß sie für so was viel zu hübsch sei.
Kapitel 5
Ich wandte mich nach Norden. Unterwegs kaufte ich einen Pfannkuchen, gefüllt mit warmem Schweinehack, den ich im Gehen aß. Ein Wachhund wedelte mit dem Schwanz, aber ich sagte ihm, er solle sich mit seinen grinsenden Fängen woandershin scheren.
Das Leben ist unfair. Oft genug zu unfair, als daß man ein freundliches Lächeln ignorieren dürfte; ich machte kehrt und teilte meinen Pfannkuchen mit dem Hund.
Ich war auf dem Weg zu einem Haus im Nobelviertel hoch oben auf dem Quirinal. Sein Besitzer war ein junger Senator gewesen, der an derselben Verschwörung beteiligt gewesen war wie der Mann, den Frontinus und ich am Morgen in die Kloake geworfen hatten. Auch der Senator war tot. Man hatte ihn festgenommen, um ihn zu verhören, und dann erdrosselt im Mamertinischen Gefängnis aufgefunden – ermordet von seinen Komplizen, die offenbar sichergehen wollten, daß er nicht den Mund aufmachte.
Jetzt wurde seine Villa geräumt. Haushaltsauflösungen waren das Familiengewerbe der Didius, und so meldete ich mich denn freiwillig, als der Fall im Palast zur Sprache kam. Übrigens war der erlauchte Besitzer einmal mit der mir so teuren Helena Justina verheiratet gewesen, und ich wollte wissen, wie sie gewohnt hatten.
Die Antwort lautete: ausgesprochen luxuriös. Mir das anzusehen war ein großer Fehler gewesen. Melancholisch näherte ich mich jetzt wieder dem Haus.
Die meisten Römer werden von ihren Nachbarn zum Wahnsinn getrieben: durch den Abfall im Treppenhaus und die ungeleerten Toiletteneimer; die ungehobelten Kaufleute mit ihren schlampigen Läden im Parterre und die grölenden Huren im Obergeschoß. Hier war alles anders. Das zweistöckige Herrenhaus erhob sich stolz über den Felsen des Quirinals. Durch eine unauffällige, aber schwer gepanzerte Tür gelangte ich von der Straße in einen ruhigen Vorhof mit zwei Pförtnerhäuschen. Über dem Atrium wölbte sich der Himmel, und der geschmackvolle Kachellambris funkelte im Lichte der schräg einfallenden Sonnenstrahlen. Ein herrlicher Springbrunnen im zweiten Hof sorgte für Kühlung und Frische; melodisches Plätschern über exotischen Palmen in schulterhohen Bronzeurnen. Reichverzierte, marmorverkleidete Korridore zweigten zu beiden Seiten ins Innere des Hauses ab. Für den Fall, daß der Besitzer seiner steifen Empfangsräume überdrüssig wurde, verbargen sich auf einer oberen Etage, hinter schweren Damastvorhängen, kleine Ruheräume.
Ehe ich mit meiner eigentlichen Arbeit im Hause beginnen konnte, mußte ich herausfinden, ob meine Sorge berechtigt war und das Individuum, das mich heute morgen verfolgt hatte, in irgendeiner Verbindung zu dieser vornehmen Villa stand.
Ich ging also zurück zum Pförtner.
»Sag mal – wie hieß gleich der Freigelassene, an dem dein Herr so einen Narren gefressen hatte?«
»Sie meinen Barnabas?«
»Richtig. Und hat dieser Barnabas mal einen scheußlichen grünen Mantel besessen?«
»Ach, der Fetzen!« Pikiert verzog der Pförtner das Gesicht.
Barnabas, der Freigelassene, war von der Bildfläche verschwunden.
Ich hatte es bisher ganz praktisch gefunden, diesen Barnabas zu übersehen. Um seinen Ruf als edelmütiger Herrscher zu fördern (ein Ruf, den er nie besessen hatte, aber gern erwerben wollte), hatte Vespasian beschlossen, die kleinen persönlichen Legate des Toten zu respektieren. Dafür war ich zuständig. Das bescheidene Abschiedsgeschenk des Senators an seinen Lieblingsfreigelassenen belief sich auf die Kleinigkeit von einer halben Million Sesterze. Ich hatte sie sicher in meinem Bankschließfach auf dem Forum verwahrt, wo die Zinsen bereits einen Rosenbusch in einem schwarzen Keramiktopf für meinen Balkon abgeworfen hatten. Bis jetzt war ich der Meinung, wenn Barnabas sein Erbe wollte, dann würde er aus eigenem Antrieb zu mir kommen.
Die Ereignisse des heutigen Tages raubten mir freilich meinen Gleichmut. Um dieses Lagerhaus herumzuschnüffeln zeugte von geradezu krankhaftem Interesse an Vorgängen, von denen jeder vernünftige Freigelassene nichts wissen wollte, und der Angriff auf mich war erst recht eine Eselei gewesen. Da ich spürte, daß ich mich noch nicht auf meine Arbeit würde konzentrieren können, nahm ich mir die Rotzlöffel vor, die wir noch nicht zum Sklavenmarkt geschickt hatten.
»Wer von euch kennt Barnabas?«
»Was ist Ihnen die Auskunft wert?«
»Gebt mir was, worüber ich nachdenken kann, dann vergesse ich vielleicht, euch durchzuprügeln …«
Diesen Tölpeln die Würmer aus der Nase zu ziehen war wirklich Schwerarbeit. Ich gab es schließlich auf und ging zu Chrysosto, einem levantinischen Sekretär, der einen hohen Preis erzielen würde, wenn wir ihn erst mal zur Auktion freigaben. Vorläufig brauchte ich ihn noch für die Inventur.
Chrysosto war ein aufgeblasener Mensch mit fahler Haut und Triefaugen, was daher kam, daß er seine Nase beständig in zugige Ritze steckte, aus denen man eine Nase tunlichst heraushalten sollte. Heute trug er eine weiße Tunika spazieren, die viel zu kurz geraten war, obwohl die Beine, auf die er sich soviel einbildete, bloß die üblichen blassen Gehwerkzeuge waren, die überall in den Büros herumschleichen, inklusive der behaarten Knorpelknie und der abgelatschten Sandalen. Mit seinen Hammerzehen hätte man Zeltpflöcke einschlagen können.
»Hör mal einen Moment auf mit dem Gekritzel. Was war eigentlich so Besonderes an diesem Barnabas?«
»Oh, Seine Gnaden und Barnabas sind auf demselben Gut aufgewachsen.«
Unter meinem stechenden Blick verbarg Chrysosto seine hageren Stelzen hinter dem Tisch. Vermutlich war er ursprünglich mal ganz talentiert gewesen, hatte aber als Schreiber eines Mannes mit trägem Hirn und cholerischem Temperament bald gelernt, seine Initiative zu unterdrücken.
»Wie ist er denn so?«
»Halt ein kalabrischer Mistkerl.«
»Hast du ihn gemocht?«
»Nicht besonders.«
»Meinst du, er wußte über die Pläne deines Herrn Bescheid?«
»Barnabas hat getan, als wüßte er alles.«
Dieser gut informierte Kalabrese war aus der Sklaverei freigelassen worden; wenn er sich absetzen wollte, war das theoretisch seine Sache. Da sein Gönner ein Verräter war, hatte ich ursprünglich durchaus Verständnis dafür, daß er sich aus dem Staub gemacht hatte. Jetzt fragte ich mich allerdings, ob er getürmt war, weil er ein krummes Ding vorhatte.
»Hast du eine Ahnung, warum er fortgelaufen ist, Chrysosto? Ist der Tod deines Herrn ihm sehr nahegegangen?«
»Schon möglich, aber niemand hat ihn seitdem zu Gesicht gekriegt. Er war die ganze Zeit in seinem Zimmer. Das Essen ließ er sich vor die Tür stellen. Von uns konnte keiner besonders gut mit ihm, also hat sich auch niemand weiter um ihn gekümmert. Sogar als er ins Gefängnis ging und den Leichnam abholte, hat hier keiner davon gewußt. Daß er die Beisetzung angeordnet hatte, habe ich erst erfahren, als der Leichenbestatter mit der Rechnung kam.«
»Ist denn niemand zur Einäscherung gegangen?«
»Es wußte ja keiner davon. Aber die Asche ist in der Familiengruft beigesetzt worden. Gestern war ich selber dort, um dem Herrn die letzte Ehre zu erweisen. Da steht eine neue Urne, aus Alabaster…«
Seine Zugehörigkeit zum Hochadel hatte den jungen Senator also davor bewahrt, in einer Kloake zu verschwinden. Nachdem er im Gefängnis den Tod gefunden hatte, war seine Leiche für eine kostspielige Feuerbestattung freigegeben worden, auch wenn die Zeremonie heimlich und nur in Gegenwart seines Freigelassenen stattfand.
»Noch eins, Chrysosto. Als dein Herr Barnabas die Freiheit schenkte, hat er ihm da ein Geschäft eingerichtet – irgendwas mit Getreideimport vielleicht?«
»Nicht daß ich wüßte. Die beiden haben eigentlich immer nur über Pferde geredet.«
Mittlerweile bereitete dieser Barnabas mir beträchtliche Kopfschmerzen. Die Neuigkeit von seiner Erbschaft, die ich ihm durch Tullia hatte übermitteln lassen, mochte ihn aus seinem Versteck locken, vorausgesetzt, er wollte das Geld kassieren. Um ein bißchen nachzuhelfen, schickte ich einen Läufer zum Forum, damit er dort ein Plakat anschlug, das eine bescheidene Belohnung für Auskünfte über Barnabas versprach. Das mochte einen hilfsbereiten Bürger dazu verführen, ihn an die Wache auszuliefern.
»Was soll ich denn als Belohnung einsetzen, Falco?«
»Versuch’s mit drei Sesterzen. Wenn jemand nicht allzu durstig ist, reicht das für den Dämmerschoppen …«
Wobei mir einfiel, daß es Zeit war für meinen.
Kapitel 6
Um mir eine Erfrischung zu genehmigen, brauchte ich das Haus nicht zu verlassen. Der Mann, der hier gewohnt hatte, hieß Gnaeus Atius Pertinax und hatte alles zurückgelassen, was das Leben angenehm macht: Getränke waren reichlich vorhanden, und ich hatte freien Zugang zu seinem Keller.
Da Pertinax ein Verräter war, fiel sein Besitz an den Staat, das heißt, er wurde von unserem jovialen neuen Kaiser kassiert. Ein paar eher kärgliche Bauernhöfe in Kalabrien (darunter auch der, auf dem Barnabas und sein Herr aufgewachsen waren) hatte man bereits eingezogen. Einiges, was von Rechts wegen noch immer seinem alten Vater gehörte, wurde widerwillig zurückgegeben: ein paar lukrative Pachtverträge und zwei stattliche Rennpferde. Dazu kamen noch zwei, drei Schiffe, aber der Kaiser überlegte noch, ob er die nicht doch für seine Flotte konfiszieren sollte. Inzwischen hatten wir diese Villa in Rom beschlagnahmt, vollgestopft mit Kostbarkeiten, die Pertinax zusammengerafft hatte, wie Playboys das so zu tun pflegen: durch Erbschaften, raffinierte Geschäfte, Geschenke von Freunden, Bestechungspräsente von Handelspartnern und Erfolge auf der Rennbahn, wo er einen unnachahmlichen Riecher hatte. Die Villa auf dem Quirinal wurde von drei kaiserlichen Agenten aufgelöst: Momus, Anacrites und meine Wenigkeit.
Wir hatten fast vierzehn Tage dazu gebraucht. Und wir taten unser Bestes, um diese Plackerei gebührend zu genießen. Allabendlich erholten wir uns in einem Bankettsaal, der noch immer schwach nach Sandelholz duftete; hier lagen wir ausgestreckt auf geschnitzten Elfenbeinbänken mit Matratzen aus feingekämmter Wolle und arbeiteten uns durch die Restbestände des fünfzehn Jahre alten Albaner Weißweins, die der verblichene Hausherr übriggelassen hatte. Auf einem der Dreifußtische stand der silberne Weinwärmer mit einer Kammer für die glimmende Holzkohle, einem Aschenbehälter und einem zierlichen Spund zum Ausgießen des Nektars, sobald die richtige Temperatur erreicht war. In schlanken Lampenständern mit drei Klauenfüßen brannte köstliches Duftöl, während wir einander davon zu überzeugen suchten, daß uns ein Leben in solchem Luxus zuwider wäre.
Den Sommerspeisesaal der Villa hatte ein begabter Freskenmaler ausgestattet; jenseits eines Gartens erblickte man phantastische Szenen vom Falle Trojas, aber selbst der Garten erwies sich bei näherem Hinsehen als minutiöses Gemälde auf der Innenwand, ein vollkommenes Trompel’oeil, bis hin zu den Pfauen, die von einer getigerten Katze gejagt wurden.
»Die Weine unseres verstorbenen Gastgebers«, erklärte Anacrites, der sich gern als Connaisseur aufspielte (von der Sorte, die viel Wind macht, aber keine Ahnung hat), »sind beinahe so geschmackvoll wie die Ausstattung seines Hauses!«
Anacrites bezeichnete sich selbst als Sekretär und war ein Spion, ein angespannter Typ von kräftiger Statur mit leerem Gesicht, ungewöhnlich grauen Augen und so dünnen Brauen, daß sie fast unsichtbar waren.
»Na, dann trink aus!« kommandierte Momus grob.
Momus war der typische Sklavenaufseher: kurzgeschorener Schädel, damit sich keine Läuse einnisten konnten, Weinbauch, ölige Visage, Stoppelkinn, krächzende Stimme als Berufskrankheit und zäh wie ein rostiger Nagel in einem Holzbrett. Er war zuständig für die Personalabwicklung. Die Freigelassenen hatte er, um sich ihrer Dankbarkeit zu versichern, mit kleinen Geldgeschenken abgespeist, und nun verfrachtete er schubweise die Sklaven, die wir in Hütten zusammengepfercht am Ende des weitläufigen Villengrundes gefunden hatten. Der Senator hatte sich seine eigenen Nagelpfleger und Haarkräusler gehalten, dazu Pastetenbäcker und Soßenköche, Bade- und Schlafzimmersklaven, Hundebetreuer und Vogelzähmer, ferner einen Bibliothekar, drei Buchhalter, Harfenisten und Sänger, ja sogar eine ganze Staffel fixer junger Burschen, die nichts weiter zu tun hatten, als zwischen den Buchmachern hin und her zu laufen, um seine diversen Wetten zu plazieren. Für einen noch jungen Mann ohne familiäre Verpflichtungen hatte er sich hervorragend eingerichtet.
»Na, kommst du voran, Falco?« fragte Momus, der gerade eine vergoldete Parfumschale als Spucknapf mißbraucht hatte. Ich kam gut aus mit Momus; er war ein Gauner, ein Saukerl, schlampig und verschlagen – ein erfreulich eindeutiger Typ.
»Beim Katalogisieren der bescheidenen Habe eines Senators kann ein schlichter Junge vom Aventin noch allerhand lernen!« Ich sah, wie Anacrites lächelte. Freunde hatten mir gesteckt, daß er in meiner Vergangenheit rumgeschnüffelt hätte, und zwar so gründlich, daß er inzwischen vermutlich wußte, in welchem Stock welches baufälligen Mietshauses ich wohnte und ob das Zimmer, in dem ich vor dreißig Jahren zur Welt gekommen war, zum Hof oder zur Straße hin lag. Bestimmt wußte er inzwischen, ob ich so einfältig war, wie ich aussah.
»Ich frage mich«, grunzte Momus, »warum ein Kerl mit soviel Zaster das alles aufs Spiel gesetzt und sich gegen den Kaiser versündigt hat?«
»Das hat er also getan?« fragte ich naiv. Wir drei verbrachten mehr Zeit damit, uns gegenseitig zu belauern, als nach Verschwörern zu fahnden. Momus, der eifrige Lauscher an der Wand, tat bald so, als wäre er eingeschlafen. Damit konnte er mich freilich nicht täuschen. Seine Plattfüße in den schwarzen beschlagenen Stiefeln, mit denen sich so gut nach Sklaven treten ließ, bildeten einen präzisen rechten Winkel.
Ich spürte, wie Anacrites mich beobachtete, ließ ihn aber ruhig gewähren. »Na, hast du ’n erfolgreichen Tag gehabt, Falco?«
»Tote Kerls und scharfe Weiber von morgens bis abends!«
»Die Sekretäre im Palast lassen dich wohl ganz schön im dunkeln tappen, wie?«
»Scheint so die allgemeine Strategie zu sein.«
Anacrites half mir, den Frust über die verlorene Zeit mit Albaner runterzuspülen. »Ich versuche mir ein Bild von dir zu machen, Falco. Was bist du für ein Mensch?«
»Oh, ich bin der Sohn eines Auktionators, bis mein leichtsinniger Vater die Familie hat sitzenlassen. Na, und jetzt verschachere ich die Antiquitäten dieses Playboys an die Nippesverkäufer auf der Saepta Julia …« Er machte immer noch ein neugieriges Gesicht, deshalb fuhr ich fort: »Mit meinem Job ist es so, als ob man eine Frau küßt – wenn ich nicht höllisch aufpasse, könnte was Ernstes daraus werden!«
Anacrites durchforstete die Privatpapiere des Toten; soviel wußte ich. (Ein Auftrag, den ich selber gern übernommen hätte.) Anacrites war schmallippig, verschlossen, ein unsicherer Kandidat. Im Gegensatz zu Momus, der ohne mit der Wimper zu zucken vier numidische Sänftenträger als zwei Geflügeltranchierer, einen Wagenlenker und einen Fächertänzer aus Xanthus hätte verkaufen können, prüfte Anacrites seine Dokumente mit der Gewissenhaftigkeit eines Revisors, der damit rechnet, daß ein anderer Revisor seine Arbeit nachkontrolliert.
»Falco, ich finde, Momus wundert sich mit Recht«, bohrte Anacrites weiter. »Wozu das Risiko?«
»Nervenkitzel? Nach Neros Tod war das Intrigenspiel darum, wer der neue Caesar werden würde, aufregender als alles andere. Und unser Mann war der geborene Spieler. Er würde zwar ein großes Vermögen erben, aber bis dahin war ein einziges Haus auf dem Quirinal für einen Emporkömmling, der in Rom Beachtung finden wollte, vielleicht nichts Besonderes.«
Anacrites schürzte die Lippen. Ich tat es ihm nach. Wir blickten uns um. Für uns war die kostspielige Pertinax-Villa etwas ganz Besonderes.
»Und was hast du in den Papyrusrollen Seiner Gnaden entdeckt?« fragte ich beiläufig.
»Ach, eine ziemlich fade Korrespondenz!« klagte Anacrites. »Seine Freunde waren lauter Großmäuler von der Rennbahn, ohne jede literarische Ader. Aber seine Bücher sind tadellos geführt und auf dem neuesten Stand. Der Mann hat für sein Geld gelebt.«
»Hast du Namen gefunden? Einzelheiten der Verschwörung? Beweise?«
»Nur Biographisches. Und das meiste davon hätte auch ein halber Tag im Büro des Censors ans Licht gebracht. Atius Pertinax stammte aus Tarentum; sein leiblicher Vater war ein Mann von Stand und hatte viele Freunde im Süden, aber weder Geld noch Einfluß. Mit siebzehn machte Pertinax dieses Manko wett: Er nahm einen greisen Ex-Konsul namens Caprenius Marcellus für sich ein, der enormes Prestige und Geld wie Heu hatte, aber keinen Erben …«
»Und dann«, mutmaßte ich, »hat dieser reiche Knopf den eben erblühten jungen Gnaeus vom Stiefelabsatz Italiens gepflückt und ihn adoptiert?«
»Nach bester Tradition. Und damit hatte der frischgebackene Pertinax Caprenius Marcellus plötzlich nicht nur große Rosinen im Kopf, sondern auch einen Monatswechsel, um sie zu finanzieren. Sein neuer Vater vergötterte ihn. Er tat Dienst als Tribun in Makedonien …«
»Eine gemütliche warme Provinz!« unterbrach ich wieder, diesmal in gereiztem Ton. Ich hatte meinen Militärdienst in Britannien absolviert: kalt, feucht, windig – und zur damaligen Zeit (während der großen Rebellion) furchtbar gefährlich.
»Versteht sich! Ein junger Mann mit großer Zukunft muß Vorsicht walten lassen! Zurück in Rom, heiratet er die Tochter eines eher begriffsstutzigen Senators und wird nach diesem ersten Schritt in die große Gesellschaft prompt selbst in den Senat gewählt – im ersten Anlauf, tja, die Kinder der Reichen haben eben überall Vortritt.«
Ich stand auf und schenkte mir nach. Anacrites schwieg und nippte an seinem Becher. Also steuerte ich ein bißchen Kolorit bei, das ihm vielleicht noch unbekannt war: »Mit der Tochter des Senators, dieser vermeintlich so fabelhaften Partie, hat er sich aber überschätzt. Nach vier Jahren Ehe reichte sie die Scheidung ein, ein schwerer Schlag für Pertinax.«
»Tatsächlich!« Anacrites lächelte ölig. Es gehörte zu seinem Nimbus als Spion, mehr über andere Leute zu erfahren, als die von sich selber wußten. Und trotzdem war ich besser über die Ex-Frau von Atius Pertinax unterrichtet als er.