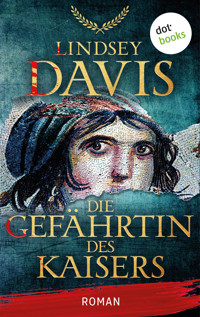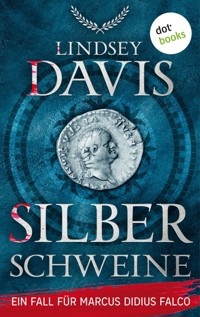
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Wenn sich die Nacht über das Forum Romanum legt: Der fesselnde historische Kriminalroman »Silberschweine« von Lindsey Davis als eBook bei dotbooks. Rom, 71 nach Christus: Niemand kennt die Gassen der Stadt am Tiber so gut wie Marcus Didius Falco. Der Ex-Legionär gilt als bester Ermittler der Metropole – und ist dennoch ständig knapp bei Kasse. Aber eines Tages verschafft die Schicksalsgöttin Fortuna ihm einen Auftrag, der sein ganzes Leben verändern wird: Als Falco Zeuge einer Entführung wird, hilft er der Tochter eines Senators, ihren Häschern zu entkommen – doch kurze Zeit später wird sie heimtückisch ermordet. Von der Familie der Toten beauftragt, beginnt Falco zu ermitteln und folgt einer Spur bis in die britannische Provinz. Dort, am Rande des Imperiums, stößt er auf eine Verschwörung, deren Netz sich bis zurück ins Zentrum der Macht erstreckt – und das Kaiserreich in den Abgrund stürzen könnte … »Ein fantastisches Buch!« Bestsellerautorin Ellis Peters Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Kriminalroman »Silberschweine« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der Auftakt zu ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 71 nach Christus: Niemand kennt die Gassen der Stadt am Tiber so gut wie Marcus Didius Falco. Der Ex-Legionär gilt als bester Ermittler der Metropole – und ist dennoch ständig knapp bei Kasse. Aber eines Tages verschafft die Schicksalsgöttin Fortuna ihm einen Auftrag, der sein ganzes Leben verändern wird: Als Falco Zeuge einer Entführung wird, hilft er der Tochter eines Senators, ihren Häschern zu entkommen – doch kurze Zeit später wird sie heimtückisch ermordet. Von der Familie der Toten beauftragt, beginnt Falco zu ermitteln und folgt einer Spur bis in die britannische Provinz. Dort, am Rande des Imperiums, stößt er auf eine Verschwörung, deren Netz sich bis zurück ins Zentrum der Macht erstreckt – und das Kaiserreich in den Abgrund stürzen könnte …
»Ein fantastisches Buch!« Bestsellerautorin Ellis Peters
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittler Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1989 unter dem Originaltitel »The Silver Pigs« bei Sidgwick & Jackson, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1989 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1991 Vito von Eichborn GmbH & Co. Verlag KG, Frankfurt/Main
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/RInArte, Olena Kurashova, Kolonko, nevio
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-732-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Silberschweine« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Silberschweine
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Reinhard Kaiser
dotbooks.
Dramatis Personae
Im Kaiserlichen Palast
Vespasian Augustus: Ein gutmütiger alter Knabe, tauchte aus dem Nichts auf und machte sich zum Kaiser von Rom.
Titus Cäsar: Dreißig, Vespasians älterer Sohn; beliebt und brillant.
Domitian Cäsar: Zwanzig, Vespasians jüngerer Sohn; weniger beliebt und weniger brillant.
In der Regio I (Bezirk Porta Capena)
Decimus Camillus Verus: Ein Senator (Millionär).
Julia Justa: Die ehrwürdige Frau des Senators.
Helena Justina: Die Tochter des Senators, dreiundzwanzig, seit kurzem geschieden: eine vernünftige junge Frau.
Publius Camillus Meto: Der jüngere Bruder des Senators; tätig im Import/Export-Handel.
Sosia Camillina: Metos Tochter, sechzehn. Blond, schön und deshalb nicht verpflichtet, vernünftig zu sein.
Naïssa: Helena Justinas Magd mit den großen Augen …
Gnäus Atius Pertinax: Ein junger Beamter im Rang eines Ädilen (Spezialgebiet: Disziplin).
In der Regio XIII (Aventinischer Bezirk)
Marcus Didius Falco: Privatermittler mit republikanischen Ansichten.
Falcos Mutter: Eine Mutter mit Ansichten über alles und jedes.
Didius Festus: Falcos Bruder. Nationalheld (verstorben).
Marcia: Drei, die Tochter von Falcos Bruder.
Petronius Longus: Hauptmann der Aventinischen Wache.
Lenia: Eine Wäscherin.
Smaractus: Ein Immobilienspekulant; außerdem Besitzer einer Gladiatorenschule.
In anderen Teilen Roms
Astia: Ein Kutscherliebchen.
Julius Frontinus: Ein Hauptmann der Prätorianergarde.
Glaucus: Ein Mann aus Kilikien. Besitzer eines ehrbaren Sportzentrums. Ein ungewöhnlicher Charakter.
Ein Glühweinkellner: (Anrüchig).
Ein Wachmann: (Betrunken).
Das Pferd eines Gärtners: (Befinden unbekannt).
In Britannien
Gaius Flavius Hilaris: Kaiserlicher Prokurator der Finanzverwaltung, in dessen Verantwortungsbereich auch die Silbergruben fallen.
Älia Camilla: Die Frau des Prokurators, die jüngste Schwester des Senators Camillus Verus und seines Bruders Publius.
Rufrius Vitalis: Zenturio a.D. der Zweiten Augusteischen Legion, lebt im Ruhestand in Isca Dumnoniorum.
T. Claudius Triferus: (Ein Brite). Verwalter der Kaiserlichen Silbermine von Vebiodunum in den Mendip-Bergen.
Cornix: Ein Sadist. Sklavenaufseher in der Kaiserlichen Silbermine.
Simplex: Sanitätsoffizier der Zweiten Augusteischen Legion in Glevum (Spezialgebiet: Chirurgie).
Einleitung
Rom: 70 n. Chr.
Eine Stadt im Aufruhr, denn mit dem Tod Neros war die von Augustus Cäsar begründete Dynastie erloschen.
Eine Stadt, die über ein gewaltiges Imperium herrschte: den größten Teil Europas, Nordafrika und Teile des Nahen Ostens. Kaiser Claudius (unterstützt von einem unbekannten jungen General namens Vespasian) hatte einige Zeit zuvor sogar schon den Fuß in eine wüste Gegend gesetzt, die den Römern immer aufs neue namenlosen Schrecken einflößte: Britannien! Dreißig Jahre später ging jener Vespasian siegreich aus dem Machtkampf um die Nachfolge Neros hervor.
Rom hatte einen erbitterten Bürgerkrieg hinter sich. Das Reich drohte aus den Fugen zu geraten. Die Staatskasse war bankrott. Vespasian mußte seine Kritiker in dieser Situation davon überzeugen, daß er und seine beiden Söhne, Titus und Domitian, die besten Hoffnungen auf Frieden und eine gute Regierung verkörperten.
Auch in Britannien, das sich langsam vom Aufstand der Königin Boudicca erholte, zeigten sich die üblen Folgen von Neros nachlässiger Verwaltung. Wichtige Schürfrechte, darunter auch die in der bedeutendsten kaiserlichen Silbermine in den Mendip-Bergen, wurden an einheimische Unternehmer verpachtet. Die Gruben wurden schlecht geführt: Vor einigen Jahren fand man vier gestohlene Barren, im 1. Jahrhundert n. Chr. in Charterhouse mit einem amtlichen Stempel versehen und nachher unter einem Steinhaufen versteckt. Wer hatte sie gestohlen und so sorgfältig versteckt, um dann nie wieder zurückzukehren? Und welche Folgen hatte dieser Diebstahl im fernen Britannien für den neuen Kaiser Vespasian, der in Rom um die Festigung seiner Position kämpfte?
Marcus Didius Falco – der das Kaisertum mißbilligte und dennoch auf seine Weise dem Staat diente – kannte die Wahrheit …
Teil I
Rom: Sommer – Herbst, 70 n. Chr.
Kapitel 1
Das Mädchen, das da die Treppe heraufgestürmt kam, hatte für mein Gefühl viel zuviel an.
Es war Spätsommer. Rom brutzelte wie ein Pfannkuchen auf dem Backblech. Die Leute schnürten sich die Schuhe auf, mußten sie aber anbehalten. Selbst ein Elefant hätte diese Straßen nicht ohne Schuhe überqueren können. Die Menschen fläzten sich auf Schemeln in schattigen Hauseingängen, die Knie gespreizt und nackt bis zur Taille – und in den Seitenstraßen des Aventinischen Bezirks, wo ich wohnte, waren das vor allem die Frauen.
Ich stand auf dem Forum. Sie rannte. Sie sah zu schick aus, und die Hitze bekam ihr ganz und gar nicht. Aber bis jetzt war ihr die Puste nicht ausgegangen. Sie glänzte wie ein glasierter Hefezopf, und als sie die Stufen des Saturntempels heraufgestürmt kam, direkt auf mich zu, machte ich keinen Versuch, ihr aus dem Weg zu gehen. Trotzdem verfehlte sie mich – knapp. Manche kommen als Glückspilze auf die Welt, andere heißen Didius Falco.
Aus der Nähe fand ich erst recht, daß ihr weniger Tunika besser gestanden hätte. Aber verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich mag es, wenn Frauen ein paar Fetzen am Leib haben: immerhin kann ich dann hoffen, sie ihnen abzustreifen. Wenn sie hingegen von vornherein ohne alles kommen, wirkt das auf mich in aller Regel eher deprimierend, denn entweder sie haben sich kurz vorher für einen anderen ausgezogen, oder, und in meinem Beruf ist das der häufigere Fall, sie sind tot. Diese hier war quicklebendig.
In einem hübschen Landhaus mit Marmortäfelung und dem einen oder anderen Springbrunnen inmitten von tiefen, schattigen Gärten hätte eine müßige junge Dame vielleicht etwas Kühle finden können, selbst wenn sie sich in allerlei bestickten Putz hüllte und ihr die Gagat- und Bernsteinarmreifen vom Ellbogen bis zum Handgelenk reichten. Aber sobald sie nach draußen ging und obendrein auch noch rannte, war es damit vorbei. Unter der Hitze mußte sie zerfließen. Die leichten Gewänder klebten an sämtlichen Linien ihrer schlanken Figur. Das helle Haar pappte in peinigenden Strähnen an ihrem Hals. Die Füße gerieten auf den nassen Sohlen ihrer Sandalen ins Rutschen, und ganze Rinnsale von Schweiß ergossen sich an ihrem heißen Hals hinab in die interessanten Gefilde unter all diesen Textilien …
»Entschuldigung«, keuchte sie.
»Ich bitte um Entschuldigung!«
Sie wollte einen Bogen um mich machen; ich trat höflich zur Seite. Sie wich aus; ich wich aus. Ich war auf das Forum gekommen, um meinem Bankier einen Besuch abzustatten, jedesmal ein bedrückendes Erlebnis. Ich begrüßte diese glühende Erscheinung mit dem Eifer eines Mannes, dem jeder Ärger recht ist, wenn er dadurch nur auf andere Gedanken kommt.
Sie war ein schmales Püppchen. Mir waren große Frauen am liebsten, aber ich machte kein Dogma draus. Sie war wahnsinnig jung. Ich hatte es damals eher mit den älteren – aber auch sie würde heranwachsen, und warten hatte ich gelernt. Während wir so auf den Stufen herumtänzelten, warf sie einen Blick über die Schulter zurück – in Panik. Zuerst bestaunte ich noch diese wohlgeformte Schulter, dann sah ich ebenfalls über sie hinweg und war wie vom Schlag gerührt.
Sie kamen zu zweit. Zwei widerliche Fettwänste, die aussahen wie Knastbrüder, beide so breit, wie sie hoch waren, schoben sich durch das Menschengewühl auf sie zu. Sie waren kaum zehn Schritte entfernt. Die Kleine bekam es offensichtlich mit der Angst.
»Lassen Sie mich vorbei!« flehte sie.
Ich überlegte, was ich tun sollte. »Manieren heutzutage!« sagte ich in tadelndem Ton, als die beiden klobigen Finsterlinge nur noch fünf Schritte entfernt waren.
»Lassen Sie mich vorbei!« schrie sie. Sie war einfach hinreißend. Das Forum bot den üblichen Anblick. Gleich links von uns das Staatsarchiv und der Kapitolshügel; rechts das Gericht und weiter unten an der Via Sacra der Kastor-Tempel. Gegenüber, auf der anderen Seite der Rednertribüne aus weißem Marmor, das Senatsgebäude. Alle Säulenhallen waren überfüllt von Schlachtern und Bankiers, überall drängten schwitzende Menschenmassen, hauptsächlich Männer. Über den Platz dröhnten die Flüche der ihren Herren vorausmarschierenden Sklavenriegen, die einander fortwährend ins Gehege kamen, wie bei einer schlecht organisierten Militärparade. In der siedenden Luft hing der Geruch von Knoblauch und Pomade.
Das Mädchen sprang zur Seite; ich glitt in die gleiche Richtung. »Soll ich Ihnen den Weg erklären, mein Fräulein?« fragte ich hilfsbereit.
Sie war zu verzweifelt, um sich noch zu verstellen. »Ich brauche Polizeischutz.« Noch drei Schritte: unsere Möglichkeiten wurden jetzt schnell knapper … Ihre Miene veränderte sich.
»Nein, helfen Sie mir!«
»Mit Vergnügen!«
Ich nahm die Sache in die Hand. Ich hakte sie unter und riß sie zur Seite, als der erste Fettwanst gerade zum Sprung ansetzte. Aus der Nähe sahen sie noch klobiger aus, und das Forum gehörte nicht zu den Gegenden, wo ich irgendwelche Hilfstruppen mobilisieren konnte. Dem ersten Schläger pflanzte ich die Sohle meines Schuhs vor die Brust und streckte dann mit aller Kraft das Bein durch. Ich spürte, wie es im Knie knirschte, aber der Halunke taumelte rückwärts, rempelte in seinen Kollegen hinein, und nun schwankten sie beide wie zwei untalentierte Akrobaten. Ich überlegte, wie ich ihnen ein bißchen Ablenkung verschaffen konnte.
Die Treppen waren wie immer bevölkert von illegalen Wettbrüdern, und auf den Absätzen hatten sich Marktstände breitgemacht, die allerlei überteuerte Waren feilboten. Ich überlegte, ob ich mir ein paar Melonen schnappen sollte. Aber aufgeplatzte Früchte machen dem Händler ein Loch in die Kasse. Ich hatte selbst ein Loch in der Kasse und entschied mich deshalb für das geschmackvolle Kupfergeschirr. Ein leichter Stoß mit der Schulter – und der komplette Stand kippte. Das Gekrächz des Verkäufers ging unter im Geschepper der Kannen, Krüge und Vasen, die mit einem Beulen-Tempo die Tempelstufen herunterpolterten, gefolgt von ihrem verzweifelten Besitzer und einer Anzahl rechtschaffener Passanten, die hofften, an diesem Abend mit einer neuen, hübsch kannelierten Obstschale unter dem Arm nach Hause zu kommen.
Ich packte das Mädchen und riß sie die restlichen Tempelstufen hoch. Es blieb uns wenig Zeit, die ehrwürdige Schönheit des ionischen Portikus zu bewundern. Ich zerrte sie zwischen den Säulen hindurch ins Innere des Heiligtums. Sie zeterte; aber ich ließ nicht los und stürmte mit großen Schritten weiter. Es war so kühl, daß wir zu frösteln begannen, und so dunkel, daß ich ins Schwitzen geriet. Der Raum war von einem alten, genauer gesagt: uralten Geruch erfüllt. Unsere Schritte hallten über den alten Steinfußboden.
»Darf ich überhaupt hier rein?« zischte sie.
»Mach ein frommes Gesicht – wir sind richtig!«
»Aber raus kommen wir hier nicht mehr!«
Wenn Sie sich mit Tempeln auskennen, wissen Sie, daß die nur einen einzigen prächtigen Eingang haben, und zwar vorne. Wenn Sie sich mit Priestern auskennen, wird Ihnen aufgefallen sein, daß sich diese Leute meistens ein diskretes Türchen offenhalten, und zwar hinten. Die Priester des Saturn enttäuschten uns nicht.
Ich brachte sie auf der Seite der Rennbahn nach draußen und schlug den Weg nach Süden ein. Aus dem Regen war das arme Mädchen direkt in die Traufe geraten, oder vielmehr aus der Arena in die Löwengrube. Ich galoppierte mit ihr durch dunkle Gassen und um stinkende Ecken, vertrauteren Gefilden entgegen.
»Wo sind wir hier?«
»Im Dreizehnten Bezirk, dem Aventinischen. Südlich vom Circus Maximus, vor uns liegt die Via Ostiensis.« Das war ungefähr so beruhigend, wie wenn der Hai die Flunder angrinst. Vor Gegenden wie dieser hatte man sie bestimmt oft genug gewarnt. Und wenn ihre liebevollen alten Kindermädchen etwas von ihrem Job verstanden, dann hatten sie sie bestimmt auch vor Kerlen wie mir gewarnt.
Nachdem wir die Via Aurelia überquert hatten, ging ich langsamer, zum einen weil ich mich nun auf dem sicheren Boden meines eigenen Viertels befand, aber auch weil sie nicht mehr konnte.
»Wohin?«
»In mein Büro.«
Sie wirkte erleichtert. Aber nicht lange: mein Büro bestand nämlich aus zwei Zimmern im sechsten Stock einer dumpfen Mietskaserne, deren Wände im wesentlichen durch Dreck und tote Bettwanzen zusammengehalten wurden. Bevor meine Nachbarn anfingen, sich Gedanken über den Preis ihrer Kleider zu machen, schob ich sie von dem Schlammpfad herunter, der angeblich unsere Hauptstraße war, und bugsierte sie in Lenias Wäscherei. Daß hier nur kleine Leute verkehrten, sah man auf den ersten Blick.
Da vernahm ich die Stimme von Smaractus, meinem Vermieter, also machten wir gleich wieder kehrt.
Kapitel 2
Zum Glück wollte er gerade gehen. Ich zog das Mädchen in die Arkade eines Korbflechters, duckte mich hinter sie und machte mir an den Riemen meines linken Schuhs zu schaffen.
»Wer ist das?« flüsterte sie.
»Ein Kotzbrocken hier aus der Gegend«, erläuterte ich und ersparte ihr meinen Vortrag über den Immobilienmagnaten als Schmarotzer. Aber sie kapierte sofort.
»Dein Hausherr!« Schlaues Kind!
»Ist er weg?«
Sie nickte. Ich wollte kein Risiko eingehen und fragte noch: »Hatte er fünf oder sechs dürre Gladiatoren im Schlepptau?«
»Alle mit einem blauen Auge und schmutzigen Verbänden.«
»Gut, dann komm!« Wir tasteten uns durch die nassen Kleidungsstücke, die Lenia zum Trocknen auf die Straße gehängt hatte, und mußten jedesmal das Gesicht abwenden, wenn sie zurückschwappten. Endlich waren wir drinnen.
Lenias Wäscherei. Dampfschwaden wälzten sich uns entgegen. Wäscherjungen stampften die Kleider. Bis an die aufgesprungenen Knie im heißen Wasser stehend, platschten sie in den Bottichen herum. Ein ziemlicher Lärm erfüllte die stickige Enge – die Wäsche wurde gewalkt und geschlagen und ausgewrungen, dazwischen das Geschepper irgendwelcher Kessel. Die Wäscherei nahm das ganze Erdgeschoß ein und hatte sich bis in den Hinterhof ausgedehnt.
Die Besitzerin kam auf uns zu und begrüßte uns mit spöttischer Miene. Lenia war vermutlich sogar jünger als ich, aber mit ihrem ausgemergelten Gesicht sah sie aus wie vierzig. Ihr schlaffer Bauch schwappte über den Rand des Korbes, den sie vor sich her trug. Ein paar Haarsträhnen kräuselten sich unter einem farblosen Band hervor, das sie um den Kopf geschlungen hatte. Als sie meine Biene sah, stieß sie ein gackerndes Lachen aus. »Falco! Erlaubt dir das deine Mutter, mit kleinen Mädchen zu spielen?«
»Dekorativ, wie?« Es sollte verbindlich klingen. »Ein Schnäppchen, das ich auf dem Forum gemacht habe.«
»Daß mir der Lack ja keine Kratzer bekommt!« spottete Lenia. »Smaractus hat dir einen Tip hinterlassen: Du sollst bezahlen, sonst pieksen dir seine Fischerjungen mit dem Dreizack in den Allerwertesten.«
»Wenn er was von mir will, soll er’s schriftlich einreichen. Sag ihm –«
»Sag’s ihm selber!«
Eigentlich stand Lenia auf meiner Seite, aber aus dem ewigen Hickhack zwischen mir und dem Hausherrn hielt sie sich heraus. Smaractus machte ihr gewisse Avancen, denen sie momentan zwar nicht nachgab, weil sie ihre Unabhängigkeit schätzte, aber als gute Geschäftsfrau hielt sie sich alle Möglichkeiten offen. Er war ein abscheulicher Kerl. In dieser Beziehung hielt ich Lenia für verrückt und hatte ihr das auch deutlich gesagt, worauf sie mir ebenso deutlich gesagt hatte, daß mich das einen feuchten Kehricht anginge.
Ihr unruhiger Blick huschte wieder zu meiner Begleiterin hinüber.
»Eine neue Klientin«, prahlte ich.
»Ach nee! Bezahlt sie dich für deine Erfahrung oder bezahlst du sie für den Spaß?«
Gemeinsam nahmen wir mein junges Fräulein in Augenschein. Sie trug eine weiße Untertunika aus feinem Stoff, die an den Achseln von blauen Emailspangen zusammengehalten wurde, und darüber ein ärmelloses Gewand. Es war so reichlich bemessen, daß es sich über ihrem aus Goldfäden gewirkten Gürtel bauschte. Nicht nur an den breiten Stickereien um ihren Hals, am Saum und vorne auf ihrem Gewand, sondern auch daran, wie Lenia ihre wäßrigen Augen zusammenkniff, konnte ich erkennen, daß wir hier erstklassiges Tuch bewunderten. In jedem ihrer hübschen kleinen Ohren trug meine Göttin einen Drahtreifen, auf den winzige Glasperlen gefädelt waren, außerdem ein paar Halsketten, drei Armreifen am linken und vier am rechten Arm, dazu noch die verschiedensten Fingerringe in Gestalt von Schlingen, Schlangen oder Vögeln mit langen gekreuzten Schnäbeln. Wenn wir die ganze Pracht verkauft hätten, wäre mehr dabei herausgesprungen, als ich im letzten Jahr verdient hatte. Und was uns ein Bordellbesitzer für das hübsche Luder selbst gegeben hätte, daran mochte ich gar nicht denken.
Sie war blond. Jedenfalls in diesem Monat, und da sie höchstwahrscheinlich weder aus Mazedonien noch aus Germanien stammte, mußte wohl Farbstoff im Spiel sein. Es war geschickt gemacht. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber Lenia hat es mir später erklärt.
Ihr Haar war in drei breite, weiche Ringellocken gelegt, die im Nacken von einem Band zusammengehalten wurden. Es zwackte mich wie Hornissenstiche, dieses Band zu lösen. Natürlich malte sie sich das Gesicht an. Meine Schwestern taten es auch. Wenn sie sich zurechtgemacht hatten, sahen sie immer aus wie frisch vergoldete Statuen. Meine Schwestern sind hinreißend, wenn sie sich angepinselt haben, aber ein bißchen aufdringlich wirkt es schon. Bei der hier war es subtiler und viel wirkungsvoller, bloß daß ihr bei dem Herumrennen in der Hitze das eine Auge ein bißchen verschmiert war. Sie hatte übrigens braune, weit auseinanderliegende Augen, wunderbar arglose Augen.
Lenia hatte lange vor mir genug vom Hinsehen.
»Kinderschänder!« sagte sie. »Los, pinkel in den Eimer, bevor du sie mit nach oben nimmst!«
Nicht daß mich Lenia für krankhaft veranlagt hielt und deshalb eine Urinprobe von mir wollte; es war vielmehr ein ganz und gar freundlich gemeintes Angebot mit geschäftlichem Hintergrund.
Die Sache mit dem Eimer und dem Bleichbottich muß ich wohl erklären.
Viel später erzählte ich diese ganze Geschichte mal einer Bekannten, und wir unterhielten uns darüber, mit welchen Mitteln die Wäschereien Kleider bleichen.
»Ausgelaugte Holzasche?« schlug meine Bekannte zögernd vor. Sie benutzen tatsächlich Asche, Pottasche. Sie benutzen auch Soda und Bleicherde, und für die prachtvollen Gewänder der Wahlkandidaten verwenden sie Pfeifenton. Aber die echten alten Togen unseres großartigen Imperiums werden wirklich und wahrhaftig mit dem Urin aus den öffentlichen Latrinen gebleicht. Kaiser Vespasian, der immer originelle Einfälle hatte, wenn es darum ging, bei den Leuten Geld lockerzumachen, hatte diesen altehrwürdigen Handel mit menschlichem Unrat eines Tages mit einer Steuer belegt, und Lenia bezahlte die Steuer auch, aber sie ergänzte ihre Vorräte kostenlos, wo immer es ging oder vielmehr lief.
Die Frau, der ich diese Geschichte erzählte, bemerkte dazu nur ganz trocken: »In der Salatzeit, wenn alle Leute Rote Bete essen, ist die Hälfte der Togen auf dem Forum wohl in einem dezenten Rosa gefärbt. Oder werden sie ausgespült?«
Damals zuckte ich die Achseln und ließ die Sache auf sich beruhen. Auch an dieser Stelle hätte ich derart unappetitliche Einzelheiten nicht zur Sprache gebracht, wenn Lenias Bleichbottich nicht eine entscheidende Rolle in dieser Geschichte gespielt hätte.
Da ich im sechsten Stock eines Blocks wohnte, der nicht besser ausgestattet war als andere Mietskasernen in Rom auch, betrachtete ich Lenias Eimer seit langem als einen lieben Freund. Lenia klang nicht unfreundlich, als sie meiner Besucherin anbot: »Kleine Mädchen gehen hinter die Krempelgestelle.«
»Lenia, bring meine reizende Klientin nicht in Verlegenheit!« Ich errötete für sie.
»Ach, ich bin tatsächlich ziemlich überstürzt von zu Hause weg –«
Hübsch und hastig huschte meine Klientin hinter die Recks, auf denen die Kleider, nachdem sie getrocknet waren, mit Karden gekratzt wurden, um den Flor wieder aufzurichten. Während ich auf sie wartete, füllte ich meinen Eimer und unterhielt mich mit Lenia über das Wetter. Wie man das so tut.
Nach fünf Minuten ging mir das Wetter aus.
»Verschwinde, Falco!« begrüßte mich eine Wollkämmerin, als ich hinter die Gestelle spähte. Von meiner Klientin keine Spur. Wäre sie weniger attraktiv gewesen, hätte ich sie vielleicht laufen lassen. Aber sie war nun mal außerordentlich attraktiv – und ich sah überhaupt keinen Grund, diese Unschuld irgendeinem anderen zu überlassen. Fluchend zwängte ich mich an den riesigen Kleiderpressen vorbei und in den Hof der Wäscherei hinaus.
Über einer Feuerstelle wurde dort das Brunnenwasser für die Wäsche erhitzt. Auf Gestellen aus Weidenzweigen waren Kleider über Heizpfannen ausgebreitet, in denen Schwefel brannte, dessen Rauch die weißen Kleider aufgrund irgendeiner geheimnisvollen Chemie noch weißer macht. Ein paar junge Burschen standen herum und amüsierten sich über meinen Zorn, außerdem stank es abscheulich. Von meiner Klientin war nichts zu sehen. Ich sprang über einen Handkarren und rannte los, die Gasse hinunter.
Sie hatte die rußschwarzen Öfen des Färbers hinter sich gelassen, den Misthaufen überwunden und war auch an den Geflügelkäfigen schon halb vorbei, wo ein paar fußlahme Gänse und ein roter Flamingo mit hängendem Kopf auf den Markt am nächsten Tag warteten. Als ich herankam, hatte sie vor einem Seiler gebremst, der ihr den Weg versperrte und gerade begann, sich den Gürtel vom Wanst zu schnallen, um sie mit jener beiläufigen Brutalität zu vergewaltigen, die in Vierteln wie diesem als Sinn für die Schönheit der weiblichen Gestalt galt. Ich bedankte mich bei dem Seiler dafür, daß er sich um sie gekümmert hatte, und schleppte sie, bevor einer von beiden irgendwelche Einwände erheben konnte, wieder zurück.
Wenn ich mit dieser Klientin klarkommen wollte, mußte ich sie mir mit einem ordentlichen Strick ans Handgelenk binden.
Kapitel 3
Nach dem Betrieb auf dem Forum und dem Drunter und Drüber in den Straßen war es im Falco-Apartment erfreulich still. Unten murmelte die Stadt und über der ausgedehnten Landschaft der Ziegeldächer zwitscherte gelegentlich ein Vogel. Ich wohnte direkt unter dem Dach. Wir kamen an, wie alle Ankömmlinge hier oben ankommen: völlig außer Atem. Das Mädchen blieb stehen und las mein Firmenschild aus gebranntem Ton. Dieses Firmenschild war eigentlich sinnlos, denn niemand steigt sechs Treppen hoch, wenn er nicht vorher schon weiß, wohin er will. Aber mich hatte eines Tages das Mitleid mit einem fliegenden Händler gepackt, der mich so lange beschwatzte, bis auch ich glaubte, Reklame sei gut fürs Geschäft. Für meine Branche stimmt das zwar nicht, aber egal.
»M. Didius Falco. M für Marcus. Soll ich Sie Marcus nennen?«
»Nein«, sagte ich.
Wir traten ein.
»Je höher die Treppe, desto niedriger die Miete«, erklärte ich ihr. »Früher habe ich auf dem Dach gewohnt, bis sich die Tauben beschwerten, ich würde das Niveau senken …«
Ich wohnte zwischen Himmel und Erde. Das Mädchen war hingerissen. Sie kannte nur die erfreulichen Wohnlagen zu ebener Erde, mit eigenem Garten und Anschluß an die Aquädukte, und ahnte wahrscheinlich nichts von den Nachteilen meines Adlerhorstes. Ich lebte in der ständigen Angst, die Fundamente des Hauses könnten nachgeben und sechs Schichten Wohnraum in einer Wolke aus Mörtelstaub in sich zusammenstürzen, oder ich könnte in einer Brandnacht den Alarm der Feuerwache verschlafen und dann im eigenen Fett brutzeln.
Im Nu war sie draußen auf dem Balkon. Ich ließ ihr einen Augenblick Zeit und trat dann neben sie – auf meine Aussicht war ich nämlich wirklich stolz. Zumindest diese Aussicht war phantastisch. Unser Block stand so hoch auf dem Aventin, daß man über die benachbarten Häuser hinweg unten in der Tiefe die Probus-Brücke sah. Meilenweit konnte der Blick in die Ferne schweifen – über den Fluß und den Transtiberinischen Bezirk zum Janiculus und die Landschaft der Westküste. Nachts war es am besten. Sobald der Lärm der Handkarren verhallt war, wurden alle Geräusche so intensiv, daß man hören konnte, wie das Wasser des Tibers am Ufer nippte und wie nach hinten hinaus, auf dem Palatin, die kaiserlichen Palastwachen ihre Speere in den Boden rammten.
Tief sog sie die warme, von Großstadtdüften erfüllte Luft ein – die Gerüche aus den zahllosen Lokalen, aus den Werkstätten der Kerzenzieher und den Duft der Pinien in den öffentlichen Gärten auf dem Pincio.
»So würde ich auch gern wohnen –« Sie mußte meinen Gesichtsausdruck bemerkt haben. »Sie halten mich für eine verhätschelte Göre! Sie glauben, ich hätte nicht bemerkt, daß Sie kein Wasser haben und keine Heizung für den Winter und keinen richtigen Backofen und daß Sie sich Ihre Mahlzeiten aus der Garküche mitbringen müssen!« Sie hatte recht, genau das hatte ich geglaubt. Sie kam näher und fragte mit gesenkter Stimme: »Wer sind Sie?«
»Sie haben es gelesen: Didius Falco«, versetzte ich und sah sie an. »Privatermittler.«
Sie überlegte. Einen Augenblick war sie unschlüssig, doch plötzlich wurde sie ganz aufgeregt: »Sie arbeiten für den Kaiser!«
»Vespasian kann Leute wie mich nicht ausstehen. Nein, ich arbeite für traurige Männer, die glauben, ihre verworfenen Frauen würden mit irgendwelchen Wagenlenkern schlafen, und für noch traurigere, die wissen, daß ihre Frauen mit den eigenen Neffen schlafen. Manchmal arbeite ich auch für Frauen.«
»Und was tun Sie für diese Frauen – oder ist das eine indiskrete Frage?«
Ich lachte. »Alles, wofür sie mich bezahlen!«
Ich ließ es dabei.
Ich ging wieder nach drinnen, räumte verschiedene Dinge weg, die sie nicht sehen sollte, und fing an, das Abendessen herzurichten. Nach einiger Zeit folgte sie mir und sah sich in dem trostlosen Loch, das ich von Smaractus gemietet hatte, ein bißchen um. Der Preis, den er dafür verlangte, war eine Unverschämtheit – aber ich bezahlte ihn auch nur selten.
Das auf den Balkon führende Zimmer war so groß, daß sich ein Hund noch eben darin umdrehen konnte – wenn er ein kleiner Hund war und den Schwanz einzog. Ein wackliger Tisch, eine schiefe Bank, ein Wandbrett mit Töpfen, eine provisorische Feuerstelle aus Ziegelsteinen, ein Bratrost, ein paar Weinkrüge (leer), ein Müllkorb (voll). Wenn man es leid war, drinnen andauernd auf Kakerlaken zu treten, konnte man auf den Balkon gehen, oder man wendete sich der zweiten Türöffnung zu, die hinter einem bunt gemusterten Vorhang mit einladenden Streifen verborgen lag – sie führte ins Schlafzimmer. Das Mädchen ahnte es vielleicht, jedenfalls fragte sie nicht.
»Falls Sie an Gelage mit sieben Gängen gewöhnt sind, bei denen zwischen Eiern in Fischsauce und Fruchteis aus der Schneegrube ein ganzer Abend verstreicht, muß ich Sie warnen: Dienstags besucht mein Koch immer seine Oma.«
Meine neue Klientin machte ein unglückliches Gesicht.
»Bitte, keine Umstände! Ich kann essen, wenn Sie mich nach Haus gebracht haben –«
»Sie gehen hier nicht weg!« sagte ich. »Nicht, solange ich nicht weiß, was Sie zu Hause erwartet. Und jetzt essen Sie!«
Es gab frische Sardinen. Ich hätte ihr gern etwas Aufregenderes angeboten, aber die Frau, die sich um mein Essen kümmerte, hatte nun mal Sardinen hingestellt. Um den Fisch ein bißchen aufzumuntern, mixte ich eine kalte süße Sauce dazu: Honig mit einem Schuß von diesem und einem Spritzer von jenem, das Übliche. Das Mädchen sah mir zu, als hätte sie noch nie im Leben gesehen, wie jemand Liebstöckel und Rosmarin in einem Mörser stößt. Vielleicht hatte sie es tatsächlich noch nie gesehen.
Ich war vor ihr mit Essen fertig, pflanzte meine Ellbogen auf die Tischkante und sah die junge Dame mit meiner vertrauenswürdigsten Miene an.
»Und jetzt erzählen Sie dem Onkel Didius mal alles der Reihe nach. Wie heißen Sie?«
»Helena.« Ich war so sehr mit meiner vertrauenswürdigen Miene beschäftigt, daß mir nicht auffiel, wie sie errötete. Diese Röte hätte mir sagen können, daß die Zuchtperle in dieser Auster eine Attrappe war.
»Kennen Sie diese Unmenschen, Helena?«
»Nein.«
»Und wo haben sich die Kerle an Sie herangemacht?«
»Bei uns zu Hause.«
Ich stieß einen Pfiff aus. Das war eine Überraschung.
Die Erinnerung machte sie wütend – und gesprächiger. Sie war von den beiden am hellichten Tage entführt worden.
»Die läuteten wie wild an der Tür, stießen den Portier zur Seite, stürmten durchs Haus, schleiften mich nach draußen zu einer Sänfte, und dann rasten sie mit mir die Straße entlang! In dem Gedränge auf dem Forum mußten sie langsamer gehen, da bin ich abgesprungen und weggelaufen.«
Sie hatten sie also so weit eingeschüchtert, daß sie sich still verhielt. Aber den Kopf hatte sie nicht verloren. »Haben Sie eine Ahnung, wohin die mit Ihnen wollten?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Na schön. Nur keine Sorge«, sagte ich. »Wie alt sind Sie eigentlich?«
Sie war sechzehn. O Jupiter!
»Verheiratet?«
»Sehe ich aus wie eine Frau, die verheiratet ist?« Sie sah aus wie eine, die es bald sein würde.
»Hat der Papa irgendwelche Pläne? Vielleicht hat er einen Offizier aus gutem Hause im Auge, der gerade aus Syrien oder Spanien zurückgekommen ist?«
Die Vorstellung schien sie zu interessieren, aber sie schüttelte den Kopf. Ich konnte mir nur einen Grund vorstellen, warum man diese Schönheit entführen sollte, und steigerte die Vertrauenswürdigkeit meiner Miene. »Hat Sie in letzter Zeit einer von Papas Freunden vielleicht ein bißchen zu freundlich angelinst? Hat Ihre Mutter Sie mit irgendwelchen gutaussehenden Söhnen irgendwelcher Jugendfreundinnen bekannt gemacht?«
»Ich habe keine Mutter«, meinte sie ruhig.
Es entstand eine Stille, und ich fragte mich, warum sie das so merkwürdig ausgedrückt hatte. Die meisten Menschen hätten gesagt: »Meine Mutter ist tot« oder etwas Ähnliches. Ich kam zu dem Schluß, daß sich ihre ehrwürdige Mama bester Gesundheit erfreute. Wahrscheinlich hatte ihr Mann sie mit einem Lakaien im Bett erwischt und verstoßen.
»Entschuldige – eine rein berufliche Frage: Gibt es einen Verehrer, von dem deine Angehörigen nichts wissen? Ich darf doch Du sagen?«
Plötzlich brach sie in ein Gekicher aus. »Ach, hören Sie doch mit diesem Unsinn auf! Nein, so jemanden gibt es nicht!«
»Du bist eine sehr attraktive junge Dame!« beharrte ich und fügte rasch hinzu: »Aber bei mir bist du – sind Sie natürlich sicher.«
»Verstehe!« Ihre großen braunen Augen funkelten vor Übermut. Verwundert mußte ich feststellen, daß sie sich über mich lustig machte.
Es war allerdings auch Bluff dabei. Vorhin war sie zu Tode erschrocken gewesen, und jetzt spielte sie die kesse Nudel. Je kesser sie wurde, desto reizender sah sie aus. Aus ihren schönen Augen, randvoll mit Unheil, sah sie mir tief in die meinen und setzte mir mächtig zu …
Gerade zur rechten Zeit kamen draußen vor der Tür Schritte zum Stehen; dann pochte es mit jener saloppen Überheblichkeit, die nur einen Besuch des Gesetzes ankündigen konnte.
Kapitel 4
Nach den vielen Treppen war das Gesetz außer Atem.
»Nur herein!« sagte ich mit freundlicher Stimme. »Es ist nicht abgeschlossen.«
Er war schon drinnen und brach soeben am anderen Ende meiner Bank zusammen. »Nimm ruhig Platz«, sagte ich.
»Falco, alter Schurke! Das nenne ich eine Verbesserung!« Er grinste mich an. Petronius Longus, Hauptmann der Aventinischen Wache. Ein großer, gutmütiger, schläfrig dreinblickender Mann mit einem Gesicht, dem die Leute vertrauten – wahrscheinlich, weil es so wenig preisgab.
Wir kannten uns schon seit einer Ewigkeit. Wir waren am selben Tag in die Armee eingetreten, begegneten uns in der Schlange der Rekruten, die dem Kaiser ihren Eid ablegten, und stellten außerdem fest, daß wir nur fünf Straßen voneinander entfernt aufgewachsen waren. Anschließend waren wir sieben Jahre lang Zeltgenossen, und als wir danach heimkehrten, hatten wir noch etwas gemeinsam: Wir waren Veteranen der Zweiten Legion Augusta in Britannien. Genauer gesagt: Wir waren Veteranen der Zweiten aus der Zeit des Aufstandes der Königin Boudicca gegen Rom. Wegen der miserablen Leistung dieser Truppe verließen wir das Heer achtzehn Jahre zu früh und hatten auf diese Weise beide etwas, worüber wir lieber nicht sprachen.
»Schieb deine Glubschaugen wieder rein«, sagte ich zu ihm. »Sie heißt Helena.«
»Hallo Helena. Hübscher Name! Wo hast du denn die gefunden, Falco?«
»Bei einem Wettrennen um den Saturntempel.« Ich hatte mich für eine ehrliche Antwort entschieden, weil immerhin die geringe Chance bestand, daß Petronius schon Bescheid wußte. Außerdem sollte das Mädchen glauben, daß sie es mit einem Mann zu tun hatte, der die Wahrheit sagt.
Ich stellte den Wachhauptmann meiner betörenden Klientin vor: »Petronius Longus, Hauptmann der Bezirkswache; der beste.«
»Guten Abend, Hauptmann«, sagte sie.
Ich lachte erbittert. »Besorg dir einen Posten bei der Stadtverwaltung, und schon reden dich die Frauen mit dem Titel an! Schätzchen, man muß es nicht übertreiben!«
»Achten Sie nicht auf diesen hinterhältigen Menschen«, spottete Petronius und schenkte ihr ein interessiertes Lächeln, das mir gar nicht gefiel.
Sie lächelte zurück, also ging ich dazwischen: »Wir Männer wollen bei einem Becher Wein ein bißchen plaudern; gehen Sie hinüber ins Schlafzimmer und warten Sie dort auf mich.«
Sie warf mir einen finsteren Blick zu, aber sie ging. Das ist der Vorteil der liberalen Erziehung: Dieses Mädchen wußte bereits, daß sie in einer Männerwelt lebte. Außerdem hatte sie gute Manieren, und es war ja schließlich mein Haus.
»Klasse!« meinte Petronius leise.
Er hat eine Frau, und aus irgendeinem Grund betet sie ihn sogar an. Er redet zwar nie von ihr, aber es muß ihm auch was an ihr liegen; er ist der Typ dazu. Sie haben drei Töchter, und wie jeder gute Vater in Rom liebt er seine Nachkommen heiß und innig. Ich sah den Tag schon kommen, an dem es im Verlies des Mamertinischen Gefängnisses von lauter widerwärtigen Schnöseln wimmelte, die irgendwann einmal ein Auge auf Petros Töchter geworfen hatten.
Ich holte zwei Becher hervor, die sauber aussahen, aber den von Petro wischte ich mit dem Saum meiner Tunika noch einmal aus, bevor ich ihn auf den Tisch stellte. In dem Loch unter einer Diele, das mir als Weinkeller diente, verwahrte ich ein rauchiges Gift spanischer Herkunft, das mir ein dankbarer Klient geschenkt hatte, einen trüben Rotwein, der schmeckte, als wäre er aus einem etruskischen Grab gestohlen, und außerdem eine Amphore mit einem anständigen weißen Sentiner. Weil mir Petros Besuch so ungelegen kam, überlegte ich, ob ich ihm einfach den Etrusker anbieten sollte, aber schließlich entschied ich mich doch für den Sentiner, weil wir alte Freunde waren und weil ich selbst Lust auf einen guten Schluck hatte.
Sobald er gekostet hatte, war ihm klar, daß er bestochen wurde. Er sagte nichts. Wir leerten mehrere Becher. Es kam die Zeit, da ein kleiner Plausch unaufschiebbar schien.
»Hör zu«, begann er. »Es gibt da ein Riesengeschrei wegen eines Rocks mit Goldsaum, der heute morgen aus dem Haus eines Senators entführt worden ist, frag mich nicht, warum –«
»Du meinst, ich soll die Augen offenhalten?« Ich warf ihm einen harmlosen Blick zu, aber ich sah schon, daß er sich nicht täuschen ließ. »Wahrscheinlich eine Erbin, oder?«
»Hör bloß auf, Falco! Später hat man sie in den Klauen eines geifernden Ungeheuers gesehen, dessen Beschreibung haargenau auf dich paßt. Sie heißt Sosia Camillina, sie ist absolut tabu, und ich werde sie dorthin zurückschaffen, wo sie hergekommen ist, bevor die Schnüffler von irgendeinem Prätor in meinem Bezirk herumkrebsen und unverschämte Bemerkungen über meine Marktaufsicht machen … Ist sie das, da drinnen?« Er machte eine Kopfbewegung in Richtung Schlafzimmer.
Ich nickte ergeben. »Schätze ja.«
Ich mochte ihn; er verstand etwas von seinem Beruf. Wir wußten beide, daß er sein Kätzchen gefunden hatte.
Ich erklärte ihm, wie alles gekommen war, und strich dabei meine Rolle als galanter Retter verrückt spielender Adelstöchter kräftig heraus, während ich (im Hinblick auf Petros frühere Bemerkung) der Zertrümmerung gewisser Marktstände in meiner Darstellung weniger Platz einräumte. Ich wollte ihn nicht in Verlegenheit bringen.
»Ich muß sie zurückbringen«, sagte Petro. Er war ziemlich betrunken.
»Ich werde sie zurückbringen«, versprach ich. »Tu mir den Gefallen, und laß mich das machen. Wenn du gehst, heißt es bloß: Danke, Hauptmann, daß Sie Ihre Pflicht getan haben! Bei mir lassen sie vielleicht eine kleine Belohnung springen. Wie wär’s mit halbe-halbe?«
Mit einem guten Wein im Bauch wird auch mein Kumpel Petronius zum Gentleman. Es gibt nicht viele Leute, die auf die Geschäftsbilanz von M. Didius Falco so viel Rücksicht nehmen. »Oh …« Er leerte seinen Becher mit gequälter Miene. »Ich glaube, das reicht jetzt. Gib mir dein Ehrenwort!«
Ich gab es ihm und außerdem auch den Rest des Sentiners, danach ging er fröhlich seiner Wege.
Eigentlich hatte ich nicht vor, sie zurückzugeben.
Jedenfalls … noch nicht.
Kapitel 5
Ich schoß ins Schlafzimmer hinüber. Der Vorhang zischte die Schiene entlang. Mit einem Gesicht, auf dem das schlechte Gewissen deutlich zu lesen war, sprang das arme Mädchen von meinem Bett auf, und alle meine privaten Notizbücher fielen zu Boden.
»Her damit!« schrie ich. Jetzt war ich wirklich wütend.
»Du bist ja ein Dichter!« Sie versuchte Zeit zu gewinnen. »Handelt ›Aglaia, die weiße Taube‹ von einer Frau? Ich nehme an, sie handeln alle von Frauen, sie sind ein bißchen grob … tut mir leid, es hat mich interessiert …«
Aglaia war ein Mädchen, das ich kannte, sie war nicht weiß und hatte auch nichts von einer Taube, und da wir schon mal dabei sind: sie hieß auch nicht Aglaia.
Lockäugelchen warf mir noch immer diesen verletzlichen Blick zu, aber das machte jetzt alles nur noch schlimmer. Auch die liebreizendsten Frauen verlieren ihren Glanz, wenn sie uns frech ins Gesicht lügen.
»Du wirst noch ganz andere Grobheiten zu hören bekommen!« fauchte ich. »Sosia Camillina? Warum der falsche Paß?«
»Ich hatte Angst!« erklärte sie. »Ich wollte meinen Namen nicht sagen, ich wußte ja nicht, was du mit mir vorhast –« Das akzeptierte ich; ich wußte es selber nicht.
»Wer ist Helena?«
»Meine Cousine. Sie ist nach Britannien gegangen. Sie ist geschieden –«
»Verschwendungssucht oder normaler Ehebruch?«
»Sie sagte, es sei zu kompliziert, um es zu erklären.«
»Aha!« rief ich erbittert. Ich war nie verheiratet gewesen, aber ein Experte in Scheidungsfragen. »Also Ehebruch! Ich habe schon gehört, daß Frauen wegen unmoralischen Verhaltens auf Inseln verbannt worden sind, aber Verbannung nach Britannien kommt mir doch sehr hart vor!«
Sosia Camillina sah mich neugierig an. »Wieso? Woher weißt du?«
»Bin mal dort gewesen.«
Wegen der Revolte faßte ich mich so kurz. Sosia mußte damals ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein. Sie konnte sich an die große Revolte der Briten wohl nicht erinnern, und ich hatte keine Lust, ihr Nachhilfeunterricht in Geschichte zu erteilen. Plötzlich fragte sie: »Warum hat dein Freund gesagt, du wärst ein hinterhältiger Charakter?«
»Ich bin Republikaner. Petronius Longus hält das für gefährlich.«
»Warum bist du Republikaner?«
»Weil jeder freie Mann eine Stimme in der Regierung der Stadt haben sollte, in der er leben muß. Weil der Senat die Herrschaft über das Imperium nicht auf Lebenszeit einem einzigen Sterblichen überlassen sollte, der sich am Ende als verrückt oder korrupt oder sittenlos erweisen könnte und wahrscheinlich auch erweisen wird. Weil ich nicht mit ansehen kann, wie Rom langsam zu einem Irrenhaus verkommt, in dem eine Handvoll Aristokraten das Sagen haben, die selbst wieder bloß die Marionetten ihrer zynischen Ex-Sklaven sind, während die Masse der Bürger kaum das Nötigste zum Leben hat …« Unmöglich zu sagen, was sie sich für einen Reim auf das alles machte. Ihre nächste Frage war jedenfalls ganz nüchtern und praktisch.
»Verdienen Privatermittler das Nötigste zum Leben?«
»Wenn sie jede legale Möglichkeit nutzen, die sich ihnen bietet, reicht es, um nicht zu sterben. Und an guten Tagen«, fügte ich hinzu, »haben wir manchmal sogar so viel zu futtern, daß wir genügend Kraft finden, gegen die Ungerechtigkeit der Welt zu wettern.« Ich war jetzt ziemlich hinüber. Was das Trinken anging, hatte ich mit Petronius inzwischen gleichgezogen.
»Du glaubst, die Welt sei ungerecht?«
»Ich weiß es, meine Liebe!«
Sosia sah mich ernst an, als betrübe es sie, daß mich die Welt so schlecht behandelt hatte. Ich war auch nicht besonders erfreut darüber.
Ich war müde. Ich ging ins Wohnzimmer hinüber, und wenig später folgte mir das Mädchen.
»Ich muß noch mal aufs Klo.«
Mich ergriff die Beklommenheit eines Mannes, der ein kleines Hündchen mit nach Hause bringt, weil es so süß aussieht, und plötzlich merkt, daß er da im sechsten Stock leicht Probleme bekommt. Aber kein Grund zur Panik. Meine Wohnung war zwar spartanisch, aber mein Lebenswandel hygienisch.
»Nun ja«, stichelte ich, »du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst nach unten flitzen und versuchen, ob du Lenia dazu bringst, ihren Laden nach Feierabend noch mal aufzuschließen. Oder du läufst die Straße runter zu der großen öffentlichen Bedürfnisanstalt drüben – aber vergiß nicht, Kleingeld mitzunehmen, sonst lassen sie dich nicht rein.«
»Ich nehme an, du und deine Freunde, ihr pinkelt vom Balkon«, fauchte sie.
Ich sah sie bestürzt an. Und das war ich auch – leicht bestürzt. »Weißt du denn nicht, daß das verboten ist?«
»Hätte nicht gedacht, daß du dich an die Vorschriften zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung hältst.« Langsam durchschaute sie auch meine Firma. Mich hatte sie schon durchschaut.
Ich krümmte einen Finger. Sie folgte mir zurück ins Schlafzimmer, wo ich ihr die Einrichtungen zeigte, deren ich mich selbst bediente.
»Danke«, sagte sie.
»Keine Ursache«, erwidert ich.
Ich pinkelte vom Balkon – bloß um zu beweisen, daß ich ein freier Mensch war.
Als sie diesmal zurückkehrte, grübelte ich vor mich hin. Irgendwie machten mir die Hintergründe dieser Entführung mehr zu schaffen als gewöhnlich. Mir war einfach nicht klar, ob ich den entscheidenden Punkt übersehen hatte oder ob ich tatsächlich alles wußte, was es zu wissen gab. Ich fragte mich, ob der Senator, dem sie gehörte, politisch aktiv war. Dann hatte man Sosia vielleicht entführt, um ihn bei irgendeiner Abstimmung zu beeinflussen. O Götter, bestimmt nicht! Sie war einfach viel zu schön! Es mußte mehr dahinterstecken.
»Bringst du mich jetzt nach Hause?«
»Zu spät. Zu gefährlich. Außerdem habe ich zuviel getrunken.« Ich machte kehrt, wankte durch das Schlafzimmer und ließ mich auf mein Bett fallen. Sie stand im Türrahmen wie eine hängengebliebene Fischgräte.
»Und wo soll ich schlafen?«
Ich war fast so betrunken wie Petronius. Ich lag flach auf dem Rücken und tätschelte meine Notizbücher. Ich brachte nur noch schwammige Gesten und albernes Getue zustande.
»An meinem Herzen, kleine Göttin!« rief ich und öffnete meine Arme, vorsichtig, einen nach dem anderen.
Sie schrak zusammen.
»Also gut!« gab sie zurück. Tapferes Mädchen.
Ich schenkte ihr ein mattes Grinsen und drehte mich in meine frühere Position zurück. Ich war selbst ziemlich erschrocken.
Aber ich hatte recht. Es war einfach zu gefährlich, mit einem so kostbaren Kind in der Gegend herumzulaufen. Nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Nicht in Rom. Nicht in diesen finsteren Straßen, in denen es von Räubern und Sittenstrolchen wimmelte. Bei mir war sie besser aufgehoben.
War sie denn gut aufgehoben? hat mich später mal jemand gefragt. Ich wich einer Antwort aus. Bis heute weiß ich nicht genau, ob Sosia Camillina bei mir damals gut aufgehoben war oder nicht.
Zu ihr sagte ich jetzt barsch: »Gäste nehmen die Lesecouch. Decken sind im Holzkasten.«
Ich sah zu, wie sie sich einen aufwendigen Kokon baute. Sie machte eine gewaltige Aktion daraus. Wie ein Zeltvoll junger Rekruten, acht lustlose Kerle in neuen, kratzigen Tuniken, die keine Ahnung haben, wie man ein ordentliches Feldbett baut. Eine halbe Ewigkeit fummelte sie an der Couch herum und stopfte viel zu viele Bettücher viel zu fest.
»Ich brauche ein Kopfkissen«, erklärte sie schließlich mit kleiner Klagestimme, wie ein Kind, das ohne ein ganz bestimmtes abendliches Ritual nicht einschlafen kann. Der Wein und die Aufregung hatten mich selig gemacht; ich konnte mit und ohne Kopfkissen schlafen. Ich stützte mich auf einen Ellbogen und warf ihr meines zu, schlecht gezielt, aber sie fing es auf.
Sosia Camillina inspizierte mein Kissen, als würden Flöhe darin hausen. Auch das sprach gegen den Adel! Vielleicht waren ja wirklich welche drin, aber alles etwaige Getier war in dem farbenfrohen Bezug fest vernäht, den mir meine Mutter aufgedrängt hatte. Ich hatte nichts übrig für arrogante junge Dinger, die über meinen Hausrat die Nase rümpften.
»Es ist vollkommen sauber! Nimm es und sei dankbar.«
Sie legte das Kissen an ihr Kopfende und zupfte es zurecht. Ich blies das Licht aus. Zuweilen benehmen sich auch Privatermittler wie Gentlemen – jedenfalls, wenn sie für andere Dinge zu betrunken sind.
Ich schlief wie ein kleines Kind. Ob meine Besucherin genauso schlief, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Kapitel 6
Der Senator Decimus Camillus Verus wohnte im Bezirk Porta Capena. Von meinem Bezirk aus gesehen, war das der übernächste, also ging ich zu Fuß. Unterwegs begegnete ich meiner jüngsten Schwester Maria und mindestens zwei von den zahlreichen kleinen Rabauken, die dem Stammbaum unserer Familie entsprossen waren.
Manche Privatermittler erwecken den Eindruck, wir wären einsame Männer. Bei mir war das anders, und vielleicht kam ich deshalb auf keinen grünen Zweig. Jedesmal wenn ich irgendeinem ehebrecherischen Bürokraten in seiner abgetragenen Tunika nachschlich, begegnete mir einer dieser Bengel, schneuzte sich in seinen Ärmel und brüllte im nächsten Augenblick meinen Namen über die Straße. Ich lief durch Rom wie ein bunter Hund, und wahrscheinlich war ich mit den meisten Leuten zwischen dem Tiber und dem Ardeatinischen Tor auch noch verwandt. Damals hatte ich fünf Schwestern, hinzu kam das arme Mädchen, das mein Bruder Festus nie geheiratet hatte, weil ihm die Zeit dazu fehlte, außerdem dreizehn Neffen, vier Nichten und einige weitere, die unterwegs waren und sich schon deutlich abzeichneten. Dabei habe ich meine Erben vierten und fünften Grades, wie die Anwälte sie nennen, noch gar nicht erwähnt: die Brüder meiner Mutter, die Schwestern meines Vaters und all die Vettern zweiten Grades der Kinder aus erster Ehe von den Stiefvätern der Tanten meines Großvaters.
Eine Mutter hatte ich auch, obwohl ich das zu ignorieren versuchte.
Ich winkte den Rabauken zu. Ich halte sie mir bei Laune. Manchmal lasse ich mich bei der Jagd auf Ehebrecher von diesen Burschen vertreten und gehe statt dessen zum Rennen.
Decimus Camillus besaß ein eigenes Haus auf eigenem Grund und Boden in einem ruhigen Wohnviertel. Er hatte sich das Recht gekauft, direkt aus dem alten Appischen Aquädukt, das in der Nähe vorbeiführte, Wasser abzuzapfen. Er hatte es nicht nötig, die Räume an der Straßenfront seines Hauses als Läden oder die im Obergeschoß als möblierte Zimmer zu vermieten, aber er teilte sein beneidenswertes Grundstück mit dem Besitzer eines Hauses nebenan, das ein genaues Gegenstück zu seinem eigenen war. Woraus ich schloß, daß dieser Senator keineswegs überreich war. Wie wir anderen hatte auch dieser arme Kerl seine liebe Not, einen Lebensstandard zu wahren, der seinem Rang entsprach. Der Unterschied zwischen ihm und den meisten von uns bestand nur darin, daß Decimus Camillus Millionär sein mußte, sonst hätte er nicht Mitglied des Senats werden können.
Da ich einer Million Sesterzen einen Besuch abstatten wollte, setzte ich meine Kehle dem Rasiermesser eines Barbiers aus. Ich trug eine fadenscheinige weiße Toga, die so gefaltet war, daß man die Löcher darin nicht sehen konnte, eine kurze saubere Tunika, meinen besten Gürtel, den mit der keltischen Schnalle, und braune Schuhe. Ein typischer freier Bürger, dessen Ansehen man an der Zahl der Sklaven ablesen konnte, die ihm vorausschritten – in meinem Fall kein einziger.
An den Türen des Senators waren nagelneue Schlüssellochschilder angebracht, aber ein Portier mit Arme-Sünder-Miene und einem großen blauen Fleck auf der Backe spähte durch das Gitterchen und öffnete mir, sobald ich den Strick an der großen Kupferglocke gezogen hatte. Sie erwarteten jemanden. Wahrscheinlich den, der dem Portier gestern eine geknallt und das Mädchen abgeschleppt hatte.
Wir durchquerten ein schwarzweiß gekacheltes Vestibül mit verblichenen, zinnoberroten Wänden und einem blubbernden Springbrunnen in der Mitte. Camillus war ein schüchterner Mann Mitte Fünfzig, der sich in einer Bibliothek zwischen Massen von Papier und Schreibereien, einer Kaiserbüste und ein paar hübschen Bronzelampen vergraben hatte. Er sah ganz normal aus, aber er war es nicht. Zum einen war er höflich.
»Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?«
»Mein Name ist Didius Falco. Wenn Sie gestatten, Senator, hier meine Beglaubigung.« Ich schob ihm einen von Sosias Armreifen zu. Es war britannischer Gagat, das Zeug, das sie von der Nordostküste holen; die einzelnen Glieder waren so geschnitten, daß sie sich ineinanderfügten. Sosia hatte mir erzählt, ihre Cousine habe es ihr geschickt. Ich kannte die Art aus meiner Soldatenzeit, aber in Rom waren sie selten.
Er prüfte den Reifen freundlich.
»Darf ich fragen, woher Sie ihn haben?«
»Vom Arm einer höchst ansehnlichen Person, die ich gestern vor zwei diebischen Halunken gerettet habe.«
»Ist sie verletzt?«
»Nein, Senator.«
Unter seinen dichten Augenbrauen sah er mich direkt an. Obwohl sein Haar nicht besonders kurz war, stand es ihm vom Kopf ab, und das gab ihm ein munteres, jungenhaftes Aussehen. Ich sah, wie er seinen ganzen Mut zusammennahm, um die Frage zu stellen, was ich von ihm wolle. Ich machte ein hilfsbereites Gesicht.
»Senator, soll ich sie zurückbringen?«
»Welches sind Ihre Bedingungen?«
»Haben Sie eine Ahnung, wer sie entführt hat, Senator?«
»Nicht die geringste.« Wenn ich geglaubt hätte, daß er lügt, hätte ich die Promptheit bewundert, mit der er antwortete. So gefiel mir seine Beharrlichkeit.
»Ihre Bedingungen bitte!«
»Rein berufliche Neugier. Ich habe sie an einem sicheren Ort versteckt. Ich bin Privatermittler. Ein Wachhauptmann aus dem dreizehnten Bezirk namens Petronius Longus wird für mich bürgen.«
Er griff nach seinem Tintenfaß und machte sich eine Notiz in der Ecke eines Briefes, den er gerade las. Auch das gefiel mir. Er wollte meinen Angaben überprüfen.
Ohne ihn zu bedrängen, deutete ich an, daß er mich, wenn er sich dankbar erweisen wolle, unter Vertrag nehmen könne. Er machte ein nachdenkliches Gesicht. Ich erläuterte ihm meine Honorarsätze, die ich im Hinblick auf seinen Rang etwas erhöhte, denn wenn ich ihn ständig mit »Senator« ansprechen mußte, würde alles ein bißchen länger dauern. Er zögerte, wahrscheinlich weil es ihm nicht gefiel, daß ich dann ständig in der Nähe des Mädchens herumhängen würde, aber schließlich vereinbarten wir, daß ich ihn in Fragen des Objekt- und Personenschutzes beraten und außerdem wegen der Entführer die Ohren offenhalten würde.
»Vielleicht hatten Sie recht, Sosia Camillina verschwinden zu lassen«, sagte er. »Ist das Versteck respektabel?«
»Von meiner eigenen Mutter persönlich überwacht, Senator!« Das stimmte: Sie durchstöberte regelmäßig meine Wohnung nach Hinweisen auf leichte Mädchen.
Manchmal wurde sie fündig, manchmal gelang es mir, die Betroffenen noch rechtzeitig hinauszuschaffen.
Dieser Senator war kein Dummkopf. Er meinte, jemand müsse mich zurückbegleiten und sich vergewissern, daß das Mädchen auch wirklich in Sicherheit sei. Ich riet ihm davon ab. Bei meinem Kommen hatte ich in dem Lokal auf der anderen Straßenseite ein paar schmierige Fettwänste gesehen, die beobachteten, wer sein Haus betrat. Möglicherweise hatten sie mit Sosia gar nichts zu tun, es konnten auch irgendwelche Einbrecher sein, die ihren nächsten Fischzug auskundschaften wollten und einen ungünstigen Tag erwischt hatten. Da er mich sowieso in seinem Haus herumführte, wollte ich sie ihm zeigen.