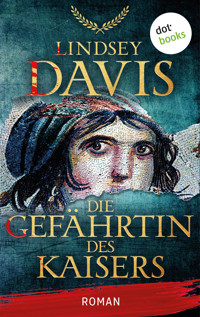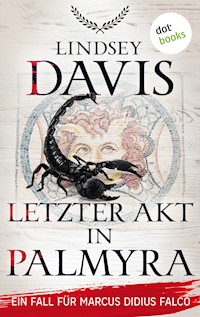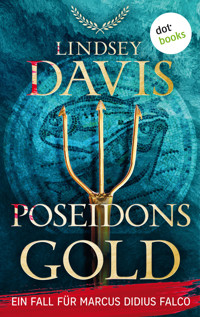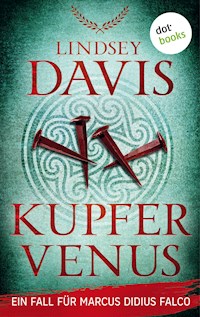6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Ein grausamer Fund in Roms Aquädukten: Der fesselnde historische Kriminalroman »Drei Hände im Brunnen« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 73 nach Christus. Als erfahrenster Privatermittler am Tiber kennt Marcus Didius Falco das schwarze Herz der »Ewigen Stadt«. Doch dann macht er in einem öffentlichen Brunnen auf dem Aventin eine Entdeckung, die selbst ihn erschreckt: die abgetrennte Hand einer Frau. Schon bald gibt es weitere grausige Fundstücke in den Aquädukten der Stadt – und Falco ist sicher: Hier ist ein Wahnsinniger am Werk, dessen Mordlust noch lange nicht befriedigt ist. Während der Kaiser die Vorfälle vertuschen lässt, um eine Panik zu verhindern, beginnt Falco, auf eigene Faust zu ermitteln. Die Zeit drängt, denn die Römischen Spiele locken von Tag zu Tag mehr Schaulustige in die Stadt – unter ihnen zahllose Frauen, die nicht ahnen, welche Gefahr in den dunklen Gassen auf sie lauert … »Wohl die beste Autorin in diesem Genre.« Bestsellerautorin Donna Leon Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Drei Hände im Brunnen« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der neunte Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 73 nach Christus. Als erfahrenster Privatermittler am Tiber kennt Marcus Didius Falco das schwarze Herz der »Ewigen Stadt«. Doch dann macht er in einem öffentlichen Brunnen auf dem Aventin eine Entdeckung, die selbst ihn erschreckt: die abgetrennte Hand einer Frau. Schon bald gibt es weitere grausige Fundstücke in den Aquädukten der Stadt – und Falco ist sicher: Hier ist ein Wahnsinniger am Werk, dessen Mordlust noch lange nicht befriedigt ist. Während der Kaiser die Vorfälle vertuschen lässt, um eine Panik zu verhindern, beginnt Falco, auf eigene Faust zu ermitteln. Die Zeit drängt, denn die Römischen Spiele locken von Tag zu Tag mehr Schaulustige in die Stadt – unter ihnen zahllose Frauen, die nicht ahnen, welche Gefahr in den dunklen Gassen auf sie lauert …
»Wohl die beste Autorin in diesem Genre.« Bestsellerautorin Donna Leon
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »Three Hands in the Fountain« bei Century/Random House, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2000 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/jantima14, Khanthachau C, RinArte, Predag Jankovic
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-766-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Drei Hände im Brunnen« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Drei Hände im Brunnen
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Für Heather und Oliver,
meine wundervolle Agentin und meinen wundervollen Lektor bei Century
(die eigentlich jeder eine Widmung verdient hätten),
mit meinem Dank für die ersten zehn
– und auf die nächsten zehn!
Dramatis Personae
Freunde und Familie
Julia Junilla Laeitana: ein Baby im Zentrum der Aufmerksamkeit
M. Didius Falco: ein frisch gebackener Vater, der angeblich einen Partner braucht
Helena Justina: seine Partnerin zu Hause und bei der Arbeit, eine frisch gebackene Mutter
Nux: ihre eigene Herrin, aber ein guter Hund
Falcos Mutter: eine Vermieterin, Julias hingebungsvolle Großmama
Anacrites: ihr Untermieter; ein Unruhestifter sondergleichen
L. Petronius Longus: ein Friedensstifter, aber in Schwierigkeiten
Arria Silvia: seine Frau, alles andere als friedlich
D. Camillus Verus: Julias Großvater, ein idealistischer Senator
Julia Justa: Julias andere hingebungsvolle Großmama
Camillus Aelianus: der gerne heiraten will
Camillus Justinus: der keine Ahnung zu haben scheint, was er will
Claudia Rufina: deren Vermögen Aelianus heiraten will
Gaius: Falcos Neffe, ein umtriebiger Bursche
Lollius: sein abwesender Vater, der vorübergehend aufgetaucht ist
Marina: eine Bortenmacherin, angeblich
Rubella: harter, aber gerechter Tribun der Vierten Kohorte der Vigiles
Fusculus: treuer (aber hoffnungsvoller) Ersatzmann für Petronius
Martinus: eifersüchtiger, aber versetzter Rivale für Petros Posten
Sergius: dessen Bestrafung seine Opfer fast tötet
Scythax: der Kohortenarzt, der seine Patienten lieber lebend hat
Liebhaber, Inspektoren, Opfer und Verdächtige
Balbina Milvia: der Grund für Petros Schwierigkeiten
Cornella Flaccida: ihre Mutter, positiv schrecklich (und schrecklich positiv)
Florius: Milvias Ehemann, absolut negativ
Anon: ein Registrator für Geburten, alles andere als fröhlich
Silvius & Brixius: Registratoren für die Toten, zwei fröhliche Gesellen
S. Julius Frontinus: ja, der Frontinus! – eine geschichtliche Figur
Statius: ein Ingenieur, zu wichtig, um etwas zu wissen oder zu tun
Bolanus: sein Assistent, der es weiß und tut
Cordus: ein Staatssklave, der auf Finderlohn hofft
Caius Cicurrus: ein Kerzenmacher, der seinen Schatz verloren hat
Asinia: seine Frau, offenbar ein gutes Mädchen
Pia: ihre Freundin, eindeutig ein schlechtes Mädchen
Mundus: Pias Liebhaber, der keine Ahnung von Mädchen hat
Rosius Gratus: ein sehr alter Mann, der abseits lebt
Aurelia Maesia: seine Tochter, der das nur recht ist
Damon: ein lahmer Kutscher, der einen flotten Ruf hat
Titus: nein, nicht der! – ein Junge vom Land
Thurius: ein mürrischer Bediensteter
Weitere Verdächtige:
250 000 Zuschauer im Circus Maximus
Jeder, der für die Spiele arbeitet
Alle Einwohner von Tibur und Umgebung
Der Mann auf der Straße
Rom: August – Oktober, 73 n. Chr.
»Kommt [die Wasserleitung] an die Stadtmauer, so soll man ein Wasserschloss errichten und einen aus drei Wasserkästen bestehenden Wasserbehälter ... in dem mittleren Kasten sollen Röhrenleitungen so angelegt werden, dass sie zu allen Brunnen führen; aus dem zweiten Wasserkasten sollen Röhrenleitungen zu den Privatbadeanstalten führen, denn so können sie das Wasser [für die Öffentlichkeit] nicht wegnehmen; aus dem dritten Wasserkasten sollen Röhrenleitungen zu den Privathäusern führen, damit die, die privat Wasser in ihre Häuser leiten, jährlich dem Volk ein Wassergeld zahlen.«
Vitruv
»Mit diesen so vielen und so notwendigen Wasserbauten kannst du natürlich vergleichen die überflüssigen Pyramiden oder die übrigen nutzlosen, weithin gerühmten Werke der Griechen!«
Frontinus (Übers. Gerhard Kühne)
»Lass uns was trinken – aber kipp ja kein Wasser rein!«
Petronius Longus von Falco & Partner
Kapitel 1
Der Brunnen lief nicht. Was nichts Ungewöhnliches war. Schließlich befanden wir uns hier auf dem Aventin.
Er schien schon eine ganze Weile abgestellt zu sein. Das Auslaufrohr, eine grob geformte Muschel in der Hand einer nackten, aber ziemlich unansehnlichen Nymphe, war mit Taubendreck verkrustet. Das Brunnenbecken war sauberer. Zwei Männer, die sich die Neige einer von der langen Reise durchgerüttelten Amphore spanischen Weins teilten, konnten sich anlehnen, ohne ihre Tuniken zu beschmutzen. Wenn Petronius und ich zu dem Fest zurückschlurfen würden, das in meiner Wohnung im Gange war, würde nichts darauf hindeuten, wo wir gewesen waren.
Ich hatte die Amphore in das leere Becken gelegt, mit der Spitze nach unten, damit wir sie nur zu kippen brauchten, um die Becher zu füllen, mit denen wir uns weggeschlichen hatten. Wir hatten schon ordentlich zugelangt. So betrunken, wie wir bei unserer Rückkehr sein würden, konnte es uns egal sein, was die anderen sagten, außer die Standpauke fiele ungewöhnlich scharf aus. Was gut möglich war, wenn Helena Justina bemerkt hatte, dass ich verschwunden war und sie mit dem Rest der Bagage allein gelassen hatte.
Der Brunnen stand in der Schneidergasse. Wir hatten uns absichtlich ein Stück von meiner Wohnung in der Brunnenpromenade entfernt, damit meine Schwäger uns bei einem Blick auf die Straße nicht entdecken und sich uns aufdrängen würden. Keiner von ihnen war zu dem heutigen Fest eingeladen, aber sobald sie davon gehört hatten, waren sie wie die Fliegen über uns hergefallen. Sogar Lollius, der Bootsmann, der sonst nie auftauchte, hatte seine hässliche Visage zur Tür hereingestreckt.
Abgesehen davon, dass er in angenehmer Entfernung von meiner Wohnung lag, war der Brunnen in der Schneidergasse ein guter Platz zum Anlehnen und Herzausschütten. Die Brunnenpromenade hatte keinen eigenen Brunnen, genauso wenig wie Schneider in der Schneidergasse ihrem Handwerk nachgingen. Tja, so ist das eben auf dem Aventin.
Ein oder zwei Passanten, die uns in der falschen Straße entdeckten, nahmen an, dass wir über unsere Arbeit sprachen. Sie bedachten uns mit Blicken, die man sonst nur zerquetschten Ratten auf der Landstraße zuwarf. Wir waren beide durchaus bekannt im Dreizehnten Bezirk. Wenige hatten etwas für uns übrig. Manchmal arbeiteten wir zusammen, obwohl die Verbindung des öffentlichen mit dem privaten Sektor eher schwierig war. Ich war Privatermittler und kaiserlicher Agent, gerade zurück von einer Reise in die spanische Provinz Baetica, wofür ich weniger Honorar bekommen hatte als vereinbart, was ich allerdings durch eine raffiniert ausgeklügelte Spesenabrechnung wieder wettgemacht hatte. Petronius Longus lebte von einem festen Gehalt. Er war Ermittlungschef einer Kohorte der Vigiles in diesem Bezirk. Nun ja, für gewöhnlich schon. Nur hatte er mich gerade mit der Eröffnung verblüfft, dass er vom Dienst suspendiert worden war.
Petronius nahm einen kräftigen Schluck Wein und stellte dann seinen Becher vorsichtig auf den Kopf der steinernen Maid, die die Nachbarschaft mit Wasser versorgen sollte. Petro hatte lange Arme, und sie war eine kleine Nymphe, dazu auch noch mit einer leeren Muschel. Petro war ein großer, muskulöser, normalerweise ruhiger und kompetenter Bürger. Jetzt starrte er niedergeschlagen auf die Gasse hinaus.
Ich füllte meinen Becher nach. Das gab mir Zeit, seine Eröffnung zu verdauen und zu überlegen, wie ich reagieren sollte. Schließlich sagte ich gar nichts. Auszurufen: Ach du je, alter Freund! oder: Bei Jupiter, mein lieber Lucius, ich kann nicht glauben, was ich da gerade gehört habe! war zu abgedroschen. Wenn er mir die Geschichte erzählen wollte, dann würde er es tun. Und wenn er es vorzog, sie lieber für sich zu behalten, auch gut. Er war mein bester Freund, und ich würde so tun, als nähme ich es hin.
Ich konnte mich später bei anderen erkundigen. Was auch immer geschehen war, er würde es mir nicht lange verheimlichen können. Ich verdiente mein Geld damit, die pikanteren Einzelheiten von Skandalen herauszufinden. Die Schneidergasse war typisch für den Aventin. Gesichtslose Mietskasernen erhoben sich über einer dreckigen, einen Karren breiten Gasse, die sich vom Emporium unten am Tiber hier auf der Suche nach dem Tempel der Ceres hinaufschlängelte, nur um sich dann irgendwo auf den steilen Hügeln über dem Pons Probi zu verlieren. Halbnackte Kinder spielten mit Steinchen neben einer fragwürdig aussehenden Pfütze und würden sich jedwedes Fieber zuziehen, das in diesem Sommer in Rom grassierte. Irgendwo über unseren Köpfen dröhnte eine Stimme und erzählte einem schweigenden Zuhörer eine endlose, nichts sagende Geschichte; es hätte mich nicht gewundert, wenn der arme Mensch durchgedreht und zum Hackmesser gegriffen hätte. Wir standen tief im Schatten, waren uns aber der wabernden Augusthitze nur allzu bewusst. Selbst hier klebten uns die Tuniken am Rücken.
»Ich hab übrigens deinen Brief doch noch bekommen.« Petronius näherte sich schwierigen Themen gerne auf verschlungenen, malerischen Pfaden.
»Welchen Brief?«
»In dem du mir schreibst, dass du Vater geworden bist.«
»Was?«
»War drei Monate unterwegs – nicht schlecht.«
Als Helena und ich vor kurzem mit dem Baby aus Tarraconensis zurückgesegelt waren, hatte die Reise nur acht Tage auf See und zwei weitere über Land von Ostia gedauert. »Das ist doch nicht möglich.«
»Du hast ihn an mich im Wachlokal adressiert«, beschwerte sich Petronius. »Die Schreiber haben ihn eine Woche lang untereinander rumgereicht, und als sie beschlossen, ihn mir auszuhändigen, war ich natürlich nicht da.« Er trug mächtig dick auf – ein deutliches Zeichen für seine Anspannung.
»Ich dachte, es wäre sicherer, den Brief an die Vigiles zu schicken. Woher hätte ich wissen sollen, dass man dich vom Dienst suspendiert hat?«, erwiderte ich. Aber er war nicht in der Stimmung für logische Argumente.
Niemand war auf der Straße. Den größten Teil des Nachmittags hatten wir uns hier völlig allein herumgedrückt. Ich hoffte, dass meine Schwestern und ihre Kinder, die Helena und ich zum Mittagessen eingeladen hatten, um ihnen allen gemeinsam unsere neugeborene Tochter vorzuführen, inzwischen gegangen waren. Als Petro und ich uns rausgeschlichen hatten, war davon noch nichts zu merken gewesen. Helena hatte bereits müde ausgesehen. Ich hätte bleiben sollen.
Ihre eigene Familie hatte den Takt besessen, nicht zu erscheinen, hatte uns aber für einen anderen Tag in dieser Woche zum Abendessen eingeladen. Einer ihrer Brüder – der, mit dem ich einigermaßen auskam – hatte die Nachricht gebracht, mit der ihre edlen Eltern höflich unser Angebot ablehnten, einen kalten Imbiss mit meinen vielzähligen Verwandten in unserer winzigen, erst halbwegs möblierten Wohnung zu teilen. Einige von der Bande hatten bereits versucht, den illustren Camilli gefälschte Kunstwerke zu verkaufen, die diese sich weder leisten konnten noch haben wollten. Der größte Teil meiner Familie war widerwärtig, und allen mangelte es an Taktgefühl. Man hätte lange suchen müssen, um eine größere Horde lautmäuliger, rechthaberischer, zänkischer Idioten zu finden. Da alle meine Schwestern unter ihrem Stand geheiratet hatten, blieb mir keine Chance, Helenas gesellschaftlich höher stehende Familie zu beeindrucken. Außerdem wollten die Camilli gar nicht beeindruckt werden.
»Du hättest eher schreiben können«, sagte Petronius verdrießlich.
»Keine Zeit. Als ich den Brief schrieb, war ich gerade wie ein Verrückter hunderte von Meilen durch Spanien galoppiert, nur um bei meiner Ankunft zu erfahren, dass Helena große Schwierigkeiten mit der Geburt hatte. Ich dachte, ich würde sie verlieren und das Baby auch. Die Hebamme war irgendwo auf halbem Weg nach Gallien, Helena war völlig erschöpft, und die Mädchen, die mit ihr gereist waren, hatten total die Nerven verloren. Ich hab das Kind selbst auf die Welt geholt – und es wird lange dauern, bis ich darüber hinweg bin!«
Petronius erschauderte. Obwohl auch er ein hingebungsvoller Vater dreier Töchter, war er von Natur aus konservativ und empfindsam. Bei der Geburt ihrer Töchter hatte Arria Silvia ihn weggeschickt, bis das Geschrei vorbei war. Das war seine Vorstellung von Familienleben. Von ihm würde ich keine Anerkennung für meine Heldentat bekommen.
»Und ihr habt sie Julia Junilla genannt. Nach beiden Großmüttern? Falco, du hast es wirklich raus, dir kostenlose Kindermädchen zu sichern.«
»Julia Junilla Laeitana«, verbesserte ich.
»Du hast deine Tochter nach einem Wein benannt?« Nun schlich sich doch ein bisschen Bewunderung in seine Stimme.
»Das ist der Bezirk, in dem sie geboren wurde«, erklärte ich stolz.
»Du bist doch ein ganz durchtriebenes Bürschchen.« Jetzt war er neidisch. Wir wussten beide, dass Arria Silvia ihm das nie hätte durchgehen lassen.
»Und wo ist Silvia?«, forderte ich ihn heraus.
Petronius atmete langsam und flach und blickte zum Himmel hinauf. Während er nach den Schwalben Ausschau hielt, fragte ich mich, was eigentlich los war. Die Abwesenheit seiner Frau und seiner Kinder von unserem Fest war bestürzend. Unsere Familien speisten regelmäßig miteinander. Wir hatten sogar gemeinsame Ferien überlebt, obwohl das hart an der Grenze gewesen war.
»Wo ist Silvia?«, sinnierte Petro, als würde die Frage auch ihn interessieren.
»Nun rück schon damit raus.«
»Ach, es ist lächerlich.«
»Du weißt nicht, wo sie ist?«
»Zu Hause, nehme ich an.«
»Sie will nichts mehr von uns wissen?«
Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Silvia hatte mich nie gemocht. Sie war stets der Meinung, ich hätte einen schlechten Einfluss auf Petronius. Was für ein Hohn. Er hatte es schon immer sehr gut allein geschafft, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Trotzdem waren wir irgendwie miteinander ausgekommen, obwohl Helena und ich Silvia nie allzu lange ertragen konnten.
»Sie will nichts mehr von mir wissen«, erklärte er.
Ein Arbeiter kam angeschlurft. Typisch. Er trug eine einarmige Tunika, die über seinen Gürtel hing, und hatte einen alten Eimer in der Hand. Offenbar wollte er den Brunnen säubern, was nach viel Arbeit aussah. Natürlich war er erst am Ende des Arbeitstags aufgetaucht. Er würde die Arbeit unvollendet lassen und nie wiederkommen.
»Lucius, mein Junge«, sagte ich streng, da es so aussah, als müssten wir unser lauschiges Plätzchen bald verlassen, falls es dem Burschen gelingen sollte, den Brunnen wieder zum Laufen zu bringen, »ich kann mir diverse Gründe vorstellen – die meisten davon weiblicher Natur –, warum Silvia von dir die Nase voll hat. Wer ist es?«
»Milvia.«
Ich hatte das als Witz gemeint. Außerdem hatte ich gedacht, dass er das Techtelmechtel mit Balbina Milvia schon vor Monaten aufgegeben hätte. Wenn er seine Sinne beisammen gehabt hätte, dann hätte er gar nicht erst damit angefangen – aber wann hat das einen Mann schon jemals davon abgehalten, einem Mädchen hinterherzujagen?
»Milvia ist Gift für dich, Petro.«
»Das findet Silvia auch.«
Balbina Milvia war etwa zwanzig Jahre alt. Sie war erstaunlich hübsch, frisch wie eine mit Tautropfen benetzte Rosenknospe, ein dunkles, süßes Püppchen, das Petro und ich im Rahmen unserer Arbeit kennen gelernt hatten. Sie war von einer Naivität, die allmählich nachließ, und mit einem Mann verheiratet, der sie vernachlässigte. Außerdem war sie die Tochter eines üblen Gangsters – eines Schwerverbrechers, den Petronius und ich überführt und schließlich aus dem Weg geräumt hatten. Ihr Ehemann Florius hatte halbherzige Pläne, in die schmutzigen Familiengeschäfte einzusteigen. Dabei wurde er von ihrer Mutter Flaccida unterstützt, einer hartherzigen, abgebrühten Schlampe, die es als Freizeitvergnügen ansah, den Tod von ihr unliebsamen Männern zu arrangieren. Früher oder später würde das auch auf ihren Schwiegersohn Florius zutreffen.
Unter diesen Umständen konnte Milvia als jemand betrachtet werden, der Trost brauchte. Als Offizier der Vigiles ging Petronius ein Risiko ein, wenn er ihr diesen Trost spendete. Und als Ehemann von Arria Silvia, die verdammt viel Haare auf den Zähnen hatte, war er völlig verrückt, überhaupt an so etwas zu denken. Er hätte es dem zarten Pflänzchen Milvia überlassen sollen, allein mit ihrem Leben fertig zu werden.
Bis heute hatte ich so getan, als wüsste ich nichts davon. Er hätte sowieso nicht auf mich gehört. Er hatte ja schon nicht auf mich gehört, als wir noch bei der Armee waren und er Augen auf die üppigen keltischen Schönheiten warf, die kraftstrotzende, rothaarige britische Väter hatten, und er hatte nie auf mich gehört, seit wir nach Rom zurückgekehrt waren.
»Bist du in Milvia verliebt?«
Er schien erstaunt über die Frage zu sein. Ich wusste, dass ich mich mit meiner Vermutung, er würde die Sache mit Milvia nicht ernst nehmen, auf sicherem Territorium befand. Ernst nahm Petronius Longus seine Ehe mit einer Frau, die ihm eine ansehnliche Mitgift eingebracht hatte (welche er zurückzahlen müsste, falls sie sich von ihm scheiden ließ), und seine Vaterrolle gegenüber Petronilla, Silvana und Tadia, die ihn anbeteten und die er abgöttisch liebte. Das wussten wir alle, aber es würde nicht leicht sein, Silvia davon zu überzeugen, sollte sie von der süßen kleinen Milvia gehört haben. Und Silvia hatte schon immer gut für sich selbst eintreten können.
»Also, wie sieht’s aus?«
»Silvia hat mich rausgeschmissen.«
»Das ist doch nichts Neues.«
»Das war vor gut zwei Monaten.«
Ich stieß einen leisen Pfiff aus. »Wo wohnst du denn jetzt?« Nicht bei Milvia. Milvia war mit Florius verheiratet. Florius war ein solches Weichei, dass selbst seine Frau keine Lust haben würde, ihn zum Hahnrei zu machen, aber er hielt an Milvia fest, weil ihre Mitgift – zusammengetragen aus den Gewinnen des organisierten Verbrechens – gewaltig war.
»Ich schlafe im Wachlokal.«
»Bin ich denn schon so betrunken? Ich dachte, das ganze Gespräch hätte damit angefangen, dass du vom Dienst suspendiert bist?«
»Das«, gab Petro zu, »macht die Sache reichlich kompliziert, wenn ich mich für ein paar Stunden aufs Ohr hauen will.«
»Martinus hätte seine wahre Freude gehabt.« Martinus war Petros Stellvertreter gewesen. Einer, der sich eng an die Vorschriften hielt – vor allem, wenn sich damit jemand anderem eins auswischen ließ. »Er ist zur Sechsten befördert worden, oder?«
Petro grinste schwach. »Das hab ich selbst eingefädelt.«
»Die arme Sechste! Und wer leitet jetzt die Vierte? Fusculus?«
»Fusculus ist ein Schatz.«
»Er übersieht es, wenn du dich in einer Ecke zusammenrollst?«
»Nein. Er befiehlt mir zu verschwinden. Fusculus denkt, seitdem er Martinus’ Posten übernommen hat, müsse er sich genau wie der aufführen.«
»Jupiter! Also bist du auf der Suche nach einem Schlafplatz?«
»Ich wollte mich bei deiner Mutter einquartieren.« Petronius und Mama waren stets gut miteinander ausgekommen. Sie steckten gern die Köpfe zusammen und zogen über mich her.
»Mama würde dich bestimmt aufnehmen.«
»Ich kann sie nicht darum bitten. Sie hat immer noch Anacrites unter ihren Fittichen.«
»Sprich mir bloß nicht von dem Armleuchter!« Der Untermieter meiner Mutter war mir ein Gräuel. »Meine alte Wohnung steht leer«, schlug ich vor.
»Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest.«
»Sie gehört dir. Vorausgesetzt«, fügte ich listig hinzu, »du verrätst mir, wie du es fertig gebracht hast, zusätzlich zu dem Streit mit deiner Frau auch noch von der Vierten suspendiert zu werden. Wann hat Rubella je einen Anlass gehabt, dir Untreue vorzuwerfen?« Rubella war der Tribun der Vierten Kohorte und Petros direkter Vorgesetzter. Rubella konnte einem zwar schwer auf den Geist gehen, war aber ansonsten gerecht.
»Silvia hatte nichts Besseres zu tun, als Rubella zu petzen, dass ich was mit der Verwandten eines Gangsters laufen habe.«
Tja, daran war er selbst schuld, aber es war schon hart. Petronius Longus hätte sich keine andere Geliebte zulegen können, die ihn gründlicher kompromittieren würde. Sobald Rubella von der Affäre erfuhr, blieb ihm nichts anderes übrig, als Petro vom Dienst zu suspendieren. Petro hatte Glück, wenn er überhaupt seine Stelle behielt. Das musste Arria Silvia gewusst haben. Sie musste sehr wütend gewesen sein, um ihren Lebensunterhalt aufs Spiel zu setzen. Es sah so aus, als würde mein alter Freund auch seine Frau verlieren.
Wir waren zu deprimiert, um noch weiter zu trinken. In der Amphore war sowieso nur noch der Bodensatz übrig. Aber wir waren auch nicht bereit, in dieser trüben Stimmung nach Hause zurückzukehren. Der Arbeiter von der Wasserbehörde hatte uns nicht direkt gebeten, aus dem Weg zu gehen, also blieben wir, wo wir waren, und er musste sich an uns vorbeibeugen, um das Auslaufrohr in der Muschel mit einem unappetitlich aussehenden Schwamm an einem Stock zu reinigen. Als das nicht funktionierte, kramte er ein Drahtstück aus seinem Werkzeugbeutel. Er stocherte und kratzte. Der Brunnen gab ein unanständiges Geräusch von sich. Ein Dreckklumpen platschte heraus. Langsam begann Wasser zu tröpfeln und floss nach weiterem Stochern allmählich stärker.
Petronius und ich richteten uns widerstrebend auf. Der Wasserdruck in Rom ist gering, aber irgendwann würde sich das Becken füllen und dann überfließen, um die Nachbarschaft nicht nur mit dem häuslichen Wasserbedarf zu versorgen, sondern auch in einem endlosen Rinnsal durch den Rinnstein zu laufen und den Straßendreck wegzuschwemmen. Die Schneidergasse hatte das bitter nötig, aber trotz unserer Trunkenheit wollten wir nur ungern in diesem nassen Matsch sitzen.
Petronius spendete dem Arbeiter sarkastischen Applaus.
»Das war alles?«
»Hat sich verstopft, während er abgestellt war, Legat.«
»Warum war er abgestellt?«
»Kam nichts mehr durch das Leitungsrohr. War am Zufluss im Castellum blockiert.«
Der Mann griff in den Eimer, den er mitgebracht hatte, wie ein Fischer, der einen Krebs herauszieht. Er hielt einen geschwärzten Gegenstand an einem klauenartigen Anhängsel hoch, damit wir ihn kurz betrachten konnten – irgendwas Altes, schwer zu Identifizierendes, und doch beunruhigend vertraut. Er warf es zurück in den Eimer, wo es mit einem erstaunlich schweren Platschen aufprallte.
Beinahe hätten wir keine Notiz davon genommen. Wir hätten uns eine Menge Ärger erspart. Doch dann sah mich Petro von der Seite her an.
»Moment mal!«, rief ich.
Der Arbeiter wollte uns beruhigen. »Nur keine Panik, Legat. So was passiert dauernd.«
Petronius und ich traten näher und schauten in den schmierigen Holzeimer. Ein Ekel erregender Geruch stieg davon auf. Der Grund für die Verstopfung im Wasserturm ruhte jetzt auf einem Bett aus Dreck und Schlamm.
Es war eine menschliche Hand.
Kapitel 2
Keiner meiner Verwandten hatte die Höflichkeit besessen zu verschwinden. Es waren sogar noch mehr gekommen. Zum Glück war wenigstens mein Vater nicht dabei. Meine Schwestern Allia und Galla verabschiedeten sich hochnäsig, als ich zur Tür hereinkam, aber ihre Ehemänner Verontius und der verdammte Lollius blieben einfach hocken. Junia saß zusammen mit Gaius Baebius und ihrem tauben Sohn eingequetscht in einer Ecke. Wie üblich machten sie auf klassische Familie, damit sie mit niemandem sprechen mussten. Mico, Victorinas Witwer, grinste blöd und wartete vergeblich darauf, dass ihm jemand sagte, wie gut sich seine entsetzlichen Kinder entwickelt hätten. Famia, der Säufer, war besoffen. Seine Frau Maia war irgendwo in einem der hinteren Zimmer und half Helena beim Aufräumen. Die Gören langweilten sich und traten zu ihrem Vergnügen mit den dreckigen Stiefeln gegen meine frisch gekalkten Wände. Alle Anwesenden reagierten erfreut, als sie bemerkten, dass ich mich nur mit Mühe zusammenriss.
»Hallo, Mama. Wie ich sehe, hast du deinen Laufburschen mitgebracht.« Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich ein paar Schläger engagiert, nur um den Mann rauszuschmeißen. Ein paar Gladiatoren, die sich was dazuverdienen wollten, mit der Anweisung, ihm den Einlass zu verwehren und ihm als Zugabe noch beide Arme zu brechen.
Meine Mutter warf mir einen finsteren Blick zu. Sie war ein kleines schwarzäugiges Energiebündel, das wie eine Barbarentruppe über die Märkte stürmen konnte. Auf ihrem Schoß saß meine Tochter, die sofort zu brüllen begann, als sie mich sah. Julias Kummer beim Anblick ihres Vaters war nicht der Grund für Mamas finstere Blicke; ich hatte ihren Liebling beleidigt.
Und dieser Liebling war niemand anderes als ihr Untermieter Anacrites. Er sah aalglatt aus, war aber ein durch und durch mieses Schwein. Er arbeitete für den Kaiser, war dessen Oberspion. Außerdem war er bleich, schweigsam und nur noch ein Schatten seiner selbst nach einer schweren Kopfverletzung, die ihn leider nicht ins Jenseits befördert hatte. Meine Mutter hatte ihm das Leben gerettet. Deshalb fühlte sie sich jetzt bemüßigt, ihn wie eine Art Halbgott zu behandeln, der es wert gewesen war, gerettet zu werden. Er ließ das alles wohlgefällig über sich ergehen. Ich biss die Zähne zusammen.
»Du könntest Anacrites ruhig etwas freundlicher begrüßen, Marcus.« Ihn begrüßen? Er war nicht mein Freund. Er hatte mich vor einiger Zeit umbringen lassen wollen, aber das war natürlich nicht der Grund, warum ich ihn verabscheute. Innerhalb meines Freundeskreises gab es einfach keinen Platz für einen verschlagenen, gefährlichen Drahtzieher mit der Moral eines räudigen Hundes. Ich nahm das brüllende Baby auf den Arm. Sofort hörte die Kleine auf zu schreien. Niemand war beeindruckt. Sie gurgelte auf eine Weise an meinem Ohr, die bedeutete, dass sie mir gleich auf die Tunika kotzen würde, wie ich aus Erfahrung wusste. Ich legte sie in die hübsche Wiege, die Petronius ihr gezimmert hatte, und hoffte, so tun zu können, als würde mich ihr Gespucke überraschen. Mama setzte gleich die Wiege in Bewegung, und die Krise schien vorüberzugehen.
»Hallo, Falco!«
»Anacrites! Sie sehen ja furchtbar aus«, sagte ich fröhlich. »Zurück aus der Unterwelt, weil Sie Charons Nachen eingesaut haben?« Ich war entschlossen, ihm sofort einen Dämpfer zu verpassen, bevor er sich an mich ranmachen konnte. »Wie steht’s um die Spionage? Die Spatzen auf dem Palatin pfeifen von allen Dächern, dass sich Claudius Laeta um Ihren Posten beworben hat.«
»Aber nein. Laeta schleicht nur in den Kulissen herum.« Ich grinste wissend. Claudius Laeta war ein ehrgeiziger Palastbeamter, der hoffte, Anacrites und das bestehende Spionagenetzwerk in seine eigene Abteilung integrieren zu können. Die beiden waren in einen Machtkampf verwickelt, der mich höchstlich amüsierte – solange ich mich da raushalten konnte.
»Der arme Laeta!«, meinte ich verächtlich. »Hätte sich nicht auf diese spanische Angelegenheit einlassen sollen. Ich musste dem Kaiser einen Bericht abliefern, der Laeta in ziemlich schlechtem Licht dastehen lässt.«
Anacrites’ Augen wurden schmal. Auch er war in die spanische Angelegenheit verwickelt gewesen und fragte sich wohl, was ich Vespasian über ihn berichtet hatte. Da er immer noch Rekonvaleszent war, stand ihm plötzlich der Schweiß auf der Stirn. Er war beunruhigt. Das gefiel mir.
»Anacrites ist noch nicht gesund genug, um die Arbeit wieder aufzunehmen.« Mama ergötzte uns mit Einzelheiten, bei denen er sich vor Verlegenheit wand. Ich bedauerte ihn gebührend und ließ ihn wissen, wie begeistert ich über seine furchtbaren Kopfschmerzen und die Verdauungsbeschwerden war. Ich versuchte weitere Einzelheiten aus ihr herauszulocken, aber Mama kapierte rasch, worauf ich hinauswollte. »Er ist für unbestimmte Zeit auf Krankenurlaub, mit Zustimmung des Kaisers.«
»Oho!«, spottete ich, als hielte ich das für den ersten Schritt zur erzwungenen Pensionierung. »Manche Leute erleiden nach einem kräftigen Schlag auf den Kopf eine Persönlichkeitsveränderung.« Das schien bei ihm leider nicht der Fall zu sein. Wie schade, denn jede Veränderung in Anacrites’ Persönlichkeit hätte bei ihm nur von Vorteil sein können.
»Ich habe Anacrites mitgebracht, damit ihr beide euch unterhalten könnt.« Mir wurde ganz kalt. »Jetzt, da du Vater bist, musst du dir einen anständigen Beruf zulegen«, belehrte mich meine Mutter. »Du brauchst einen Partner, jemand, der dir ein paar Tipps zu geben vermag. Anacrites kann dir auf die Beine helfen – an Tagen, an denen es ihm gut genug geht.«
Nun war ich derjenige, der sich krank fühlte.
Lucius Petronius, mein treuer Freund, hatte meinen Schwägern in einer Ecke heimlich die abgehackte Hand aus dem Castellum gezeigt. Diese Perversen waren immer für Sensationelles zu haben.
»Pah!«, prahlte Lollius. »Das ist doch nichts. Wir fischen jede Woche noch viel Schlimmeres aus dem Tiber ...«
Die Kinder meiner Schwestern hatten den grässlichen Gegenstand entdeckt und drängten sich vor, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Petro wickelte die Hand hastig in einen Lappen; hoffentlich war es keine von unseren neuen spanischen Servietten. Nux, der beherzte Straßenköter, der mich adoptiert hatte, fand das Päckchen äußerst interessant und schnappte danach. Alle versuchten es zu retten. Dabei rutschte die Hand aus dem Lappen. Sie fiel zu Boden und wurde von Marius in Sicherheit verbracht, dem äußerst ernsthaften ältesten Sohn meiner Schwester Maia, die ausgerechnet in diesem Moment ins Zimmer kam. Als sie ihren normalerweise so vernünftigen Achtjährigen an dem schon ziemlich verwesten Relikt schnüffeln sah, offenbar mit freundlicher Zustimmung von Lucius Petronius, bediente sich meine Lieblingsschwester einer Sprache, die ich ihr nie zugetraut hätte. Das meiste davon beschrieb Petronius, und der Rest war mir gewidmet.
Maia schnappte sich die Flasche besten Olivenöls, die ich ihr aus Baetica mitgebracht hatte, und scheuchte Famia, Marius, Ancus, Cloelia und die kleine Rhea schleunigst aus unserer Wohnung.
Nun ja, zumindest hatte wir jetzt mehr Platz.
Während alle anderen kicherten und verschlagen grinsten, warf Petro den Arm um meine Schultern und begrüßte meine Mutter liebevoll: »Junilla Tacita! Wie Recht Sie damit haben, dass sich Falco hinter seine Arbeit klemmen muss. Wie es der Zufall will, hatten wir beide draußen genau darüber gerade ein langes Gespräch. Sie wissen ja, wie nutzlos er wirken kann, aber er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Er muss sein Büro einrichten, ein paar lukrative Aufträge annehmen und sich einen Ruf erwerben, damit das Geld weiterhin fließt.« Das klang gut. Ich wunderte mich, warum ich noch nicht darauf gekommen war. Doch Petronius war mit seinem Sermon noch nicht fertig. »Wir haben die ideale Lösung gefunden. Solange ich bei den Vigiles pausiere, werde ich in seine alte Wohnung ziehen und ihm selbst als Partner zur Seite stehen.«
Ich strahlte Anacrites wohlmeinend an. »Sie kommen leider ein Ideechen zu spät. Der Posten ist schon vergeben, alter Freund. So ein Pech aber auch!«
Kapitel 3
Als wir das Päckchen auf den Tisch des Schreibers legten, griff Fusculus begierig danach. Er hatte schon immer einen gesegneten Appetit und dachte, wir hätten ihm was Leckeres mitgebracht. Wir ließen ihn das Päckchen öffnen.
Im ersten Augenblick hielt er den Inhalt für eine interessante neue Art von Wurst, dann zuckte er mit einem Aufschrei zurück.
»Igitt! Wo habt ihr beiden kindischen Bettler denn wieder gespielt? Zu wem gehört die?«
»Wer weiß?« Petronius hatte sich inzwischen an die abgehackte Hand gewöhnt. Während der fidele Fusculus immer noch bleich aussah, konnte Petro sich blasiert geben. »Kein Siegelring mit dem Namen eines Geliebten, keine hübsche keltische Tätowierung – das Ding ist so aufgequollen, dass man noch nicht mal sagen kann, ob es von einer Frau oder einem Mann stammt.«
»Von einer Frau«, meinte Fusculus. Er bildete sich etwas auf seine berufliche Erfahrung ein. Die Hand, an der vier Finger fehlten, war so vom Wasser verunstaltet, dass es keinen ersichtlichen Grund für seine Annahme gab.
»Was macht die Arbeit?«, fragte Petronius sehnsuchtsvoll. Ich merkte schon, dass sein Engagement als mein Geschäftspartner minimal sein würde.
»Lief alles bestens, bis ihr zwei aufgetaucht seid.«
Wir befanden uns im Wachlokal der Vierten Kohorte. Der größte Teil diente der Unterbringung von Geräten zur Feuerbekämpfung, was die Hauptbeschäftigung der Vigiles ist. Seile, Leitern, Eimer, große Grasmatten, Breithacken und Äxte sowie die Wasserpumpe standen alle in Bereitschaft. Es gab eine kleine kahle Zelle, in die man Einbrecher und Brandstifter werfen konnte, und einen Aufenthaltsraum, in dem die Diensthabenden würfeln oder die Einbrecher und Brandstifter windelweich prügeln konnten, falls das mehr Spaß versprach. Beide Räume waren um diese Zeit normalerweise leer. Die Arrestzelle wurde nachts gebraucht; am Morgen wurden die jämmerlichen Insassen entweder mit einer Verwarnung entlassen oder zu einem formellen Verhör ins Büro des Tribuns gebracht. Da die meisten Verbrechen im Schutz der Dunkelheit verübt wurden, war während des Tages nur eine Rumpfmannschaft im Dienst. Die Männer waren unterwegs, um Verdächtige aufzuspüren, oder sie saßen auf einer Bank in der Sonne.
Aber man darf sich dadurch nicht täuschen lassen. Das Leben der Vigiles ist rau und gefährlich. Die meisten von ihnen waren Staatssklaven gewesen. Sie hatten sich zum Dienst verpflichtet, weil sie, falls sie überlebten, schließlich als Bürger in Ehren entlassen werden würden. Die offizielle Dienstzeit betrug sechs Jahre. In den Legionen dienten die Soldaten mindestens zwanzig Jahre. Es gab also einen guten Grund, sich zu den Vigiles zu melden, und nicht viele erreichten das Ende ihrer Dienstzeit.
Tiberius Fusculus, der Beste von Petros handverlesenen Männern und jetzt Ersatzmann für seinen Chef, betrachtete uns wachsam. Er war ein rundlicher, fröhlicher Bursche mit dünnem Haar, außerordentlich gesund und mit einem scharfen Verstand gesegnet. Sein größtes Interesse galt der Verbrechenstheorie, aber aus der Art, wie er die aufgequollene Hand von sich wegschob, konnten wir entnehmen, dass er nicht vorhatte, die Sache weiter zu verfolgen, wenn er sie unter »Kein Aufklärungsbedarf« ablegen konnte.
»Und was soll ich eurer Meinung nach damit machen?«
»Den Rest dazu finden?«, schlug ich vor. Fusculus schnaubte.
Petronius betrachtete das grässliche Ding. »Sie hat offensichtlich lange Zeit im Wasser gelegen.« Sein Ton war entschuldigend. »Man sagte uns, sie hätte ein Rohr im Castellum an der Aqua Appia verstopft, aber sie hätte auch von irgendwo anders dahin gelangen können.«
»Die meisten Leichen werden eingeäschert«, sagte Fusculus. »Ein Hund könnte eine menschliche Hand an einer Kreuzung in einem Dorf in der Provinz ausbuddeln, aber in Rom werden Leichen nicht im Ganzen vergraben.«
»Das riecht nach einem Verbrechen«, stimmte Petro zu. »Wenn jemand, vermutlich eine Frau, umgebracht worden ist, warum hat es dann keinen Aufschrei gegeben?« »Weil Frauen dauernd umgebracht werden«, erklärte Fusculus hilfsbereit. »Von ihren Ehemännern oder Liebhabern, und wenn sie dann nüchtern wieder aufwachen, brechen die Männer entweder vor Gewissensbissen zusammen und rennen gleich hierher, um ein Geständnis abzulegen, oder sie finden den Frieden und die Ruhe so angenehm, dass sie nicht daran denken, ein Geschrei zu veranstalten.«
»Alle Frauen haben neugierige Freundinnen«, hielt Petro dagegen. »Viele haben Mütter, die sich ständig einmischen. Manche sorgen für alte Tanten, die auf die Straße laufen und die Esel erschrecken würden, wenn man sie sich selbst überließe. Und was ist mit den Nachbarn?«
»Die Nachbarn melden die Sache«, erwiderte Fusculus. »Also gehen wir hin und fragen den Ehemann. Der erzählt uns, dass die Nachbarn Gift spritzende Neider seien, die ihm nur eins auswischen wollten, und dann behauptet er, seine Frau sei zu Besuch bei Verwandten in Antium. Wir sagen, sie soll doch nach ihrer Rückkehr bitte bei uns vorbeikommen, um das zu bestätigen. Wir notieren die Einzelheiten. Sie kommt nie, aber wir haben keine Zeit, die Angelegenheit weiter zu verfolgen, weil inzwischen zwanzig andere Sachen passiert sind. Außerdem hat sich der Ehemann derweil längst aus dem Staub gemacht.« Er fügte zwar nicht hinzu, dass er ihm Glück wünschte, aber sein Ton war viel sagend genug.
»Erteil mir hier keine Abfuhr. Ich gehöre schließlich nicht zur Plebs.« Petronius entdeckte, wie sich die Plebs fühlte, wenn sie in sein Büro kam. Er klang ärgerlich, wahrscheinlich auf sich selbst, weil er nicht darauf vorbereitet gewesen war.
Fusculus blieb weiterhin vollkommen höflich. Er hatte fünfzehn Jahre lang die Plebs abgewiesen. »Wenn hier ein Verbrechen vorliegt, dann kann es überall verübt worden sein, und unsere Möglichkeiten, den Rest der Leiche zu finden, sind gleich null.«
»Du bist nicht scharf auf die Sache«, erriet ich.
»Gut erkannt.«
»Das Beweisstück tauchte auf dem Aventin auf.«
»Auf dem Aventin taucht aller mögliche Dreck auf«, schnaubte Fusculus verächtlich, beinahe so, als würde er auch uns in diese Kategorie einordnen. »Das ist kein Beweisstück, Falco. Beweisstücke sind materielle Objekte, die ein brauchbares Licht auf einen bekannten Vorfall werfen und die Strafverfolgung ermöglichen. Wir haben keine Ahnung, wo diese einsame Faust herkommt, und ich wette, wir werden es nie erfahren. Wenn du mich fragst«, fuhr er fort und war offenbar der Ansicht, eine hervorragende Lösung gefunden zu haben, »muss das Ding die Wasserzufuhr verschmutzt haben, also ist die Wasserbehörde dafür zuständig, alle anderen Körperteile zu finden. Ich werde den Fund melden. Dann liegt es beim Kurator der Aquädukte, etwas zu unternehmen.«
»Sei doch nicht blöd«, wies ihn Petro zurecht. »Wann hat jemand von der Wasserbehörde denn schon mal irgendwelche Initiative gezeigt? Die sind doch alle viel zu sehr mit Schiebungen und Bestechungen beschäftigt.«
»Ich kann ihnen ja drohen, einige von ihnen bloßzustellen. Irgendwelche Anzeichen, dass du bald wieder zur Arbeit kommst, Chef?«
»Frag Rubella«, knurrte Petro, obwohl ich wusste, dass der Tribun darauf bestanden hatte, Petronius müsse die Gangstertochter fallen lassen, bevor er sich wieder bei der Kohorte blicken ließ. Falls mir nicht irgendwas entgangen war, hatte Petro die Abschiedsrede für Milvia immer noch nicht einstudiert.
»Wie ich hörte, bist du bei Falco ins Geschäft eingestiegen?« Für einen sonst so umgänglichen Mann wirkte Fusculus plötzlich ziemlich steif. Was mich nicht wunderte. Privatermittler haben bei den meisten Römern nicht gerade einen guten Ruf, aber bei den Vigiles sind wir besonders schlecht angesehen. Die Kohorten haben Listen mit unseren Namen, damit sie während des Essens an unsere Tür klopfen und uns zu völlig überflüssigen Verhören abführen können. Staatsbeamte können nun mal keine Leute leiden, die nach den Ergebnissen bezahlt werden.
»Ich helfe ihm nur informell aus. Warum – vermisst du mich etwa?«, fragte Petro.
»Nein, ich wollte nur wissen, wann ich mich für deinen Posten bewerben kann.« Das war spaßig gemeint, aber wenn es Petronius Longus nicht gelang, sein Privatleben schnellstens auf die Reihe zu bringen, konnte sich der Spaß bald in bitteren Ernst verwandeln. Doch es hatte keinen Zweck, ihm das vorzuhalten. Petronius war dickköpfig. Er hatte immer die Tendenz gehabt, gegen Autoritäten zu rebellieren. Das war der Grund, warum wir Freunde waren.
Die Vierte besaß eine grausige Sammlung, die sie der Bevölkerung für einen halben Denarius Eintritt zeigte, um Geld für die Witwen der Kohortenmitglieder zu beschaffen. Wir überließen Fusculus die Hand für die Sammlung und sagten uns, damit sei es nicht mehr unser Problem. Petronius und ich machten uns auf den Weg über den Circus Maximus zum Forum, wo wir eine Verabredung mit einer Wand hatten.
Kapitel 4
Wenn ich bei klarem Verstand gewesen wäre, hätte ich die Partnerschaft beendet, während wir noch vor der Wand standen. Ich hätte Petro sagen sollen, dass ich zwar dankbar für sein Angebot sei, es für den Erhalt unserer Freundschaft aber besser wäre, wenn ich ihn einfach nur in meiner Wohnung hausen ließe. Ich würde mir jemand anderen als Partner suchen. Selbst wenn das hieß, dass ich mich mit Anacrites zusammentun musste.
Die Omen waren von Anfang an schlecht. Meine Methode bestand gewöhnlich darin, zum Fuß des Kapitols zu marschieren, rasch die Reklame von jemand anderem am besten Platz des Tabulariums abzuwischen und dann mit ein paar flotten Kreidestrichen das hinzuschreiben, was mir gerade in den Sinn kam. Petronius Longus ging die Sache viel ernsthafter an. Er hatte sich ein Konzept gemacht, hatte verschiedene Variationen des Textes aufgeschrieben (wie ich an seinen Notiztafeln sah) und gedachte, seine Lieblingsversion in akribischen Buchstaben anzubringen, umgeben von einem Rahmen in einem verschlungenen griechischen Muster.
»Hat gar keinen Zweck, sich solche Mühe zu geben.«
»Sei doch nicht so gleichgültig, Falco.«
»Die Ädilen wischen es sowieso ab.«
»Wir müssen es richtig machen.«
»Nein, wir müssen aufpassen, dass wir nicht erwischt werden.« Graffitischmierereien an nationalen Monumenten mag zwar nach den Zwölf Tafeln nicht als Verbrechen gelten, aber eine Prügelstrafe ist allemal drin.
»Ich mach das schon.«
»Lass mich meinen Namen hinschreiben und was von Scheidung und Wiederbeschaffung gestohlener Kunstgegenstände erwähnen.«
»Mit Kunst geben wir uns nicht ab.«
»Das ist aber meine Spezialität.«
»Deswegen verdienst du ja auch nie was.«
Da war was dran. Leute, die ihre Kunstschätze verloren hatten, sträubten sich meist, noch mehr Geld auszugeben. Außerdem waren sie oft Geizhälse. Was der Grund war, warum sie ihr kostbares Gut nicht von vornherein mit anständigen Schlössern und aufmerksamen Wachen gesichert hatten.
»Na gut, Pythagoras, wie lautet deine Philosophie? Was gedenkst du denn den Leuten Aufsehen Erregendes anzubieten?«
»Ich werde keine Beispiele nennen. Wir müssen ihnen den Mund wässrig machen, andeuten, dass wir alles übernehmen. Wenn dann die Klienten kommen, können wir die Nieten aussortieren und an irgendeines dieser grünen Bürschchen in den Saepta Julia verweisen. Wir werden uns Didius Falco & Partner nennen.«
»Ach, du bleibst also anonym?«
»Muss ich.«
»Du willst deinen alten Posten immer noch zurückhaben?«
»Ich habe nie gesagt, dass dem nicht so ist.«
»Ich wollt’s ja nur wissen. Arbeite bloß nicht mit mir, wenn dir mein Leben nicht passt.«
»Halt doch mal die Klappe. Falco & Partner: Ausgewählte Dienstleistungen für anspruchsvolle Klienten.«
»Klingt wie ein billiges Bordell.«
»Hab Vertrauen, Junge.«
»Oder ein überteuerter Schuster: Falco & Partner: Probieren Sie unsere dreifach genähten Kalbslederstiefeletten. Gern getragen von dekadenten Nichtstuern, der schiere Luxus in der Arena und hervorragend geeignet für jede Art von Orgie ...«
»Du bist schlimmer als ein räudiger Hund, Falco.«
»Subtilität ist ja gut und schön, aber wenn du nicht wenigstens zart andeutest, dass wir Nachforschungen durchführen und dafür auch ganz gerne bezahlt werden möchten, kriegen wir keine Arbeit.«
»Hör zu – Unter bestimmten Umständen ist eine persönliche Betreuung durch die Partner möglich. Das deutet darauf hin, dass wir eine solide Firma mit vielen Angestellten sind, die sich um den Kleinkram kümmern; wir können jedem Klienten damit schmeicheln, dass er besonders bevorzugt wird – wofür er natürlich den Höchstsatz zahlt.«
»Du hast wirklich ausgefallene Ansichten über die Arbeit als Freiberufler.« Er genoss es in vollen Zügen. »Hör mal, Schreiber, du hast immer noch nicht gesagt ...«
»Doch, hab ich. Steht alles in meinem Entwurf. Spezialisierte Nachforschungen. Und dann schreib ich unten in kleineren Buchstaben Vorbesprechungen werden nicht in Rechnung gestellt. Das lockt sie an, weil sie denken, sie kriegen was umsonst, deutet aber gleichzeitig auf unser hohes Honorar für den Rest hin.«
»Meine Honorare waren stets angemessen.«
»Tja, und was hast du davon? Die Hälfte der Zeit lässt du dich dazu überreden, für lau zu arbeiten. Du bist zu weich, Falco.«
»Offenbar ist damit Schluss.«
»Mach mal ein bisschen Platz. Steh mir nicht im Weg.«
»Du übernimmst einfach das Steuer«, warf ich ihm vor.
»Es ist mein Geschäft, aber du drängst dich rein.«
»Dafür sind Partner da«, sagte Petro grinsend.
Ich erklärte, ich hätte noch eine andere Verabredung.
»Lass dich nicht aufhalten«, murmelte er, völlig in seine Aufgabe vertieft.
Kapitel 5
Zu meiner nächsten Verabredung stand eine formelle Eskorte bereit: meine Freundin, das Baby und der Hund Nux.
Ich war spät dran. Sie saßen auf den Stufen des Saturntempels. Das war ein sehr belebter Ort am Nordende des Forums auf der Seite des Palatin. Sie waren verschwitzt. Das Baby wollte gestillt werden, der Hund bellte jeden Vorübergehenden an, und Helena Justina hatte diesen übermäßig geduldigen Gesichtsausdruck aufgesetzt. Mir stand also noch was bevor.
»Entschuldige. Ich war noch in der Basilica, um die Anwälte wissen zu lassen, dass ich wieder in der Stadt bin. Könnte mir ab und an das Zustellen von Vorladungen einbringen.«
Helena dachte, ich sei in einer Weinschenke gewesen. »Lass nur«, sagte sie. »Mir ist schon klar, dass die Registrierung deines erstgeborenen Kindes in deinem geschäftigen Leben einen sehr niedrigen Stellenwert hat.«
Ich streichelte den Hund, küsste Helenas warme Wange und kitzelte das Baby. Diese überhitzte, gereizte kleine Gruppe war meine Familie. Alle hatten kapiert, dass meine Rolle als Haushaltungsvorstand darin bestand, sie an unbequemen Orten warten zu lassen, während ich in Rom herumtrödelte und mein Leben genoss.
Zum Glück hob sich Helena ihre Kommentare auf, bis sie genügend zusammenhatte, um mir einen ordentlichen Anschiss zu verpassen. Sie war ein großer, wohlgerundeter, dunkelhaariger Traum mit tiefbraunen Augen, bei deren zärtlichstem Ausdruck ich wie ein Honigkuchen dahinschmelze, den man auf einer sonnigen Fensterbank hat liegen lassen. Selbst der vernichtende Blick, den sie mir jetzt zuwarf, machte mich ganz benommen. Eine feurige verbale Balgerei mit Helena war mein größtes Vergnügen, das nur noch von einem Schäferstündchen übertroffen werden konnte.
Der Tempel des Saturn liegt zwischen dem Tabularium und der Basilica Julia. Ich hatte damit gerechnet, dass Helena Justina beim Tempel auf mich warten würde, also hatte ich mich, nachdem ich Petro verlassen hatte, hinten über die Via Nova herumgedrückt. Ich hasse Anwälte, aber ihre Aufträge konnten den Unterschied zwischen Überleben und Untergang bedeuten. Meine finanzielle Situation war, um ehrlich zu sein, zum Verzweifeln. Ich sagte nichts, um Helena nicht zu beunruhigen; sie blinzelte mich misstrauisch an.
Ich versuchte mich unter den Augen der Öffentlichkeit in meine Toga zu winden, während Nux an den hinderlichen Falten des Wollstoffs hochsprang und es für ein Spiel hielt, das ich extra für sie veranstaltete. Helena rührte keinen Finger, um mir zu helfen.
»Ich brauche das Kind nicht zu sehen«, seufzte der Schreiber des Zensors. Er war ein Staatssklave, und sein Los war trübsinnig. Aufgrund des ständigen Stroms von Leuten, die durch sein Büro kamen, war er dauernd erkältet. Seine Tunika hatte vor ihm einem viel größeren Mann gehört, und bei der Auswahl des Barbiers, der ihn rasiert hatte, hatte er nicht das große Los gezogen. Seine Augen hatten einen leicht parthischen Schnitt, was ihm in Rom bestimmt nicht viele Freunde eingebracht hatte.
»Genauso wenig wie die Mutter, nehme ich an?«, schnaubte Helena.
»Manche kommen gern mit.« Er konnte auch taktvoll sein, wenn ihn das vor Beschimpfungen bewahrte.
Ich setzte Julia Junilla auf seinen Schreibtisch, wo sie mit den Beinen strampelte und gurgelte. Sie wusste, wie sie sich bei den Leuten beliebt machte. Sie war jetzt drei Monate alt und sah meiner Meinung nach allmählich richtig niedlich aus. Sie hatte das zerknautschte, ungeformte Aussehen verloren, mit dem die Neugeborenen ihre frisch gebackenen Eltern ängstigen. Wenn sie zu sabbern aufhörte, war sie nur noch einen Schritt davon entfernt, allerliebst zu sein.
»Bitte entfernen Sie das Baby«, murmelte der Schreiber taktvoll, aber nicht freundlich. Er glättete eine Schriftrolle aus dickem Pergament, bereitete eine minderwertigere vor (unsere Kopie) und machte sich daran, seine Feder in ein Fass mit Gallapfeltinte zu stecken. Er hatte rote und schwarze Tinte; für uns verwandte er die schwarze. Ich fragte mich, was wohl der Unterschied war.
Er tauchte die Feder ein und streifte sie dann am Rand des Tintenfasses ab, um die überflüssige Tinte zu entfernen. Seine Bewegungen waren präzise und formell. Helena und ich beschäftigten uns mit unserer Tochter, während er das Datum des Eintrags notierte, der ihr ihren bürgerlichen Status und ihre Rechte verleihen würde. »Name?«
»Julia Junilla.«
Er sah mich scharf an. »Ihr Name!«
»Marcus Didius Falco, Sohn des Marcus. Bürger von Rom.« Das beeindruckte ihn nicht. Er musste gehört haben, dass die Didii eine Bande streitsüchtiger Rüpel waren. Unsere Vorfahren haben Romulus vielleicht Ärger gemacht, aber seit Jahrhunderten Anstoß erregend zu sein gilt nicht als Stammbaum.
»Rang?«
»Plebejer.« Er hatte es bereits hingeschrieben.
»Adresse?«
»Brunnenpromenade, abgehend von der Via Ostiana auf dem Aventin.«
»Der Name der Mutter?« Er wandte sich immer noch an mich.
»Helena Justina«, erwiderte die Mutter forsch.
»Name des Vaters der Mutter?« Der Schreiber richtete die Fragen weiter an mich, und Helena knirschte hörbar mit den Zähnen. Warum ihren Atem verschwenden? Sie ließ den Mann seine Arbeit tun.
»Decimus Camillus Verus.« Ich merkte, dass ich aufgeschmissen war, falls der Schreiber den Namen des Vaters ihres Vaters wissen wollte.
Helena merkte es auch. »Sohn des Publius«, murmelte sie und machte deutlich, dass diese Bemerkung nur mir persönlich galt und der Schreiber sich verpissen konnte. Er schrieb es nieder, ohne auch nur danke zu sagen.
»Rang?«
»Patrizier.«
Wieder sah der Schreiber auf. Diesmal gestattete er sich, uns beide zu mustern. Das Büro des Zensors war für die öffentliche Moral verantwortlich. »Und wo wohnen Sie?«, wollte er wissen, direkt an Helena gewandt.
»In der Brunnenpromenade.«
»Nur zur Überprüfung«, murmelte er und senkte den Kopf.
»Sie wohnt bei mir«, erklärte ich unnötigerweise.
»Offensichtlich.«
»Was dagegen?«
Wieder hob der Schreiber seinen Blick von dem Dokument. »Sie sind sich der Konsequenzen zweifellos beide vollkommen bewusst.«
Aber ja. Und in einem Jahrzehnt oder zwei würde es Tränen und Wutausbrüche geben, wenn wir das unserem Kind erklären mussten.
Helena Justina war die Tochter eines Senators, und ich stammte aus der Plebs. Sie war mit einem Mann aus ihrer Gesellschaftsschicht unglücklich verheiratet gewesen und hatte nach der Scheidung das Glück oder Unglück gehabt, mich kennen zu lernen und sich in mich zu verlieben. Nach ein paar anfänglichen Fehlversuchen hatten wir beschlossen zusammenzuleben. Und zwar auf einer permanenten Basis. Durch diese Entscheidung waren wir, rein rechtlich gesehen, verheiratet.
Doch vom gesellschaftlichen Standpunkt aus waren wir ein Skandal. Wenn der edle Camillus Verus beschlossen hätte, sich über den Raub seiner Tochter aufzuregen, hätte mein Leben äußerst schwierig werden können. Und ihres auch.
Unsere Beziehung war unsere Angelegenheit, aber Julias Ankunft forderte eine Veränderung dieses Status. Immer wieder wurden wir gefragt, wann denn nun die Heirat stattfinden würde, aber es gab keinen Anlass für Formalitäten. Wir hatten beide die Freiheit zu heiraten, und wenn wir uns entschieden zusammenzuleben, war damit dem Gesetz Genüge getan. Wir hatten überlegt, ob wir es leugnen sollten. In dem Fall hätten unsere Kinder den gesellschaftlichen Rang ihrer Mutter übernommen, obwohl das nur ein theoretischer Vorteil gewesen wäre. Solange ihrem Vater die Ehrentitel fehlten, auf die er sich bei öffentlichen Gelegenheiten berufen konnte, würden sie in demselben Sumpf feststecken wie ich.
Daher hatten wir bei unserer Rückkehr aus Spanien beschlossen, unsere Stellung öffentlich zu machen. Helena hatte sich damit auf meine Ebene hinabbegeben. Sie war sich im Klaren, was sie tat, sie kannte meinen Lebensstil und war sich der daraus resultierenden Konsequenzen bewusst. Unseren Töchtern waren gute Ehen verwehrt. Unsere Söhne hatten keine Möglichkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, wie sehr sich auch ihr edler Großvater, der Senator, wünschen würde, dass sie sich zur Wahl stellten. Die Oberschicht würde sich ihnen verschließen, während die niederen Ränge sie vermutlich als Außenseiter ebenso ablehnen würden.
Um Helenas und unserer Kinder willen hatte ich es als meine Pflicht betrachtet, meine Stellung zu verbessern. Ich hatte versucht, in den mittleren Rang aufzusteigen, was die Unannehmlichkeiten verringert hätte. Der Versuch war kläglich gescheitert. Ich hatte nicht vor, noch einmal einen Narren aus mir zu machen. Trotzdem waren alle anderen davon überzeugt, dass ich es tun sollte.
Der Schreiber des Zensors musterte mich, als wären ihm plötzlich Zweifel gekommen. »Haben Sie Ihre Angaben für den Zensus gemacht?«
»Noch nicht.« Wenn irgend möglich, würde ich das vermeiden. Der Zweck von Vespasians neuem Zensus bestand nicht darin, aus bürokratischer Neugier eine Bevölkerungszählung durchzuführen, sondern Besitztümer für die Steuer zu veranlagen. »Ich war im Ausland.«
Er warf mir diesen Blick zu, der so viel besagte wie: Das behaupten sie alle. »Militärdienst?«
»Spezialeinsatz.« Da er das nicht in Frage stellte, fügte ich geheimnisvoll hinzu: »Genaueres darf ich Ihnen nicht sagen.« Es schien ihn immer noch nicht zu interessieren. »Sie haben die Angaben also noch nicht gemacht? Sind Sie der Familienvorstand?«
»Ja.«
»Ihr Vater ist tot?«
»Leider nicht.«
»Sie sind aus der Autorität Ihres Vaters entlassen?«
»Ja«, log ich. Papa würde nicht im Traum daran denken, etwas so Zivilisiertes zu tun. Mir war das völlig schnuppe.
»Didius Falco, können Sie nach bestem Wissen und Gewissen sagen, dass Sie aus eigenem Antrieb im rechtsgültigen Stand der Ehe leben?«
»Ja.«
»Danke.« Sein Interesse war rein oberflächlich. Er hatte nur gefragt, um sich abzusichern.
»Sie sollten mir dieselbe Frage stellen«, sagte Helena schnippisch.
»Nur Familienvorstände«, erklärte ich und grinste sie an. Sie betrachtete ihre Rolle in unserer Familie als eine zumindest gleichgestellte. Das tat ich auch, da ich wusste, was gut für mich war.
»Name des Kindes?« Die Gleichgültigkeit des Schreibers deutete darauf hin, dass er ständig mit so unpassenden Paaren wie uns zu tun hatte. Rom galt als moralischer Sumpf, daher mochte es tatsächlich stimmen – obwohl wir noch niemandem begegnet waren, der dasselbe Risiko so offen auf sich nahm. Zum einen hängen die meisten Frauen an dem Luxus, in dem sie geboren werden. Und zum anderen werden die meisten Männer, die sie von zu Hause fortzulocken versuchen, von Trupps sehr großer und kräftiger Sklaven zusammengeschlagen.
»Julia Junilla Laeitana«, verkündete ich stolz.
»Das schreibt sich ...?«
»J-U-«
Er sah mich schweigend an.
»L«, sagte Helena geduldig, als wäre sie sich bewusst, dass der Mann, mit dem sie zusammenlebte, ein Idiot war, »A-E-I-T-A-N-A.«
»Drei Namen? Und es ist ein Mädchen?« Die meisten hatten nur zwei.
»Sie braucht einen guten Start ins Leben.« Warum hatte ich nur das Gefühl, mich entschuldigen zu müssen? Ich hatte das Recht, sie so zu nennen, wie ich wollte. Der Schreiber runzelte die Stirn. Er hatte für heute genug von wunderlichen jungen Eltern.
»Geburtsdatum?«
»Sieben Tage vor den Kalenden des Juni.«
Diesmal warf der Schreiber seine Feder auf den Tisch. Ich wusste, was ihn verärgert hatte. »Wir akzeptieren Registrationen nur am Tag der Namensgebung!«
Nach den Vorschriften hatte ich meiner Tochter innerhalb von acht Tagen nach ihrer Geburt einen Namen zu geben. (Für Jungs waren es neun Tage; wie Helena sagte, brauchen Männer eben für alles länger.) Es war Sitte, dass die Familie zur Ausstellung der Geburtsurkunde am selben Tag einen Ausflug zum Forum unternahm. Julia Junilla war im Mai geboren; jetzt hatten wir August. Der Schreiber hatte seine Richtlinien. Einen derart schamlosen Bruch der Regeln würde er nicht zulassen.
Kapitel 6
Ich benötigte eine Stunde, um zu erklären, warum mein Kind in Tarraconensis geboren war. Ich hatte nichts Falsches getan, und es war auch nichts Ungewöhnliches. Handel, die Armee und kaiserliche Aufträge führen viele Väter ins Ausland; willensstarke Ehefrauen (besonders diejenigen, die ausländische Mädchen als wandelnde Versuchung betrachten) begleiten sie. Im Sommer finden die meisten Geburten in Familien, die etwas auf sich halten, sowieso in vornehmen Villen außerhalb Roms statt. Es ist sogar völlig akzeptabel, außerhalb von Italien geboren worden zu sein; nur der elterliche Status ist ausschlaggebend. Ich würde es keinesfalls hinnehmen, dass meine Tochter ihre bürgerlichen Rechte verlor, bloß weil der unpassende Zeitpunkt einer Ermittlung für den Palast mich gezwungen hatte, ihr in einem fernen Hafen namens Barcino auf die Welt zu helfen.
Ich hatte alle mir möglichen Schritte unternommen. Diverse frei geborene Frauen waren bei der Geburt zugegen gewesen und konnten als Zeuginnen auftreten. Ich hatte sofort den Stadtrat von Barcino unterrichtet (der von mir als Ausländer keine Notiz nahm) und innerhalb der festgelegten Frist eine formelle Erklärung in der Residenz des Provinzstatthalters in Tarraco abgegeben. Ich hatte das Siegel des Kerls auf einem verschmierten Zettel, um das zu beweisen.
Es gab einen offensichtlichen Grund für unser heutiges Problem. Staatssklaven werden nicht für ihre Tätigkeiten bezahlt. Natürlich hatte ich das übliche Sümmchen mitgebracht, aber der Schreiber meinte, er könne noch mehr rausholen als gewöhnlich, wenn er ordentlich Schwierigkeiten machte. Mein einstündiger Vortrag war nötig, um ihn davon zu überzeugen, dass ich nicht mehr Geld besaß.
Er wurde allmählich weich. Dann fiel Julia ein, dass sie Hunger hatte, also kniff sie ihre kleinen Augen zusammen und brüllte, als würde sie schon mal dafür üben, wie sie mich als Halbwüchsige davon überzeugen konnte, sie zu einem Fest gehen zu lassen, das ich missbilligte. Sie erhielt ihre Geburtsurkunde ohne weitere Verzögerung.
Rom ist eine maskuline Stadt. Orte, an denen eine ehrbare Frau ihr kleines Kind sittsam stillen kann, gibt es kaum. Was daran liegt, dass ehrbare stillende Mütter zu Hause zu bleiben haben. Helena dachte nicht daran, zu Hause zu bleiben. Vielleicht lag es daran, dass es mir nicht gelungen war, für sie eine reizvollere Umgebung zu schaffen. Sie fand es ebenfalls abstoßend, das Baby in einer der Frauenlatrinen zu stillen, und sie schien nicht bereit zu sein, ein As für die Frauenbäder zu bezahlen. Also blieb uns nichts anderes übrig, als einen Tragestuhl zu mieten und darauf zu achten, dass die Vorhänge die ganze Zeit fest geschlossen waren. Wenn mich etwas noch mehr nervte, als für den Stuhl bezahlen zu müssen, dann war es die Tatsache, dass er sich für das Geld nirgendwohin bewegte.
»Schon gut«, beruhigte Helena mich. »Wir müssen hier nicht stehen bleiben. Du brauchst nicht draußen Wache zu halten und dich zu Tode zu schämen.«
Das Kind musste gestillt werden. Außerdem war ich stolz darauf, dass Helena so hoch gesinnt war, Julia selbst zu stillen. Viele Frauen ihres Standes behaupten zwar, es wunderbar zu finden, zahlen dann aber doch lieber für eine Amme. »Ich warte.«
»Nein, bitte die Männer, uns zum Atrium Libertatis zu tragen«, befahl Helena entschieden.
»Was soll da sein?«
»Dort werden die Akten gelagert, für die im Büro des Zensors kein Platz mehr ist. Außerdem werden da die Toten registriert.« Das wusste ich.
»Wer ist denn gestorben?« Ich ahnte, worauf sie hinauswollte, aber ich lasse mich nun mal nicht gern in Sachen hineindrängen.
»Genau das musst du rausfinden, Marcus.«
»Wie bitte?«
»Du erinnerst dich an die Hand, die ihr, Petro und du, gefunden habt? Ich glaube zwar nicht, dass du dort etwas über den Besitzer der Hand erfährst, aber es muss doch einen Schreiber geben, der dir zumindest sagen kann, wie die Vorgehensweise ist, wenn ein Mensch verschwindet.«
Ich sagte, ich hätte für heute genug von Schreibern, aber wir wurden trotzdem zum Atrium Libertatis getragen.
Wie alle Beerdigungsunternehmer waren die Schreiber in der Sterberegistratur ein munteres Häuflein, ganz im Gegensatz zu ihrem verdrießlichen Kollegen in der Geburtenregistratur. Ich kannte bereits zwei von ihnen, Silvius und Brixius. Privatermittler werden von Erben oder Testamentsvollstreckern oft ins Atrium geschickt. Doch zum ersten Mal kam ich mit meiner vornehmen Freundin, einem schlafenden Baby und einem neugierigen Hund in ihr Büro geschlurft. Sie machten kein Theater, hielten Helena für meine Klientin – eine aufdringliche, die darauf bestand, jeden meiner Schritte zu überwachen. Sah man von der Tatsache ab, dass ich ihr keine Rechnung schicken würde, lagen sie damit gar nicht so falsch.
Sie arbeiteten in demselben kleinen Loch, tauschten schlechte Witze aus und schoben Schriftrollen herum, als wüssten sie nicht, was sie taten; insgesamt gesehen hielt ich sie für sehr tüchtig. Silvius war an die vierzig, schlank und gepflegt. Brixius war jünger, bevorzugte aber den gleichen kurzen Haarschnitt und kunstvollen Tunikagürtel wie Silvius. Es ließ sich kaum übersehen, dass die beiden eine sexuelle Beziehung hatten. Brixius war der empfindsamere der beiden und wollte Julia auf den Arm nehmen. Silvius gab sich nach außen hin säuerlich und kümmerte sich um mich.
»Ich brauche eine allgemeine Information, Silvius.« Ich erzählte von der gefundenen Hand und erklärte, dass Petronius und ich neugierig geworden seien. »Es scheint eine Sackgasse zu sein. Wenn jemand vermisst wird und eine Meldung an die Vigiles erfolgt, wird das notiert, aber ich würde nicht darüber spekulieren wollen, wie lange der Fall offen bleibt. Ob sie der Sache nachgehen, hängt von einer Menge Dinge ab. Doch das ist nicht das Problem. Dieses Überbleibsel kann kaum noch zur Identifikation dienen. Es könnte uralt sein.«
»Und wie können wir dir helfen?«, fragte Silvius misstrauisch. Er war ein Staatssklave. Er verbrachte sein Leben damit, sich neue Möglichkeiten auszudenken, Informationsanfragen an andere Abteilungen weiterzuleiten. »Unsere Unterlagen beziehen sich auf ganze Personen, keine unappetitlichen Teile ihrer Anatomie.«