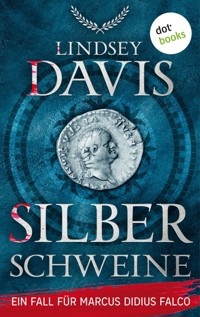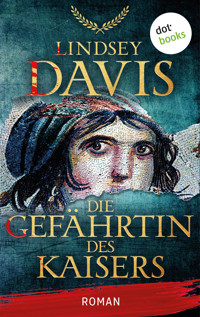
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Sklavin und der Imperator: Der packende historische Roman »Die Gefährtin des Kaisers« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom im Jahre 31 nach Christus. Eigentlich ist der Sklavin Caenis ein steiniger Weg vorgezeichnet – doch dann bekommt die intelligente junge Frau die Chance ihres Lebens: Weil sie der Schriftkunst mächtig ist, vertraut ihr die kaiserliche Nichte ein Geheimnis von politischer Brisanz an. So öffnen sich für Caenis die Tore zur Welt der Reichen und Mächtigen, wo sie den jungen Tribun Vespasian kennenlernt, dem ein beispielloser Aufstieg vorherbestimmt ist. Trotz ihrer ungleichen Stellung findet Caenis in dem feinsinnigen Politiker einen Gleichgesinnten. Doch je mehr Macht Vespasian erlangt, desto brisanter wird die Situation für seine Geliebte. Und noch dazu werden die beiden durch das Ränkespiel der römischen Elite vor eine Entscheidung gestellt, die ihnen absolute Freiheit schenken könnte – oder Elend und Vergessen bedeutet … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der prachtvolle Historienroman »Die Gefährtin des Kaisers« von Lindsey Davis, der Autorin der Erfolgsserie rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom im Jahre 31 nach Christus. Eigentlich ist der Sklavin Caenis ein steiniger Weg vorgezeichnet – doch dann bekommt die intelligente junge Frau die Chance ihres Lebens: Weil sie der Schriftkunst mächtig ist, vertraut ihr die kaiserliche Nichte ein Geheimnis von politischer Brisanz an. So öffnen sich für Caenis die Tore zur Welt der Reichen und Mächtigen, wo sie den jungen Tribun Vespasian kennenlernt, dem ein beispielloser Aufstieg vorherbestimmt ist. Trotz ihrer ungleichen Stellung findet Caenis in dem feinsinnigen Politiker einen Gleichgesinnten. Doch je mehr Macht Vespasian erlangt, desto brisanter wird die Situation für seine Geliebte. Und noch dazu werden die beiden durch das Ränkespiel der römischen Elite vor eine Entscheidung gestellt, die ihnen absolute Freiheit schenken könnte – oder Elend und Vergessen bedeutet …
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Die Website der Autorin: www.lindseydavis.co.uk
Die Autorin veröffentlichte bei dotbooks ihre Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe April 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1997 unter dem Originaltitel »Course of Honour«.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1997 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1998 bei Eichborn GmbH & Co. Verlag KG, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/Bulent Sari
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-060-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Gefährtin des Kaisers« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Die Gefährtin des Kaisers
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Das Julische-claudische Haus
Teil 1Eine übellaunige Dienstmagd
Oktober 31 n. Chr., als alles begann und Tiberius Kaiser war
Kapitel I
Was war denn das?
Der junge Mann verlangsamte den Schritt und blieb schließlich stehen. Auch sein Bruder hielt erstaunt inne. Ein verführerischer, nicht zu diesem Ort passender Geruch wehte sie an. Sie schnupperten beide.
Unglaublich! Da wurde gerade eine Schweinswurst gebraten!
Überall herrschte Stille. Das Echo ihrer Schritte war verklungen. Nichts regte sich in den kühlen, hohen, marmorverkleideten Fluren des Palastes auf dem Palatin, von dem aus das Römische Reich regiert wurde. Seit dem Regierungsantritt des nun schon lange abwesenden Kaisers Tiberius boten die Räume Fremden kein freundliches Willkommen mehr. Heute war es schlimmer denn je. Bogengänge, die eigentlich bewacht sein sollten, waren nur von düsteren Portieren eingerahmt, deren Faltenwurf seit dem Tag, an dem man sie aufgehängt hatte, nicht mehr verändert worden war. Außer den beiden Männern war niemand hier. Nur der Geruch von gebratenem Fleisch und Gewürzen stieg ihnen weiterhin verführerisch in die Nase.
Der jüngere Mann setzte sich wieder in Bewegung. Er ging jetzt schneller, bog um Ecken und stürmte Flure entlang, als hätte er gerade den richtigen Weg entdeckt, bis er, nach kurzem Zögern, eine kleine Tür aufstieß. Bevor sein Bruder ihn einholen konnte, duckte er sich und trat ein.
Eine wütende Sklavin fuhr ihn an: »Spring in den Styx! Du hast hier nichts verloren!«
Ihr Haar hing in glatten, fettigen Strähnen herunter. Ihr Gesicht war teigig, ein trauriger Gegensatz zu den dick geschminkten Damen des Hofes. Doch trotz ihrer Schmuddeligkeit trug sie ihr schlichtes Frieskleid mit trotziger Würde, und wider besseres Wissen antwortete er trocken: »Danke! Was für ein erstaunliches Mädchen!«
Später wußte Caenis nicht mehr genau, welches Fest es gewesen war. Die Jahreszeit war klar. Herbst. Herbst, sechs Jahre vor Tiberius’ Tod. Das Jahr, in dem Aelius Seianus, Präfekt der Prätorianergarde, gestürzt wurde. Seianus, der sich angeblich eine Hundemeute hielt, die er mit Menschenblut fütterte. Seianus, der seit fast zwei Jahrzehnten Rom mit eisernem Griff regierte und Kaiser werden wollte.
Es mochte während der zehntägigen Spiele zu Ehren von Augustus gewesen sein. Die Augustalia, die der Erinnerung an den ersten römischen Kaiser gewidmet waren und jetzt zu Ehren des gesamten kaiserlichen Hauses abgehalten wurden, wären eine Gelegenheit, zu der Antonia den meisten ihrer Sklaven und Freigelassenen, einschließlich ihres Chefsekretärs Diadumenus, freigegeben hätte. Noch wahrscheinlicher war es Augustus’ Geburtstag, ein seit langem eingeführter Festtag, eine Woche vor Beginn des Monats Oktober. Der Gedanke an Augustus, den Gründer des Kaiserreichs, konnte Antonia sehr wohl zu dem bewegt haben, was sie plante.
Auf jeden Fall war es dumm, an einem solchen Tag etwas im Palast erledigen zu wollen. An allen gesetzlichen Feiertagen kamen die Priester des Kaiserkultes ihren religiösen Pflichten mit besonderer Inbrunst nach, während Senatoren, Bürger, Freigelassene und sogar Sklaven, von den privilegiertesten Bibliothekaren bis hin zu den schweißglänzenden Badehausheizern, die Chance ergriffen und ebenfalls in die Tempel drängten. Hier auf dem Palatin waren die Kübelträger und Treppenfeger, die Polierer der Silberbecher und edelsteinbesetzten Schalen, die Buchhalter und Sekretäre, die Kammerherren, die die Besucher überprüften, die Haushofmeister, die sie ankündigten, die Portierenanheber und Kissenträger schon vor Stunden verschwunden. Seianus würde bei den Feierlichkeiten den Ehrenplatz innehaben, und die Prätorianer, die eigentlich den Kaiser beschützen sollten, würden statt dessen ihn beschützen. Der kaiserliche Palast, der trotz des Kaisers langer Abwesenheit von Rom täglich bis in die späte Nacht voller Geschäftigkeit zu sein pflegte, war heute wie ausgestorben.
Da flog die Tür auf. Jemand trat ein. Caenis schaute auf. Sie blickte finster. Der Mann runzelte die Stirn.
»Hier ist jemand – Sabinus!« rief er über die breite Schulter zurück, während er geduckt im niedrigen Türrahmen stand. Unter dem Löffel des Mädchens spritzte das Fett gefährlich auf.
»Juno und Minerva«, hustete Caenis und mußte von der Pfanne zurücktreten, weil das Feuer seitlich aus dem Kohlebecken herausschlug. »Wir werden alle in Flammen aufgehen. Mach die Tür zu!«
Ein zweiter Mann, offenbar Sabinus, trat ein. Seine Toga schmückte der breite Purpurstreifen eines Senators. »Was haben wir denn hier?«
Wieder spritzte das Fett auf. »Ach, schert euch zum Hades!« schimpfte Caenis, ohne auf den Rang der beiden zu achten. Beinahe hätte ihr Kleid Feuer gefangen.
»Eine übellaunige Sklavin mit einer Pfanne voller Würste.« Endlich war er so vernünftig, die Tür zu schließen.
Sie hatten sich verlaufen. Das war Caenis sofort klar. Selbst die Plätze und Tempel zwischen den Häusern der kaiserlichen Familie oberhalb des Circus Maximus lagen verlassen da. Die Büros auf der Forumseite des Palatin waren geschlossen. An einem solchen Tag herzukommen war einfach dumm. Ohne Wachen, die vor ihrer Nase die Speere kreuzten, waren die zwei in den falschen Flur abgebogen und hatten die Orientierung verloren. Nur Leute, die bei ihrem zweifelhaften Tun ungestört sein wollten, drückten sich an diesem Tag in dunklen Ecken herum. Exzentriker und Abweichler, Geizhälse und Unzufriedene – und Caenis.
Sie gehörte zu einer Gruppe von Mädchen, die unter Diadumenus arbeiteten und die Korrespondenz für Antonia kopierten. Heute hatte er ihr befohlen, sich ein ruhiges Plätzchen weitab vom Trubel zu suchen. Später sollte sie zum Haus der Livia gehen, wo ihre Herrin wohnte, um nachzufragen, ob ihre Dienste benötigt wurden. Caenis war zwar noch jung, aber tüchtig. Außerdem rechnete Diadumenus nicht damit, daß irgend etwas Wichtiges geschehen würde. Also hatte auch Caenis, wie alle anderen, mehr oder weniger frei.
Daher die Wurst. Sie hatte ihr Alleinsein – selten für eine Sklavin – und die Vorfreude auf die Mahlzeit genossen. Das Geld dafür hatte sie sich mühsam zusammengespart, hatte Briefe für andere geschrieben und verlorene Münzen auf den Palastfluren aufgelesen. Dann hatte sie sich hierhergeschlichen, die Wurst in gleich große Stücke geschnitten und briet sie nun in einer Pfanne, die zum Emulgieren von Gesichtscreme gedacht war. Sie hatte vor, diesen Leckerbissen ganz allein zu verzehren, und freute sich aus gutem Grund auf ihre Wurst: Ihr magerer Körper brauchte Fleisch und Fett, ihre Sinne sehnten sich nach dem Geschmack von Nüssen und Gewürzen und dem Luxus einer heißen Mahlzeit direkt aus der Pfanne. Sie war wütend über die Störung.
»Entschuldigen Sie, meine Herren, aber Sie haben hier keinen Zutritt.«
Wachsam versuchte sie, ihren Ärger zu verbergen. In Rom war es klug, diplomatisch zu sein. Das galt für alle. Männer, die heute meinten, das Vertrauen des Kaisers zu besitzen, konnten schon morgen in die Verbannung geschickt oder ermordet werden. Wollten sie überleben, mußten sie irgendwie Zugang zu der Clique um Seianus finden. Sich mit jemandem anzufreunden war seit Jahren gefährlich, denn falsche Verbindungen wurde man so schwer wieder los wie ein Koch den Zwiebelsaft unter seinen Fingernägeln. Vielversprechende Karrieren endeten so häufig im Desaster, daß Männer, die heute noch unwichtig waren, vielleicht schon morgen lorbeergeschmückt unter den Bändern der goldenen etruskischen Krone triumphierend in die Stadt einzogen.
Für eine Sklavin war es immer das Beste, höflich zu erscheinen: »Meine Herren, falls Sie zu Veronica wollen ...«
»Ach, laß den Kopf nicht hängen!« hänselte sie der Jüngere.
»Vielleicht bist du uns ja lieber.«
Caenis ruckte so heftig an ihrer Pfanne, daß der Löffel fast herausgefallen wäre. Sie lachte spöttisch. »Reich, hoffe ich?« Die beiden Männer sahen einander an und schüttelten dann mit dem gleichen bedauernden Grinsen den Kopf. »Dann bin ich nicht interessiert!«
Sie sah, daß die beiden ihre Verlegenheit zu überspielen suchten. Traditionalisten mit guter Familienmoral – zumindest in der Öffentlichkeit. Veronica würde sie ganz schön durcheinanderwirbeln. Sie war genau die Richtige, um prüde Senatoren aus der Fassung zu bringen. Veronica war überzeugt, daß eine muntere und hübsche Sklavin tun konnte, was sie wollte.
Caenis war zu zielstrebig und ernsthaft. Sie würde sich ihren Lebensunterhalt auf andere Weise verdienen müssen.
»Wir scheinen uns verlaufen zu haben«, erklärte der vorsichtige Sabinus.
»Hat Ihr Diener Sie im Stich gelassen?« wollte Caenis wissen und deutete mit dem Kopf auf seinen Begleiter.
»Mein Bruder«, berichtigte der Senator. Sehr gradlinig, dieser Senator.
»Wie heißt er?«
»Vespasianus.«
»Und, wo sind Ihre breiten Streifen?« forderte sie den Bruder heraus. »Nicht alt genug?« Das Eintrittsalter für den Senat war fünfundzwanzig; er war vermutlich erst Anfang zwanzig.
»Du klingst wie meine Mutter. Nicht schlau genug!« gab er zurück.
Bürger machten Sklavinnen gegenüber normalerweise keine Witze über ihre ehrwürdigen Mütter. Caenis starrte ihn an. Er hatte einen breiten Brustkorb, muskulöse Schultern, einen kräftigen Hals. Ein angenehmes, ausdrucksstarkes Gesicht. Sein Kinn ragte vor, seine Nase war gebogen, die Lippen fest zusammengepreßt, trotzdem wirkte er gutmütig. Er hatte einen ruhigen Blick. Sie schaute weg. Als Sklavin zog sie es vor, einem solchen Blick nicht zu begegnen.
»Noch nicht bereit dafür«, fügte er hinzu, mit trotzigem Blick zu seinem Bruder, als handele es sich um einen Familienstreit. Wider besseres Wissen entgegnete sie: »Oder ist der Senat noch nicht bereit für Sie?« Caenis hatte bereits seine dickköpfige Ungeschliffenheit bemerkt, eine bewußte Weigerung, seine ländliche Herkunft und seinen Dialekt zu verbergen. Sie bewunderte ihn dafür, obwohl viele Römer ihn als ungehobelt bezeichnet hätten.
Er spürte ihr Interesse. Wenn er wollte (und sie nahm an, daß er es tat), mochten die Frauen ihn vermutlich. Caenis widerstand der Versuchung.
»Sie haben sich in Livias Vorratsraum verirrt, mein Herr«, erklärte sie dem anderen Mann, Sabinus.
Eine plötzliche Stille trat ein, die Caenis insgeheim genoß. Obwohl das Kämmerchen wie eine Parfümerie aussah, fragten die beiden Männer sich sicher, ob die berühmte Kaiserin wohl hier das Gift zusammengemischt hatte, mit dem sie angeblich jene ermordete, die ihr im Weg standen. Inzwischen war Livia tot, aber die Gerüchte hatten sich verselbständigt und waren sogar noch wilder geworden.
Die beiden Männer betrachteten nervös die Salbentöpfchen und Fläschchen. Einige waren leer, ihr Inhalt hatte sich schon vor Jahren verflüchtigt. Andere waren undicht und standen in klebrigen Pfützen. Manche waren noch in Ordnung: Glasflaschen mit Mandelöl, Specksteindosen mit feinem Wachs und Fett, Amethystflakons mit Pomade, korkverschlossene Phiolen mit Antimon und Seetangextrakten, Alabastertöpfe mit rotem Ocker, Asche und Kalk. Kein Ort für einen Koch; eher eine Apotheke. Veronica hätte für diese kleine Schatzkammer drei Finger gegeben.
Es gab noch andere Behälter, die Caenis angeschaut, aber unberührt auf den Regalen hatte stehen lassen. Einige Ingredienzen waren mit Sicherheit nicht harmlos und hatten sie davon überzeugt, daß Livia tatsächlich mit der berühmten Giftmischerin Lucusta unter einer Decke gesteckt haben mußte. Aber das würde sie für sich behalten.
»Und was machst du hier?« fragte Sabinus interessiert.
»Ich katalogisiere die Kosmetika, Herr«, erwiderte Caenis bescheiden und vieldeutig.
»Für wen?« murmelte Vespasianus, mit einem Glitzern im Blick, das klarmachte, wie sehr ihn interessierte, wer an die Stelle der gefährlichen Livia getreten war.
»Antonia.«
Er hob die Augenbraue. Vielleicht war er ja doch ehrgeizig. Ihre ältliche Herrin war eine der am meisten bewunderten Frauen Roms. Als allererste Lektion hatte Diadumenus Caenis eingebläut, jedes Gespräch mit Männern zu meiden, die hofften, sich dadurch einen Kontakt mit Antonia zu erschleichen. Tochter von Marcus Antonius und Octavia, Nichte des Augustus und Schwägerin des Tiberius, Mutter des berühmten Germanicus (und auch Mutter des seltsamen Claudius und der skandalumwitterten Livilla), Großmutter von Caligula und Gemellus, die eines Tages gemeinsam das Römische Reich regieren sollten ... Sollte eine Frau durch ihre männlichen Verwandten bestimmt sein, so hatte sich Antonia wirklich einige Rosinen herausgepickt, obwohl Caenis die ganze Familie insgeheim für eine stockfleckige und angeschimmelte Bande hielt. Geschlagen mit dieser berühmten Männerriege, war Antonia weise, mutig und noch nicht vollkommen abgestumpft durch die empörenden Dinge, die sie hatte mit ansehen müssen. Wenn sogar der Kaiser sie ernst nahm, mochten auch ihre Sklavinnen über Einfluß verfügen.
»Ich sehe meine Herrin nur selten«, erklärte Caenis ruhig, damit es keine Mißverständnisse gab. »Ich wohne hier im kaiserlichen Palast. Ihr Haus ist zu klein.«
Das stimmte, aber als Kopistin für Antonia zu arbeiten war für Caenis ein großer Schritt gewesen.
Obwohl als Sklavin geboren, war Caenis keine Dienstmagd. Man hatte ihre Intelligenz erkannt und sie für Bürotätigkeiten ausgebildet: lesen, schreiben, chiffrieren und Kurzschrift, Diskretion, gutes Benehmen, anmutige Unterhaltung mit angenehmer Stimme. Ihr Latein war erstklassig, ihr Griechisch überdurchschnittlich gut. Sie konnte rechnen und die Bücher führen. Sie konnte sogar denken, obwohl sie das für sich behielt, um andere nicht dadurch in Verlegenheit zu bringen, daß sie sich als ihnen überlegen zeigte. Nur weil sie noch so jung war, arbeitete sie bisher nicht in einem der kaiserlichen Büros. Man durfte erst dann im Büro arbeiten, wenn sicher war, daß man mit zudringlichen Senatoren fertig wurde.
Caenis nahm die Pfanne vom Kohlebecken und richtete sich auf, um nun mit diesen beiden Männern fertig zu werden. Ihre Ausbildung war umfassend gewesen. Sie konnte mit dem Hintergrund verschmelzen und doch Tüchtigkeit ausstrahlen. Sie saß immer aufrecht, um sich eine gute Handschrift zu bewahren, stand gerade, ohne die Schultern hängen zu lassen. Ihr Gang war selbstbewußt. Sie sprach deutlich, wußte, wie man uneingeladenen Senatoren mit Charme die Tür wies.
Ob das auch für einen Vorratsraum galt, würde sich zeigen.
»Antonias Köchin?« fragte Sabinus neugierig, als sie die Pfanne wegstellte. Männer hatten ja keine Ahnung.
»Antonias Sekretärin«, prahlte sie.
»Warum dann die Wurst, Antonias Sekretärin?« fragte der jüngere Bruder, der sie immer noch mit gerunzelter Stirn betrachtete. »Geben sie dir hier nichts zu essen?«
Der Blick, mit dem die beiden Caenis’ Essen beäugten, wirkte auf anrührende Weise hoffnungsvoll. Caenis grinste, schaute aber auf ihr Pfännchen hinunter. »Ach, die tägliche Sklavenration: nichts Gutes und nie genug.«
Sabinus zuckte zusammen. »Klingt wie bei uns zu Hause!«
Sie mochte diesen Senator mehr, als sie erwartet hatte. Er schien aufrichtig und wohlmeinend. Sie platzte heraus: »Tja, alles ist relativ! Ein reicher Ritter ist bestimmt fröhlicher als ein armer Senator. Aber arm zu sein und dem Ritterstand anzugehören ist immer noch besser, als ein gewöhnlicher Bürger zu sein, der kaum das Recht hat, auf der Straße in der Nase zu bohren. Ein Sklave im kaiserlichen Palast hat ein angenehmeres Leben als ein freier Bootsmann, der in einem stets von der Flut bedrohten Schoppen am Tiberufer haust ...« Da man ihr nicht den Mund verbot, redete sie schnell weiter: »Die Macht des Senats ist zu einer Illusion geworden. Rom wird vom Präfekten der Prätorianergarde regiert ...«
Das hätte sie niemals laut sagen dürfen.
Um die beiden Männer abzulenken, plapperte sie weiter: »Was mich angeht, ich bin in einem Palast geboren. Ich habe Wärme und Musik, leichte Arbeit und Aufstiegschancen. Vielleicht mehr Freiheit als ein römisches Mädchen von hoher Geburt mit Granatsteckern in den Ohren, das im Haus ihres Vaters eingesperrt ist. Die kann doch nichts anderes tun, als einen wohlhabenden Halbidioten zu heiraten, der dann nur darauf aus ist, ihr zu entkommen – und zwar zu solchen wie Veronica und mir –, um sich einigermaßen vernünftig zu unterhalten und unerzwungene Leibesfreuden zu genießen, und wenn er kein vollkommener Idiot ist, sogar ein wenig echte Zuneigung.«
Atemlos hielt sie inne. Ihr war eine politische Meinung entschlüpft. Schlimmer noch, sie hatte etwas von sich selbst preisgegeben. Unruhig trat sie von einem Fuß auf den anderen.
Der ernsthafte Blick des jüngeren Mannes beunruhigte sie. Darum murmelte sie: »Ach, hören Sie auf, nach meiner Wurst zu schielen! Wollen Sie ein Stück?«
Eine Pause entstand.
Das war undenkbar.
»Nein, vielen Dank!« sagte Sabinus hastig und versuchte, seinen Bruder zu übertönen – keine einfache Aufgabe.
Caenis war zwar schroff, aber großzügig. Da ihr Alleinsein ohnehin gestört war, bot sie dem jungen Ritter auf der Spitze ihres Messers eine Scheibe Wurst an. Er griff sofort danach. »Hm! Das schmeckt gut!« Während er kaute, betrachtete er sie und lachte. Alle Sorgen waren plötzlich aus seinem Gesicht verschwunden. Sie hatte angenommen, daß jeder, der eine anständige weiße Toga trug, täglich Pfauenfleisch mit zwei Soßen vorgesetzt bekäme, aber er aß mit einem Appetit, der dem eines ausgehungerten Küchenjungen glich. Vielleicht ging all sein Bargeld für das Waschen dieser Togen drauf. »Gib dem Dummkopf da auch ein Stück. Er ist ganz heiß darauf.«
Caenis beäugte den Senator. Wieder bot sie eine Wurstscheibe auf ihrer Messerspitze an. Eifrig griff Sabinus danach. Die Hand des Bruders legte sich so schwer auf seine Schulter, daß Caenis den goldenen Ritterring glitzern sah. Dann gestand er ihr: »Sein Diener, genau wie du sagst! Ich schaffe ihm Platz auf der Straße, verjage Gerichtsvollzieher und unattraktive Frauen, bewache seine Kleider in den Thermen wie ein Hund – und achte darauf, daß er genug zu essen bekommt.« Wieviel davon als Witz gemeint war, ließ sich nur schwer ausmachen.
Inzwischen sah sie ihm an, daß sie ihm gefiel. Sie kannte diesen Blick, hatte ihn bei Männern gesehen, die Veronica umschwärmten. Caenis wich zurück. Sie fand das Leben schon so schwer genug. Auf einen überfreundlichen Galan mit ländlichem Akzent und ohne Geld konnte sie gut verzichten. »Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen, meine Herren.« »Wir bringen das Mädchen in Schwierigkeiten«, warnte Sabinus.
Zum ersten Mal lächelte sein Bruder sie an. Es war das angespannte, bedauernde Lächeln eines Mannes, der Zwänge kennt. Sie war zu klug, um zurückzulächeln. Immer noch kauend, rührte er sich nicht von der Stelle. Die Augen zu Boden gerichtet, knabberte Caenis ihr eigenes Wurststück langsam von der Messerspitze. Es war eine recht anständige Schweinefarce, gewürzt mit Myrtenbeeren, Pfefferkörnern und Pinienkernen. In das heiße Bratfett hatte sie eine Porreestange hineingeschnitten.
Nur noch zwei Scheiben lagen in der Pfanne. Der jüngere Bruder, Vespasian, griff nach der einen, hielt dann inne und tadelte sie sanft: »Du läßt dir von uns dein Essen stehlen, Mädchen.« »Ach, greifen Sie schon zu!« drängte sie ihn, plötzlich verlegen und ärgerlich. Es hatte ihr Freude gemacht, etwas anderes als die übliche Tauschware der Sklavinnen anzubieten.
Er sah sie ernst an. »Ich werde die Schuld zurückzahlen.«
»Mag sein.«
So aßen sie zusammen, sie und der stämmige junge Mann mit dem energischen Kinn. Sie aßen, während der Bruder wartete. Dann leckten sich beide die Finger und seufzten verzückt. Alle drei lachten.
»Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen, meine Herren«, wiederholte Caenis, gedämpft, als das Sonnenlicht einer anderen Welt in die Leere ihrer eigenen fiel. Sie führte sie hinaus auf den Flur. Die beiden Männer gingen rechts und links neben ihr, und sie genoß ihre Gegenwart, während sie sie zu den Verwaltungsbüros führte.
»Danke«, sagten beide in der lässigen Art, die ihrem Rang entsprach.
Ohne zu antworten, machte Caenis auf dem Absatz kehrt und ging davon, wie man sie es gelehrt hatte: erhobener Kopf, gerader Rücken, ausgeglichene, kontrollierte Bewegungen. Die trostlosen und erniedrigenden Umstände ihrer Geburt wurden unwichtig; sie ignorierte ihr trübes Los und war einfach sie selbst. Caenis spürte, daß die beiden stehengeblieben waren, in der Erwartung, sie würde sich noch einmal umdrehen. Sie tat es nicht, weil sie befürchtete, daß die Männer sich über sie lustig machten.
Caenis täuschte sich. Der Senator, Flavius Sabinus, nahm ihr seltsames Abenteuer gelassen hin. Und sein Bruder lächelte kaum wahrnehmbar, aber nicht spöttisch.
Er wußte, daß er nicht versuchen durfte, sie wiederzusehen. Caenis war die Tragweite des Geschehens entgangen, aber er hatte sie sofort erkannt. Das war typisch für ihn: rasche Einschätzung der Situation, gefolgt von einer Entscheidung, lange bevor er sie in Handeln umsetzte. Er stand kurz davor, Rom wieder zu verlassen, Italien zu verlassen. Aber während seiner langen Reise nach Thrakien und auch danach dachte Flavius Vespasianus immer wieder: Was für ein erstaunliches Mädchen!
Kapitel II
In der Abenddämmerung des gleichen Tages folgte Caenis der Anweisung von Diadumenus und ging zum Haus ihrer Herrin, um sich zu erkundigen, ob ihre Dienste gebraucht würden. Frisch gewaschen und gekämmt, machte sie sich auf den Weg, ausgerüstet mit Schreibtafeln und ihrem hölzernen Stiluskasten.
Das Haus der Livia grenzte an den Palast, bequem zu erreichen, aber doch abgeschieden, wenn es darum ging, Distanz zu halten. Es war – theoretisch – das berühmte »bescheidene Heim«, daß Augustus sich bewahrt hatte. Damit ließ sich der Mythos aufrechterhalten, daß er, trotz der Ehren, mit denen man ihn nach der Annahme des Kaisertitels überhäuft hatte, ein gewöhnlicher Bürger geblieben war Der Erste unter Gleichen, wie man so schön sagt. In diesem Haus, hieß es, hätten seine Frau und seine Tochter auf ihren Webstühlen die kaiserlichen Gewänder gewebt, wie es römische Frauen traditionell für ihre männlichen Verwandten taten. Vielleicht hatten Livia und Julia, wenn nichts anderes sie ablenkte, tatsächlich ein wenig gewebt. In Julias Fall allerdings nicht oft genug. Sie hatte trotzdem Zeit gefunden, ein so ausschweifendes Leben zu führen, daß es ihr Verbannung, Verlust der Ehrenrechte und schließlich den Tod durch das Schwert eingebracht hatte. Livias Haus, das seit dem Tod der ehrwürdigen Kaiserin vor zwei Jahren von Antonia allein bewohnt wurde, befand sich im Südosten des Palatin, dort, wo einst die Häuser angesehener Republikaner gestanden hatten. Augustus, der hier geboren worden war, hatte die anderen Familien ausgekauft und das Gelände zu seiner Privatdomäne gemacht. Sein Wohnhaus war abgerissen worden, um seinem großen neuen Apollotempel im Portikus der Danaiden Platz zu machen, deshalb hatte ihm der Senat neben dem Tempel ein neues Gebäude mit prächtigen Repräsentationsräumen zum Geschenk gemacht. Seine Frau Livia behielt ihr eigenes bescheidenes (wenn auch exquisites) Haus hinter dem Tempel. Damit genoß das Kaiserpaar alle Vorteile eines privaten Palastes, konnte aber immer noch in einem klassischen, schlichten römischen Heim wohnen.
Antonia war hier eingezogen, nachdem sie Livias beliebten und heldenhaften Sohn Drusus geheiratet hatte. Als sie bereits mit siebenundzwanzig Jahren Witwe wurde, entschied sie sich, im Haus ihrer Schwiegermutter zu bleiben, dasselbe Zimmer und Bett zu behalten, das sie mit ihrem Ehemann geteilt hatte. Inzwischen selbst Mutter von drei Kindern, hatte sie das Recht, sich nicht in die Obhut eines Vormundes begeben zu müssen. Mit Livia unter einem Dach zu leben, bewahrte ihr die Unabhängigkeit und vermied Skandale. Es gab ihr außerdem die Möglichkeit, eine zweite Ehe abzulehnen. Antonia gehörte zu den wenigen römischen Frauen, die sich für dauerhafte Unabhängigkeit entschieden.
Livias Haus war an den Hügel gebaut und vom Verwaltungskomplex des Palastes durch einen unterirdischen Gang zu erreichen. Caenis wählte automatisch diesen Weg. So war es unwahrscheinlich, daß sie Mitgliedern der Prätorianergarde begegnete. Deren Aufgabe war es, den Kaiser zu schützen, aber da Tiberius seit langem auf Capri weilte und ihr Kommandeur Seianus alle Macht an sich gerissen hatte, waren sie unerträglich geworden. Zum Glück hatten heute nur wenige Dienst und keiner davon in der unterirdischen Passage.
Caenis kam an zwei Abzweigungen vorbei, bewältigte rasch das restliche Stück des Weges und fühlte sich in Sicherheit. Normalerweise wagten sich nicht mal die Gardisten an Antonias Besucher heran. Aber wenn ihnen der Sinn danach stand oder sie zuviel getrunken hatten, konnten sie einer Sklavin immer noch gefährlich werden. Die Prätorianer waren eine arrogante Elite, durch den Namen Seianus perfekt geschützte, üble Burschen, die sich nach Lust und Laune mit jedem anlegten.
Seianus selbst war unangreifbar. Er war aus dem mittleren Rang, dem Ritterstand, aufgestiegen, ein Soldat, dessen Ehrgeiz berüchtigt war. Da er über einigen Charme verfügte, hatte er sich zum Freund des Kaisers gemacht, der sonst wenig enge Vertraute besaß. Wenn man auch nicht offen darüber sprach, war doch allgemein bekannt, daß Seianus der Liebhaber von Antonias Tochter Livilla wurde, die mit dem Sohn des Kaisers verheiratet war. Es ging sogar das Gerücht, Seianus und Livilla hätten geplant, ihren Gatten zu ermorden. Und gewiß waren bereits schlimmere Verschwörungen im Gange. Am besten dachte man nicht allzu gründlich darüber nach.
Mit leichtem Frösteln betätigte Caenis die Glocke und wartete darauf, eingelassen zu werden. Der Pförtner war bestimmt in Feiertagslaune und würde sich Zeit lassen. Der unterirdische Gang endete am Garten nahe des Hintereinganges, und hier würde der Pförtner noch langsamer reagieren als am Haupteingang beim Siegestempel. Caenis stand nicht gern vor einer geschlossenen Tür, erwartete stets, unsichtbar und unhörbar bespitzelt zu werden. Sie fühlte sich ungeschützt und wandte der Tür den Rücken zu.
Als Antonias Verwalter Caenis von der kaiserlichen Ausbildungsschule kaufte, glich der Vorgang eher einer Adoption denn einem Geschäft, bei dem Besitztitel übertragen wurden und Geld von einer Hand in die andere wechselte. Antonia selbst wußte vermutlich nichts davon. Die Gelegenheit, in dieser hohen Position zu arbeiten, war nicht von selbst gekommen und auch nicht automatisch mit vollem Vertrauen verbunden. In den von einer Sekretärin verlangten Fähigkeiten übertraf Caenis alle ihre Konkurrentinnen ohne weiteres, aber Antonia gewährte nur zögernd Zugang zu ihren Privatpapieren, und das mit Recht. Das Mädchen mußte sich erst bewähren und war zunächst wenig mehr als eine Kopistin. Daß Diadumenus sie heute allein den Dienst versehen ließ, mochte ein erstes Zeichen der Akzeptanz sein. Es war ein wichtiger Schritt vorwärts, das wußte Caenis. Ihr war ungeheuer daran gelegen, alles richtig zu machen.
Schließlich wurde sie von einem leise vor sich hin grummelnden Pförtner eingelassen. Geduldig ertrug sie die Begrüßung, noch vollkommen mit der Freude über die Entwicklung der Dinge beschäftigt. Durch das diskrete Portal dieses vergleichsweise bescheidenen Hauses kamen römische Staatsmänner und ausländische Potentaten, Sprößlinge aus Klientelkönigreichen – Judäa, Kommagene, Thrakien, Mauretanien, Armenien, Parthien – und die exzentrischen oder berüchtigten Mitglieder von Antonias eigener Familie. Einflußreiche Römer, solche, die die Zukunft im Blick hatten, sahen in Antonia ihre Patronin und Gönnerin. Da heute ein Feiertag war, mochten Besucher anwesend sein, obwohl Caenis das Haus außergewöhnlich ruhig fand.
Nachdem sie den Säulengang und einen kurzen Korridor durchquert hatte, erreichte sie im Zentrum der Empfangsräume ein überdachtes Atrium mit schwarzweiß gefliestem Boden. Gegenüber führte eine lange Treppe vom Haupteingang herunter. Zu beiden Seiten lagen die Repräsentationsräume, ein Eingangsbereich und ein Eßzimmer, alle mit auserlesenen Fresken dekoriert. Die Privaträume und Schlafzimmer, alle sehr viel kleiner, lagen dahinter und in den oberen Stockwerken.
Ihr Auftrag lautete, sich beim Pförtner Maritimus zu melden und, falls etwas zu diktieren war, ihrer Herrin in einem der kleinen Zimmer neben dem Empfangsraum zur Verfügung zu stehen. Heute abend jedoch führte Maritimus, der aufgeregt schien, sie in den Empfangsraum. Dort mußte sie warten. Sie betrachtete das kunstvolle Fresko der von Argus bewachten Io, die erwartungsvoll zuschaute, wie Merkur hinter einem großen Felsen hervorkroch, um sie zu retten; er sah aus wie einer dieser lockenköpfigen Schlawiner, vor denen Ios Mutter sie wahrscheinlich gewarnt hatte.
Um sich zu beruhigen, klappte Caenis ihre gebundenen Wachstafeln auf und zog einen Stilus heraus. Normalerweise wäre Diadumenus als Chefsekretär dagewesen, und sie hätte sich nicht so ausgesetzt gefühlt. Doch die Art der erforderlichen Korrespondenz war ihr vertraut. Antonia verfügte über ausgedehnte Besitzungen, auch Ländereien in Ägypten und Arabien, die sie von ihrem Vater Marcus Antonius geerbt hatte. Unter ihrer Obhut waren Prinzen aus weit entfernten Provinzen aufgewachsen, von ihren gewieften römischen Vätern nach Rom geschickt oder einfach von den Römern als Geiseln mitgenommen, und viele Briefe wurden immer noch an jene geschrieben, die inzwischen nach Hause zurückgekehrt waren. Für eine fähige Schreiberin keine Schwierigkeit, obwohl es das erste Mal sein würde, daß Caenis ohne Aufsicht mit Antonia zusammentraf.
Der nervöse Pförtner stürzte wieder herein. »Ich soll Diadumenus finden. Bist du allein? Wo ist Diadumenus?«
»Er hat frei wegen des Feiertags.«
»Das geht nicht!« Der Pförtner schwitzte.
»Es muß«, erwiderte Caenis fröhlich. Sie weigerte sich, seine Panik zu teilen, solange er keine Erklärung abgab.
Maritimus funkelte sie finster an. »Sie will einen Brief diktieren.«
»Das kann ich doch auch.« Caenis sehnte sich nach mehr Autorität. Sie genoß ihre neue Arbeit, genoß es, ihre Fähigkeiten zu nutzen, und war fasziniert von dem, was sie von Antonias Korrespondenz zu sehen bekam. Ihr war klar, daß sie noch nicht in alles eingeweiht war. »Wirst du ihr sagen, daß ich hier bin?«
»Nein. Sie will Diadumenus. Ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwas hat sie verstört. Du kannst das nicht machen. Es hat was mit ihrer Familie zu tun.«
Antonia sprach nie über ihre Familie. Sie trug die schreckliche Bürde ganz allein.
»Ich bin diskret!« brauste Caenis auf.
»Es ist was Politisches!« zischte der Pförtner.
»Ich kann den Mund halten.« Jeder vernünftige Sklave tat das. Es reichte nicht. Maritimus schnalzte mit der Zunge und eilte wieder hinaus. Caenis überließ sich ihrer Enttäuschung und überlegte, welches Problem Antonia wohl so zusetzte.
Sie sah die Welt und ihren eigenen Platz darin mit neuen Augen. In einem Privathaus zu arbeiten war ein wunderbares Gefühl. Sie hatte bereits aus nächster Nähe mitbekommen, wie die römische Regierung funktionierte. Wie die meisten Familienangelegenheiten basierte sie auf kurzfristigen Loyalitäten und langfristiger Launenhaftigkeit und fand in einer Atmosphäre von Boshaftigkeit, Habgier und Hartleibigkeit statt. Caenis hatte nie eine Familie gehabt. Sie beobachtete alles mit Entzücken.
Was immer ihre Herrin an diesem Abend in Unruhe versetzt hatte, die junge Sekretärin kannte bereits den Hintergrund: Der Kaiser Tiberius, dessen berühmter Bruder Drusus Antonias Ehemann gewesen war, verbrachte die letzten Jahre seiner bitteren Herrschaft im einsamen Exil auf der Insel Capri. In Rom hatte man akzeptiert, daß er nie mehr zurückkehren würde. Er war bereits über siebzig, so daß man sich Gedanken machte über einen Nachfolger.
Seit Augustus als erster seine politische Position aus seiner Verwandtschaft zu Julius Cäsar hergeleitet hatte, war die Herrschaft über Rom zu einem Erbrecht geworden. Echte Unfälle und der glühende Ehrgeiz, den die furchteinflößenden Frauen der Familie an den Tag legten, hatten einen Großteil der männlichen Erben bereits ins Grab gebracht. Der Sohn des Kaisers, verheiratet mit Antonias Tochter Livilla, war vor acht Jahren unter reichlich mysteriösen Umständen gestorben. In Ermangelung anderer Kandidaten gab es jetzt nur noch zwei Möglichkeiten zur Auswahl: Livillas Sohn Gemellus und sein Vetter Caligula. Ein nettes Paar – Caligula, der bereits im jugendlichen Alter hier in Antonias Haus seine eigene Schwester verführt hatte, und Gemellus, ein zutiefst unerfreulicher und zudem ständig kränkelnder Junge. Aber wenn Tiberius in naher Zukunft starb, würde Rom diesen beiden Jungen überlassen werden, während Seianus ebenfalls unermeßliche Macht ausübte. Vielleicht würde Seianus eine andere Lösung vorziehen.
Leise und ohne jede Vorwarnung betrat Antonia den Raum. Caenis sprang auf.
Antonia war fast siebzig, obwohl ihr rundes Gesicht, ihre sanften Züge, die weit auseinanderliegenden Augen und der fein geschwungene Mund, die sie einst zu einer berühmten Schönheit gemacht hatten, beinahe unverändert wirkten. Ihr allmählich dünner werdendes Haar war in der Mitte gescheitelt und im Nacken zu einer traditionellen Frisur aufgesteckt. Gewand und Stola waren von unaufdringlicher Qualität, Ohrringe und Anhänger schwergewichtige Antiquitäten – Zeichen von Wohlstand und Macht, getragen mit großer Selbstverständlichkeit.
»Du bist Caenis?« Die junge Sklavin nickte. Die Selbstsicherheit ihrer Herrin gab ihr das Gefühl, ungehobelt und plump zu sein. »Du versiehst deinen Dienst allein? Nun ja, es hat sich etwas Wichtiges ergeben, das keinen Aufschub duldet. Wir werden das Beste daraus machen müssen.« Ihre Herrin warf ihr einen scharfen Blick zu. Eine Entscheidung wurde getroffen. Das Leben der jungen Sklavin nahm eine plötzliche Wendung: Aus unersichtlichen Gründen zog Antonia sie ins Vertrauen.
Caenis spürte, daß alles, was ihr diktiert werden würde, bereits sorgfältig durchdacht worden war. Sie hatte schon oft erlebt, daß ihre Herrin aus dem Stegreif diktierte. Diesmal war es anders. Jetzt führte Antonia sie rasch in einen der intimeren kleinen Nebenräume und hieß sie auf einem niedrigen Hocker Platz nehmen, während sie weiter auf und ab ging und kaum erwarten konnte, daß Caenis ihren Stilus parat hatte. Es war eine seltsame Umkehrung. In Rom saßen die Mächtigen, während ihre Untergebenen standen. Caenis hatte gelernt, das Diktat stehend aufzunehmen, während der Diktierende auf einer Liege ruhte.
»Der Brief ist an den Kaiser gerichtet und betrifft Lucius Aelius Seianus.«
Da verstand Caenis. Diese kurze, förmliche Ankündigung war eine Warnung und ließ sie erstarren. Ihre Herrin gedachte, den Mann bloßzustellen.
Mit schmerzerfüllter, bedachtsamer Stimme diktierte Antonia Fakten für Tiberius, die sie nur ungern formulierte und die er nur ungern lesen würde. Sie hatte eine großangelegte Verschwörung entdeckt. Die sensationelle Geschichte hätte in Rom kaum Erstaunen ausgelöst, obwohl nur wenige gewagt hätten, dies zu äußern, und schon gar nicht dem Kaiser gegenüber. Hier, in ihrem abgeschiedenen Haus, war Antonia nur quälend langsam dahintergekommen, aber jene, die ihr nahestanden, hatten ihr Seianus’ Pläne enthüllt. Sie hatte sich nicht auf deren Wort verlassen, sondern eigene Nachforschungen angestellt. Aufgrund ihrer privilegierten Position besaß sie den Mut, Tiberius zu informieren, und sie untermauerte jede ihrer Beschuldigungen mit aufschlußreichen Einzelheiten. Sie schreckte auch nicht davor zurück, ihre eigene Tochter zu belasten.
Antonia schilderte dem Kaiser, wie sein Freund, der Prätorianerpräfekt Seianus, plante, die Macht völlig an sich zu reißen. Seine einschüchternde Position hatte ihm die Ergebenheit vieler Senatoren und kaiserlicher Freigelassener gesichert, die das Reich verwalteten. Führende Persönlichkeiten der Armee waren bestochen worden. Die Ehrungen, mit denen Seianus in letzter Zeit überhäuft worden war, hatten seinen Ehrgeiz noch weiter angestachelt und die Kontrolle, die er über Rom ausübte, verstärkt. Durch die Heirat seiner Verwandten Aelia Paetina mit Antonias Sohn Claudius, die Verlobung seiner Tochter mit Claudius’ Sohn (der inzwischen gestorben war) und die gerade nach langem Zögern vom Kaiser gegebene Einwilligung zu seiner eigenen Vermählung mit Antonias Tochter, hatte er sich enge Verbindungen zur kaiserlichen Familie geschaffen. Livilla hatte er schon lange vorher verführt, dann entweder ihren Mann vergiftet oder sie dazu überredet und plante nun, durch Heirat Teil des Kaiserhauses zu werden, um so seine eigene Position als zukünftiger Kaiser zu legitimieren. Seine Ehefrau, von der er sich vor kurzem hatte scheiden lassen, war jetzt bereit, als Zeugin gegen ihn auszusagen.
Seianus hatte vor, den prominenteren Thronfolger Caligula auszuschalten. Sollte der alte Mann nicht bereit sein, bald zu sterben, beabsichtigte der Gardekommandeur zweifellos, auch Tiberius aus dem Weg zu räumen.
Als das Diktat beendet war, gelang es Caenis, ihre ausdruckslose Miene beizubehalten. Nach einem brüsken Nicken von Antonia nahm sie die erforderlichen Dinge aus ihrem Arbeitskorb und machte sich daran, den Brief sorgfältig auf eine Schriftrolle zu übertragen.
Pallas, der Sklave, dem Antonia am meisten traute, betrat den Raum. Er trug einen Reiseumhang und war offensichtlich dazu ausersehen, den Brief zu befördern. Ihre Herrin bedeutete ihm, schweigend zu warten, während Caenis ihre Aufgabe vollendete. Mit neuem Selbstvertrauen übertrug sie ihre Kurzschriftnotizen ohne jeden Fehler, schrieb ruhig und gleichmäßig, obwohl ihr Mund trocken und ihre Wangen erhitzt waren. Was sie da in Tinte auf Pergament übertrug, konnte das Todesurteil für sie alle sein.
Antonia las den Brief durch und unterzeichnete ihn. Caenis schmolz Wachs, um die Schriftrolle zu versiegeln. Pallas nahm sie entgegen.
»Das darf keinesfalls in fremde Hände fallen.« Antonia wiederholte damit eine offenbar schon früher gegebene Anweisung. »Wenn du angehalten wirst, sagst du, du seist auf dem Weg zu meinem Landgut in Bauli. Übergib den Brief nur dem Kaiser persönlich und warte, falls er dir Fragen stellen will.« Der Bote ging. Caenis mochte Pallas nicht besonders. Er war ein Grieche aus Arkadien, sichtbar ehrgeizig, und Caenis verstand nicht, was Antonia an ihm fand. Seine lässige Unbekümmertheit schien fehl am Platze. Aber vielleicht würde gerade seine sorglose Art die Wichtigkeit seiner Mission vor Spionen und Soldaten geheimhalten.
Die beiden Frauen saßen einen Moment schweigend da.
»Entferne jede Spur des Briefes von deinen Notiztafeln, Caenis.«
Caenis hielt die Tafeln über die Lampe, um das Wachs etwas weicher zu machen, und glättete dann sorgfältig jede Zeile der Kurzschrift mit der flachen Seite ihres Stilus. Den Blick auf die jetzt wieder glatte Oberfläche der Tafel gerichtet, sagte sie mit leiser Stimme: »Es nutzt nichts, Herrin. Ich hätte den Brief sowieso gelöscht, aber jedes Dokument, daß Sie mir diktieren, bleibt in meinem Gedächtnis haften.«
»Dann laß uns hoffen, daß deine Loyalität deinem Gedächtnis gleicht«, erwiderte Antonia trübe.
»Sie können sich auf beides verlassen.«
»Welch ein Glück für Rom! Du wirst hier in diesem Haus bleiben«, befahl Antonia. »Du darfst mit niemandem sprechen, bis diese Dinge geregelt sind. Es geht um die Sicherheit Roms und des Kaisers, um meine Sicherheit – und deine eigene.« Ein leichter Widerwille schlich sich in ihre Stimme: »Hast du Verehrer, die nach dir suchen könnten?«
»Nein, Herrin.« Erst an diesem Morgen war Caenis einem Mann begegnet, der ihre Gedanken für lange Zeit hätte beschäftigen können, aber die Geschehnisse des heutigen Abends hatten alles ausgelöscht. »Ich habe eine Freundin«, fuhr sie sachlich fort, »eine Girlandenflechterin namens Veronica. Sie wird vielleicht nach mir fragen, aber wenn der Pförtner sagt, daß ich für Sie arbeite, Herrin, wird sie zufrieden sein.« Veronica hatte nie Interesse an Caenis’ Pflichten als Schreiberin gehabt.
»Es tut mir leid, daß ich dich hier einsperren muß.«
»Ich werde es schon aushalten«, erwiderte Caenis lächelnd. Sie konnte ebensogut zugeben, was es für sie bedeutete, in Livias Haus zu wohnen.
In der Zwischenzeit konnten sie nur abwarten. Es würde Wochen dauern, wenn nicht länger, bis Pallas die Bucht von Neapel erreichte und der Kaiser reagierte. Möglicherweise kam die Botschaft niemals dort an.
Und selbst wenn Pallas Capri erreichte, bestand nach allem, was Caenis gehört hatte, durchaus die Möglichkeit, daß Tiberius Antonias Enthüllungen ignorieren würde. Er war launisch und unberechenbar, und niemand hört gern, daß man ihn betrogen hat. Selbst wenn Antonias wohlausgewogene Worte ihn überzeugten, war es möglich, daß er nichts unternahm. Die Prätorianergarde hatte in Rom die absolute Macht. Ihren Kommandeur zu verhaften schien unmöglich. Sie würden Seianus bis zum letzten Mann verteidigen.
Seine Spione und Agenten waren überall. Nur das Unerwartete an Antonias Vorgehen konnte Seianus vielleicht überlisten.
Kapitel III
Für Caenis war es in vieler Hinsicht die wichtigste Zeit ihres Lebens. Alles schien zu leicht. Alle wirkten zu froh, sie bei sich zu haben. Caenis, die jedem Lächeln mißtraute, fühlte sich für einige Zeit aus dem Gleichgewicht gebracht.
In einem Privathaus zu leben war wunderbar. Sie hatte eine eigene kleine Schlafkammer, statt sich einen Schlafplatz mit Veronica teilen zu müssen. Sie genoß sowohl das Gefühl der Zugehörigkeit als auch des Alleinseins.
Im Palast geboren und aufgewachsen, konnte Caenis kein Vaterland und keine Familie ihr eigen nennen; sie gehörte zu »Cäsars Familie«, aber dieser Titel bedeutete nur, daß sie kaiserliches Eigentum war. In gewisser Weise hatte sie Glück gehabt. So war ihr erspart geblieben, nackt und würdelos auf dem Marktplatz stehen zu müssen, angekettet zwischen Afrikanern, Syrern und Galliern, mit einem Schild um den Hals, auf dem ihr guter Charakter und ihre blühende Gesundheit gepriesen wurden, während gleichgültige Augen sie abtasteten und rauhe Hände in ihren Busen kniffen und sich zwischen ihre Schenkel schoben. Damit war sie ständiger Unsicherheit, einem Leben in Schmutz und Unrat, brutaler Gewalt und regelmäßiger sexueller Mißhandlungen entkommen. Das war ihr bewußt. Bis zu einem gewissen Grade war sie dankbar dafür.
Von ihrem Vater wußte sie nichts, von ihrer Mutter nur, daß auch sie eine Sklavin gewesen sein mußte. Caenis hatte nur bei ihrer Mutter bleiben dürfen, solange sie sehr klein war. Manchmal überkam sie kurz vor dem Einschlafen eine vage Erinnerung an diese Zeit. Bevor sie an die Palastschule übergeben wurde, in der die begabteren Sklavenkinder schreiben lernten, hatte ihre Mutter ihr die Ohren durchstochen, obwohl sie ihr als Ohrringe nur ein Stück Bindfaden mit aufgefädelten Steinchen geben konnte. Sie hatte offenbar angenommen, daß ihre Tochter nun soweit war, Goldscheibchen von den für solche Verlockungen empfänglichen Männern anzunehmen. Alle gingen von der törichten Annahme aus, ein Sklavenmädchen habe hübsch zu sein. Caenis war nicht hübsch. Sie wußte, daß sie durch ihre Klugheit vorwärtskommen würde, aber es machte sie trotzdem traurig.
Caenis war klug und aufgeweckt. Als Kind sogar in erschrekkendem Maße. Sie hatte gelernt, ihre Fähigkeiten zu verbergen, um in der Schule Bosheit und Neid zu entgehen, und diese dann später wirkungsvoll eingesetzt, um ein so lebensprühendes Mädchen wie Veronica als Freundin zu gewinnen. Schon als einsames Kind hatte Caenis begriffen, daß sie andere Menschen brauchte. Mit dem Älterwerden ließ ihr Widerstand nach, so daß sie sich nicht allzusehr quälen mußte und auch bei den Aufsehern nicht als widerspenstig galt. Aber sie war fest entschlossen, das Bestmögliche für sich zu erreichen. Daher war ihr die Arbeit bei Antonia so wichtig. Ermutigt durch das neue in sie gesetzte Vertrauen, machte Caenis ihre Sache ungewöhnlich gut. Nachdem sie einmal Antonias Aufmerksamkeit erregt hatte, nutzte sie nun jede Gelegenheit. Ruhig und gelassen arbeitete sie, als sei nichts geschehen – und gewann durch ihre zurückhaltende Reaktion auf die Ereignisse immer mehr das Vertrauen ihrer Herrin.
Diadumenus, der erfahren haben mußte, was geschehen war, zeigte gelegentliche Anzeichen der Eifersucht. Er war immer noch Chefsekretär, aber Caenis hatte etwas Besonderes zu bieten. Sie war eine Frau, und der siebzigjährigen Antonia mangelte es an weiblicher Gesellschaft. Ihre Herrin wollte weder ein junges Ding, das sie herumkommandieren konnte, noch einen Drachen, der versuchte, sie herumzukommandieren. Antonia brauchte jemanden mit gesundem Menschenverstand, jemand, mit dem sie reden, dem sie absolut vertrauen konnte. In Caenis hatte sie das alles gefunden, obwohl sie das Mädchen noch nicht gut genug kannte, um das zuzugeben. Aber beide hatten einen Akt des Wagemutes miteinander geteilt (und dazu einen traurigen, weil Antonia ihre eigene Tochter preisgegeben hatte). Jetzt besaßen sie ein gemeinsames Geheimnis und mußten das Ergebnis abwarten. Und falls Seianus herausfand, daß Antonia ihn denunziert hatte, war Herrin und Sklavin der Tod sicher.
Das Leben ging weiter. Alles mußte völlig normal erscheinen, das war von entscheidender Bedeutung. Besucher kamen und gingen. Aus Gründen der Geheimhaltung durfte Caenis sich ihnen nicht nähern, aber da sie ans Haus gebunden war, meldete sie sich freiwillig zu jeder Art Arbeit. Das schloß das Führen der Gästeliste mit ein. Caenis war eine Sekretärin, die praktisch unsichtbar blieb – während sie gleichzeitig alle Personen, deren Namen auf ihrer Liste auftauchten, genauestens inspizierte.
Unter Antonias Freunden befanden sich wohlhabende Männer im Konsulsrang wie Lucius Vitellius und Valerius Asiaticus, die manchmal eigene Klienten mitbrachten. Caenis entdeckte bald unter Vitellius’ Begleitern den Namen Flavius Sabinus, einer der beiden jungen Männer, denen sie im Palast den Weg gezeigt hatte. Momentan hatte er den zivilen Posten eines Ädilen inne, was ihn für einen Besuch in diesem Hause qualifizierte; für den tatsächlichen Zutritt war die Schirmherrschaft eines weit höher stehenden Senators nötig gewesen. Der Rahmen dieses inoffiziellen Hofes war für verarmte junge Männer mittleren Ranges aus ländlichen Regionen eine gute Gelegenheit, Einfluß zu gewinnen. Hier konnten sie Caligula und Gemellus, die Erben des Reiches, kennenlernen. Sie trafen auf Senatoren und Gesandte. Sie konnten sogar, wenn sie bereit waren, sich lächerlich zu machen, Bekanntschaft mit Claudius schließen, Antonias einzigem noch lebenden Sohn, der aufgrund verschiedener Behinderungen nicht am öffentlichen Leben teilnahm.
Die Brüder stammten aus Reate, das hatte Caenis bald herausgefunden. Reate war eine kleine Stadt in den Sabinerbergen – ein Geburtsort, über den römische Snobs sich mokieren würden. Die Familie vermittelte Verträge für Erntearbeiter und hatte ihr Geld als Steuereintreiber in verschiedenen Provinzen verdient. Der Vater war außerdem Bankier gewesen. In ihrer Heimat gehörten sie zu den Honoratioren, mußten sich aber in Rom, wo die Stammbäume der Senatoren bis ins Goldene Zeitalter zurückreichten, schwer durchkämpfen. Da Sabinus sich für den Senat qualifiziert hatte, mußte die Familie zumindest über eine Million Sesterzen verfügen, aber es war offensichtlich neues Geld, und wenn alles in Grund und Boden angelegt war, konnte Caenis sich gut vorstellen, daß die Brüder ihr tägliches Leben aus sehr geringen Mitteln bestreiten mußten.
Mit einiger Mühe, da es niemand zu wissen oder sich dafür zu interessieren schien, fand sie durch den Verwalter heraus, daß der jüngere Bruder Vespasian auf seinen Militärposten im Ausland zurückgekehrt war.
Am 17. Oktober bekam Antonia einen Brief, den Pallas aus Capri mitgebracht hatte. Sie las ihn allein und blieb in ihrem Zimmer. Pallas tauchte nicht wieder auf.
Bei Einbruch der Nacht wußte jedoch der ganze Haushalt Bescheid, und am nächsten Tag wurde das Ergebnis von Antonias Tat in ganz Rom bekannt: Um die Prätorianergarde zu umgehen, hatte der Kaiser frühere und jetzige Kommandeure der Stadtkohorten ins Vertrauen gezogen. Einer davon, Macro, war insgeheim zum neuen Prätorianerpräfekten ernannt worden. Er betrat Rom inkognito und trat gemeinsam mit Laco, dem gegenwärtigen Präfekten der Vigiles, in Aktion. Nachdem sie sorgfältige Vorkehrungen getroffen hatten, überredete Macro Seianus, in den Tempel des Apollo auf den Palatin zu kommen, wo der Senat tagte – nur wenige Schritte von Antonias Haus entfernt. Ein Brief des Kaisers an den Senat sollte verlesen werden. Seianus ließ sich davon überzeugen, daß ihm darin noch weit größere Ehrungen offeriert werden würden. Nachdem Seianus den Tempel betreten hatte, entließ Macro die Prätorianereskorte und befahl ihr, in ihr Lager zurückzukehren (das ironischerweise von Seianus selbst im Norden der Stadt für sie erbaut worden war). Macro ersetzte sie durch ergebene Mitglieder der Vigiles. Er selbst begab sich ins Prätorianerlager, um das Kommando zu übernehmen, befahl den Gardisten, in ihren Unterkünften zu bleiben, und verhinderte damit einen Aufstand. Währenddessen mußte Seianus feststellen, daß der kaiserliche Brief seine Verurteilung enthielt. Als er den Tempel verlassen wollte, wurde er von Laco, dem Kommandeur der Vigiles, festgenommen und in den Kerker auf dem Kapitol gebracht. Die Garde versuchte einen Aufstand, der jedoch bald niedergeschlagen wurde.
Seianus und seine Mitverschwörer wurden hingerichtet. Der erdrosselte Seianus wurde auf die Gemonische Treppe geworfen, die vom Kapitol hinunterführte. Dort schändete der Pöbel die Leiche drei Tage lang, bevor man sie mit Haken wegzog und wie Abfall in den Tiber warf. Seine Statuen wurden vom Forum und aus den Theatern entfernt. Auch seine Kinder wurden hingerichtet, wobei das Mädchen zuerst vergewaltigt wurde, um dem Henker das Verbrechen zu ersparen, eine Jungfrau zu töten. In Rom herrschten harte Gesetze, aber sie wurden eingehalten.
Antonia wurde zur Retterin von Rom und Kaiser erklärt. Tiberius pries ihre Rolle bei der Aufdeckung der Verschwörung und bot ihr den Titel Augusta an, dazu die formellen Ehren einer Kaiserin. Das lehnte sie mit der Bescheidenheit ab, die ihre Bewunderer von ihr erwarteten.
Von Mitte Oktober bis weit in den November hinein wurden in Livias Haus keine Besucher empfangen. Das Leben ging einigermaßen normal weiter. Eine gewisse Menge an Korrespondenz war zu erledigen, und der normale Tagesablauf wurde peinlich genau eingehalten. Inzwischen hatte man Antonias Tochter Livilla hierhergebracht und mit Erlaubnis des Kaisers der Obhut ihrer Mutter übergeben.
Anders als frühere gestrauchelte Töchter des Kaiserhauses, die nur ein skandalöses, ehebrecherisches Leben geführt und dem eigenen Vergnügen gelebt, sich aber nicht hatten hinreißen lassen, die Söhne von Kaisern zu vergiften oder die Stabilität Roms zu gefährden, wurde Livilla nicht auf eine einsame Insel verbannt oder von Soldaten hingerichtet. Sie hatte die strengen Grundsätze ihrer Mutter Antonia und ihrer noch strikteren Großmutter Octavia mit Füßen getreten. Sie war so dumm gewesen, sich von Seianus hinters Licht führen zu lassen. Sie hatte das Haus des Augustus in den Schmutz gezogen und ihre eigenen Kinder, die Enkelkinder und rechtmäßigen Erben des Kaisers, entehrt. Ihre Stellung rettete sie vor dem Henker, aber ihr Schicksal war gnadenlos.
Antonia nahm Livilla in ihrem Haus auf, sperrte sie in ein Zimmer und ließ sie dort verhungern.
Kapitel IV
Es gibt eine Zeit der Trauer und eine der Freude, und sie vergehen beide. Die Schreie und Hilferufe von Livilla wurden immer schwächer, bis sie schließlich verstummten. Jene, die dem erschüttert zuhören mußten, erholten sich, so gut es ging.
Allmählich beruhigte sich das Haus der Livia, kehrte wie Rom zu dem zurück, was als normale Häuslichkeit galt. Ein Schatten hatte sich vom Römischen Reich gehoben, und die Stadt war voller Erleichterung.
Jahre vergingen. Alpträume endeten. Das Leben einzelner nahm eine bessere Wendung. Das war der Grund, warum Caenis sang, als fast zwei Jahre später der jüngere Bruder von Flavius Sabinus die Tür eines gewissen Büros im Verwaltungstrakt des Palatin öffnete.
Sie sang sogar ziemlich laut, weil sie meinte, daß niemand in der Nähe sei. Außerdem sang sie gern. Und Livias Haus war kaum der richtige Ort dafür.
Sie verstummte jäh.
»Hallo!« rief Vespasian. »Du siehst sehr tüchtig aus!«
Er trat ein. Caenis setzte eine Miene totaler Überraschung auf.
Sie wußte, daß seine Stationierung in Thrakien beendet war.
Sie hatte ihn erwartet.
Männer seines Ranges hatten nicht auf der Suche nach weiblichen Schreibern durch den kaiserlichen Palast zu schlendern. Doch Vespasian schaute sich völlig unbeeindruckt in aller Ruhe um.
Antonia hatte für ihre Kopisten ein großes Büro besorgt. Sie führte einen sparsamen Haushalt und war skrupelloser darin, sich Vorteile zu verschaffen, als es ihr Ruf vermuten ließ. Tiberius wäre früher geizig genug gewesen, selbst von einer verwitweten Verwandten Miete zu kassieren, aber niemand hatte ihm je gesagt, daß sie diese Räume nutzte. Er hatte den Verdacht, daß man ihn hinterging, also tat man es auch. Außerdem konnte Antonia heutzutage tun, was sie wollte. Sie war die Mutter Roms.
Die Luft im Raum war abgestanden. Es war kalt, roch nach Tieren im Winterschlaf. Die Farben der Fresken waren verblichen. Während der langen Abwesenheit des Kaisers waren große Teile seines Palastes verfallen; unbeaufsichtigt, kümmerten sich die kaiserlichen Beamten wenig um die Renovierung von Gebäudeteilen, die sie nicht selbst benutzen wollten. Caenis, ein Mädchen, das seinen Willen durchzusetzen wußte, war entschlossen, sich mit dem Präfekten der Palastarbeiter anzufreunden.
Vespasian piekte mit dem Finger in ein aufgeworfenes Stück Putz. »Das hält nicht mehr lange.«
»Ganz Rom fällt auseinander«, bemerkte Caenis. »Warum sollte es im Haus des Kaisers anders sein?«
Tiberius ging bei öffentlichen Bauvorhaben ziellos und unstet vor. Er begann mit dem Bau eines dem Augustus geweihten Tempels und der Renovierung des Pompeiustheaters, aber beides blieb unvollendet. Den Palast hatte der Kaiser nur hin und wieder bewohnt, bevor er sich ganz aus Rom zurückzog. Vespasian grummelte: »Er sollte ordentlich bauen, mehr bauen, besser bauen, andere ermutigen und ein vernünftiges Vorbild sein.«
Dann wandte er Caenis seine kritische Aufmerksamkeit zu. An ihr waren deutliche Anzeichen der Verbesserung zu bemerken. Sie sah sauber und ordentlich aus. Antonia erlaubte ihr und den Kopistinnen, während der für Frauen reservierten Öffnungszeiten die öffentlichen Bäder zu benutzen. Caenis’ dunkles Haar war im Nacken zu einem Knoten zusammengesteckt, und sie trug ein Gewand von besserer Qualität. Obwohl sie an einem wackeligen Tisch arbeitete, der mit einem Holzstückchen unter dem einen Bein stabilisiert werden mußte, saß sie mit offensichtlichem Besitzerstolz da. Sie war zur Leiterin des Büros befördert worden. Keine ihrer Untergebenen war anwesend. Caenis blieb absichtlich länger, genoß ihre Autorität, während sie die Arbeit der anderen durchsah und korrigierte. Das bekannte Gesicht vor sich, lächelte sie erfreut.
Der zurückgekehrte Tribun nahm alles in sich auf. Caenis war sicher, daß er die feinen Veränderungen ihrer Situation bemerkt hatte.
»Eine Tyrannin des Sekretariats!« neckte er sie, während er näher trat. Er schien größer und noch muskulöser, als sie ihn in Erinnerung hatte, tiefgebräunt durch das Soldatenleben im Freien. »Dieses erstaunlich beängstigende Glitzern in den Augen ...« Caenis ging nicht darauf ein.
Er kam an ihren Tisch, hockte sich auf die Ecke und sah sich weiter um, als wäre selbst ein heruntergekommenes Kabuff im Palast neu für ihn. Eine Öllampe neigte sich gefährlich. Caenis stützte die Ellbogen schwer auf den Tisch, damit er nicht umkippte und Vespasian zu Boden fiel. Er bemerkte es, machte aber keine Anstalten, sein Gewicht zu verlagern. Sie faltete die Hände über den Notiztafeln, die sie gerade geordnet hatte, um Vespasian (der neugierig den Hals reckte) den Blick zu versperren.
»Guten Abend, mein Herr.«
Flavius Vespasianus schenkte ihr sein seltenes, aber hinreißendes Grinsen. »Du läßt nach. Das letzte Mal wurde mir befohlen, in den Styx zu springen!«
»Antonias Sekretariat respektiert Standesprivilegien.« Caenis durfte inzwischen so ironisch sein, wie es die angesprochene Person tolerieren würde. Durch die Wichtigkeit ihrer Herrin und die Verantwortung, die ihr Posten mit sich brachte, hatte sie eine gewisse Autorität gewonnen. Antonias Besucher behandelten sie mit Achtung. »Sind Sie inzwischen reich, Tribun?« stichelte sie.
»Ich werde niemals reich sein, aber ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Nur keine Aufregung, es ist nichts zum Anziehen.« Er war ohne Begleitung gekommen. Unter seinem Arm klemmte ein ziemlich schmieriges Paket.
»Kann man es essen?« kicherte sie plötzlich.
»Ich schulde dir eine Wurst.«
»Und das ist sie? Nach zwei Jahren, Herr?«
»Ich mußte nach Thrakien«, erklärte er gewichtig. »Wenn ich die Überfahrt verpaßt hätte, wäre es das Ende meiner Karriere gewesen.« Er sagte das so, als hätte er ernstlich überlegt, sein Schiff trotzdem zu verpassen. Caenis verspürte ein seltsames Flattern im Bauch und ignorierte es tapfer. Er gab ihr das Paket. »Ich nehme an, du bist ein Mädchen, das eingelegten Fisch mag?« Sie aß eingelegten Fisch für ihr Leben gern. »Schaffst du auch noch ein gefülltes Ei?«
»Nur eins?«
»Das andere habe ich auf dem Weg hierher gegessen.«
Ehrlich schockiert, platzte sie heraus: »Auf der Straße, Herr?«
»Auf der Straße«, bestätigte er seelenruhig. Einen Moment lang hielt sie ihn für einen richtigen Bauerntölpel, der gar nicht wußte, was er da getan hatte, dann begegnete sie seinem belustigten Blick. Er hatte sie durchschaut. Caenis runzelte die Stirn mit einer Mischung aus Vergnügen und Verwirrung. Sie stellte sich vor, wie er durch die lärmenden Straßen Roms schlenderte. Vermutlich würde er sowas einfach machen, und wahrscheinlich hatte es nicht einmal jemand bemerkt. Ein Ritter, ein eben aus dem Militärdienst entlassener und für die höchsten Verwaltungsämter qualifizierter Tribun, ohne jede Begleitung, mit einem Paket unter dem Arm, der ein gefülltes Ei verzehrte.
»Empörend«, nickte er verschmitzt. »Also: Du hast einen Mann vor dir, der seine Schulden bezahlt.«
»So einer ist mir noch nie untergekommen!«
Ihre sarkastische Bemerkung ließ ihn innehalten, dann fuhr er fort: »Seit Tagen versuche ich, dich zu finden. Beim Fleischer bin ich derart zum lebenden Inventar geworden, daß er meint, ich würde ihn und seine Frau ausspionieren. Ich wäre heute schon früher hiergewesen, aber das Zeug war in das alte Manuskript eines zweitklassigen Poeten verpackt. Du weißt, wie das geht – man entdeckt einen einigermaßen guten Satz und steht eine Stunde später immer noch an der gleichen Straßenecke und sucht das gesamte Einwickelpapier nach einem wenigstens einigermaßen vernünftigen Reim ab ... Wie ist es, können wir uns das hier teilen?«
Caenis bekam allmählich Angst. Jedes Wort, das er aussprach, erzwang geradezu ihre Sympathie. Zum ersten Mal mit ihr allein, bemühte er sich nicht, galant zu sein, noch machte er sonst irgendwelche Umstände. Vielleicht nahm er an, daß Ritter und Senatoren ständig mit improvisierten Mahlzeiten hier hereinplatzten. Diese braunen Augen wußten genau, was sie ihr antaten. Plötzlich versuchte er, ihr Informationen zu entlocken: »Es gab einige große Ereignisse in Rom nach meiner Abreise nach Thrakien. Wußtest du, was auf Seianus zukommen würde?«
Caenis betrachtete Antonias Brief nach wie vor als vertraulich. Außerdem war sie darin geschult, die Neugier Fremder abzuwehren. Sie fragte streng: »Ich nehme nicht an, daß Sie auch Brot mitgebracht haben?« Und bevor er reagieren konnte, griff sie nach unten und holte den flachen, runden Brotlaib aus ihrem Korb, von dem sie später hatte essen wollen. »Ich denke, wir sollten besser in den Vorratsraum umziehen«, sagte sie. »Ich möchte nicht dabei erwischt werden, wie ich eingelegten Fisch esse und den Brief meiner Herrin an den König von Judäa als Serviette benutze.«
Caenis besaß jetzt einen Teller. »Angeschlagen, aber nicht zersprungen, genau wie mein Herz ...«
Er lachte nicht. Er hatte eine Art, beim Zuhören unverbindlich zu schauen, die ihr nicht verriet, ob sie ihn amüsierte oder erstaunte.
Es war eine andere Jahreszeit. April. Der Kaiser weilte immer noch auf Capri. Die Tage wurden länger, aber der Palast lag schweigend da, erleuchtet von Myriaden von Öllampen, die niemandem nützten.
Diesmal aßen sie die Wurst kalt. Vespasian schnitt sie selbst auf. »Ich finde, die schmeckt nicht so gut wie deine; ich hätte dich fragen sollen, was ich besorgen muß ...« Es war eine geräucherte lukanische Salami mit zu viel Kümmel, dafür aber zuwenig anderen Gewürzen. Caenis beschwerte sich nicht. Es war das erste Geschenk, das sie jemals bekommen hatte. Veronica hätte sie ausgelacht. Für sie war ein Geschenk etwas Glitzerndes und leicht zu Versetzendes.
»Wenn man über ein Jahr auf die Bezahlung einer Schuld gewartet hat«, bemerkte Caenis mild, »macht man das Beste aus dem, was man bekommt.«
Nach einer Weile wollte er, immer noch kauend, wissen:
»Darfst du in deiner Freizeit allein ausgehen?«
Genau das hatte sie vermeiden wollen. Da sie aber dummerweise sehr ehrlich war, sagte sie: »Manchmal.«
»Und was machst du dann?«
»Morgen schaue ich mir einen Mimen an.«
Er betrachtete sie interessiert. Sie stöhnte innerlich. »Ich habe dich singen hören. Gefallen dir auch die Tänzer?«
»Ich mag Flötenmusik. Man kann sich darin verlieren«, murmelte sie. Sie wollte nicht darüber reden, dachte nicht daran, jemandem von Rang ihre Seele zu offenbaren.
»Verlieren ist gar nicht nötig«, stichelte er. »Hast du nette Begleitung?«
»Allerdings!« gab sie schnippisch zurück, ohne nachzudenken. »Mich selbst.« Sie biß in ein knuspriges Stück Brotkruste und sah ihn nicht an. Eine kurze Pause entstand.
»Kein Mann?«
Inzwischen vorbereitet, gelang es ihr, der Frage auszuweichen: »Männer sind nicht nett, Herr. Manchmal nützlich, gelegentlich amüsant, selten aufrichtig und niemals nett.«
»Frauen sind schlimmer. Sie kosten eine Menge Geld und enttäuschen einen trotzdem«, neckte er. Sie ging nicht darauf ein.
»Ich gehe vor allem deswegen allein, weil ich es nicht leiden kann, wenn irgendwelche Idioten mir die Ohren vollquatschen, während die Musik spielt.«
Lächelnd stellte er fest, wie typisch dieser Satz für sie war. Sie war genauso gradlinig wie er. »Wer ist der Mime?«
»Blathyllos.«
»Ist er gut? Vielleicht komme ich auch. Ich rede nicht; ich schlafe immer ein. Zum Glück schnarche ich nicht.«