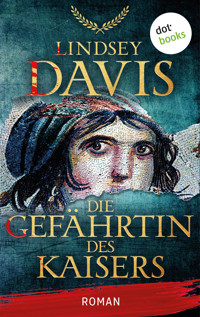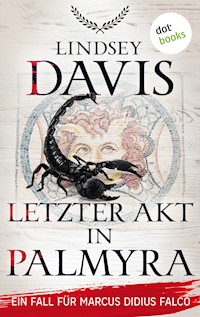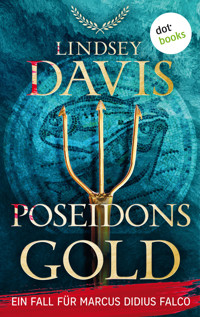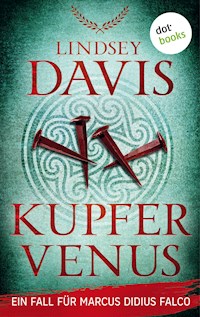5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Die tödliche Welt der Literatur: Der fesselnde historische Kriminalroman »Tod eines Mäzens« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 74 nach Christus. Marcus Didius Falco, der begabteste Privatermittler der »Ewigen Stadt«, ist ein Mann vieler Talente: Wenn er einmal nicht niederträchtigen Verbrechern das Handwerk legt, widmet er sich in seiner Freizeit der Dichtkunst. Bei einer öffentlichen Lesung wird der vermögende Aurelius Chrysippus auf ihn aufmerksam; doch sein Angebot, Falcos Schriften zu verlegen, entpuppt sich schnell als mieses Geschäft. Als der Mäzen kurz darauf zu Tode geprügelt aufgefunden wird, gerät Falco unter Verdacht. Ihm bleibt nur eine Lösung: selbst in dem Fall zu ermitteln und den wahren Mörder zu finden. Falco taucht ein in einen Sumpf aus Habgier und Missgunst, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint … »Das Porträt der überfüllten Metropole des Kaisers Vespasian ist so elegant und malerisch wie nie zuvor bei Davis.« The Birmingham Mail Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Tod eines Mäzens« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der zwölfte Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 74 nach Christus. Marcus Didius Falco, der begabteste Privatermittler der »Ewigen Stadt«, ist ein Mann vieler Talente: Wenn er einmal nicht niederträchtigen Verbrechern das Handwerk legt, widmet er sich in seiner Freizeit der Dichtkunst. Bei einer öffentlichen Lesung wird der vermögende Aurelius Chrysippus auf ihn aufmerksam; doch sein Angebot, Falcos Schriften zu verlegen, entpuppt sich schnell als mieses Geschäft. Als der Mäzen kurz darauf zu Tode geprügelt aufgefunden wird, gerät Falco unter Verdacht. Ihm bleibt nur eine Lösung: selbst in dem Fall zu ermitteln und den wahren Mörder zu finden. Falco taucht ein in einen Sumpf aus Habgier und Missgunst, aus dem es kein Entkommen zu geben scheint …
»Das Porträt der überfüllten Metropole des Kaisers Vespasian ist so elegant und malerisch wie nie zuvor bei Davis.« The Birmingham Mail
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe März 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »Ode to a Banker« bei Century, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2000 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2003 Knaur VerlagEin Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Alfiya Safnanova, Andrea Izzotti
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-96655-980-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Marcus Didius Falco 12« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Tod eines Mäzens
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Für Simon King
(ein weiteres meiner »Lieber Simon«-Briefchen ...)
zu deinem Abschied von Random House.
Mit Dank für deine Freundschaft, Geduld
und treue Unterstützung für Falco – und im Gedenken
an den geräucherten Aal.
Dementi der Autorin
Ich versichere hiermit ausdrücklich, dass der Schriftrollenladen des Aurelius Chrysippus auf dem Clivus Publicus keine Ähnlichkeit mit meinen Verlegern hat – die ein Vorbild an literarischer Urteilskraft, prompter Bezahlung, fairen Umgangs, durchdachten Marketings und köstlicher Luncheinladungen sind. (NB: Dieses Buch ist einem der hervorragendsten Männer gewidmet, der einer von ihnen war.)
Die Ansichten von M. Didius Falco über die Charaktere und Gewohnheiten von Autoren sind ausschließlich seine eigenen; offensichtlich ist er meinen wunderbaren Kollegen noch nicht begegnet.
Das Goldene Pferd ist mit Sicherheit nicht meine Bank.
Dramatis Personae
Alte Hasen
M. Didius Falco/Dillius Braco/Ditrius Basto: ein bekannter Römer
Helena Justina: eine Heldin (eine treue Leserin)
Mama (Junilla Tacita): eine gerissene Anlegerin
Papa (Geminus): ein angeschlagener alter Bock
Maia Favonia (eine Schwester): eine Spätentwicklerin auf Arbeitssuche
Junia (noch eine Schwester): eine erfahrene Führungskraft
Rutilius Gallicus: ein ranghoher Freizeitautor
Anacrites: ein niedriger Kriecher mit wechselnden Interessen
A. Camillus Aelianus: ein schlecht gerüsteter aristokratischer Lehrling
Gloccus und Cotta: unsichtbare Badehausbauunternehmer
Diverse Kinder, Hunde, Schwangerschaften, Welpen
Die Vigiles
Petronius Longus: ein Stellvertreter, der einen guten Fang machen will
Fusculus: ein alter Hase mit Vorurteilen
Passus: ein Neuer mit einem Sinn für Abenteuer
Sergius: ein beamteter Schläger
Die literarische Welt
Aurelius Chrysippus: ein Mäzen der Literatur (ein Schwein)
Euschemon: ein Schriftrollenverkäufer (ein guter Kritiker) (ein was?)
Avenius: ein Historiker mit Schreibblockade
Turius: ein Utopist mit Allergien (gegen Arbeit)
Urbanus Trypho: der Shakespeare (Bacon?) seiner Zeit
Anna, Tryphos Frau: die sich auszukennen scheint
Pacuvius (Scrutator): ein tratschender Satiriker (ausgestorbene Spezies)
Constrictus: ein Liebeslyriker, der verlassen werden will
Blitis: aus einer Schriftstellergruppe (schreibt momentan nicht)
Aus der Geschäftswelt
Nothokleptes: ein diebischer Drecksack (ein Bankier)
Aurelius Chrysippus: (der schon wieder) ein geheimnistuerischer Geschäftsmann
Lucrio: ein Bankangestellter (unsichere Depositen)
Bos: ein großer Mann, der Bankforderungen erklärt
Diomedes: ein sehr religiöser Sohn mit künstlerischen Steckenpferden
Lysa (erste Frau des Chrysippus): eine Frau, die Männer und ihre Geschäfte aufbaut (voller Groll)
Vibia (zweite Frau von dito): eine begeisterte Hausfrau (liebt weiche Möbel)
Pisarchus: ein Transportunternehmer, der vielleicht nichts mehr zu transportieren hat
Philomelus: sein Sohn, ein Arbeitstier mit einem Traum
In den Nebenrollen
Domitian: ein junger Prinz (ein Hasser)
Aristagoras: ein alter Mann (ein Liebhaber?)
Eine alte Frau: eine Zeugin
Perella: eine Tänzerin
Rom: Mitte Juli – 12. August, 74 n. Chr.
Buch, im Allgemeinen mehrere zu einem Ganzen verbundene Blätter oder Bogen Papier, Pergament etc., mögen diese beschrieben sein oder nicht; meistenteils versteht man jedoch heutzutage unter einem Buch einen Band von bedruckten Blättern.
[Der Gläubiger] überprüft deine Familienangelegenheiten; er mischt sich in deine Geschäfte ein. Trittst du aus deiner Kammer, zerrt er dich mit und schleppt dich fort; versuchst du dich drinnen zu verstecken, steht er vor deinem Haus und klopft an die Tür.Wenn [der Schuldner] schläft, sieht er hinter seinem Kopf den Geldverleiher stehen, ein böser Traum ... Wenn ein Freund an die Tür klopft, versteckt er sich unter dem Bett. Bellt der Hund? Ihm bricht der Schweiß aus. Die fälligen Zinsen vermehren sich wie ein Hase, ein wildes Tier, von dem die Alten glaubten, dass es sich ununterbrochen fortpflanzt, noch während es die Jungen säugt, die es bereits geworfen hat.
Basilius von Caesarea
Kapitel I
Dichten sollte eine ruhige Beschäftigung sein, bei der einem nichts zustößt.
»Nimm deine Schreibtafeln mit in unser neues Haus«, schlug Helena Justina vor, meine kultivierte Lebenspartnerin. Ich kämpfte noch mit dem Schock und der körperlichen Erschöpfung nach einer dramatischen unterirdischen Rettungsaktion. In der Öffentlichkeit hatten die Vigiles den Ruhm dafür eingestrichen, aber ich war der bekloppte Freiwillige gewesen, der sich kopfüber an Seilen in den Schacht hatte hinabsenken lassen. Das hatte mich für etwa einen Tag zum Helden gemacht, und ich war namentlich (falsch geschrieben) im Tagesanzeiger erwähnt worden. »Setz dich einfach in den Garten und ruh dich aus«, besänftigte mich Helena, nachdem ich mehrere Wochen lang in unserer römischen Wohnung auf und ab getigert war. »Du kannst die Arbeiten am Badehaus überwachen.«
»Das kann ich nur, wenn diese faulen Kerle endlich mal auftauchen.«
»Nimm die Kleine mit. Ich komme vielleicht auch – wir haben inzwischen so viele Freunde im Ausland, dass ich an den Gesammelten Briefen der Helena Justina arbeiten sollte.«
»Unter deinem Namen?«
Was – dem einer Senatorentochter? Die meisten sind zu dumm und zu sehr damit beschäftigt, ihren Schmuck zu zählen. Keine wurde je ermutigt, mit ihren literarischen Fähigkeiten an die Öffentlichkeit zu treten, vorausgesetzt, sie besitzen welche. Aber man setzt ja auch nicht voraus, dass sie mit Privatermittlern zusammenleben.
»Wird höchste Zeit«, erwiderte sie energisch. »Die meisten veröffentlichten Briefe stammen von blasierten Männern, die nichts zu sagen haben.«
Meinte sie das ernst? Schrieb sie heimlich Liebesgeschichten? Oder zog sie nur am Seil meines Flaschenzugs, um zu sehen, wann es mich zerriss? »Na gut«, meinte ich milde. »Setz du dich in den Schatten einer Pinie mit deinem Stilus und deinen hochfliegenden Gedanken, Schätzchen. Ich kann derweilen gern hinter unserer süßen Tochter herrennen und gleichzeitig diese unzuverlässigen Bauarbeiter überwachen, die unseren neuen Dampfraum zerstören wollen. Und wenn zwischen dem Schreien und dem Steineschneiden mal eine Pause eintritt, kann ich rasch meine eigenen kleinen Oden hinschmieren.«
Jeder Möchtegernautor braucht Ruhe und Frieden.
Es wäre wunderbar gewesen, den Sommer so zu verbringen, der Hitze der Stadt zu entfliehen und in unserem geplanten neuen Haus auf dem Juniculum zu sitzen – bis auf eines: Unser neues Haus war eine Bruchbude, unsere Tochter war im Trotzalter, und die Dichtkunst verleitete mich zu einer öffentlichen Lesung, was schon töricht genug war. Das brachte mich in Kontakt mit der Chrysippus-Organisation. Alles im Geschäftsleben, das wie ein sicheres Angebot aussieht, kann ein Schritt auf dem Leidensweg sein.
Kapitel II
Ich muss verrückt gewesen sein. Vielleicht auch noch betrunken.
Warum hatten mich die kapitolinischen Götter nicht beschützt? Na gut, ich gebe zu, dass Jupiter und Minerva mich wahrscheinlich als ihren allerunwichtigsten Diener betrachteten, ein bloßer Sklave einer Pfründe, ein Pöstcheninhaber, ein Karrieremacher, und dazu auch noch ein halbherziger. Aber Juno hätte mir da raushelfen können. Juno hätte sich wirklich aufraffen können, statt lässig auf dem Ellbogen zu lehnen und olympische Brettspiele mit Heldenquälerei und Ehemannverfolgung zu spielen; die Königin des Herzens hätte den Würfel lange genug still halten können, um zu bemerken, dass dem neuen Prokurator ihrer heiligen Gänse eine unmögliche Panne in seinem ansonsten so glatt laufenden Gesellschaftsleben passiert war: Ich hatte mich dummerweise bereit erklärt, die Vorgruppe zur Dichterlesung eines anderen abzugeben.
Mein Schriftstellerkollege war ein Senator im Rang eines Konsuls. Eine Katastrophe. Er würde davon ausgehen, dass seine Freunde und Verwandten auf bequemen Bänken saßen, während meine sich in die paar Zoll der Stehplätze quetschten. Er würde den größten Teil der Lesezeit für sich beanspruchen. Und statt mich tatsächlich als Vorgruppe zu benutzen, würde er als Erster lesen, solange das Publikum noch wach war. Darüber hinaus war er garantiert ein absolut grausiger Dichter. Ich spreche von Rutilius Gallicus. Genau. Dem Rutilius Gallicus, der eines Tages Stadtpräfekt sein würde – des Kaisers Vertreter für Ruhe und Ordnung, Domitians Muskelbubi, der große Mann, der heutzutage von der Bevölkerung so geliebt wird (wie uns jene weismachen, die uns sagen, was wir zu denken haben). Vor zwanzig Jahren, zur Zeit unserer Lesung, war er nur ein x-beliebiger alter Exkonsul. Damals saß immer noch Vespasian auf dem Thron. Als dessen Legat in Tripolitanien hatte Rutilius vor kurzem einen Grenzstreit beigelegt, was immer auch davon zu halten war (nicht viel, außer man hatte das Pech, in Leptis Magna oder Oea zu leben). Er hatte sich noch nicht für den Statthalterposten in einer Provinz qualifiziert, war noch nicht berühmt für seine germanischen Heldentaten, und niemand hätte je erwartet, dass er selbst einstmals der Gegenstand heroischer Dichtung werden würde. Eine Berühmtheit in Wartestellung. Ich hielt ihn für einen freundlichen Menschen mit mäßiger Begabung, einen Provinzler, der sich gerade mal daran aufrecht hielt, eine Senatorentoga zu tragen.
Falsch, Falco. Er war mein Freund, wie es schien. Ich betrachtete diese Ehre mit großer Vorsicht, da ich schon zu dem Zeitpunkt den Eindruck hatte, dass er sich bei Domitian einschleimte, unserem am wenigsten geliebten kaiserlichen Prinzlein. Rutilius schien zu glauben, das würde ihm Vorteile einbringen. Ich wählte meine Kumpel sorgfältiger aus.
Zu Hause bei seiner matronenhaften Frau, die aus seiner eigenen Heimatstadt stammte – Augusta Taurinorum in Norditalien –, und bei seiner Familie, wie immer die auch aussehen mochte (wie sollte ich das wissen? Ich war nur ein vor kurzem beförderter Ritter; er mochte sich mit mir als Leidensgenossen im Exil angefreundet haben, als wir uns im entlegenen Afrika getroffen hatten, aber in Rom würde ich nie in sein Haus eingeladen werden, um seine edle Verwandtschaft kennen zu lernen), zu Hause wurde der fröhliche Gallicus wahrscheinlich Gaius oder so gerufen. Ich war nicht dazu berechtigt, sein Praenomen zu benutzen. Und auch er würde mich nie Marcus nennen. Ich war Falco; für mich würde er »Herr« bleiben. Ich wusste nicht, ob er den versteckten Spott in meinem respektvollen Ton bemerkte. Ich trug nie zu dick auf, wollte mir nichts zu Schulden kommen lassen. Außerdem, falls er tatsächlich Domitians Busenfreund wurde, wusste man nie, wohin Speichelleckerei führen konnte.
Tja, einige von uns wissen es jetzt. Aber damals hätte niemand vermutet, dass Rutilius Gallicus es mal zu Gunst und Ehren bringen würde.
Einer der Vorteile, sich die Bühne mit einem Patrizier zu teilen, lag darin, dass er einen eindrucksvollen Vortragsort wählte. Unsere Bühne war nichts Geringeres als die Gärten des Maecenas – diese luxuriösen Spazierwege an der Rückseite des Oppius, quer durch die alten republikanischen Stadtmauern, angelegt auf den uralten Begräbnisstätten der Armen. (Eine Menge Dünger in situ, wie Helena bemerkte.) Jetzt befanden sich die Gärten im Windschatten des neueren Goldenen Hauses, waren weniger gepflegt als früher, existierten aber noch und gehörten der kaiserlichen Familie, seit Maecenas vor siebzig Jahren gestorben war. In der Nähe stand ein Pavillon, von dem aus Nero angeblich das Wüten des Großen Feuers beobachtet hatte.
Maecenas war Augustus’ berüchtigter Finanzier: Geldbeschaffer für Kaiser, Freund berühmter Dichter – und ein rundherum wirklich abscheulicher Perverser. Doch wenn ich jemals einen etruskischen Edelmann finden sollte, der mich zum Essen einlud und meine Dichtkunst förderte, würde ich mich wohl damit abfinden können, dass er hübsche Jungs betatschte. Vermutlich gab er auch ihnen zu essen. Jedes Patronat ist eine Art Zuhälterei. Ich hätte mich fragen sollen, welche Dankesbezeigungen Rutilius von mir erwartete.
Nun ja, unsere Situation war anders, sagte ich mir. Mein Patron war ein wohlerzogener flavischer Tugendbold. Aber kein Tugendbold ist perfekt, zumindest nicht aus der Sicht der aventinischen Plebs, in der Charakterfehler sprießen wie Schimmel in schlecht gepflegten Badehäusern, in rüpelhaften Familien wie meiner Verheerung anrichten und uns mit der hochmütigen Elite in Konflikt bringen. Warum ich so drauf rumhacke? Weil Gallicus’ großer Augenblick in Tripolitanien darin bestanden hatte, die öffentliche Hinrichtung eines Säufers anzuordnen, der die örtlichen Götter beleidigt hatte. Zu spät hatten wir entdeckt, dass der glücklose Schreihals, der von dem Löwen gefressen wurde, mein Schwager war. Rutilius musste unsere gemeinsame Lesung wohl aus Schuldgefühl mir gegenüber, seinem damaligen Hausgast, finanzieren.
Besorgt fragte ich mich, ob meine Schwester ihre Witwenschaft durch einen Besuch der Veranstaltung beleben würde. Wenn ja, würde sie meine Verbindung zu Rutilius durchschauen? Maia war die Kluge in unserer Familie. Wenn ihr klar wurde, dass ich gemeinsam mit dem Mann las, der ihren verstorbenen Mann verurteilt hatte, was würde sie ihm dann antun – oder mir?
Besser, ich dachte nicht darüber nach. Ich hatte genug Sorgen.
Schon einmal hatte ich versucht eine öffentliche Lesung zu veranstalten, aber aufgrund eines Missgeschicks bei der Werbung war niemand erschienen. Offenbar hatte am selben Abend ein rauschendes Fest stattgefunden. Alle, die ich eingeladen hatte, ließen mich im Stich. Jetzt fürchtete ich mich vor noch mehr Beschämung, war aber trotzdem entschlossen, meinem engsten Freundes- und Familienkreis zu beweisen, dass die Liebhaberei, die sie verspotteten, gute Ergebnisse hervorbringen konnte. Als Rutilius mir gestand, er würde ebenfalls dichten, und diese Lesung vorschlug, hatte ich erwartet, dass er dafür vielleicht seinen eigenen Garten zur Verfügung stellen würde, für eine kleine Gruppe vertrauenswürdiger Bekannter, denen wir in der Abenddämmerung ein paar gemurmelte Hexameter vortragen würden, begleitet von Süßigkeiten und mit viel Wasser verdünntem Wein. Aber er war derart ehrgeizig, dass er loszog und Roms elegantesten Saal mietete, das Auditorium in den Gärten des Maecenas. Ein exquisiter Ort, in dem die Echos von Horaz, Ovid und Virgil herumspukten. Um dem Ganzen Ehre zu machen, erfuhr ich, dass die persönliche Gästeliste meines neuen Freundes von seinem anderen lieben Freund Domitian angeführt wurde.
Ich stand an der äußeren Schwelle des Auditoriums, eine ganz neue Schriftrolle unter den Arm geklemmt, als mein Kumpel mir stolz diese Nachricht verkündete. Wie er sagte, gehe sogar das Gerücht, dass Domitian Cäsar auftauchen werde. Gute Götter.
Es gab kein Entkommen. Alle Speichellecker von Rom hatten die Nachricht vernommen, und die sich hinter mir drängende Menge ließ mir keine Möglichkeit, mich zu verdrücken.
»Was für eine Ehre!«, höhnte Helena Justina, während sie mich mit der flachen Hand zwischen meinen plötzlich schweißnassen Schulterblättern die berühmte geflieste Eingangsrampe runterschob. Es gelang ihr, ihre Brutalität mit einem gleichzeitigen Zurechtrücken ihrer feinen, mit geflochtenen Borten verzierten Stola zu überdecken. Ich hörte zartes Geklimper von den vielen Goldplättchen ihrer Ohrringe.
»Was machst du da mit mir? Nüsserollen?« Die Rampe war sehr steil. Mumienartig in meine Toga gewickelt, schlitterte ich die lange Schräge hinunter wie eine Haselnuss bis zu dem großen Durchgang ins Innere. Helena schob mich direkt hindurch. Mich überkam Nervosität. »Oh, schau mal, Liebste, man hat einen Sittsamkeitsvorhang aufgehängt, hinter dem sich die Frauen verbergen sollen. Zumindest kannst du dort einschlafen, ohne dass es jemand merkt.«
»Ich geb dir gleich Nüsserollen«, erwiderte die wohlerzogene Senatorentochter, die ich manchmal wagte meine Frau zu nennen. »Wie altmodisch! Wenn ich ein Picknick mitgebracht hätte, würde ich mich vielleicht dahinter zurückziehen. Da mich niemand vor dieser Abscheulichkeit gewarnt hat, Marcus, werde ich in aller Öffentlichkeit sitzen und bei jedem deiner Worte entzückt lächeln.«
Ich brauchte ihre Unterstützung. Aber abgesehen von meiner Nervosität staunte ich jetzt mit offenem Mund über die Schönheit der Lokalität, die sich Rutilius Gallicus für unser großes Ereignis unter den Nagel gerissen hatte.
Nur ein außergewöhnlich reicher Mann mit einer Neigung für die Vermischung von Literatur mit üppigen Banketts konnte es sich leisten, diesen Pavillon zu bauen. Ich war noch nie im Inneren gewesen. Als Veranstaltungsort für zwei Amateurdichter war es lächerlich. In hohem Maße übertrieben. Unsere Stimmen würden widerhallen. Die Hand voll unserer Freunde würde jämmerlich aussehen. Wir konnten von Glück sagen, wenn wir es überstehen würden.
Im Inneren hätte man glatt eine halbe Legion unterbringen können, einschließlich der Belagerungsartillerie. Die Decke schien hoch über dem herrlich proportionierten Saal zu schweben, an dessen Ende sich eine Apsis mit traditionellen marmorverkleideten Stufen befand. Maecenas musste einen eigenen Marmorbruch besessen haben. Die Böden und Wände, die Umrandungen und Simse der zahllosen Nischen in den Wänden waren mit Marmor ausgekleidet. Das Halbrund über den Stufen zur Apsis war vermutlich als prächtiges Plätzchen zum Herumlümmeln für den Patron und seine Vertrauten gedacht. Es mochte sogar als Kaskade entworfen worden sein – doch falls dem so war, hatten Rutilius’ Geldmittel nicht ausgereicht, das Wasser für diesen Abend anzustellen.
Wir konnten auch ohne das auskommen. Es gab genug anderes zur Ablenkung des Publikums. Die Ausstattung war hinreißend. All die rechteckigen Wandnischen waren mit herrlichen Gartenszenen bemalt – kniehohe gekreuzte Spaliere, alle mit Ausbuchtungen, in denen eine Urne, ein Springbrunnen oder ein besonderer Baum stand. Es gab zarte Blumenbeete, alle wunderschön gemalt, zwischen denen Vögel herumflogen oder aus Brunnenschalen tranken. Der Maler hatte einen erstaunlichen Strich. Seine Palette basierte auf verschiedenen Blautönen, Türkis und subtilen Grüntönen. Es war ihm gelungen, die Fresken so realistisch wirken zu lassen wie den tatsächlichen Garten, den wir durch die weit geöffneten Türen gegenüber der Apsis sehen konnten. Ein Blick, der sich über die üppig begrünte Terrasse bis zu den fernen Albanerbergen erstreckte.
Helena pfiff durch die Zähne. Mich überlief ein Angstschauer, dass sie diese Art von Kunst auch in unserem neuen Haus haben wollte. Sie erriet meine Gedanken und lächelte.
Sie hatte mich so hingestellt, dass ich die Gäste begrüßen konnte. (Rutilius drückte sich immer noch im äußeren Portikus herum, in der Hoffnung, dass Domitian Cäsar unsere Zusammenkunft beehren würde.) Das bewahrte mich zumindest davor, meinen Gefährten beruhigen zu müssen. Er wirkte gelassen, aber Helena meinte, er sei innerlich vor Angst ganz aufgewühlt. Manche Leute müssen sich schon bei dem Gedanken an einen öffentlichen Auftritt übergeben. Ein Exkonsul zu sein, verlieh keine Garantie für einen Mangel an Schüchternheit. Schneid gehörte seit den Tagen der Scipios nicht mehr zum Berufsbild. Heutzutage musste man nur jemand sein, dem der Kaiser einen billigen Gefallen schuldig war.
Freunde des favorisierten Rutilius trafen allmählich ein. Ich hatte schon gehört, wie ihre lauten Oberschichtstimmen ihn aufzogen, bevor sie heruntergeschlendert kamen. Sie strömten herein und schlenderten weiter, ohne mich zu beachten, und begaben sich dann automatisch zu den besten Plätzen. Inmitten einer Gruppe Freigelassener kam eine pummelige Frau herein, die ich als seine Ehefrau erkannte, mit steifer, gekräuselter Hochfrisur und für den Abend ordentlich herausgeputzt. Sie schien zu überlegen, ob sie mich ansprechen sollte, beschloss aber stattdessen, sich Helena vorzustellen. »Ich bin Minicia Paetina. Wie schön, Sie hier zu sehen, meine Liebe ...« Sie beäugte den Sittsamkeitsvorhang, woraufhin Helena ihr rundheraus abriet, sich dahinter zu setzen. Minicia schaute schockiert. »Oh, ich würde mich vielleicht wohler fühlen, wenn ich nicht den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt bin ...«
Ich grinste. »Heißt das, Sie haben Ihren Mann schon früher lesen hören und wollen nicht, dass die Leute sehen, was Sie davon halten?«
Die Frau von Rutilius Gallicus warf mir einen Blick zu, der meine Magensäfte gerinnen ließ. Diese Leute aus dem Norden wirken auf uns in Rom Geborene oft sehr kalt.
Klinge ich eingebildet? Olympus, das tut mir aber Leid.
Meine eigenen Freunde kamen spät, doch wenigstens kamen sie diesmal überhaupt. Meine Mutter war die Erste, eine kleine misstrauische Gestalt, die sofort mit finsterem Blick den Marmorboden betrachtete, der ihrer Meinung nach besser gewischt gehörte, bevor sie mir, ihrem einzigen noch lebenden Sohn, ihre Zuneigung zeigte. »Ich hoffe, du machst dich nicht zum Narren, Marcus!«
»Danke für dein Vertrauen, Mama.«
Sie wurde von ihrem Untermieter begleitet, Anacrites, meinem ehemaligen Partner und Erzfeind. Von diskreter Gepflegtheit, hatte er sich einen der schmissigen Haarschnitte zugelegt, die er bevorzugte, und trug jetzt einen protzigen Goldring, um allen zu zeigen, dass er in den mittleren Rang aufgestiegen war (mein Ring, den Helena mir gekauft hatte, war einfach nur hübsch).
»Wie läuft’s mit der Schnüffelei?«, höhnte ich, wobei mir natürlich bekannt war, dass er am liebsten so tat, als wüsste niemand, dass er der Oberspion des Palastes war. Er überging die spitze Bemerkung und führte Mama zu einem der besten Plätze, mitten unter Rutilius’ hochnäsigsten Anhängern. Da saß sie, kerzengerade, in ihrem besten schwarzen Kleid, wie eine strenge Priesterin, die sich gestattet, sich unter das gemeine Volk zu mischen, aber darauf achtet, dass ihre Aura nicht verunreinigt wird. Anacrites fand allerdings keinen Platz mehr auf der Marmorbank, hockte sich ihr zu Füßen und sah aus wie etwas Unappetitliches, in das sie getreten war und jetzt nicht mehr von ihrer Sandale abbekam.
»Wie ich sehe, hat deine Mutter ihre zahme Schlange mitgebracht!« Mein bester Freund Petronius Longus hatte es nicht deichseln können, als Ermittlungschef der Vierten Kohorte der Vigiles für diesen Abend dienstfrei zu bekommen, aber das hielt ihn nicht davon ab, sich einfach dünnzumachen. Er kam in Arbeitskleidung – solide braune Tunika, schwere Stiefel und ein Schlagstock –, als würde er ein Gerücht überprüfen, dass es hier Ärger gab. Das dämpfte die Stimmung ziemlich.
»Petro, hier geht es heute Abend um Liebesgedichte, nicht um ein republikanisches Komplott.«
»Du und dein Konsulkumpel stehen auf einer geheimen Liste möglicher Aufrührer.«
Er grinste. So wie ich ihn kannte, konnte das sogar stimmen. Womöglich hatte Anacrites die Liste zur Verfügung gestellt.
Wenn die Zweite Kohorte, die für diesen Teil der Stadt zuständig war, ihn hier bei der Schwarzarbeit erwischte, würde er eins aufs Dach kriegen. Das kümmerte Petro nicht. Er war in der Lage, ihnen selbst kräftig eins aufs Dach zu geben.
»Du brauchst einen Rausschmeißer an der Tür«, meinte er, postierte sich an der Schwelle und zückte bedeutungsvoll seinen Schlagstock, als eine Gruppe Fremder hereinströmte. Ich hatte sie bereits wegen ihrer seltsamen Mischung unansehnlicher Haarschnitte und unförmigen Schuhwerks bemerkt. Ich hörte ein paar schrille Töne und roch schlechten Atem. Keine dieser merkwürdigen Gestalten hatte ich eingeladen, und sie sahen nicht so aus, als fände Rutilius Gallicus Gefallen an ihnen. Ja, er hastete sogar mit verärgertem Gesicht hinter ihnen her, konnte sie aber offensichtlich nicht aufhalten.
Petronius stellte sich ihnen in den Weg. Er erklärte, dies sei eine Privatveranstaltung, und fügte hinzu, dass wir, hätten wir die breite Bevölkerung hier haben wollen, Karten verkauft hätten. Die plumpe Erwähnung von Geld schien Rutilius noch peinlicher zu sein; er flüsterte mir zu, dass er meinte, die Männer gehörten zu einem Schriftstellerkreis, der von einem modernen Literaturmäzen gefördert wurde.
»Wie aufregend! Sind Sie gekommen, um zu hören, was gute Dichtkunst ist, Herr – oder um uns mit Zwischenrufen zu nerven?«
»Wenn ihr meint, hier gibt’s kostenlosen Wein, habt ihr euch geschnitten«, warnte Petronius sie mit lauter Stimme. Intellektuelle waren für ihn nur Prügelknaben. Freunden der Literatur begegnete er mit Misstrauen. Er hielt sie alle für Schnorrer – genau wie die meisten Gauner, mit denen er zu tun hatte. Was stimmte.
Der Mann, der sie mit Taschengeld versorgte, schien gerade anzukommen, denn die Gruppe richtete ihre Aufmerksamkeit auf ein plötzliches Gedränge weiter oben auf der Rampe. Der Mäzen, vor dem sie katzbuckelten, schien der zudringliche Typ mit dem griechischen Bart zu sein, der versuchte, sich einem dickbäuchigen, desinteressierten jungen Mann in den Zwanzigern aufzudrängen, den ich ohne weiteres erkannte.
»Domitian Cäsar!«, hauchte Rutilius, absolut überwältigt.
Kapitel III
Helena trat mich, als ich fluchte. Meine Verärgerung lag nicht bloß daran, dass ich feinfühlige Lyrik schrieb, die sich meiner Meinung nach nur für den Vortrag in intimem Kreise eignete, und auch nicht an meinen verleumderischen Satiren. Ein Aufflackern kaiserlicher Aufmerksamkeit war mir heute Abend durchaus nicht willkommen. Ich würde meine Schriftrolle zensieren müssen.
Domitian und ich hatten ein schlechtes Verhältnis. Ich konnte ihn ins Unglück stürzen, und er wusste das. Das ist keine ungefährliche Position bei Inhabern höchster Macht.
Vor ein paar Jahren, während der chaotischen Zeit, als wir ständig die Kaiser wechselten, waren viele Dinge passiert, die später unglaublich erschienen; nach einem brutalen Bürgerkrieg grassierten die scheußlichsten Komplotte. Mit zwanzig war Domitian in schlechte Gesellschaft geraten, und es mangelte ihm an Urteilsvermögen. Und das war noch freundlich ausgedrückt – wie sein Vater und Bruder es taten, selbst als das Gerücht aufkam, er hätte sich gegen sie verschworen. Sein Pech war, dass am Ende ich als derjenige Agent hinzugezogen wurde, der die Sache aufzuklären hatte. Was natürlich genauso mein Pech war.
Ich beurteilte ihn nur anhand der Fakten. Zum Glück für Titus Flavius Domitianus, zweiter Sohn Vespasians, zählte ich als bloßer Ermittler für ihn nicht. Aber wir beide wussten, was ich von ihm hielt. Im Laufe seiner Machenschaften war er verantwortlich für den Tod eines jungen Mädchens gewesen, das mir einmal etwas bedeutet hatte. »Verantwortlich« war hier ein diplomatischer Euphemismus.
Domitian wusste, dass ich verheerende Informationen besaß, gestützt auf gut verborgene Beweise. Er hatte alles getan, um mich klein zu halten, hatte bisher allerdings nur gewagt, meinen gesellschaftlichen Aufstieg zu verzögern, doch die Drohung für Schlimmeres war immer vorhanden. Was natürlich auch umgekehrt galt. Wir wussten beide, dass wir noch nicht miteinander fertig waren.
Der Abend versprach jetzt schwierig zu werden. Der anmaßende junge Cäsar war dazu degradiert worden, literarische Preise zu verleihen. Er schien unparteiisch zu urteilen – aber es war unwahrscheinlich, dass Domitian ein freundlicher Kritiker meiner Arbeit sein würde.
Nachdem er alle bis auf Rutilius beiseite geschoben hatte, stolzierte das Prinzlein vorbei, begleitet von seiner glanzvoll ausgetricksten Frau Domitia Lepida – die Tochter des großen Generals Corbulo, ein spektakulärer Fang, den Domitian unverfroren ihrem früheren Ehemann weggeschnappt hatte. Er übersah mich. Daran gewöhnte ich mich heute Abend allmählich.
In der Aufregung gelang es den Ungeladenen, sich reinzuschmuggeln, aber es schien jetzt das Beste, ein so großes Publikum wie möglich zusammenzukriegen. Unter den letzten Ankömmlingen entdeckte ich plötzlich Maia; typisch für sie, trat sie rasch herein, erweckte Aufsehen mit ihren dunklen Locken und ihrer selbstbeherrschten Art. Petronius Longus wollte sie hineinbegleiten, aber sie drängte sich durch die Menge, umging sowohl Petro als auch mich, steuerte beherzt auf den besten Platz im Saal zu und quetschte sich neben Mama. Das kaiserliche Gefolge hätte sich mit großem Zeremoniell in der Apsis niederlassen sollen, aber alle blieben seitlich stehen. Höflinge wuchteten sich auf die schulterhohen Wandvorsprünge hoch. Domitian geruhte auf einer tragbaren Bank Platz zu nehmen. Ich erkannte – was Rutilius vermutlich entgangen war –, dass es sich nur um einen Höflichkeitsbesuch handelte. Man war gekommen, um sich huldvoll zu zeigen, achtete aber darauf, freie Bahn zu haben, sobald man sich langweilte.
Inzwischen war klar, dass der von uns in kleinem Kreise geplante Abend aus dem Ruder gelaufen war. Rutilius und ich hatten die Kontrolle über die Ereignisse vollkommen verloren. Es herrschte eine Atmosphäre gespannter Erwartung. Die Gewichtung des Publikums war ungleich, da der Prinz und sein Gefolge sich auf der linken Seite zusammendrängten, den freien Platz einnahmen, den wir hatten bewahren wollen, und die Sicht unserer Freunde und Familien dahinter behinderten. Selbst Rutilius wirkte leicht verärgert. Vollkommen Fremde schoben sich durch den Saal. Helena küsste mich förmlich auf die Wange, dann ließen sie und Petronius mich stehen, um sich irgendwo einen Platz zu suchen.
Wir räusperten uns zögernd. Niemand hörte es.
Dann kehrte von allein Ordnung ein. Rutilius ging noch einmal rasch seine Schriftrollen durch, war bereit, als Erster zu beginnen. Er hatte einen ganzen Arm voll, während ich nur eine Schriftrolle hatte, auf die mein dubioses Opus von meinen Frauensleuten übertragen worden war. Helena und Maia waren der Ansicht, dass schlechte Handschrift zu peinlichen Pausen führte, wenn sie mich mit meinen ursprünglichen Schrifttafeln mir selbst überließen. Es stimmte, dass meine Bemühungen eine ganz andere Würde anzunehmen schienen, nachdem sie in sauberen, drei Zoll breiten Spalten auf makellosem Papyrus niedergeschrieben waren. (Helena hatte den Papyrus als Geste der Unterstützung zur Verfügung gestellt; Maia hatte sparsamer vorgehen und die Rückseiten alter Rezepte für Pferdearzneien verwenden wollen, das einzige Erbe, das ihr verstorbener Mann ihr hinterlassen hatte.) Ich drückte an der Rolle herum, wickelte sie unabsichtlich immer enger um den Stab, während ich so tat, als würde ich Rutilius ermutigend zugrinsen. Dann erhob sich zu unserer Überraschung der Bärtige, um den sich die Uneingeladenen drängten, und trat vor die Stufe, auf der wir unsere Lesung abhalten wollten.
Jetzt sah ich ihn deutlicher – graue Haare, die in Büscheln von seiner eckigen Stirn abstanden, dazu ebenfalls buschige graue Augenbrauen, obwohl sie so aussahen, als wären sie mit Bohnenmehl gepudert worden, um zu seinem silbrigen Haar zu passen. Er hatte eine schlaffe Haltung, in der etwas Wissendes mitschwang – als Persönlichkeit ein Niemand, aber einer, der daran gewöhnt war, anderen Leuten im Weg zu stehen.
»Haben Sie den eingeladen?«, zischte ich Rutilius zu.
»Nein! Ich dachte, Sie müssten das getan haben ...«
Dann begann der Kerl ohne Einleitung zu sprechen. Er hieß den jungen Prinzen mit salbungsvoll öligen Worten willkommen. Ich dachte, der Kerl müsse einer der Hoflakaien sein, mit dem vorher gegebenen Befehl, seiner kaiserlichen Hoheit für ihr Kommen zu danken. Domitian wirkte unbeeindruckt, und seine Höflinge flüsterten laut miteinander, als würden sie sich auch fragen, wer der Eindringling sei.
Wir folgerten, dass der Mann ein regelmäßiger Teilnehmer an literarischen Ereignissen im Auditorium war. Er hatte die Sache in die Hand genommen, und für uns war es zu spät, jetzt noch einzuschreiten. Er ging davon aus, dass alle ihn kannten – ein echtes Zeichen von Mittelmäßigkeit. Aus irgendeinem erstaunlichen Grund hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, uns formell vorzustellen. Zu dem intimen Auftritt, den wir geplant hatten, stand es in keinem Verhältnis und war so belangvoll wie ein Haufen Maultierdung. Außerdem stellte sich sehr bald heraus, dass er keine Ahnung hatte, wer wir waren oder was wir vortragen wollten.
Die Rede dieses Schleppankers roch vom ersten Wort an nach Katastrophe. Da er nichts über uns wusste, begann er mit der immer wieder gern verwendeten Beleidigung »Ich muss zugeben, dass ich ihr Werk bisher noch nicht gelesen habe«, um dann unbarmherzig fortzufahren mit »Wie ich höre, scheint es gewissen Leuten zu gefallen«. Offensichtlich erwartete er sich nicht viel. Schließlich bat er mit der Miene eines Mannes, der sich zu einem guten Essen im Hinterzimmer verzieht, während alle anderen leiden müssen, das Publikum, Dillius Braco und Rusticus Germanicus willkommen zu heißen.
Rutilius nahm es besser hin als ich. Als Mitglied des Senats war er es gewohnt, verwechselt und falsch dargestellt zu werden, wohingegen ein Ermittler für seine wahren Missetaten verhöhnt werden will, als wäre er ein Schurke, auf den es ankommt. Während ich erstarrte und am liebsten nach einem Dolch gegriffen hätte, feuerte die Gereiztheit Rutilius regelrecht an.
Er las als Erster. Und er las endlos. Er bot uns Auszüge aus einem sehr langen militärischen Epos dar; angeblich stand Domitian auf solche Langweiligkeiten. Das Hauptproblem war das übliche: Mangel an lohnendem Material. Homer hatte die besten mythischen Helden geklaut, und Virgil hatte sich dann auf die heimischen Vorfahren gestürzt. Rutilius brachte daher selbst erfundene Personen ins Spiel, und seinen Holzfiguren fehlte es entschieden an Zugkraft. Außerdem war er, wie ich immer vermutet hatte, alles andere als ein aufregender Dichter.
Ich erinnere mich an eine Zeile, die mit »Siehe, der hyrcanäische Parder mit blutigen Lefzen!« begann. Das kam dem Löwen, der meinen Schwager gefressen hatte, gefährlich nahe – und es war grauenhafte Lyrik. Beim ersten Anzeichen, dass ein »Siehe« drohte, biss ich die Zähne zusammen und wartete auf Erlösung. Die dauerte sehr lange. Ein fähiger Läufer hätte es von Marathon hierher geschafft, bis mein Kollege mit seinen Auszügen zum Ende kam.
Domitian Cäsar genoss seit vier Jahren ein zweifelhaftes Ansehen in Rom – lange genug, um einen guten Abgang gelernt zu haben. Er trat vor, um Rutilius zu gratulieren, während sein ganzes Gefolge auf uns zuströmte, ein höfliches Lächeln aufsetzte und dann per Zentrifugalkraft nach draußen befördert wurde. Der junge Cäsar wurde mitgesogen wie ein Blatt in den Gulli. Er verschwand, während Rutilius noch über Domitians höfliche Bemerkungen errötete. Wir hörten prasselnden Applaus von der radikal ausgedünnten Menge. Dann beruhigte sie sich.
Jetzt war ich dran, und ich spürte, dass meine Lesung möglichst kurz ausfallen sollte.
Inzwischen hatte ich beschlossen, alle Liebesgedichte wegzulassen. Einige hatte ich schon zu Hause aussortiert angesichts dessen, dass meine Aglaia-Sequenz geschrieben worden war, bevor ich Helena Justina kennen lernte, und wahrscheinlich zu persönlich war, sie laut vorzulesen, während Helena daneben saß und mich anfunkelte. Eine oder zwei meiner sexuell spezifischeren Oden waren von ihr bereits als Fischgrätenverpackung zweckentfremdet worden. (Zweifellos versehentlich.) Ich erkannte jetzt, dass es rücksichtsvoll wäre, auch den Rest fallen zu lassen.
Damit blieben noch meine Satiren. Helena meinte, sie seien gut. Ich hatte sie mit Maia kichern hören, als die beiden sie für mich abschrieben.
Als ich zu lesen begann, brachten Freunde von Rutilius Wein, um ihn nach seiner Zerreißprobe zu erfrischen; sie waren anständiger, als ich gedacht hatte, und etwas von dem Wein kam auch bei mir an. Das mochte mich ermutigt haben, die Passagen zu vergessen, die ich hatte zensieren wollen. Stattdessen übersprang ich, als ich merkte, dass das Publikum unruhig wurde, all das, was ich jetzt als langweilig und ehrbar empfand. Komisch, wie sich die redaktionelle Beurteilung verschärft, wenn man vor Publikum liest.
Die Leute waren dankbar für etwas Zotiges. Sie wollten sogar noch mehr hören. Inzwischen hatte ich nichts mehr zu bieten, außer ich kam auf Aglaia zurück und gab preis, einst philosophische Gefühle für eine etwas anrüchige Zirkustänzerin gehabt zu haben, deren Auftritt hauptsächlich aus anzüglichem Schlängeln bestanden hatte. Ich wickelte die Schriftrolle bis zum Ende auf und fand nur noch ein paar Zeilen, die, wie ich wusste, meine Schwester Maia einst selbst verfasst hatte. Sie hatte sie offenbar klammheimlich eingefügt, um mir eine Falle zu stellen.
Rutilius strahlte glücklich; nachdem seine Feuerprobe hinter ihm lag, hatte er noch mehr Wein getrunken als ich. Dieser Abend war als kultivierte Zerstreuung gedacht gewesen, eine Soiree, auf der wir uns als vielseitige Römer darstellen konnten: Männer der Tat, die Augenblicke nachdenklichen Intellekts schätzten. Ein Exkonsul, einer, der hohe Erwartungen hatte, würde mir nicht dafür danken, seinen vornehmen Bekannten ein rüdes Verslein aufzudrängen, dazu noch geschrieben von einer Frau. Aber eben jene Bekannten hatten uns mit einem erstaunlich starken Gebräu versorgt, also hob ich meinen Weinbecher, und als Rutilius mit verschwommenem Blick den seinen ebenfalls hob, las ich es trotzdem.
»Meine Damen und Herren, nun müssen wir uns trennen, aber hier ist noch ein letztes Epigramm mit dem Titel ›Gedicht einer Exjungfrau‹:
Es gibt welche
von denen Blumenkelche
mich zum Lächeln brächten.
Und andere
mit denen wanderte
ich gern durch die Nächte.
Ein Kuss in Ehren
kann niemand verwehren
und macht auch nicht blind.
Doch der Götter Zorn
soll sich bohren wie ein Dorn
in den, der gezeugt dieses Kind.«
Ich sah, dass Maia sich vor Lachen krümmte. Es war das erste Mal, seit ich ihr die Nachricht von ihrer Witwenschaft überbringen musste, dass sie reine, spontane Heiterkeit zeigte. Das war Rutilius Gallicus ihr schuldig.
Inzwischen war das Publikum so dankbar für etwas Kurzes, dass es vor Begeisterung brüllte.
Der Abend hatte sich hingezogen. Die Leute lechzten danach, sich in Weinschenken oder Schlimmeres zu verziehen. Rutilius wurde von seiner altmodischen Frau und seinen unerwartet anständigen Freunden davongetragen. Wir fanden noch die Zeit, einander zu versichern, dass unser Abend gut gelaufen war, aber er lud mich nicht ein, den Triumph mit ihm in seinem Heim zu feiern. Das war in Ordnung, so blieb es mir erspart, ihn in meines einzuladen.
Ich machte mich auf den Spott meiner eigenen Familie und Freunde gefasst. Den Schriftstellerkreis übersah ich geflissentlich, als sie in ihren ausgelatschten Sandalen davonwatschelten, zurück in ihre Dachkammern, um sie mit ihrem sauren Schweiß zu erfüllen. Petronius Longus drängte sich rücksichtslos an ihnen vorbei. »Wer zum Hades war dieser öde Dingsbums, den ihr zwei für die Eloge eingeladen habt?«
»Wirf uns das nicht vor.« Ich schaute dem selbstgefälligen Geschäftsmann böse nach, als er inmitten seiner Klienten davonschlenderte. »Wenn ich wüsste, wer das war, würde ich es einrichten, ihn an einem netten, ruhigen Ort zu treffen, und ihn umbringen!«
Als Privatschnüffler hätte ich wissen müssen, dass man so etwas Dummes nicht sagt.
Kapitel IV
»Merkwürdige Frau, deine Schwester«, sinnierte Petronius Longus am nächsten Tag.
»Sind sie das nicht alle?«
Petronius war fasziniert von Maias frechem Vers. Helena musste ihm erzählt haben, wer ihn wirklich geschrieben hatte. Zumindest hatte ihn das davon abgehalten, meine dichterischen Leistungen zu verspotten. Da er jetzt dienstfrei hatte, war er auf dem Heimweg zu einem Morgenschläfchen in der Wohnung auf der anderen Seite der Brunnenpromenade, die wir ihm untervermietet hatten. Wie ein treuer Freund war er zuerst bei uns vorbeigekommen; mich zu ärgern, würde ihm den Schlaf versüßen.
»Schreibt Maia Favonia immer noch Gedichte?«, fragte er neugierig.
»Das bezweifle ich. Sie würde sagen, eine Mutter von vier Kindern hat keine Zeit für solches Gekritzel.«
»Oh, sie hat das geschrieben, bevor sie verheiratet war?«
»Vielleicht erklärt es, warum sie sich mit Famia verbandelt hat.«
Helena kam aus einem der Innenräume zu uns heraus, wo sie versucht hatte unserer brüllenden einjährigen Tochter Frühstück einzuverleiben. Sie sah müde aus. Wir Männer hatten uns auf die Veranda verzogen, um ihr aus Höflichkeit nicht im Weg zu stehen. Wir machten ihr Platz. Es wurde eng. Und noch enger, als Nux, meine schwangere Hündin, sich zusätzlich dazwischenquetschte.
»Und, wie geht es dem glücklichen Dichter heute Morgen?«, fragte Petro strahlend. Von ihm würde ich also doch noch mein Fett abkriegen. Während er die halbe Nacht auf der Suche nach Strauchdieben durch die Straßen patrouilliert war oder Brandstifter freundlich mit der hilfreichen Stiefeltechnik verhört hatte, war ihm genügend Zeit geblieben, sich seine Kritik zurechtzulegen. Ich stand auf und sagte, ich müsse einen Klienten treffen. Ein alter Ermittlertrick, auf den niemand hereinfiel.
»Welchen Klienten?«, höhnte Helena. Sie wusste, wie wenig ich im Moment zu tun hatte. Ihre Brüder sollten eigentlich als meine Juniorpartner ausgebildet werden, aber ich hatte Aelianus entlassen müssen und war dankbar, dass Justinus auf Freiersfüßen im fernen Baetica war.
»Der Klient, für den ich auf den Stufen des Saturntempels zu werben gedenke.«
»Während dich die echten Aussichtsreichen in der Basilika Julia suchen?«, meinte Petro. Er wusste, was Sache war. Er kannte meine lässige Arbeitsweise.
Ich hatte das Gefühl, Petronius schon mein ganzes Leben lang zu kennen. Er schien Teil der Familie zu sein. In Wahrheit waren wir erst seit unserem achtzehnten Lebensjahr befreundet – also seit etwa fünfzehn Jahren. Obwohl wir nur ein paar Straßen voneinander groß geworden waren, hatten wir uns erst im Rekrutierungsbüro richtig kennen gelernt, als wir uns als junge Burschen der Armee anschlossen, um von zu Hause fortzukommen. Danach hatten wir in derselben miesen Legion in Britannien gedient, teilweise während des von Königin Boudicca angeführten Aufstands. Jupiter helfe uns.
Wir waren beide dem Militärdienst mit der Ausrede »schwerer Verletzungen« entkommen, hatten uns still verhalten, während wir gemeinsam auf wundersame Weise genasen, und kamen buchstäblich am Trinkarm miteinander verwachsen nach Hause zurück. Petro hatte dann geheiratet. Gut, dadurch ergab sich ein gewisser Bruch, weil ich seinem Beispiel nicht folgte. Zumindest für lange Zeit nicht. Er hatte eine beneidenswerte Stellung bei den Vigiles ergattert, wobei ich ihm auch da nicht nachzueifern versuchte. Er hatte drei Kinder, wie es jeder anständige Römer haben sollte; ich hatte mich erst jetzt dazu aufgerafft und war mir angesichts der neuesten Angewohnheit unserer kleinen Julia, ständig Wutausbrüche und Schreikrämpfe zu kriegen, nicht sicher, ob ich diese Richtung weiter verfolgen wollte. Jetzt hatte sich Petro von seiner Frau getrennt, was mir mit meiner nie passieren würde, obwohl er sich das von sich und Silvia vermutlich auch mal gedacht hatte. Petro war nie so ganz der aufrechte Charakter gewesen, für den andere ihn hielten. Es ging das Gerücht, dass er in frühen Jahren meine verstorbene Schwester Victorina »gekannt« hatte, aber andererseits hatten die meisten Menschen Victorina gekannt, ein unvermeidlicher Schandfleck auf dem Aventin. Sie hatte selbst dafür Sorge getragen, dass alle Männer sie bemerkten. Den Rest meiner grässlichen Familie hatte Petronius erst später kennen gelernt, nachdem wir aus der Armee entlassen wurden. Maia zum Beispiel. Ich kann mich noch an den Tag erinnern, an dem ich ihm Maia vorstellte. Zu der Zeit musste ich mich immer noch daran gewöhnen, dass während meines Legionärsdienstes in Britannien meine jüngere Schwester – meine Lieblingsschwester, so ich denn irgendeine von ihnen ertragen konnte – nicht nur geheiratet hatte, ohne mich zu konsultieren, sondern auch noch zwei Kinder zur Welt gebracht hatte und mit dem dritten sichtbar schwanger war. Ihre erste Tochter war jung gestorben, also muss es Cloelia gewesen sein. Cloelia war jetzt acht.
Petro war aus irgendeinem Grund überrascht gewesen, als er Maia kennen lernte; er fragte mich, warum ich sie nie erwähnt hätte. Sein Interesse hätte mich misstrauisch machen können, aber Maia war offensichtlich eine ehrbare junge Mutter, und kurz darauf war Petro mit Silvia verheiratet. Wenigstens hatten wir die peinliche Situation vermieden, dass sich die kleine Schwester in den gut aussehenden Freund ihres Bruders verliebt, der natürlich kein Interesse an ihr hat.
Dass Maia sich mit Famia verbandelte, erschien wie ein Verzweiflungsakt, selbst bevor dieser Penner ernsthaft zu trinken begann. Trotzdem, auch Mädchen müssen einen Weg finden, von zu Hause fortzukommen. Von Jugend an lebenssprühend und attraktiv, besaß sie einen gefährlichen Eigensinn. Maia war die Art junger Frau, die etwas Besonderes zu bieten scheint – Außergewöhnlichkeit und Reife. Sie war intelligent und führte zwar ein tugendhaftes Leben, schien aber einem guten Spaß nie abgeneigt zu sein. Ehe und Mutterschaft waren uns, die wir uns für Maia verantwortlich fühlten, wie eine gute, sichere Möglichkeit vorgekommen.
Und Petronius hielt sie für eine merkwürdige Frau? Das war stark, wenn er tatsächlich mal mit Victorina geflirtet oder Schlimmeres getan hatte. Maia und sie waren totale Gegensätze gewesen.
Während ich so sinnierte, war Petronius verstummt, trotz der wunderbaren Gelegenheit, mich wegen des gestrigen Auftritts im Auditorium des Maecenas aufzuziehen. Er musste nach seiner Schicht müde sein. Er redete nie viel über seine Arbeit, aber ich wusste, wie grausig sie sein konnte.
Helena hatte die Augen geschlossen, ließ sich von der Sonne erwärmen und versuchte gleichzeitig den fernen, ermüdenden Wutausbruch von Julia zu überhören. Die Schreie wurden lauter. »Was sollen wir nur machen?«, fragte Helena, an Petro gewandt. Er hatte drei Töchter, die bei seiner Frau und deren Freund in Ostia lebten. Seine Kinder waren der hysterischen Phase entwachsen. Er hatte es überstanden und die Kinder dann verloren.
»Das geht vorüber. Wenn nicht, werdet ihr euch sehr bald daran gewöhnen.« Sein Gesicht hatte sich verschlossen. Er liebte seine Töchter. Und es half wenig, dass er sie durch seine eigene Dummheit verloren hatte, wie er sehr wohl wusste. »Wahrscheinlich ein Zahn.« Wie alle Eltern betrachtete er sich als den Experten und alle anderen, die wie wir neu in diesem Geschäft waren, als unfähige Idioten.
»Sie hat Ohrenschmerzen«, log ich. Es gab keinen sichtbaren Grund, warum Julia sich so aufführte. Nein, das stimmte nicht, es gab doch einen. Sie war viel zu lange ein braves Kind gewesen; wir hatten damit angegeben und gedacht, Elternschaft sei die einfachste Sache der Welt. Und das war jetzt unsere Strafe.
Petronius zuckte mit den Schultern, erhob sich und ging. Offenbar hatte er vergessen, mir seine Ansicht zu meiner Dichtkunst mitzuteilen. Ich gedachte nicht, ihn daran zu erinnern.
»Geh und triff dich mit deinem Klienten«, murmelte Helena. Sie wusste genau, dass es diesen Klienten nicht gab, und bereitete sich innerlich darauf vor, wütend zu werden, weil ich sie mit dem schreienden Blag alleine ließ. Sie hievte sich von ihrem Hocker hoch, um sich um unser Kind zu kümmern, bevor uns die Nachbarn wegen Ruhestörung anzeigten.
»Nicht nötig.« Ich sah stirnrunzelnd auf die Straße hinunter. »Ich glaube, er hat mich von allein gefunden.«
Für gewöhnlich erkennt man sie.
Die Brunnenpromenade, die dreckige Gasse, in der wir wohnten, war eine typische unbedeutende Nebenstraße, in der Schnorrer und Gammler in feuchten kleinen Läden versauerten. Die Häuser waren sechs Stockwerke hoch. Dadurch war die Straße selbst tagsüber düster, doch sogar an einem heißen Tag wie heute boten die dreckigen Mietskasernen nicht genug Schatten. Zwischen den bröckelnden Mauern wallte der unangenehme Geruch von Tintenherstellung und von der Wärme aufgedunsener Leichen im Beerdigungsinstitut, während leichter Rauch aus verschiedenen kommerziellen Unternehmen (einige davon legal) mit dem aufsteigenden Dampf aus Lenias Wäscherei wetteiferten.
Menschen waren unterwegs, gingen ihren morgendlichen Beschäftigungen nach. Der riesige Seiler, ein Mann, mit dem ich nie sprach, war vorbeigeschlurft und sah aus, als wäre er gerade von einer langen Nacht in einer üblen Kaschemme heimgekehrt. Kunden drängten sich vor dem Stand, an dem Cassius altbackene Brötchen zusammen mit noch älterem Tratsch verkaufte. Ein Wasserträger watschelte mit überschwappenden Eimern in eines der Häuser, ein Huhn floh vor dem Rupfen und brachte den ganzen Hühnerstall in Aufruhr. Es waren Schulferien, daher tobten die Kinder herum und suchten nach Möglichkeiten, Ärger zu machen. Und Ärger einer anderen Art suchte nach mir.
Ein dicklicher, unsauberer Fettkloß, dessen Bauch über seinen Gürtel hing. Dünne, ungepflegte dunkle Locken fielen ihm über die Stirn und kringelten sich feucht über seinen Tunikakragen, als hätte er sich in den Bädern nicht ordentlich abgetrocknet. Sein Doppelkinn war mit Stoppeln bedeckt. Er kam die Straße entlang, offensichtlich nach einer Adresse suchend. Für das Beerdigungsinstitut runzelte er die Stirn zu wenig, und für die billige Nutte, die sich als Schneiderin ausgab, wirkte er nicht einfältig genug. Außerdem ging die Frau nur nachmittags zu Hause in die Horizontale.
Petronius kam an ihm vorbei, bot ihm aber keine Hilfe an, obwohl er den Mann mit dem betonten Misstrauen der Vigiles musterte. Der Bursche war bemerkt worden. Um vielleicht später von einer Einsatztruppe aufgegriffen zu werden. Er schien es gar nicht zu beachten, statt verängstigt zu reagieren. Musste wohl ein behütetes Leben führen. Was nicht unbedingt bedeutete, dass er ehrbar war. Er hatte die Haltung eines freigelassenen Sklaven. Ein Sekretär oder eine Abakuslaus.
»Dillius Braco?«
»Didius Falco.« Meine Zähne trafen knirschend aufeinander.
»Sind Sie sicher?«, fragte er nach. Ich antwortete nicht, aus Furcht, grob zu werden. »Wie ich höre, haben Sie gestern eine erfolgreiche Lesung gehalten. Aurelius Chrysippus ist der Meinung, wir könnten vielleicht etwas für Sie tun.«
Aurelius Chrysippus? Der Name sagte mir nichts, aber ich hatte bereits jetzt ein ungutes Gefühl.
»Das bezweifle ich. Ich bin Privatermittler. Ich dachte, Sie wollten vielleicht, dass ich etwas für Sie tue.«
»Olympus, nein!«
»Als Erstes sollten Sie mir lieber sagen, wer Sie sind.«
»Euschemon. Ich führe das Skriptorium Goldenes Pferd für Chrysippus.«
Das musste ein Laden sein, in dem schwer geprüfte Schreiber Manuskripte kopierten, entweder zum persönlichen Gebrauch der jeweiligen Besitzer oder in mehreren Ausführungen für den kommerziellen Verkauf.
Ich hätte die Ohren gespitzt, aber ich erriet bereits, dass Chrysippus vermutlich die Nervensäge mit dem Griechenbart war, der unsere Lesung an sich gerissen hatte. Der falsche Name, den er mir in seiner Einführung verliehen hatte, blieb mir anscheinend erhalten. Und hin ist der Ruhm. Der Name wird bekannt – in der falschen Version. Das passiert nur einigen von uns. Mir kann doch keiner erzählen, dass er je eine Ausgabe von Julius Castors Gallischen Kriegen gekauft hat.
»Sollte ich von dem Skriptorium unter dem Zeichen des Goldenen Pferdes gehört haben?«
»Oh, das ist ein bekanntes Unternehmen«, machte er mir weis. »Erstaunlich, dass Sie uns nicht kennen. Wir haben dreißig fest angestellte Schreiber. Chrysippus hat sich gestern natürlich Ihr Werk angehört. Er meinte, es würde sich für eine kleine Ausgabe eignen.«
Jemandem gefiel meine Arbeit. Unwillkürlich hoben sich meine Augenbrauen. Ich bat ihn herein.
Helena befand sich mit Julia in dem Zimmer, in dem ich Klienten empfing. Das Kind hörte sofort auf zu schreien, sein Interesse durch den Fremden geweckt. Helena hätte die Kleine normalerweise ins Schlafzimmer gebracht, aber da Julia still war, durfte sie auf ihrer Decke bleiben, wo sie abwesend an ihrem Holztier kaute, während sie Euschemon anstarrte.
Ich stellte Helena vor und erwähnte schamlos den Patrizierrang ihres Vaters, um durchblicken zu lassen, ich sei ein Dichter, der einen wohlmögenden Patron wert war. Ich bemerkte, dass sich Euschemon erstaunt umblickte. Er sah, dass es sich um eine typische enge Mietwohnung handelte, mit einfarbigen Wänden, schlichten Holzfußböden, einem dürftigen Arbeitstisch und wackligen Hockern.
»Unser Heim befindet sich außerhalb der Stadt«, verkündete ich stolz. Das klang natürlich wie eine Lüge. Aber wir würden umziehen, wenn die Arbeiter das Badehaus je fertig bauen würden. »Das hier ist nur eine Absteige, die wir behalten, um in der Nähe meiner alten Mutter zu sein.«
Rasch erklärte ich Helena, dass Euschemon angeboten habe, mein Werk zu veröffentlichen; ich sah, wie sich ihre Augenbrauen misstrauisch zusammenzogen.
»Gehen Sie auch zu Rutilius?«, fragte ich.
»Oh! Sollte ich das?«
»Nein, nein. Er scheut Publizität.« Ich mochte zwar ein Amateur sein, aber ich kannte die Regeln. Das größte Interesse eines Autors besteht darin, seine Kollegen bei jeder Gelegenheit schlecht zu machen. »Also, worum geht es?« Ich wollte ein Angebot hören, während ich Gleichgültigkeit heuchelte.
Euschemon machte einen nervösen Rückzieher. »Als unbekannter Autor können Sie nicht mit einer hohen Auflage rechnen.« Gleich war er mit einem Scherz bei der Hand, hatte so was offenbar schon öfter gemacht: »Die verkaufte Auflage Ihrer ersten Veröffentlichung könnte davon abhängen, wie viele Freunde und Verwandte Sie haben!«
»Zu viele – und alle werden ein kostenloses Exemplar erwarten.« Meine trockene Erwiderung schien ihn zu erleichtern. »Also, was bieten Sie an?«
»Oh, einen umfassenden Vertrag«, versicherte er mir. Ich bemerkte seinen freundlichen Ton – überlassen Sie uns alle Einzelheiten, wir verstehen unser Geschäft. Ich hatte es mit Experten zu tun, was mich immer unruhig macht.
»Was enthält der Vertrag?«, drängte Helena ihn. Ihr Ton klang unschuldig, eine Senatorentochter, die einen neugierigen Blick in die Männerwelt wirft. Aber sie behielt stets meine Interessen im Auge. Es hatte eine Zeit gegeben, als das, was mir bezahlt wurde – oder falls es mir bezahlt wurde –, nicht nur in direktem Zusammenhang mit dem stand, was wir auf den Tisch bringen konnten, sondern ob wir überhaupt etwas zu essen hatten.
»Ach, das Übliche«, murmelte Euschemon leichthin.
»Wir einigen uns mit Ihnen auf einen Preis, dann veröffentlichen wir. Alles ganz einfach.«
Wir betrachteten ihn beide schweigend. Ich fühlte mich geschmeichelt, aber nicht so sehr, dass ich den Verstand verlor.
Er holte ein bisschen weiter aus: »Nun ja, wir werden Ihr Manuskript für einen angemessenen Preis nehmen, Falco.« Aber würde mir der auch gefallen? »Dann stellen wir Kopien her und verkaufen sie in unserem Laden, der sich direkt an das Skriptorium anschließt.«
»Auf dem Forum?«
Sein Blick wich mir aus. »Am Ende des Clivus Publicus. Direkt beim Circus Maximus – eine ausgezeichnete Lage«, versicherte er mir. »Viel Laufkundschaft.«
Ich kannte den Clivus Publicus. Ein einsames Loch, ein finsteres Seitengässchen vom Aventin zum Circus.
»Können Sie mir eine realistische Zahl nennen?«
»Nein, nein. Den Preis wird Chrysippus verhandeln.«
Ich verabscheute Chrysippus jetzt schon. »Und welche Möglichkeiten gibt es? Welche Art von Ausgabe?«
»Das hängt davon ab, wie viel Wert wir Ihrem Werk beimessen. Klassiker werden, wie Sie wissen, mit erstklassigem Papyrus und einer Titelseite aus Pergament ausgestattet, um die äußeren Enden der Schriftrolle zu schützen. Unbedeutendere Werke sind in der Ausstattung natürlich weniger aufwändig, und eine Erstveröffentlichung erscheint möglicherweise als Palimpsest.« Kopiert auf bereits benutzte Schriftrollen, auf denen die alten Zeilen ausgewischt wurden. »Sehr sorgfältig ausgeführt, muss ich dazu sagen«, murmelte Euschemon gewinnend.
»Vielleicht, aber das möchte ich für mein Werk nicht haben. Wer entscheidet über das Format?«
»Oh, das müssen wir natürlich tun!« Er war entsetzt, dass ich es überhaupt ansprach. »Wir wählen die Schriftrollengröße, die Ausstattung, mögliche Verzierungen, Art und Umfang der Ausgabe aus, alles aufgrund langer Erfahrung.«
Ich spielte den Dummen. »Und ich muss nur etwas für Sie schreiben und es Ihnen dann übergeben?«
»Genau!« Er strahlte.
»Kann ich weitere Abschriften zum Eigengebrauch machen?«
Er zuckte zusammen. »Leider nicht. Aber Sie können sie von uns zum verbilligten Preis kaufen.« Mein eigenes Werk kaufen?
»Etwas einseitig, oder?«, erlaubte ich mir zu sagen.
»Eine Partnerschaft«, wies er mich zurecht. »Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen.« Er klang so verlässlich wie ein billiger Eintänzer, der sich kurz vor dem Ziel weiß. »Außerdem entwickeln wir die Absatzmärkte und tragen das gesamte Risiko.«
»Wenn sich das Werk nicht verkauft, meinen Sie?«
»Richtig. Das Haus von Aurelius Chrysippus ist kein Geschäft, das Badehausöfen beliefert, wenn wir gezwungen sind, Fehlschläge billig abzugeben. Wir sind darum bemüht, es von Anfang an richtig zu machen.«
»Klingt gut.«
In seinen verbindlichen Ton schlich sich größere Härte.
»Ich kann also davon ausgehen, dass Sie interessiert sind?«
Helena, die hinter ihm stand, schüttelte vehement den Kopf und bleckte die Zähne.
»Ich bin interessiert«, meinte ich mit einem unbekümmerten Lächeln. Helena schloss die Augen. »Ich glaube, ich würde gern mehr von dem sehen, was Sie machen.« Obwohl Helena über meine Vorsicht hätte erleichtert sein sollen, reagierte sie jetzt mit manischer Verzweiflung; sie wusste, was passieren würde, wenn ich unbeaufsichtigt in einen Schriftrollenladen spazierte. Sie las genauso begeistert wie ich, doch wenn es um den Kauf ging, teilte sie meinen Geschmack nicht. Da mein Geschmack bis vor kurzem davon abhing, was ich an Ständen aus zweiter oder gar dritter Hand bekommen konnte, hatte sie mit ihrer Skepsis vielleicht sogar Recht. In der Regel hatte ich nur Teile von Schriftrollensammlungen (ohne Hülle) und hatte sie tauschen müssen, sobald sie gelesen waren.
»Sie können uns ja besuchen«, willigte Euschemon mürrisch ein.
»Das werde ich tun«, erwiderte ich. Helena führte eine Pantomime auf, tat so, als würde sie mir einen großen Tiegel an den Kopf werfen. Eine hervorragende Pantomime. Ich konnte die Klöße in der imaginären heißen Brühe riechen und spüren, wie sich die scharfkantigen Henkelnieten in meinen Schädel bohrten.
»Bringen Sie Ihr Manuskript mit«, wies mich Euschemon an. Er hielt inne. »Falls Sie erwägen, etwas Spezielles zu schreiben, gebe ich Ihnen gerne ein paar Tipps. Selbst unsere besten Werke gehen nicht über die griechische Schriftrollenlänge hinaus – das sind fünfunddreißig Fuß, was aber nur für hohe Literatur gilt. Als Daumenregel sind das ein Buch von Thukydides, zwei von Homer oder ein Schauspiel von fünfzehnhundert Zeilen. Nicht viele moderne Autoren verdienen die volle Länge. Zwanzig Fuß oder sogar die Hälfte davon sind ein guter Durchschnitt für einen beliebten Autor.« Er ließ mich den Eindruck gewinnen, dass mein Werk nicht zu den beliebten zählen könnte. »Daher ist kurz gut – Langes könnte abgelehnt werden. Und gehen Sie beim Einrichten des Manuskripts praktisch vor, wenn Sie ernst genommen werden wollen. Eine Schriftrolle hat fünfundzwanzig bis vierzig Zeilen pro Spalte und achtzehn bis fünfundzwanzig Buchstaben pro Zeile. Versuchen Sie unseren Schreibern entgegenzukommen. Ich bin sicher, Sie möchten professionell wirken.«
»O ja«, keuchte ich.
»Wenn Sie die Zeilenlänge berechnen, vergessen Sie nicht, die modernen Lesehilfen mit einzukalkulieren.«
»Was?«
»Satzzeichen, Leerstellen hinter den Wörtern, Zeilenendmarkierungen.«
Diese hatten anscheinend den Platz überholter Konzepte wie Intensität der Gefühle, Witz und stilistischer Eleganz eingenommen.
Kapitel V
Euschemon war in die alte Falle getappt. Er dachte, er hätte mich übers Ohr gehauen. Privatermittler sind dem Ruf nach dumm, das weiß jeder. Die meisten sind es tatsächlich – akribisch darin, keine wertvollen Informationen zu sehen und zu hören und dann das zu missdeuten, was sie mitkriegen. Aber einige von uns wissen, wie man blufft.
Daher unterließ ich es, direkt zu Chrysippus’ Skriptorium zu eilen, total begierig darauf, meine inspiriertesten Schöpfungen für ein lächerliches Honorar zu übergeben. Nicht mal, wenn mir das vertragliche Recht gewährt wurde, Kopien für den lächerlichen Preisnachlass zurückzukaufen, den ihre kriecherischen Lohnschreiberlinge ansonsten hinnahmen; nicht mal, wenn sie mir Goldblattpalmetten auf ihren Verkaufshochrechnungen anboten. Da ich Ermittler war, beschloss ich, mich über sie zu erkundigen. Und da ich keine Klienten hatte (wie üblich), hatte ich genug Zeit dazu. Außerdem kannte ich die richtigen Kontaktleute.
Mein Vater war Auktionator. Manchmal befasste er sich mit dem Markt für seltene Schriftrollen, obwohl ihm hauptsächlich Kunst und Möbel am Herzen lagen. Literatur aus zweiter Hand betrachtete er als die unterste Ebene seines Gewerbes. Ich sprach nur selten mit meinem Vater. Er war abgehauen, als ich sieben war, obwohl er jetzt behauptete, er habe meine Mutter finanziell bei der Aufzucht der rüpelhaften Kinder unterstützt, die er gezeugt hatte. Er mochte gute Gründe für sein Verschwinden gehabt haben – zumindest bessere Gründe als die Verlockung eines gewissen Rotschopfs –, aber ich hatte immer noch das Gefühl, da ich ohne väterliche Anwesenheit aufgewachsen war, auch jetzt auf seine Lästigkeit verzichten zu können.
Er genoss es, mich zu verärgern, weswegen ich mich fragte, wieso Papa gestern nicht zu meiner Lesung erschienen war. Er hätte sich nicht dadurch abhalten lassen, dass ich versäumt hatte, ihn einzuladen. Früher hätte Helena das getan, weil sie mit dem alten Schwerenöter auf gutem Fuß gestanden hatte, aber das war, bevor er ihr Gloccus und Cotta empfohlen hatte, die Bauunternehmer unseres neuen Badehauses, denen es gelungen war, unser neues Heim unbewohnbar zu machen. Als ihre Gerüste und ihr Staub, ihre Lügen und ihre Vertragsbrüche Helena in die frustrierte Wut eines endlos enttäuschten Kunden getrieben hatten, hatte sich ihre Meinung über meinen Vater der meinen genähert. Das einzige Risiko bestand jetzt noch darin, dass sie zu dem Schluss kam, ich wäre ihm ähnlich. Das konnte unser Ende sein.