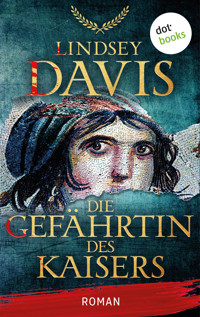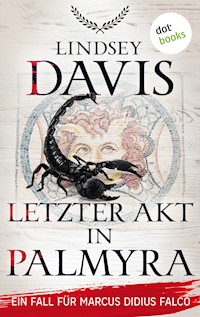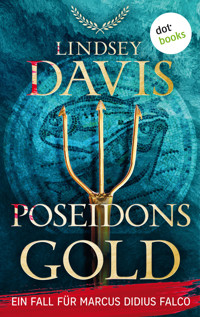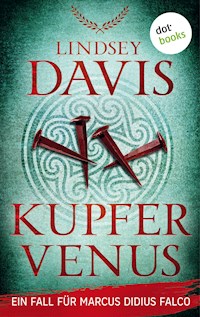6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Ein Festessen mit tödlichen Folgen: Der fesselnde historische Kriminalroman »Zwielicht in Cordoba« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 73 nach Christus. Sein Ruf als begabtester Privatermittler im Imperium Romanum bringt für Ex-Legionär Marcus Didius Falco einige Vorzüge mit sich: So staunt er nicht schlecht, als er zu einem rauschenden Gelage auf dem Palatin ausrichtet. Doch schnell wird Falco klar, dass der Reichtum der Olivenölhändler, die hier feiern, sich nicht allein auf rechtmäßigen Geschäften begründet – und als er einen der Gäste grausam hingerichtet auffindet, sieht er sich gezwungen, die Ermittlung aufzunehmen. Seine Nachforschungen führen ihn bis nach Cordoba, die Schatzkammer von Spanien. Doch er ahnt nicht, dass in der brütenden Mittagshitze bereits einer der Mörder seine Fährte aufgenommen hat … »Wie immer in dieser großartigen Serie mischen sich exzellente Details über die damalige Zeit und eine Reihe von exzentrischen Charakteren mit einer spannenden Handlung«, urteilt die kanadische Zeitschrift ›The Rue Morgue‹. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Zwielicht in Cordoba« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der achte Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 73 nach Christus. Sein Ruf als begabtester Privatermittler im Imperium Romanum bringt für Ex-Legionär Marcus Didius Falco einige Vorzüge mit sich: So staunt er nicht schlecht, als man ihn zu einem rauschenden Gelage auf dem Palatin einlädt. Doch schnell wird Falco klar, dass der Reichtum der Olivenölhändler, die hier feiern, sich nicht allein auf rechtmäßigen Geschäften begründet – und als er einen der Gäste grausam hingerichtet auffindet, sieht er sich gezwungen, die Ermittlung aufzunehmen. Seine Nachforschungen führen ihn bis nach Cordoba, die Schatzkammer von Spanien. Doch er ahnt nicht, dass in der brütenden Mittagshitze bereits einer der Mörder seine Fährte aufgenommen hat …
»Wie immer in dieser großartigen Serie mischen sich exzellente Details über die damalige Zeit und eine Reihe von exzentrischen Charakteren mit einer spannenden Handlung«, urteilt die kanadische Zeitschrift ›The Rue Morgue‹.
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Originaltitel »A Dying Light in Corduba« bei Century/Random House, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1996 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1999 bei Eichborn GmbH & Co. Verlags KG, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/cpaulfell, volkova natalia, Second Banana Images, Olemac
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-765-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Zwielicht in Cordoba« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Zwielicht in Cordoba
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
In Erinnerung an Edith Pargeter
Dramatis Personae
Römer in und außerhalb Roms
M. Didius Falco: ein besorgter werdender Vater und Held
Helena Justina: eine durch und durch vernünftige werdende Mutter und Heldin
D. Camillus Verus: ihr Vater, ebenfalls recht vernünftig, für einen Senator
Julia Justa: ihre Mutter, so vernünftig, wie man es erwarten kann
A. Camillus Aelianus: übellaunig, selbstgerecht und auf nichts Gutes aus
Q. Camillus Justinus: zu sanftmütig und gut, um auf der Bildfläche zu erscheinen
Falcos Mama: die vielleicht Brühe in den falschen Mund löffelt
Claudius Laeta: Obersekretär, auf Höheres aus
Anacrites: Oberspion und das Niederste vom Niederen
Momus: ein »Aufseher« und Mann, der Spione ausspioniert
Calisthenus: ein Architekt, der auf etwas Häßliches tritt
Quinctius Attractus: ein Senator mit großen Ambitionen in Baetica
T. Quinctius Quadratus: sein Sohn, ein Aufsteiger, der nicht aus Baetica wegkommt
L. Petronius Longus: ein treuer und nützlicher Freund
Helva: ein kurzsichtiger Türsteher, der auch mal wegsieht
Valentinus: ein gewitzter ungeladener Gast auf dem Weg nach draußen
Perella: eine reife Tänzerin mit ungeahnten Talenten
Stertius: ein Transportunternehmer mit ausgefallenen Ideen
Der Prokonsul von Baetica: der in nichts verwickelt werden will
Cornelius: Exquästor von Baetica, der die Szene hastig verläßt
Gn. Drusillus Placidus: ein Prokurator mit einem seltsamen Hang zur Rechtschaffenheit
Nux: ein Hund, der viel herumkommt
Baeticaner außerhalb und innerhalb von Baetica
Licinius Rufius: alt genug, um zu wissen, daß es nie genug Profit geben kann?
Claudia Adorata: seine Frau, die nichts mitgekriegt hat
Rufius Constans: sein Enkel, ein junger Hoffnungsträger mit einem Geheimnis
Claudia Rufina: ein ernstes Mädchen mit vielversprechender Zukunft
Annaeus Maximus: ein führendes Gemeindemitglied, das in die falsche Richtung führt?
Seine drei Söhne: bekannt als Großmaul, Knallkopp und Frettchen (was alles sagt!)
Aelia Annaea: eine Witwe mit attraktiven Besitztümern
Cyzacus senior: ein Flußschiffer, der in trüben Gewässern schippert?
Cyzacus junior: ein verkrachter Poet, der auf dem falschen Floß herumstakt?
Gorax: ein pensionierter Gladiator mit einer Vorliebe für Hühner
Norbanus: ein Negotiator, der zwielichtige Verträge abschließt?
Selia: eine außerordentlich schlüpfrige Tänzerin
Zwei Musiker: deren musikalische Fähigkeiten nicht ausschlaggebend sind
Marius Optatus: ein vergrätzter Pächter
Marmarides: ein Fahrer mit einer vielverlangten Rarität
Cornix: eine schlechte Erinnerung
Der Schreiber des Quästors: der das Büro führt
Die Schreiber des Prokonsuls: die viel trinken (und das Büro führen)
Tänzler: ein sehr alter Ackergaul
Teil I
Rom
Am Abend des 31. März 73 n.Chr.
»Cordobaner jeden Ranges versuchten, mindestens so römisch zu sein wie die Römer selbst. Es gibt keine Anzeichen für ein ›nationales Bewußtsein‹ bei Männern wie dem älteren Seneca, obwohl vermutlich eine gewisse Sympathie zwischen den Söhnen Spaniens herrschte, wenn sie sich in Rom begegneten ...«
Robert C. Knapp, Roman Cordoba
Kapitel I
Vergiftet wurde niemand beim Festessen der Gesellschaft der Olivenölhersteller von Baetica – was, im nachhinein betrachtet, recht überraschend war.
Hätte ich gewußt, daß Anacrites, der Oberspion, anwesend sein würde, dann hätte ich eine kleine Phiole mit Krötenblut mitgebracht und in meiner Serviette versteckt bereitgehalten. Allerdings mußte der Mann sich so viele Feinde gemacht haben, daß er bestimmt täglich Gegengifte schluckte, falls eine arme Seele, die er zu töten versucht hatte, die Chance nutzte und ihm Aconitessenz in den Wein träufelte. Vorzugsweise ich, wenn möglich. Das war Rom mir schuldig.
Der Wein war vielleicht nicht so vollmundig wie ein Falerner, aber es war das Beste, was die Gilde der hispanischen Weinimporteure zu bieten hatte, und er war zu gut, um ihn mit tödlichen Tropfen zu verderben, außer man hegte einen wirklich ernsthaften Groll gegen jemanden. Viele der Anwesenden mochten Mordgedanken haben, aber ich war neu hier, mußte mich erst mal zurechtfinden und herausbekommen, wer mit wem ein Hühnchen zu rupfen hatte. Vielleicht hätte ich aber doch mißtrauischer sein sollen. Die Hälfte der Gäste arbeitete in der Regierung, die anderen hatten mit Handel zu tun. Das roch nach nichts Gutem.
Ich war an diesem Abend auf alles mögliche vorbereitet. Der erste – wenn auch angenehme – Schock war, daß mir der Sklave am Eingang zur Begrüßung einen Becher ausgezeichneten Rotwein aus Barcino reichte. Der Abend war Baetica gewidmet, der reichen, heißen Schatzkammer im südlichen Spanien. Ich persönlich finde die Weine aus dieser Provinz seltsam enttäuschend: weiß und dünn. Aber offenbar waren die Leute aus Baetica vernünftig. Kaum verließen sie ihre Heimat, tranken sie Tarraconenser – den berühmten Lacitana aus dem Nordwesten von Barcino, von den Hängen der Pyrenäen, wo der Wein in den langen, heißen Sommermonaten reift, es im Winter aber genügend Regen gibt. Ich selbst war nie in Barcino, hatte weder eine Ahnung, was Barcino für mich bereithielt, noch war ich daran interessiert, es herauszufinden. Wer braucht schon die düsteren Prophezeiungen von Wahrsagern? Das Leben hält auch so genug Unannehmlichkeiten bereit.
Dankbar nippte ich an dem lieblich schmeckenden Wein. Ich war als Gast eines Ministerialbeamten namens Claudius Laeta hier, war ihm hinein gefolgt und tappte höflich in seinem Troß mit, während ich mir klarzuwerden versuchte, was ich eigentlich von ihm hielt. Sein Alter war schwer zu schätzen, irgendwo zwischen vierzig und sechzig. Er hatte volles Haar (eine stumpfe, braune Matte, kurz, gerade, nicht sonderlich aufregend geschnitten). Sein Körper war durchtrainiert, seine Augen scharf, sein Verhalten wachsam. Er trug eine weitgeschnittene Tunika mit schmaler Goldborte unter der schlichten weißen Toga des Palastbeamten. An seiner Hand blitzte der breite Goldring der Ritterschaft, was bewies, daß irgendein Kaiser viel von ihm hielt. Mehr, als die Obrigkeit von mir zu halten schien.
Ich hatte ihn während einer offfiziellen Untersuchung für Vespasian kennengelernt, unseren bärbeißigen, rigorosen neuen Kaiser. Laeta war mir wie die Art aalglatter Sekretär vorgekommen, ein Meister in der Kunst, tüchtig zu wirken, während er die Drecksarbeit Leuten wie mir überließ. Jetzt hatte er sich meiner angenommen – nicht, daß ich es darauf angelegt hätte, aber ich betrachtete ihn als einen möglichen Verbündeten gegen jene im Palast, die sich meinem gesellschaftlichen Aufstieg widersetzten. Ich würde ihn noch nicht mal mein Pferd halten lassen, während ich mich bückte, um mir die Schnürsenkel zuzubinden, aber das galt für alle Beamten. Er wollte etwas von mir; ich wartete darauf, daß er mir sagte, was es war.
Laeta hatte es ganz bis nach oben geschafft: Ein kaiserlicher Exsklave, geboren und ausgebildet im Palast der Cäsaren von den kultivierten, gebildeten, skrupellosen Orientalen, die lange das Römische Reich verwaltet hatten. Heutzutage bildeten sie einen diskreten Zirkel hinter den Kulissen, aber ich nahm nicht an, daß sich an ihren Methoden viel geändert hatte seit der Zeit, als sie noch offen auftraten. Laeta selbst mußte es irgendwie geschafft haben, Nero zu überleben, hatte offenbar den Kopf tief genug gehalten, um nicht als Neros Mann zu gelten, als Vespasian die Macht übernahm. Jetzt trug er den Titel Obersekretär, aber es war deutlich zu erkennen, daß er mehr sein wollte als nur derjenige, der dem Kaiser die Schriftrollen reichte. Er war ehrgeizig und suchte nach einem Bereich, in dem er sich voll entfalten konnte. Ob er größere Bestechungssummen annahm, mußte ich erst noch herausfinden. Er schien ein Mann zu sein, der seine Stellung und ihre Möglichkeiten zu sehr genoß, um sich mit so was abzugeben. Ein Organisator. Ein Mann langfristiger Pläne. Das Reich war bankrott und schwer angeschlagen, aber unter Vespasian herrschte eine neue Stimmung von Aufbruch und Wiederaufbau. Palastbeamte konnten sich Geltung verschaffen und wurden anerkannt.
Ich wünschte, das könnte ich auch von mir sagen.
»Der heutige Abend sollte sich als nützlich für Sie erweisen, Falco«, meinte Laeta, als wir im alten Palast eine Reihe nur noch wenig benutzter Räume betraten. Meine Gastgeber bewiesen einen seltsamen Geschmack bei der Wahl ihres Treffpunktes. Vielleicht hatten sie die spinnwebverhangenen kaiserlichen Kellergewölbe billig mieten können. Der Kaiser würde gern seine persönlichen Repräsentationsräume vermieten, um an ein paar Nebeneinnahmen zu kommen.
Wir befanden uns tief unter dem Palatin, in staubigen Sälen mit düsterer Geschichte, wo Tiberius und Caligula einst rebellische Männer gefoltert und legendäre Orgien gefeiert hatten. Ich fragte mich, ob es wohl immer noch geheime Gruppen gab, die diese Ereignisse nachstellten. Dann begann ich über meine Gastgeber nachzudenken. In den Räumen gab es keine obszönen Fresken, aber das verblichene Dekor und die verschüchterten, katzbuckelnden Faktoten, die im Schatten der Torbogen herumlungerten, gehörten alten, düsteren Zeiten an. Jeder, der es für eine Ehre hielt, hier zu speisen, konnte keine sehr hohe Meinung vom öffentlichen Leben haben.
Mir war nur wichtig, ob heute abend hier mit Laeta aufzukreuzen mir etwas nützen würde. Ich stand kurz davor, zum ersten Mal Vater zu werden, und brauchte dringend gesellschaftliche Anerkennung. Um in angemessenem Stil den Bürger spielen zu können, brauchte ich außerdem sehr viel mehr Geld.
Als der Beamte mich hineinführte, lächelte ich und gab vor, seinen Versprechungen zu glauben. Insgeheim hatte ich nur wenig Hoffnung, durch die hier geknüpften Kontakte etwas zu gewinnen, aber ich fühlte mich verpflichtet, die Farce mitzumachen. Wir lebten in einer Stadt der Beziehungen. Als Privatermittler und kaiserlicher Agent war ich mir dessen mehr bewußt als die meisten. Jeden Morgen waren die Straßen voll mitleiderregender Gestalten, die in mottenzerfressenen Togen durch die Stadt eilten, um angeblich wichtigen Männern ihre Aufwartung zu machen. Und laut Laeta würde dieses Essen der Gesellschaft der Olivenölhersteller von Baetica mir erlauben, mich unter die mächtigen kaiserlichen Freigelassenen zu mischen, die die eigentliche Regierungsarbeit leisteten (oder sich einbildeten, das zu tun).
Laeta hatte gesagt, ich sei die perfekte Ergänzung für seine Mannschaft – meine Aufgabe dabei war unklar geblieben. Er hatte mich irgendwie davon überzeugt, daß die mächtigen Löwen der Bürokratie von ihren Freßnäpfen aufschauen und in mir sofort einen loyalen Staatsdiener erkennen würden, der auf der Erfolgsleiter einen Schubs nach oben verdiente. Ich wollte ihm glauben. Doch in meinen Ohren klangen noch die spöttischen Worte meiner Freundin nach; Helena Justina war überzeugt davon, daß mein Vertrauen in Laeta naiv war. Zum Glück sind Eßgelage in Rom Männersache, also war Helena mit einem Becher stark verdünnten Weins und einem Käsebrötchen zu Hause geblieben. Jeden etwaigen Schwindel mußte ich selbst aufdecken.
Eines an der baetischen Gesellschaft ließ allerdings nichts zu wünschen übrig: das Essen, aufgetragen auf geborgten augusteischen Vorlegeplatten und eingebettet zwischen die üppigen Goldverzierungen der von Nero übriggebliebenen Servierschalen, war hervorragend. Pfeffrige kalte Vorspeisen lachten uns bereits von den niedrigen Tischen entgegen; Fleischgerichte in zweierlei Saucen wurden auf kunstvollen Holzkohlerechauds warm gehalten. Offenbar wurden viele Gäste erwartet. Gruppen von Speiseliegen rahmten in diversen Räumen niedrige Tische ein, auf denen dieses luxuriöse Mahl serviert werden sollte.
»Ein bißchen mehr als die traditionellen neun Essensgäste!« prahlte Laeta stolz. Dieses war eindeutig sein Lieblingsclub.
»Erzählen Sie mir etwas über die Gesellschaft.«
»Nun, sie wurde von einem der Pompejis gegründet ...«
Laeta hatte uns einen Platz an einem Tisch gesichert, wo die Auswahl aufgeschnittenen baetischen Schinkens besonders verlockend aussah. Er nickte den anderen Speisenden in der Runde zu: weiteren Beamten in höherer Stellung. (Sie gluckten zusammen wie die Kellerasseln.) Genau wie Laeta signalisierten sie ungeduldig dem Sklaven, mit dem Servieren zu beginnen, obwohl noch längst nicht alle Gäste einen Platz gefunden hatten. Laeta stellte mich vor. »Marcus Didius Falco – ein interessanter junger Mann. Falco war für unsere Freunde vom Geheimdienst an verschiedenen Unruheherden im Ausland tätig.« Ich spürte etwas in der Luft – nicht feindselig, aber auffallend. Zweifellos interne Eifersucht. Zwischen dem Korrespondenzsekretariat und der Spionage herrschte wenig Sympathie. Ich merkte, wie man mich prüfend und mit Interesse musterte – kein angenehmes Gefühl.
Laeta erwähnte die Namen seiner Freunde, die ich mir gar nicht erst merkte. Sie waren nur Schriftrollenschubser und Stilusschwinger. Ich wollte Männer vom Status der bedeutenden kaiserlichen Minister der Vergangenheit kennenlernen – Narcissus oder Pallas, die jene Posten innehatten, auf die Laeta offenbar scharf war.
Das Gespräch drehte sich weiter um nichtige Dinge. Dank meiner nur aus höflicher Neugier gestellten Frage mußte ich eine längere Diskussion über die Frage ertragen, ob die Gesellschaft von Pompejus dem Großen gegründet worden war (den der Senat mit der Statthalterschaft über beide spanische Provinzen geehrt hatte) oder von Pompejus, dem Rivalen Julius Cäsars (der Baetica zu seiner persönlichen Ausgangsbasis gemacht hatte).
»Und wer gehört zur Gesellschaft?« murmelte ich, um das Ganze zu beschleunigen. »Sie unterstützen doch bestimmt nicht mehr die Pompejis?« Nicht, seit die Pompejis mit einem nachhallenden Rums in Ungnade gefallen waren. »Ich nehme an, wir sind zur Förderung des Handels mit Spanien hier?«
»Jupiter schütze uns!« meinte einer der hochtrabenden Politikmacher schaudernd. »Wir sind hier, um einen gemütlichen Abend mit Freunden zu erleben!«
»Ach so.« Tat mir leid, daß ich ins Fettnäpfchen getreten war. (Allerdings nicht allzusehr. Ich trete mit Vergnügen in Fettnäpfchen.)
»Vergessen Sie den Namen der Gesellschaft«, lächelte Laeta jovial. »Das ist nur ein historisches Versehen. Alte Kontakte ermöglichen es uns, für unsere Gastmahle die größten Köstlichkeiten dieser Provinz zu bekommen – aber das ursprüngliche Bestreben war nur, in Rom einen legitimen Treffpunkt für gleichgesinnte Männer zu finden.«
Auch ich lächelte. Ich wußte, was er damit sagen wollte. Er meinte Männer mit gleichen politischen Anschauungen.
Ein Hauch von Gefahr umgab diese Gruppe. In großen Gruppen zu speisen – oder sich privat, für welchen Zweck auch immer, zu treffen – war verboten. Rom hatte organisierte Gruppen stets mißbilligt. Nur Gilden bestimmter Kaufleute oder Handwerker war es erlaubt, sich für regelmäßige Festmahle ihren Frauen zu entziehen. Und selbst sie mußten sich einen seriösen Anstrich geben und behaupten, hauptsächlich ginge es darum, Beiträge für ihren Beisetzungsfonds einzusammeln.
»Also brauche ich nicht damit zu rechnen, hier wichtige Exporteure spanischen Olivenöls kennenzulernen?«
»O nein!« Laeta tat ganz schockiert. Jemand machte eine leise Bemerkung. Er zuckte zusammen und sagte dann zu mir: »Nun ja, manchmal drängt sich eine entschlossene Gruppe baetischer Geschäftsleute rein. Einige sind heute abend hier.«
»Wie gedankenlos!« bemerkte ein anderer Schriftrollenschubser mitfühlend. »Jemand sollte der gesellschaftlichen Elite in Cordoba und Gades erklären, daß die Gesellschaft baetischer Olivenölhersteller bestens ohne Mitglieder auskommt, die tatsächlich aus Südspanien stammen!«
Meine Frage war reinste Bosheit gewesen. Unter den Snobs von Rom – und freigelassene Sklaven sind natürlich die größten Snobs überhaupt – herrschte starke Antipathie gegen aufdringliche Provinzler. Die Spanier waren schon viel länger in der Kelten-Fraktion als die Gallier oder die Britannier und hatten daher ihre Vorgehensweisen verfeinert. Seit sie vor sechzig oder siebzig Jahren in die römische Gesellschaft aufgenommen worden waren, überschwemmten sie den Senat, sicherten sich die bestdotierten Stellen in der Ritterschaft, forderten die Literaturszene mit ganzen Horden von Dichtern und Rhetorikern heraus, und jetzt schienen auch ihre Handelsmagnaten überall herumzuwieseln.
»Der verdammte Quinctius muß mal wieder seine gesamte Klientel vorführen!« brummelte einer der Schreiber, und die Münder der anderen verzogen sich in zustimmender Verachtung.
Ich bin ein höflicher Mensch. Um die Stimmung zu heben, meinte ich: »Ihr Öl scheint von bester Qualität zu sein.« Worauf ich meinen Finger in den Brunnenkressesalat tauchte und ihn ableckte. Das Öl schmeckte nach Wärme und Sonnenschein.
»Pures Gold!« Laeta klang respektvoller, als ich es von einem Freigelassenen bei einem Gespräch über Handelsgeschäfte erwartet hätte. Vielleicht war das ein Hinweis auf den neuen Realismus unter Vespasian. (Der Kaiser kam aus einer Familie, die dem mittleren Rang, der Ritterschaft, angehörte, und wußte genau, warum Bedarfsgüter wichtig für Rom waren.)
»Sehr gut – sowohl im Essen als auch für die Lampen.« Die Räume wurden durch verschiedenste Hänge- und Stehlampen erleuchtet, die alle in stetiger Helligkeit und natürlich geruchlos brannten. »Die Oliven sind ebenfalls nicht übel.« Ich nahm mir eine von der Garnierung und griff gleich noch einmal zu.
»Didius Falco ist berühmt für seine politischen Analysen«, bemerkte Laeta, zu den anderen gewandt. Das war mir neu. Wenn ich für irgendwas berühmt bin, dann höchstens dafür, Trickbetrüger in die Enge zu treiben und Verbrecher mit einem gezielten Fußtritt in die Eier lahmzulegen. Und dafür, daß ich eine Senatorentochter aus ihrem Heim und den Fängen ihrer liebevollen Verwandten geraubt hatte. Eine Tat, die mich in den Augen mancher Leute selbst zum Kriminellen macht.
Während ich überlegte, ob ich hier auf etwas gestoßen war, das mir Laetas Einladung eingetragen hatte, plauderte ich weiter über das »pure Gold«: »Mir ist klar, daß Ihre ehrenwerte Gesellschaft nicht nach irgendeinem beliebigen Produkt benannt worden ist, sondern nach einer Grundsubstanz kultivierten Lebens. Olivenöl ist für jeden Koch die wichtigste Zutat. Es erleuchtet die vornehmsten Villen und öffentlichen Gebäude. Die Armee konsumiert es in großen Mengen. Olivenöl ist die Ausgangsbasis für Parfums und Arzneien. Es gibt kein Badehaus und kein Gymnasium, das ohne ölhaltige Produkte auskommt ...«
»Und es ist ein unfehlbares Verhütungsmittel!« fügte einer der fröhlicheren Stilusschwinger hinzu.
Ich lachte und sagte, es wäre schön gewesen, wenn ich das vor sieben Monaten gewußt hätte.
Nachdenklich wandte ich dann meine Aufmerksamkeit dem Essen zu. Das schien den anderen nur recht zu sein. Sie wollten, daß Außenseiter den Mund hielten, während sie das große Wort führten. Die Unterhaltung wurde zu dem üblichen Kauderwelsch mit kryptischen Anspielungen auf ihre Arbeit.
Die letzte Bemerkung hatte mich zum Grinsen gebracht. Unwillkürlich stellte ich mir vor, wie Helena, wenn ich ihr vom Vorschlag des Stilusschwingers erzählte, nur spöttisch bemerken würde, das höre sich an, als ginge man mit einem marinierten Rettich ins Bett. Trotzdem war Olivenöl mit Sicherheit leichter zu bekommen als das illegale Alaunwachs, das wir hatten benutzen wollen, um die Gründung einer Familie zu verhindern. (Illegal, weil man, wenn man sich für eine junge Dame aus der falschen Gesellschaftsschicht erwärmte, nicht mit ihr sprechen und sie schon gar nicht ins Bett zerren durfte – und wenn der Schwarm aus der eigenen Schicht kam, hatte man zu heiraten und Soldaten zu produzieren.) Olivenöl war nicht billig, aber es gab genug davon in Rom.
Das ganze Essen stand unter einem passenden spanischen Motto. Das hieß, wir bekamen äußerst Schmackhaftes vorgesetzt, doch alle Rezepte kamen aus der gleichen Provinz: kalte Artischocken in Garum, der Fischsoße von der baetischen Küste; heiße Eier in gesalzener Fischsoße mit Kapern; eine in Fischsoße und Rosmarin gekochte Geflügelfarce. Die Endivien wurden pur serviert, nur mit gehackten Zwiebeln garniert – obwohl ein Silberschälchen mit Sie-haben-es-erraten dazu gereicht wurde. Ich beging den Fehler, zu erwähnen, daß meine schwangere Freundin ganz verrückt nach diesem alles überlagernden Garum war, worauf die gütigen Beamten sofort einigen Sklaven befahlen, mir eine ungeöffnete Amphore als Mitbringsel zu überreichen. Jene von ihnen, die eine bescheidene Küche führen, haben vielleicht noch nicht bemerkt, daß Fischsoße in riesigen birnenförmigen Gefäßen importiert wird – von denen eines für den Rest des Abends zu meinem persönlichen Gepäck wurde. Zum Glück liehen mir meine extravaganten Gastgeber zwei Sklaven, die das schwere Ding tragen sollten.
Neben dem köstlichen geräucherten Schinken, für den Baetica berühmt ist, bestanden die Hauptgerichte überwiegend aus Fisch: weniger Sardinen, über die wir alle witzeln, sondern Austern und riesige Muscheln, dazu all der Fisch, der an den Küsten des Atlantiks und des Mare Internum gefangen wird – Dorade, Makrele, Thunfisch, Meeraal und Stör. Wenn im Topf noch Platz für eine Handvoll Garnelen war, hatte der Koch auch sie noch hineingeworfen. Es gab Fleisch, meiner Vermutung nach von feurigen spanischen Pferden, und eine große Auswahl an Gemüse. Schon bald war ich pappsatt und erschöpft – aber meine Karriere war noch keinen Fingerbreit vorangekommen.
Da es ein Club war, bewegten sich die Leute zwischen den einzelnen Gängen ungezwungen von Tisch zu Tisch. Ich wartete, bis Laeta sich abgewandt hatte, dann schlüpfte auch ich davon (nachdem ich den Sklaven befohlen hatte, mir mit der Garum-Amphore zu folgen), als wolle ich mich ebenfalls ein wenig umsehen. Laeta bedachte mich mit einem zustimmenden Blick; er meinte, ich wolle mich zu einem der Grüppchen setzen, in denen über Politik gekungelt wurde.
In Wirklichkeit wollte ich mich heimlich zu einem Ausgang schleichen und heimgehen. Doch als ich meine Träger und das Garum in einen Durchgang führte, stieß ich mit jemand zusammen. Der Neuankömmling war eine Frau; die einzige weit und breit. Natürlich blieb ich sofort stehen, befahl den Sklaven, die Amphore abzustellen, zupfte meine Festgirlande zurecht und lächelte sie an.
Kapitel II
Sie war in einen bodenlangen Umhang gehüllt. Ich mag es, wenn Frauen gut verpackt sind. Es läßt sich herrlich darüber spekulieren, was sie verbergen und warum sie es für sich behalten wollen.
Diese verlor ihr Geheimnis, als sie mit mir zusammenstieß. Ihr langer Umhang glitt zu Boden und enthüllte, daß sie als die Jägerin Diana verkleidet war. Allerdings war der Ausdruck »Kleidung« nur bedingt anwendbar. Sie trug ein nur auf einer Schulter befestigtes kurzes goldfarbenes Kostümchen. In einer Hand hielt sie einen großen Beutel, aus dem ein Tamburin hervorlugte, unter den Arm hatte sie einen Köcher und einen lächerlichen Spielzeugbogen geklemmt.
»Die jungfräuliche Jägerin!« begrüßte ich sie fröhlich. »Sie müssen für die Unterhaltung zuständig sein.«
»Und Sie sind wohl der Possenreißer!« schnappte sie. Ich bückte mich und hob ihren Umhang auf, was mir erlaubte, ihre wohlgeformten Beine zu betrachten. »Gerade die richtige Haltung für einen schmerzhaften Tritt!« fügte sie spitz hinzu. Ich kam schnellstens wieder hoch.
Auch so gab es genug zum Anschauen. Normalerweise hätte sie mir bis an die Schulter gereicht, trug aber hohe Korkabsätze unter ihren geflochtenen Jagdsandalen. Selbst ihre Zehennägel waren wie Alabaster poliert. Ihre glatte, extrem dunkle Haut war ein Wunder der Haarentfernungskunst. Man mußte ihr jedes einzeln ausgezupft und sie mit Bimsstein abgerieben haben – allein der Gedanke daran ließ mich schaudern. Ebensoviel Aufmerksamkeit hatte ihrem Schminken gegolten: die Wangen betont durch purpurfarbene Wischer von zermahlenem Weinstein, die Augenbrauen perfekte, halbfingerbreite Bögen, die Lider mit Safran bestäubt, die Wimpern mit Lampenruß geschwärzt. Am einen Oberarm trug sie einen Reif aus Elfenbein, am anderen eine silberne Schlange.
Die Wirkung war absolut professionell. Sie war niemandes teure Mätresse (keine Gemmen oder Filigranarbeiten), und da Frauen nicht eingeladen waren, war sie auch niemandes Gast.
Sie mußte eine Tänzerin sein. Ihr Körper war gut gepolstert, aber muskulös. Ihre schimmernde Mähne, so schwarz, daß sie bläuliche Glanzlichter hatte, war zu einem einfachen Zopf zusammengedreht, den man für dramatische Effekte rasch lösen konnte. Ihren Händen sah man die Übung mit den Kastagnetten deutlich an.
»Mein Fehler«, gab ich vor, mich zu entschuldigen. »Mir war eine spanische Tänzerin versprochen worden. Ich hatte gehofft, Sie seien ein unartiges Mädchen aus Gades.«
»Tja, ich bin aber ein artiges Mädchen aus Hispalis«, gab sie zurück und wollte sich an mir vorbeidrängen.
Sie sprach in abgehacktem, recht geschliffenem Latein. Hätte der Abend nicht unter dem baetischen Motto gestanden, wäre es schwer gewesen, die Herkunft dieser Diana zu erraten.
Dank meiner dicken Amphore blockierte ich den halben Durchgang. Wenn sie sich vorbeidrückte, würden wir uns erfreulich nahekommen. Ich bemerkte ihren Blick, der mir klarmachte, daß sie mir bei einer falschen Bewegung die Nase abbeißen würde.
»Mein Name ist Falco.«
»Gut, dann gehen Sie mir aus dem Weg, Falco.«
Entweder hatte ich meinen Charme eingebüßt, oder sie hatte einen Eid geleistet, sich von gutaussehenden Männern mit einnehmendem Lächeln fernzuhalten. Oder machte ihr mein großer Krug mit fermentierten Fischinnereien angst?
Ein älterer Mann mit einer Kithara trat aus einem Raum auf der anderen Seite des Flures. Sein Haar war graumeliert, und sein scharf geschnittenes Gesicht hatte eine dunkle, mauretanische Färbung. Er kümmerte sich nicht um mich. Die Frau erwiderte sein Nicken und ging ihm nach. Ich beschloß, dazubleiben und mir ihren Auftritt anzusehen.
»Tut mir leid, das sind private Gemächer!« fauchte sie und knallte mir die Tür vor der Nase zu.
»Völliger Blödsinn! Die baetische Gesellschaft hat Mauscheleien in dunklen Ecken noch nie geduldet. Wir gestatten hier keine privaten Festivitäten ...«
Es war Laeta. Ich hatte zu lange herumgebummelt, und er war mir gefolgt. Mitzubekommen, was das Mädchen sagte, verwandelte ihn in einen allwissenden Beamten übelster Sorte. Ich war zurückgewichen, um meine edle Etruskernase nicht gebrochen zu bekommen, aber er drängte sich an mir vorbei, wild entschlossen, ihr nachzustürmen. Seine anmaßende Art hielt mich fast davon ab, ihm zu folgen, doch er hatte mich erneut in seinen Dunstkreis hineingezogen. Die geduldigen Sklaven lehnten die Amphore gegen den Türrahmen, und wir segelten in den Salon, in dem das unverschämte Mädchen seinen Tanz vorführen sollte.
Kaum hatte ich meinen Blick über die Liegen wandern lassen, erkannte ich, daß Laeta mich belogen hatte. Statt der hochrangigen Weltherrscher, die er mir vorgegaukelt hatte, ließ dieser auserlesene Speiseclub auch Gäste zu, die ich bereits kannte – darunter zwei, die zu vermeiden ich freiwillig Rom zu Fuß durchquert hätte.
Sie hatten es sich auf zwei Liegen nebeneinander bequem gemacht, was in sich schon Grund zur Beunruhigung war. Der eine war Camillus Aelianus, der Bruder meiner Freundin, ein ungehobelter, übellauniger junger Mann, der mich nicht ausstehen konnte.
Der andere war Anacrites, der Oberspion. Auch Anacrites verabscheute mich – vor allem, weil er wußte, daß ich im selben Feld bessere Arbeit leistete als er. Seine Eifersucht hatte beinahe tödliche Folgen gehabt, und wenn ich je die Gelegenheit dazu bekäme, würde ich ihn mit großer Wonne auf einem Leuchtturm an einen Pfahl binden, dann ein großes Signalfeuer unter ihm aufschichten und es anzünden.
Vielleicht hätte ich gehen sollen. Doch aus reiner Dickköpfigkeit marschierte ich hinter Laeta her.
Anacrites wirkte unangenehm berührt. Da wir ja als Kollegen im Staatsdienst galten, schien er sich zur Höflichkeit verpflichtet zu fühlen und winkte mich zu einem freien Platz neben ihm. Statt mich zu setzen, ließ ich von den Sklaven meine Amphore zur Ruhe betten, den schlanken Hals auf dem Ellbogenpolster. Anacrites verabscheute alles Exzentrische. Genau wie Helenas Bruder. Auf der Liege nebenan kochte der illustre Camillus Aelianus jetzt vor Wut.
Das war schon besser. Ich schnappte mir einen Becher Wein von einem hilfreichen Bediensteten und bekam im Handumdrehen strahlende Laune. Dann strafte ich beide Männer mit Mißachtung und ging quer durch den Raum zu Laeta, der mich zu sich rief, da er mich jemandem vorstellen wollte.
Kapitel III
Um zu Laeta zu kommen, mußte ich mich durch eine Mischung seltsamer Gäste schlängeln. Ich hatte gehofft, heute abend kein berufliches Interesse entwickeln zu müssen, aber die unklaren Motive des Obersekretärs für meine Einladung hatten mich wachsam bleiben lassen. Außerdem nahm ich diese Gesellschaft ganz automatisch unter die Lupe. Während Laeta mich zunächst zum harten Kern der hier regelmäßig Essenden und Trinkenden geführt hatte, wirkten diese Männer fast wie Fremde, die sich nur zufällig auf freien Liegen zusammen niedergelassen hatten und jetzt das Beste aus dem Abend machen mußten. Ich spürte leises Unbehagen.
Allerdings konnte ich mich täuschen. In der Welt der Ermittler sind Fehler alltäglich.
Dieser Salon war von vornherein als Eßzimmer entworfen worden – unter den neun strengen, zueinander passenden, schwergewichtigen Liegen war das schwarzweiße Mosaik schlicht, wies aber in der Mitte des Fußbodens ein komplexeres geometrisches Muster auf. Laeta und ich durchquerten jetzt diesen Bereich, wo noch die niedrigen Serviertische standen, später aber die Tänzerin auftreten würde. Wir gingen auf einen Mann zu, der wie ein bedeutender Gastgeber das Kopfende einnahm. Er sah aus, als meinte er, den ganzen Raum zu beherrschen.
»Falco, darf ich Ihnen eines unserer eifrigsten Mitglieder vorstellen – Quinctius Attractus!«
Der Name sagte mir etwas. Das war der Mann, über den sich die anderen beschwert hatten, weil er eine Gruppe echter Baeticaner mitgebracht hatte.
Er schnaubte, schien verärgert, weil Laeta ihn störte. Der Mann war ein massiger Senator von über Sechzig mit schweren Armen und dicken Fingern – nicht direkt ein Fettwanst, aber er lebte offensichtlich gut. Die Überreste seiner einstigen Haarpracht waren schwarz und lockig und seine Haut wettergegerbt, als hielte er sich an altmodische Gewohnheiten und inspizierte seine ausgedehnten Weinberge, weil er sich einreden wollte, daß er dem Land nach wie vor eng verbunden sei.
Vielleicht stammten seine Nebeneinkünfte ja auch aus Olivenhainen.
Ich brauchte mich eindeutig nicht um Konversation zu bemühen, denn der Senator zeigte kein Interesse an mir. Laeta übernahm die Gesprächsführung: »Haben Sie heute abend mal wieder eine Ihrer kleinen Gruppen mitgebracht?«
»Scheint mir ein angemessener Ort, meine Besucher zu unterhalten!« schnauzte Quinctius. Im Prinzip hatte der Mann recht, aber seine Art war unsympathisch.
»Dann wollen wir hoffen, daß Sie alle Gewinn daraus ziehen!« erwiderte Laeta lächelnd mit der heiteren Überheblichkeit des Beamten, der eine bösartige Anspielung macht. Da ich den Hintergrund dieses Schlagabtausches nicht verstand, mußte ich sehen, wo ich etwas zu meiner eigenen Unterhaltung fand. Als ich hereingekommen war, hatte Anacrites ausgesehen, als würde er sich gut amüsieren. Doch als ich jetzt in seine Richtung schaute, sah ich, daß er ganz steif und still auf seiner Liege lag. Seine merkwürdigen hellgrauen Augen waren verschleiert, sein Gesichtsausdruck undeutbar. Der fröhliche Festgast mit glatt zurückgekämmtem Haar und makelloser Tunika war jetzt angespannt wie eine Jungfrau, die sich zum Treffen mit ihrem ersten Schäfer hinausschleicht. Meine Anwesenheit hatte ihm offensichtlich den Spaß verdorben. Und so wie er schaute – und gleichzeitig so tat, als bemerke er nichts –, gefiel es ihm nicht, daß Laeta mit Quinctius Attractus sprach.
Rasch ließ ich meinen Blick über die auf drei Seiten verteilte Gruppe der Speiseliegen wandern. Die baetischen Eindringlinge zu entdecken, deren Invasion Laetas Kollegen so verärgert hatte, fiel nicht schwer. Man erkannte sie an ihrer typisch spanischen Gestalt – breiter Körper mit kurzen Beinen. Zwei saßen je rechts und links von Quinctius auf den Ehrenplätzen, zwei weitere seitlich zu seiner Rechten. Sie trugen die gleichen Borten an ihren Tuniken und Ausgehsandalen mit zähen Sohlen aus Espartogras. Wie gut sie einander kannten, ließ sich nicht sagen. Sie sprachen Latein, was zu dem teuren Material ihrer Kleidung paßte, aber wenn sie nach Rom gekommen waren, um Olivenöl zu verkaufen, wirkten sie eher zurückhaltend, zeigten nicht die entspannte Selbstsicherheit, mit der man Käufer einwickelte.
»Warum stellen Sie uns nicht Ihren baetischen Freunden vor?« fragte Laeta den Senator. Quinctius sah aus, als hätte er Laeta am liebsten geraten, schnurstracks in die Unterwelt zu verschwinden, aber da wir bei diesem Essen ja alle Blutsbrüder sein sollten, mußte er der Aufforderung nachkommen.
Die zwei Besucher zur rechten Seite, die rasch und eher abschätzig als Cyzacus und Norbanus vorgestellt wurden, hatten in einer vertraulichen Unterhaltung die Köpfe zusammengesteckt. Obwohl sie uns zunickten, waren sie zu weit weg, um ein Gespräch zu beginnen. Die uns näher Sitzenden auf den Ehrenplätzen neben Quinctius hatten geschwiegen, während Laeta sprach. Sie hatten gehört, wie Laeta und der Senator sich gegenseitig mit liebenswürdigen Unfreundlichkeiten zu überbieten suchten, aber ihre Neugier verborgen. Dem Obersekretär des Kaisers vorgestellt zu werden schien sie mehr zu beeindrucken als die anderen beiden. Vielleicht dachten sie, daß Vespasian nun jederzeit auftauchen könnte, um zu sehen, ob Laeta die morgige Audienzliste fertig hatte.
»Annaeus Maximus und Licinius Rufius.« Brüsk nannte Quinctius Attractus ihre Namen. Er mochte zwar der Patron dieser Gruppe sein, aber sein Interesse an ihnen klang nicht eben väterlich. Etwas freundlicher fügte er jedoch hinzu: »Zwei der wichtigsten Ölhersteller aus Cordoba.«
»Annaeus!« warf Laeta sofort ein. Er wandte sich an den Jüngeren der beiden, einen breitschultrigen, kompetent aussehenden Mann von etwa fünfzig Jahren. »Heißt das, Sie sind ein Verwandter von Seneca?«
Der Baeticaner bestätigte es mit einer Kopfbewegung, die aber von keiner großen Begeisterung sprach. Das konnte daran liegen, daß Seneca, Neros einflußreicher Tutor, seine berühmte Karriere mit einem erzwungenen Selbstmord hatte beenden müssen, nachdem Nero seines Einflusses überdrüssig geworden war. Jugendliche Undankbarkeit im höchsten Extrem.
Laeta war zu taktvoll, das Thema weiter zu verfolgen. Statt dessen wandte er sich an den anderen Mann. »Und was bringt Sie nach Rom, mein Herr?«
Offenbar kein Öl. »Ich führe meinen jungen Enkel ins öffentliche Leben ein«, erwiderte Licinius Rufius. Er war eine Generation älter als sein Gefährte, sah aber immer noch so scharf aus wie ein Militärnagel.
»Eine Reise in die Goldene Stadt!« flötete Laeta in dick aufgetragener Unaufrichtigkeit, täuschte Bewunderung für diese kosmopolitische Initiative vor. Ich hätte mich am liebsten unter den nächsten Tisch geduckt und losgelacht. »Welchen besseren Start könnte er haben? Und, weilt der glückliche junge Mann heute unter uns?«
»Nein, er ist mit einem Freund unterwegs«, unterbrach der römische Senator mit kaum verhohlener Ungeduld. »Sie sollten sich besser einen Platz suchen, Laeta. Die Musikanten stimmen bereits ihre Instrumente. Einige von uns haben dafür bezahlt, und wir möchten für unser Geld auch etwas bekommen!«
Laeta schien zufrieden mit sich. Er hatte den Senator deutlich verärgert. Während wir uns den Weg durch den Raum bahnten und die Sklaven die Serviertische wegtrugen, um Platz zu schaffen, zischelte Laeta mir zu: »Unerträglicher Mann! Er macht sich in einem Maße wichtig, das allmählich unakzeptabel wird. Vielleicht werde ich Sie um Ihre Unterstützung bitten, Falco, wenn ich ihn zur Ordnung rufen muß ...«
Da konnte er lange bitten. Mitgliedern von Freßclubs auf die Finger zu klopfen gehörte nicht zu meinen Aufgaben.
Mein Gastgeber war noch nicht damit fertig, Aufsteigern einen Nasenstüber zu verpassen. »Anacrites! Und wer unter unseren illustren Mitgliedern hat Ihre Aufmerksamkeit verdient?«
»Ja, für mich ist es ein Arbeitsessen.« Anacrites hatte eine sanfte, kultivierte Stimme, der ebensowenig zu trauen war wie einem Teller überreifer Feigen. Schon beim ersten Wort stieg mir die Galle hoch. »Ich bin hier, um Sie zu beobachten, Laeta!« Der Gerechtigkeit halber mußte man sagen, daß er keine Angst hatte, die Sekretariate zu verärgern. Er konnte auch, wenn nötig, rasch mit dem Dolch zustoßen. Ihre Fehde lag offen zutage – der legitime Administrator, der sich der Manipulation und Arglist bediente, und der Tyrann der Sicherheitskräfte, der Erpressung, Einschüchterung und Heimlichtuerei benutzte. Sie wurden von demselben Motiv angetrieben: beide wollten König des Misthaufens sein. Bisher gab es keinen großen Unterschied zwischen einem von Laeta verfaßten, gut formulierten, vernichtenden Bericht auf erstklassigem Papyrus und einer in das Ohr des Kaisers geflüsterten falschen Anschuldigung des Spions. Aber eines Tages mußte dieser Konflikt offen ausbrechen.
»Ich erzittere!« Laeta beleidigte Anacrites, indem er ihm mit Sarkasmus begegnete. »Kennen Sie Didius Falco?«
»Selbstverständlich.«
»Das sollte er wohl«, grummelte ich. Jetzt war ich an der Reihe, den Spion zu attackieren: »Anacrites mag zwar desorganisiert sein, aber selbst er vergißt es nicht, wenn er einen Agenten in feindliches Gebiet schickt und dann die örtliche Regierung informiert. Ich verdanke diesem Mann eine Menge, Laeta. Ohne meine Findigkeit wäre es ihm gelungen, mich als Fraß für alle Krähen von Petra in der nabatäischen Wüste an einen Felsen ketten zu lassen. Und ich glaube nicht, daß die grausamen Nabatäer sich damit aufhalten, einen unwillkommenen Besucher vorher zu töten.«
»Falco übertreibt«, meinte Anacrites mit einem süffisanten Lächeln. »Es war ein bedauerliches Versehen.«
»Oder ein taktischer Schachzug«, erwiderte ich kühl.
»Falls es mein Fehler war, entschuldige ich mich.«
»Lassen Sie nur«, sagte ich zu ihm. »Zum einen lügen Sie, und zum anderen ist es ein Vergnügen, Sie weiterhin zu hassen.«
»Falco ist ein wunderbarer Agent«, sagte Anacrites zu Laeta. »Er weiß fast alles, was man über schwierige Auslandsmissionen wissen muß – und er hat das alles von mir gelernt.«
»So ist es«, stimmte ich milde zu. »Kampanien vor zwei Jahren. Sie haben mir all die Fehler und Stümpereien beigebracht. All die Möglichkeiten, örtliche Empfindlichkeiten zu verletzen, Beweise zu zertrampeln und ohne Ergebnis nach Hause zu kommen. Sie haben mir das vorgemacht – und dann zog ich los und habe den Auftrag vernünftig erledigt. Der Kaiser dankt mir noch heute dafür, daß ich in jenem Sommer gelernt habe, Ihre Fehler zu vermeiden!«
Laeta mischte sich ein: »Ich bin sicher, daß wir alle von Ihrer gemeinsamen Vergangenheit profitieren!« Damit ließ er Anacrites wissen, daß ich jetzt für ihn arbeitete. »Das Unterhaltungsprogramm beginnt«, meinte er dann lächelnd in meine Richtung. Der allgemeine Lärm im Raum hatte sich beim Anblick der Tänzerin gelegt, die sich auf ihren Auftritt vorbereitete. Laeta klopfte mir auf die Schulter – eine Geste, die mich schrecklich nervte, aber ich achtete darauf, daß Anacrites das nicht mitbekam. »Bleiben Sie und genießen Sie es, Falco. Ich würde zu gegebener Zeit dann gerne Ihre Meinung hören ...« Es war offensichtlich, daß er nicht über die Musiker sprach. Er wollte Anacrites den Eindruck vermitteln, daß hier etwas vorging. Was mir durchaus recht war.
Es gab nur noch zwei freie, sich gegenüberstehende Liegen an der Schmalseite des Raumes. Ich hatte bereits eine ausgewählt, aber jemand kam mir zuvor. Ein Mann, den ich schwer einschätzen konnte – ein Bursche in unauffälliger, haferfarbener Tunika, etwa in meinem Alter. Er ließ sich auf die Liege fallen, als habe er schon vorher da gelegen, und lehnte sich dann auf den Ellbogen, die muskulösen Beine bequem ausgestreckt. Am Oberarm hatte er eine alte Narbe, und seine dicken Fußsohlen wiesen darauf hin, daß er viel unterwegs war. Er sprach mit niemandem, wirkte aber durchaus umgänglich, wie er sich so die Trauben in den Mund fallen ließ und das Mädchen angrinste, das sich für seinen Auftritt bereit machte.
Ich griff nach einem Weinbecher, um mich für das Kommende zu stärken, und nahm auf der letzten verbliebenen Liege Platz – derjenigen neben Anacrites, die bereits teilweise von meiner Garum-Amphore besetzt war.
Kapitel IV
Zwei Musiker traten auf, beide mit der tiefschwarzen Haut der Nordafrikaner. Der eine spielte Kithara, und das ziemlich schlecht. Der andere war jünger und hatte bedrohlich wirkende, schrägstehende Augen. Er entlockte seiner Handtrommel schnelle, komplexe Rhythmen, während das Mädchen aus Hispalis sich daranmachte, uns mit dem traditionellen Zigeunertanz zu erfreuen. Ich schenkte Anacrites ein freundliches Lächeln, um ihn zu ärgern, während wir uns darauf vorbereiteten, über die Geschmeidigkeit ihrer Hüften zu staunen. »Diana scheint eine heiße Nummer zu sein. Haben Sie sie schon vorher gesehen?«
»Ich glaube nicht ... Und, womit hat sich unser Falco denn in letzter Zeit so beschäftigt?« Ich kann Leute nicht ausstehen, die mich so gönnerhaft behandeln.
»Staatsgeheimnis.« Ich hatte den Winter damit verbracht, Vorladungen für eine Reihe schmieriger Winkeladvokaten zu überbringen, und außerdem als unbezahlter Träger im Auktionshaus meines Vaters gearbeitet. Aber es machte Spaß, so zu tun, als unterhielte der Palast ein von Claudius Laeta geführtes, rivalisierendes Spionagenetz, über das Anacrites keine Kontrolle hatte.
»Falco, falls Sie für Laeta arbeiten, rate ich Ihnen, sich in acht zu nehmen!«
Ich ließ ihn mein amüsiertes Grinsen sehen und wandte mich dann wieder der Tänzerin zu. Sie führte uns mit ihrem goldenen Pfeil und Bogen ein paar aufreizende Stellungen vor: auf der Zehenspitze stehend, das eine Bein nach hinten, während sie scheinbar auf Gäste zielte, damit sie sich zurücklehnen und ihren halbentblößten Busen vorführen konnte. Da wir uns hier in Rom befanden, löste sie damit keinen Aufruhr aus. Zumindest nicht, solange kein angesehener Ritter nach Hause ging und seiner mißtrauischen Frau das dürftige griechische Kostüm in aller Ausführlichkeit beschrieb.
»Ich habe mich mit dem jungen Camillus unterhalten.« Anacrites hatte sich herübergebeugt, um mir ins Ohr zu flüstern. Ich riß die Hand hoch und kratzte mich, als sei irgendwelches Ungeziefer auf mir gelandet. Dabei hätte ich ihm um ein Haar ein blaues Auge verpaßt. Er schnellte auf seiner Liege zurück.
»Aelianus? Das muß Ihre Geduld schwer auf die Probe gestellt haben«, sagte ich. Auf Anacrites’ anderer Seite achtete Helenas wütender Bruder darauf, meinem Blick auszuweichen.
»Er scheint ein vielversprechender junger Mann zu sein. Ganz offensichtlich hat er nichts für Sie übrig, Falco.«
»Aelianus wird schon noch erwachsen werden.« Der Spion hätte inzwischen wissen müssen, daß ich so nicht zu ködern war.
»Ist er nicht Ihr Schwager oder so was?« Das klang ebenso nebenbei wie beleidigend.
»Oder so was«, stimmte ich ruhig zu. »Was tut er hier? Erzählen Sie mir nicht, er hätte hier hohe Staatsbeamte erwartet und sich eine Pfründe erschleichen wollen.«
»Nun, er ist gerade aus Baetica zurück!« Anacrites drückte sich gerne geheimnisvoll aus.
Mir mißfiel der Gedanke, daß Helenas feindseliges Miststück von einem Bruder hier mit dem Spion klüngelte. Vielleicht sah ich Gespenster, aber das Ganze roch danach, als würden hier Komplotte gegen mich geschmiedet.
Das Mädchen aus Hispalis war jetzt mitten in ihrer Darbietung, und die Gespräche verstummten. Sie war recht gut, aber nicht außergewöhnlich. Tänzerinnen sind ein blühender Exportartikel aus dem südlichen Spanien und scheinen ihre Ausbildung alle in der gleichen Tanzschule zu erhalten, einer, deren Lehrer in Pension geschickt werden sollte. Dieses Frauenzimmer hier konnte mit den Augen rollen und mit verschiedenen Teilen ihrer Anatomie wackeln. Sie warf sich auf den Boden, als wolle sie den gesamten Mosaikboden mit ihrem wild wehenden Haar aufwischen. Wenn man erst mal eins von diesen knackigen Mädels hintenübergebeugt mit stürmisch klappernden Kastagnetten gesehen hat, schweift die Aufmerksamkeit in der Regel ab.
Ich sah mich um. Die im Raum Versammelten waren sehr unterschiedlich. Die beiden Weltverdrossenen aus Baetica auf den gegenüberstehenden Liegen schienen von den Bemühungen des Mädchens ebenso unbeeindruckt wie ich und unterhielten sich immer noch leise. Quinctius Attractus, der angeblich für die Vorführung bezahlt hatte, lehnte selbstgefällig lächelnd zwischen seinen beiden vornehmeren Gästen.
Die beiden schauten höflich zu, obwohl vor allem der Ältere so aussah, als verbäte ihm sein Sinn für Ästhetik normalerweise das Betrachten eines solchen Auftritts. Alle vier Baeticaner schauten so höflich, daß es erzwungen sein mußte, und ich fragte mich, warum sie meinten, diese Veranstaltung geschehe ihnen zu Ehren. Anacrites, der sich aus vermeintlicher Staatsräson in alles einmischte, schien sich ganz zu Hause zu fühlen, obwohl ich mir nicht vorstellen konnte, daß Quinctius Attractus ihn eingeladen hatte, sich dieser Gruppe anzuschließen. Dann war da noch Aelianus, zu jung, um selbst ein Clubmitglied zu sein. Wer hatte ihn mitgebracht? Und wer war der Mann in der haferfarbenen Tunika auf der gegenüberstehenden Liege, der sich so gesellig gab, aber tatsächlich mit niemandem sprach?
Ich stieß Anacrites an. »Wer ist der Kerl?«
Er zuckte die Schultern. »Vermutlich einer, der sich hier eingeschmuggelt hat.«
Zum Abschluß ihres Tanzes schoß die Tänzerin nun wirklich einen Pfeil ab. Er traf den jungen Aelianus, der aufquietschte, als sei er heftiger getroffen worden, als ihr Spielzeugbogen vermuten ließ. Danach schoß sie einen ganzen Schauer von Pfeilen ab; die meisten trafen, und ich machte mir in Gedanken eine Notiz, wen ich zu befragen hätte, falls später jemand an einer langsamen Vergiftung starb. Als sie sich zu einer kurzen Pause zurückzog, deutete sie mit einem Blick voll lüsternen Versprechens an, daß Camillus Aelianus seinen hübschen Pfeil als Souvenir behalten könne.
Ich richtete mich auf, ging um Anacrites herum, setzte mich auf Aelianus’ Liege und zwang so das ungehobelte Bürschchen, mich zu begrüßen. »Ach, Sie sind auch hier, Falco!« sagte er rüde. Er war ein stämmiger, wenn auch untrainierter junger Mann mit glattem, schlaff herabhängendem Haar und permanent höhnischem Grinsen. Er hatte einen jüngeren Bruder, der sowohl besser aussah als auch wesentlich sympathischer war. Ich hätte lieber Justinus heute abend hier getroffen.
Ich befingerte den Pfeil, als sei Aelianus ein Schuljunge mit einem illegalen Spielzeug. »Das ist ein gefährliches Erinnerungsstück. Passen Sie auf, daß Ihre Eltern es nicht in Ihrem Schlafzimmer finden. Geschenke von Künstlerinnen können mißverstanden werden.« Ich drohte ihm gern damit, ihn so anzuschwärzen, wie er es ständig mit mir versuchte. Ich hatte noch nie einen Ruf besessen, aber er würde sich bald für die Wahl in den Senat aufstellen lassen und hatte etwas zu verlieren.
Aelianus brach den Pfeil entzwei. Eine unhöfliche Geste, da das Mädchen aus Hispalis immer noch im Raum war und mit ihren Musikern sprach. »Sie ist nichts Besonderes.« Er klang nüchtern und gelangweilt. »Verläßt sich auf ihren anzüglichen Blick und ihr knappes Kostümchen. Ihre Technik ist sehr bescheiden.«
»Ach ja?« Ich kenne eine Schlangentänzerin, die sagt, daß die Leute nur auf das Kostüm achten oder das Fehlen desselben. »Sie sind also ein Kenner spanischer Choreographie?«
»Das ist jeder, der in dieser Provinz Dienst getan hat«, sagte er mit gleichgültigem Schulterzucken.
Ich lächelte. Ihm mußte klar sein, daß seine jugendliche Erfahrung im friedlichen Baetica einen kaiserlichen Agenten nicht beeindrucken konnte, der darauf spezialisiert war, in den unruhigsten Grenzgebieten des Reiches zu operieren. Wenn nötig, war ich sogar das Risiko eingegangen, diese Grenzen zu überschreiten. »Und, wie hat es Ihnen in Hispanien gefallen?«
»Ganz gut.« Er wollte sich nicht mit mir unterhalten.
»Und jetzt stellen Sie Ihr Expertenwissen der Gesellschaft baetischer Olivenölhersteller zur Verfügung! Kennen Sie die Männer neben Quinctius Attractus?«
»Flüchtig. Ich war in Cordoba mit den Annaeus-Jungs befreundet.«
»Wie steht es mit dem Enkel von Licinius Rufius? Er ist momentan hier in Rom.«
»Mag schon sein.« Aelianus hatte keinesfalls vor, mit mir über seine Freunde zu sprechen. Er konnte es kaum erwarten, mich loszuwerden.
»Ich hörte, der Junge sei heute abend in der Stadt unterwegs – ich hätte gedacht, daß Sie dabei wären.«
»Statt dessen bin ich hier! Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Falco, möchte ich der Tänzerin zusehen.«
»Nettes Mädchen«, log ich. »Ich hatte ein interessantes Gespräch mit ihr.«
Der Schuß ging nach hinten los: »Natürlich. Sie kommen zu Hause sicherlich zu kurz«, meinte Aelianus unfreundlich. »Bei dem Zustand meiner Schwester.« Wie Helena und ich lebten, war unsere eigene Angelegenheit. Ich hätte ihm erzählen können, daß das Teilen des Bettes mit einem noch für mehrere Monate ungeborenen Nachkömmling unser gesundes Liebesleben nicht beeinträchtigte, eher eine größere Herausforderung darstellte. »Und jetzt hintergehen Sie Helena und machen sich an Tänzerinnen ran. Wenn ihr das jemand erzählt, wird sie vielleicht eine Fehlgeburt haben.«
»Wird sie nicht!« schnappte ich.
Ich hatte gerade sechs Monate damit verbracht, beruhigend auf Helena einzuwirken (die tatsächlich schon einmal eine Fehlgeburt hatte, obwohl ihr Bruder davon vermutlich nichts wußte). Sie zu überzeugen, daß bei der Geburt alles gutgehen und sie es überleben würde, war Schwerstarbeit. Sie war voller Angst, und ich war auch nicht gerade glücklich.
»Vielleicht verläßt sie Sie!« spekulierte er eifrig. Das war immer eine Möglichkeit gewesen.
»Wie ich sehe, liegt Ihnen Helenas Wohlergehen wirklich am Herzen.«
»Oh, Sie beide zusammen zu sehen macht mich glücklich. Ich denke, wenn ich mich für den Senat aufstellen lasse, werde ich meinen Wahlkampf darauf aufbauen, daß ich Ihre Beziehung anprangere – ich werde als Mann von derart traditioneller Redlichkeit auftreten, daß ich sogar meine eigene Schwester kritisiere ...«
»Damit werden Sie keinen Erfolg haben«, behauptete ich. Doch ich konnte mich irren. Rom hat schon immer etwas für aufgeblasene Wichtigtuer übrig gehabt.
Aelianus lachte. »Nein, Sie haben vermutlich recht. Mein Vater würde sich weigern, den Wahlkampf zu finanzieren.« Camillus Verus, Vater meiner Liebsten und dieses giftspritzenden jungen Frettchens, wirkte stets wie ein gutmütiger alter Schluffen, aber Aelianus hatte offenbar kapiert, wie sehr ihr gemeinsamer Vater Helena liebte, und verstand, daß ich es ebenfalls tat.
Mochte der Senator unsere Beziehung auch noch so bedauern, er wußte, daß er sich damit abfinden mußte. Außerdem hatte ich die leise Vermutung, daß er sich auf sein Enkelkind ziemlich freute.
»Jupiter, Sie müssen sich ja ins Fäustchen lachen, Falco!« Die Bitterkeit von Helenas Bruder war noch schlimmer, als ich gedacht hatte. »Sie sind aus dem Nichts aufgetaucht und haben sich die einzige Tochter einer Patrizierfamilie geschnappt ...«
»Blödsinn. Ihre Schwester war froh, den Käfig verlassen zu können. Sie hatte die Rettung bitter nötig. Helena Justina hatte ihre Pflicht getan und einen Senator geheiratet, aber was geschah? Pertinax war ein Schwein, ein Verräter, der sie vernachlässigte und mißhandelte. Ihr ging es so schlecht, daß sie sich scheiden ließ. Ist es das, was Sie wollen? Jetzt ist sie mit mir zusammen, und sie ist glücklich.«
»Es ist ungesetzlich!«
»Eine reine Formsache.«
»Man könnte Sie beide des Ehebruchs anklagen.«
»Wir betrachten uns als verheiratet.«
»Versuchen Sie das mal dem Zensor zu erzählen.«
»Das würde ich sofort tun. Doch niemand wird uns vor den Zensor bringen. Ihr Vater weiß, daß Helena ihre Wahl getroffen hat und mit einem Mann zusammenlebt, der sie anbetet. Es gibt keinen moralischen Einspruch, den der Senator geltend machen kann.«
Auf der anderen Seite des Raumes schüttelte das Tanzmädchen mit den beschränkten Kenntnissen ihr hüftlanges Haar aus. Darin schien sie sehr gut zu sein. Ich merkte, daß sie unseren Streit beobachtet hatte. Das gab mir ein ungutes Gefühl.
Um die Auseinandersetzung zu beenden, stand ich auf und wollte zu meiner eigenen Liege zurück. »Sagen Sie, Camillus Aelianus, was bringt Sie eigentlich in die ehrenwerte Gesellschaft baetischer Olivenölhersteller?«
Der wütende junge Mann hatte sich soweit beruhigt, daß er prahlen konnte: »Freunde in hoher Position. Und wie sind Sie reingekommen, Falco?«
»Noch viel bessere Freunde in wesentlich höherer Position«, gab ich vernichtend zurück.
Wieder neben Anacrites zu sitzen war fast eine Erleichterung. Bevor er versucht hatte, mich umbringen zu lassen, hatten wir miteinander gearbeitet. Er war verschlagen, aber genau wie ich verfügte er über einige Lebenserfahrung. Er trank gern einen guten Wein, hatte seinen Friseur unter Kontrolle und war dafür bekannt, daß er hin und wieder einen Witz über das Establishment losließ. Mit einem Kaiser, der Kosten sparen wollte und gegen übermäßige Sicherheitsmaßnahmen war, mußte sich Anacrites unwohl fühlen. Zum einen wollte er mich so weit wie möglich aus dem Weg haben. Er hatte versucht, mich anzuschwärzen, und er hatte vorgehabt, mich von einem unberechenbaren ausländischen Potentaten hinrichten zu lassen. Doch selbst jetzt wußte ich, woran ich mit ihm war. Zumindest so weit, wie das bei einem Spion möglich ist.
»Was ist los, Falco? Will mein junger Freund aus der noblen Familie sich an Ihnen rächen?«
Ich sagte, sein junger Freund sei kurz davor, was auf die Nase zu bekommen. Anacrites und ich verfielen wieder in unsere gewohnte Feindseligkeit.
Ich schaute nach oben und richtete meinen Blick auf die Lampe. Sie brannte mit der klaren, geruchlosen Flamme guten baetischen Öls, war aus glitzernder Bronze und hatte die Form eines fliegenden Phallus. Entweder schwankte dieses obszöne Gefäß mehr, als es sollte, oder der gesamte Raum war in Bewegung ... Ich beschloß, daß ich genug von dem roten Barcino hatte. Im gleichen Moment, wie das so oft geschieht, goß mir ein Sklave den Becher wieder voll. Ich seufzte und stellte mich auf eine lange Nacht ein.
Später muß ich noch mehr getrunken haben, obwohl ich es nicht genau sagen könnte. Deshalb geschah nichts Interessantes – zumindest mir nicht. Andere genossen zweifellos Risiken und Intrigen. Jemand traf vermutlich eine Verabredung mit der Tänzerin aus Hispalis. Es schien die Art von Fest zu sein, auf der traditionelle Bräuche gewürdigt wurden.
Ich ging, als noch alles in vollem Schwunge war. Niemand war erkennbar umgekippt, und zu diesem Zeitpunkt war auch mit Sicherheit noch niemand tot. Alles, was ich von dieser letzten Stunde noch weiß, sind ein paar schwierige Augenblicke, als ich versuchte, meine Amphore zu schultern. Sie war halb so groß wie ich und für einen Mann in meiner Verfassung viel zu schwer. Der junge Bursche in der haferfarbenen Tunika von der Liege gegenüber hatte ebenfalls nach seinem Umhang gegriffen. Er schien relativ nüchtern und machte den hilfreichen Vorschlag, ich solle ein paar Sklaven auftreiben, die das klobige Gefäß an einer Tragestange für mich heimtrugen. Augenblicklich erkannte ich die Logik darin. Wir lachten. Ich war viel zu betrunken, ihn nach seinem Namen zu fragen, aber er wirkte freundlich und intelligent. Daß er ganz alleine bei diesem Essen gewesen war, überraschte mich.
Irgendwie mußten meine Füße den Weg vom Palatin zum Aventin gefunden haben. Die Wohnung, in der ich seit einigen Jahren wohnte, lag im sechsten Stock eines heruntergekommenen Mietshauses. Die Sklaven weigerten sich, mit nach oben zu kommen. Ich ließ die Amphore unten, versteckte sie unter einem Haufen dreckiger Togen in Lenias Wäscherei im Erdgeschoß. Es war eine dieser Nächte, in denen mein linker Fuß in die eine Richtung losging und beim Zurückkommen den rechten traf. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich sie dazu brachte, mir zu gehorchen und mir die Treppe hoch zu helfen.
Irgendwann erwachte ich aus beunruhigender Schwärze und hörte die fernen Schreie von den Marktständen und das gelegentliche Klingeln von Geschirrglocken. Ich merkte, daß die Aktivitäten unten auf den Straßen mich schon seit einiger Zeit im Schlaf gestört hatten. Es war der erste Tag im April und das Straßenleben bereits hektisch. Wachhunde bellten Hühner an. Hähne krähten aus lauter Spaß an der Freude. Der Tag hatte begonnen – schon vor ein paar Stunden. Auf dem Dach über mir gurrte nervtötend eine Taube. Das Licht fiel mit schmerzhafter mittäglicher Intensität vom Balkon herein.
Automatisch kroch der Gedanke an Frühstück in meinen Kopf – und zog sich schnellstens wieder zurück.
Mir ging es entsetzlich schlecht. Als ich mich vorsichtig auf der durchhängenden Leseliege aufrichtete, auf die ich mich letzte Nacht hatte fallen lassen, machte ein Blick durch die Wohnung alles noch schlimmer. Es hatte keinen Zweck, Helena zu rufen oder mich auch nur bei ihr zu entschuldigen. Sie war nicht da.
Ich befand mich in der falschen Wohnung.
Unbegreiflich, wie ich das fertiggebracht hatte – aber der pochende Schmerz in meinem Kopf machte es nur allzu plausibel. Das hier war unsere alte Wohnung. Wir wohnten nicht mehr hier.
Helena Justina würde in unserem neuen Heim sein, wo sie die ganze Nacht auf mich gewartet hatte. Vorausgesetzt, sie hatte mich nicht bereits wegen meines nächtlichen Wegbleibens verlassen. Eine Tatsache, aus der jede vernünftige Frau geschlossen hätte, daß ich die Nacht mit einem anderen Mädchen verbracht hatte.
Kapitel V
Es gab eine dunkle Wohnung im ersten Stock auf der schattigen Seite der Brunnenpromenade. Auf den ersten Blick wirkte die schattige Seite besser erhalten, was aber nur daran lag, daß die Sonne den Verfall, der diese Häuser wie eine modrige Kruste überzog, nicht beschien. An den Fensterläden blätterte die Farbe ab. Die Türen hingen schief. Viele Bewohner verließ der Mut, und sie hörten auf, Miete zu zahlen. Oft starben sie in ihrem Elend, bevor die muskelbepackten Geldeintreiber des Vermieters die Miete aus ihnen herausprügeln konnten.
Alle, die hier wohnten, wollten eigentlich nur weg: Der Korbflechter mit dem Laden im Erdgeschoß wollte sich nach Kampanien zurückziehen, die Mieter der oberen Stockwerke zogen so schnell ein und aus, daß es viel über die Wohnlichkeit ihrer Behausungen aussagte (das heißt, sie war nicht existent), während Helena und ich als Untermieter des Korbflechters davon träumten, in eine schicke Villa zu entfliehen, wo es fließendes Wasser gab, Pinien um das Gelände und luftige Kolonnaden, in denen man sich kultiviert über philosophische Themen unterhalten konnte ... Alles wäre besser als diese winzigen drei Zimmer, deren Treppenabsatz wir uns auch noch mit den spuckenden und fluchenden Bewohnern der oberen Stockwerke teilen mußten.
Die Eingangstür war abgelaugt und geschliffen und wartete darauf, frisch gestrichen zu werden. Drinnen mußte ich mich durch einen mit Paketen vollgestellten Flur zwängen. Das erste davon abgehende Zimmer hatte kahle Wände und war leer. Im zweiten sah es genauso aus, abgesehen von einem unglaublich obszönen Fresko, das die Wand direkt gegenüber der Tür schmückte. Helena verbrachte Stunden damit, die lüstern ineinander verschlungenen Paare und derben Satyre in schreiend hyazinthroten Umhängen mühsam abzukratzen, die, die Panflöte in der Hand, hinter Lorbeerbüschen lauerten und glubschäugig dem schamlosen Treiben zusahen. Sie kam nur langsam voran, und heute lagen alle feuchten Schwämme und Schaber verlassen in einer Ecke. Ich konnte mir denken, warum.
Langsam ging ich weiter den Gang hinunter. Hinten gaben die wieder festgenagelten Bodenbretter unter meinen Füßen nicht nach. Ich hatte Tage damit verbracht, sie eben zu bekommen. An den Wänden hing eine Reihe kleiner griechischer Reliefplatten mit olympischen Motiven, die Helena ausgesucht hatte. Eine Nische schien auf die beiden Hausgötter zu warten. Vor dem letzten Zimmer lag eine rotweiß gestreifte Matte, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Darauf schlief ein schmuddliger Hund, der sich erhob und angewidert davonstolzierte, als ich mich näherte.
»Hallo, Nux.«
Nux furzte leise und machte dann eine Drehung, um, milde erstaunt, ihr Hinterteil zu beschnüffeln.
Ich klopfte leise an den Türrahmen und öffnete die Tür. Ein Teil von mir hoffte, daß die Bewohnerin einen Spaziergang unternommen hatte.
Es gab kein Entkommen. Sie war da. Ich hätte es wissen müssen. Ich hatte ihr befohlen, den Wachhund mitzunehmen, wenn sie ohne mich ausging. Sie neigte nicht dazu, meinen Anweisungen zu folgen, hatte aber in der Zwischenzeit den Hund liebgewonnen.
»Hallo, Braunauge. Sind das hier die Räume, in denen Falco wohnt?«
»Offensichtlich nicht.«
»Erzähl mir nicht, daß er abgehauen ist, um Gladiator zu werden. Was für ein Schwein.«
»Der Mann ist erwachsen. Er kann tun, was er will.« Nicht, wenn er seine sieben Sinne beisammenhatte.
Falcos neues Büro war eingerichtet wie ein Schlafzimmer. Ermittlungsarbeit ist ein schmutziges Geschäft, und die Klienten wollen von der Umgebung schockiert sein. Außerdem weiß jeder, daß ein Ermittler die Hälfte seiner Zeit seinem Buchhalter Anweisungen gibt, wie er die Klienten übers Ohr hauen kann, und jeden freien Moment nutzt, um seine Sekretärin zu verführen.
Falcos Sekretärin lag gegen ein hübsches, muschelförmiges Kopfteil gelehnt und las einen griechischen Roman. Sie war gleichzeitig Falcos Buchhalterin, was ihr desillusioniertes Verhalten erklärte. Ich versuchte nicht, sie zu verführen. Der Gesichtsausdruck dieser großen, begabten jungen Frau traf mich wie ein plötzlicher Schluck schneegekühlten Weins. Sie war in Weiß gehüllt und hatte ihr glänzendes schwarzes Haar seitlich locker mit Elfenbeinkämmen hochgesteckt. Auf einem kleinen Tischchen neben ihr lagen neben einer Schüssel mit Feigen und der Kurzschriftkopie des gestrigen Tagesanzeigers alle Geräte, die man zur Maniküre braucht. Mit diesen Dingen vertrieb sie sich die Zeit, während sie auf die Rückkehr ihres Herrn wartete. So blieb ihr reichlich Gelegenheit, sich schneidende Bemerkungen auszudenken.
»Wie fühlst du dich?« fragte ich mit einem zärtlichen Blick auf ihren gewölbten Bauch.
»Wütend.« Sie genoß es, direkt zu sein.
»Das ist schlecht für das Baby.«
»Laß das Baby da raus. Ich hoffe, ich kann das Baby vor der Erkenntnis bewahren, daß sein Vater ein degenerierter Herumtreiber ist, dessen Respekt vor seinem häuslichen Leben ebenso minimal ist wie seine Höflichkeit mir gegenüber.«