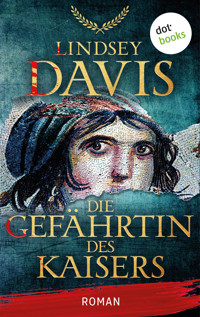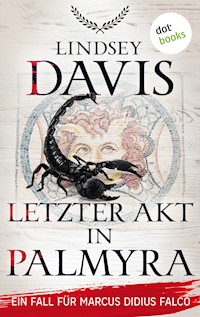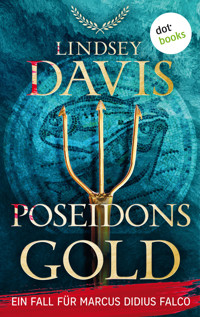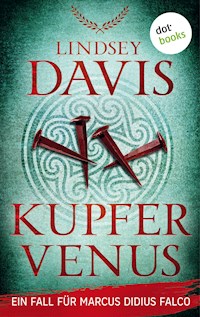6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Tod im antiken Griechenland: Der fesselnde historische Kriminalroman »Delphi sehen und sterben« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 76 nach Christus. Seine Aufträge führen den besten Privatermittler der »Ewigen Stadt« durch das gesamte Reich: Diesmal ist Marcus Didius Falco auf dem Weg nach Griechenland, zur Wiege der Demokratie. Um den Mord an zwei Römerinnen aufzuklären, schließt er sich einer Reisegesellschaft an, mit der beide Frauen kurz vor ihrem Verschwinden unterwegs waren. Doch seine Ermittlungen werden durch die römische Verwaltung blockiert, und schnell bestätigen sich seine Befürchtungen, dass jemand in der Gruppe etwas zu verbergen hat. Als dann auch noch weitere Reisende in seinem Umfeld verschwinden, sieht Falco nur noch eine Lösung: Er muss das sagenumwobene Orakel von Delphi um Antworten ersuchen … »Davis’ Krimis sind äußerst verworren, aber Falcos verschmitzte Art und die häuslichen Verwicklungen sind der eigentliche Spaß.« Time Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Delphi sehen und sterben« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der 17. Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 76 nach Christus. Seine Aufträge führen den besten Privatermittler der »Ewigen Stadt« durch das gesamte Reich: Diesmal ist Marcus Didius Falco auf dem Weg nach Griechenland, zur Wiege der Demokratie. Um den Mord an zwei Römerinnen aufzuklären, schließt er sich einer Reisegesellschaft an, mit der beide Frauen kurz vor ihrem Verschwinden unterwegs waren. Doch seine Ermittlungen werden durch die römische Verwaltung blockiert, und schnell bestätigen sich seine Befürchtungen, dass jemand in der Gruppe etwas zu verbergen hat. Als dann auch noch weitere Reisende in seinem Umfeld verschwinden, sieht Falco nur noch eine Lösung: Er muss das sagenumwobene Orakel von Delphi um Antworten ersuchen …
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Die Website der Autorin: www.lindseydavis.co.uk
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint der historische Roman »Die Gefährtin des Kaisers«.
***
eBook-Neuausgabe April 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »See Delphi and Die« bei Century, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2005 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2010 für die deutschsprachige Ausgabe by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Ivanovich Oleg, Galapagos Photo, Dmitr1ch
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-98690-058-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Marcus Didius Falco 17« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Delphi sehen und sterben
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Für Elys,
die mir Latein beizubringen versuchte
und es mutig erneut mit Griechisch probierte,
mich aber vor allem in die Archäologie einführte
Dramatis Personae
In Rom
Julia Justa: eine Mutter mit Sorgen
D. Camillus Verus: der Senator, der sie ihr überlässt
Caesius Secundus: ein Vater auf der Suche nach Antworten
Marcella Caesia: eine Tochter auf der Suche nach Aufregung (verstorben)
Tullia Longina: eine Schwiegermutter auf der Suche nach einem ruhigen Leben (vergebens)
Claudius Laeta: ein kaiserlicher Beamter, der Beförderung sucht
Polystratus: ein Reisekaufmann auf der Suche nach Dummköpfen
Auf der »Sport-und-Tempel-Tour« mit Sieben-Stätten-Reisen
Valeria Ventidia: eine glückselige Braut (verstorben)
Die Sertorius-Familie: Vater, aufopfernde Mutter, zwei zauberhafte Kinder
Cleonymus und Cleonyma: betuchtes Paar auf der Suche nach Abenteuern
Amaranthus und Minucia: ein Sportsfreund und seine heimwehkranke Gefährtin
Indus: der nicht gefunden werden will
Volcasius: von allen gemieden
Marinus: ein skrupelloser Witwer auf der Suche nach Moneten
Helvia: eine findige Witwe auf der Suche nach Gesellschaft
Turcianus Opimus: nicht mehr von dieser Welt
Unabhängig Reisende
M. Didius Falco: ein Privatermittler
Helena Justina: seine Frau, Partnerin, Assistentin und Reiseführerin
Albia: eine Britin, die nach römischer Kultur strebt
Der junge Glaucus: Sohn des Glaucus, ein aufstrebender Athlet
Gaius und Cornelius: Falcos Neffen, üblicherweise auf der Suche nach Ärger
Nux: Falcos Hündin, üblicherweise mittendrin
In Olympia
Barzanes: ein interessanter Fremdenführer
Milon von Dodona: ein starker Mann mit einer Mission
Lacheses: ein lästiger Priester
Megiste: eine bestens organisierte Bürgerin
Myron: ein Flötenspieler
Ein Palästra-Aufseher: ein Schlägertyp
In Korinth
Der Statthalter: auf Dienstreise (nie in Korinth)
Aquillius Macer: ein Quästor, der noch viel lernen muss
Phineus: ein wirklich ausgezeichneter Reiseleiter
Philomela: eine kulturvernarrte Nachtigall (oder Schwalbe)
In Delphi
Tullius Statianus: ein verstörter Bräutigam auf der Suche nach Wahrheit
Lampon: ein Dichter, der zu viel weiß
In Athen
A. Camillus Aelianus: ein passionierter Scholar
Minas von Karystos: bringt Aulus alles bei, was er weiß
Anderswo auf Reisen
Marcella Naevia: Caesias Tante und Reisegefährtin
Teil I
Rom
»Er beschloss, eine Rundreise durch Griechenland zu machen, um jene berühmten Stätten zu besuchen, von denen man Größeres gehört hat, als man dort sehen kann ...
Er zog durch Thessalien nach Delphi, dem berühmten Orakel. Er besuchte auch in Lebadia das Heiligtum des Zeus Trophonius und sah dort die Öffnung der Höhle, durch die die Benutzer des Orakels hinabsteigen ...
Dann nach Athen, das zwar ebenfalls voll ist von seinem alten Ruhm, aber auch viel Sehenswertes besitzt ...
Er reiste weiter nach Korinth. Damals, vor ihrer Zerstörung, war die Stadt sehr berühmt ... Die Akropolis ragte innerhalb der Stadtmauern zu gewaltiger Höhe auf und sprudelte von Quellen ...
Dann Epidauros, berühmt durch das bekannte Heiligtum des Asklepios ...
Weiter nach Olympia hinauf. Dort besichtigte er auch andere Sehenswürdigkeiten; als er den Zeus betrachtete, wurde er im Innersten bewegt, als ob er den Gott selbst vor sich hätte.«
Livius über die Urlaubsreise des Aemilius Paulus im Jahre 167 v. Chr.
Anmerkung: Da es schwierig ist, Lagepläne in kleinem Maßstab abzubilden, sind keine beigefügt worden. Pläne des antiken Olympia, Korinth, Delphi und Athen sind ohne weiteres in Reiseführern und auf Webseiten zu finden, falls Leser meinen, sie würden zum Genuss des Romans beitragen.
Rom und Achaea: September – Oktober 76 n. Chr.
Drei Jahre nach den 213. Olympischen Spielen, ein Jahr vor den 214. [Anmerkung: Diese Nummerierung geht davon aus, dass die Neronischen Spiele des Jahres 67 n. Chr. entfallen, da sie für unrechtmäßig erklärt wurden.]
Kapitel I
»Marcus, du musst mir helfen!«
Ich bin Privatermittler, ein einfacher Mann, und war verblüfft über diese dramatisch vorgebrachte Bitte. Meine in Seide gekleidete, parfümierte Schwiegermutter forderte selten etwas von mir. Plötzlich klang die edle Julia Justa wie eine meiner Klientinnen.
An diesem Abend wollte ich bloß ein besseres Nachtmahl, als ich es in meinem eigenen Haushalt erwarten konnte, für den ich – nicht zum ersten Mal – den dummen Fehler begangen hatte, einen Koch zu kaufen. Julia Justa war bereits genüsslich über meine traurige Bilanz beim Erwerb von Haushaltssklaven hergezogen. Als Dank für das Abendessen würde ich zusätzlich noch spitze Bemerkungen über Helenas und mein Versagen als Eltern hinnehmen müssen. Helena würde kontern, während ihr Vater und ich hinter vorgehaltener Hand grinsten, bis die beiden Frauen uns attackierten, woraufhin die Sklaven die Nachspeise hereintragen und wir uns über die Quitten und Feigen hermachen würden ...
Familienleben. Ich wusste, auf welchem Stand ich da war. Gegenüber früheren Zeiten, als ich noch allein arbeitete und in einer Bruchbude hauste, in der mich selbst die Geckos höhnisch angrinsten, hatte sich einiges gebessert. Die Frauen, die mich dort aufgesucht hatten, standen zwei Ränge und um viele Höflichkeitsgrade unter meiner Schwiegermutter. Ihre Anliegen waren jämmerlich, und sie brauchten meine Hilfe aus zwielichtigen Gründen. Was sie allerdings als Gegenleistung anboten, ging weit über den missmutigen Dank hinaus, den ich hier erwarten konnte, obwohl es sich dabei selten um Geld handelte.
»Ich stehe dir selbstverständlich zur Verfügung, liebe Julia.«
Der Senator grinste. »Nicht allzu beschäftigt im Moment?«
»Ist erstaunlich ruhig«, teilte ich ihm mit. »Ich warte auf den üblichen Scheidungsrummel, wenn die Paare aus dem Sommerurlaub nach Rom zurückkehren.«
»Sei nicht so zynisch, Marcus! Was ist los, Mutter?« Helena beäugte einen Früchteteller und suchte nach einem Stück Obst, das sie unserer älteren Tochter geben konnte. Favonia, unsere Jüngste, brachte es fertig, ganz zufrieden eine halbe Stunde an einer einzigen Traube zu lutschen, aber die kleine Julia würde, sich selbst überlassen, jede Pflaume und jeden Pfirsich anbeißen und sie dann heimlich wieder auf den Teller legen.
»Alles ist los!« Julia Justa hatte eine kunstvolle Pose eingenommen, doch mehrere Reihen goldener Perlenanhänger bebten in den wohlduftenden Falten salbeigrüner Seide über ihrem Busen. Der Senator rutschte neben ihr auf der Speiseliege ein wenig zur Seite, um sich vor blauen Flecken durch ihren wütenden Ellbogen zu schützen.
Helena warf ihrem Vater einen kurzen Blick zu, als hielte sie ihn für den Störenfried. Voller Vergnügen beobachtete ich das Wechselspiel. Wie bei den meisten Familien hatten sich Mythen über die Camilli gebildet: Der Senator werde dauernd schikaniert, und seiner Frau werde daheim kein Einfluss gestattet, zum Beispiel. Die Legende, dass ihre drei Kinder eine ständige Plage seien, kam der Wahrheit noch am nächsten, wenngleich Helena und ihr jüngster Bruder Justinus inzwischen zur Ruhe gekommen waren, beide mit Ehepartnern und Kindern. Wobei ich keinen sehr beruhigenden Ehepartner abgab.
Der ältere Sohn, Julia Justas Liebling, war derjenige, der ihren momentanen Kummer ausgelöst hatte. »Ich bin verzweifelt, Marcus! Ich dachte, Aulus würde endlich mal etwas Vernünftiges tun!«
Mit siebenundzwanzig war Aulus Camillus Aelianus immer noch ein fröhlicher Junggeselle, der das Interesse verloren hatte, in den Senat einzutreten. Er war unzuverlässig und wurzellos. Er gab zu viel Geld aus, trank, trieb sich bis in die Nacht herum; vermutlich war er auch ein Schürzenjäger, wobei es ihm gelungen war, das geheim zu halten. Am schlimmsten war, dass er manchmal für mich arbeitete. Privatschnüffler zu sein war ein hartes Brot für einen Senatorensohn. Tja, es war sogar hart für mich, und ich stamme aus der Gosse. Die Camilli hatten gesellschaftlich zu kämpfen. Ein Skandal würde sie vernichten.
»Er war einverstanden, nach Athen zu gehen!«, wetterte seine Mutter, während wir anderen schweigend zuhörten. Zur allgemeinen Überraschung hatte er sich selbst dazu entschieden, die Universität zu besuchen – in der Hoffnung, es würde funktionieren. »Es war eine Lösung. Wir haben ihn gehen lassen, damit er studieren, seinen Geist entwickeln und reifen kann ...«
»Habt ihr etwa schon von ihm gehört?« Erst vor ein paar Wochen hatten wir Aulus zum Schiff nach Griechenland gebracht und ihm nachgewunken. Das war im August gewesen. Seine Mutter hatte sich Sorgen gemacht, dass Monate vergehen würden, bevor er sich endlich meldete. Sein Vater hatte gewitzelt, das werde geschehen, sobald seine Kreditbriefe erschöpft seien. Dann werde mit der ersten Nachricht die traditionelle Bitte eintreffen: Bin gut gelandet – schickt sofort Geld! Der Senator hatte ihn gewarnt, es sei kein Geld mehr da, doch Aulus wusste, dass er der Liebling seiner Mutter war. Er würde an sie schreiben, und sie würde Decimus bearbeiten.
Jetzt erfuhren wir, dass Aulus von der geplanten Route abgewichen war und es, seltsam für einen intelligenten Burschen, seiner Mama gebeichtet hatte.
»Marcus, das verdammte Schiff hat in Olympia angelegt. Natürlich habe ich nichts dagegen, dass Aulus das Heiligtum des Zeus besucht, aber er hat sich da auf etwas völlig anderes eingelassen ...«
»Was zieht ihn denn dann so an? Abgesehen von Sonne, Sport und dem Vermeiden ernsthafter Studien?«
»Mach dich nicht über mich lustig, Marcus.«
Ich versuchte mich zu erinnern, ob in diesem Jahr Olympische Spiele abgehalten worden waren. Der verrückte Nero war dafür berühmt geworden, die jahrhundertealte Abfolge zu verändern, damit er während seiner Bildungsreise durch Griechenland an Wettkämpfen teilnehmen konnte. Eine Liste unvergesslicher Peinlichkeiten: Sein Auftritt als Herold, die öden Rezitationen und die Erwartung, als Kaiser in allen Wettkämpfen zu gewinnen, ob er gut war oder nicht.
Ich vermutete, dass man die Abfolge inzwischen wieder richtiggestellt hatte. Nach meiner raschen Berechnung würden die nächsten Spiele im folgenden August ausgetragen werden. »Entspann dich, Julia. Aulus kann seine Zeit dort nicht als Zuschauer verplempern.«
Julia Justa erschauerte. »Nein, es ist schlimmer. Anscheinend ist er in Olympia auf eine Reisegruppe gestoßen, und einer von ihnen wurde auf entsetzliche Weise ermordet.«
»Tatsächlich?« Mir gelang ein neutraler Ton, doch Helena, die damit beschäftigt war, Saft von Favonias weißer Tunika zu tupfen, blickte auf.
»Nun ja, Marcus«, sagte Julia Justa düster, als wäre es eindeutig meine Schuld, »schließlich hast du Aulus beigebracht, solche Situationen aufregend zu finden.« Ich bemühte mich, unschuldig zu schauen. »Aulus ist misstrauisch geworden, da allgemein bekannt ist, dass bei den letzten Olympischen Spielen ein junges Mädchen aus Rom verschwand. Und sie wurde später ebenfalls ermordet aufgefunden.«
»Aulus versucht diesen Leuten zu helfen?«
»Es ist nicht an ihm, sich da einzumischen ...« Jetzt sah ich es deutlich vor mir. Meine Aufgabe würde darin bestehen, die Sache zu übernehmen und den jungen Aulus zurück auf den Weg zur Universität zu lenken. Die edle Julia war so begierig, ihn mit der Nase in einer juristischen Schriftrolle zu sehen, dass sie bereit war, ihren Schmuck zu verkaufen. »Ich werde für deine Überfahrt bezahlen, Marcus. Aber du musst dich einverstanden erklären, nach Griechenland zu fahren und die Angelegenheit in Ordnung zu bringen.«
Kapitel II
Befehle von einem Untergebenen zu erhalten ist schlimm genug. Einer lausigen Spur folgen zu sollen, die er nur ganz beiläufig über seine Mutter weitergegeben hat, stinkt ganz einfach zum Himmel. Trotzdem bat ich darum, den Brief lesen zu dürfen.
Später, in der Sicherheit unseres eigenen Heims, knuffte mich Helena in die Rippen. »Spuck’s aus. Du bist fasziniert.«
»Nur etwas neugierig.«
»Warum hat mein lächerlicher Bruder Mama angespitzt?«
»Zu faul, uns getrennt zu schreiben. Er will wissen, was der Vater zu sagen hat – der Vater des ersten toten Mädchens.«
»Hattest du davon gehört?«
»Vage. Es handelt sich um den Caesius-Fall.«
»Und du wirst den Vater aufsuchen? Kann ich mitkommen?«
»Nein.«
Helena kam mit.
Wir wussten im Voraus, dass die Befragung heikel sein würde.
Die Situation war folgende: Bei den Olympischen Spielen vor drei Jahren verschwand ein junges Mädchen, das mit einer Reisegruppe unterwegs war. Ihr verzweifelter Vater versuchte zu ermitteln, hatte das praktisch ununterbrochen getan – viel zu lange, um noch weiter darauf herumzuhacken, wie die hartherzige römische Öffentlichkeit fand. Er reiste nach Olympia und suchte verbissen, bis er die Überreste des Mädchens fand. Er bemühte sich, hinter die Umstände ihres Todes zu kommen, und hatte bald darauf die weitverbreitete Behauptung aufgestellt, sein Kind sei ermordet worden. Seither jagte er immer noch Antworten nach.
Das Auffinden der Leiche hatte die Behörden verärgert. Sie hatten die Ermittlungen verhunzt und lehnten es daher ab, den Fall neu zu untersuchen. Zu wissen, dass seine Tochter tot war, brachte Caesius nicht weiter. Schließlich gingen ihm Zeit, Geld und Energie aus, und er war gezwungen, heimzukehren. Der Fall blieb ungelöst. Da er immer noch davon besessen war, gelang es ihm, den Klatsch auf dem Forum zu beflügeln, wodurch ich davon gehört hatte. Die meisten taten ihn als einen Mann ab, der durch die Trauer verrückt und zu einer Peinlichkeit geworden war. Ich empfand ein gewisses Mitgefühl. Ich wusste, wie ich reagieren würde, sollte eine meiner Töchter je vermisst werden.
Wir begaben uns früh zu seinem Haus. Es war ein warmer, klarer römischer Morgen, der zu einem sehr heißen Mittag zu werden versprach. Als wir auf das Forum bogen, war zu erkennen, dass der leichte Dunstschleier über dem Kapitol sich bald in blendende Helle verwandeln würde, zu hell, um zum neuen Tempel des Jupiter mit dem goldenen Dach und dem schimmernden weißen Marmor aufzuschauen. Über dem anderen Ende des Forums hing eine Staubwolke von der riesigen Baustelle des Flavischen Amphitheaters. Inzwischen nicht mehr nur das größte Loch der Welt, hoben sich die Wände langsam in einer phantastischen Travertinellipse, und um diese Uhrzeit waren die Bauarbeiten am hektischsten. Überall sonst waren weniger Menschen als üblich unterwegs. Alle, die es sich leisten konnten, hatten die Stadt verlassen. Gelangweilte Senatoren und aufgeschwemmte Ex-Sklaven mit Multimillionen-Unternehmen hatten sich für zwei Monate an die Küste, in die Berge oder an die Seen zurückgezogen und würden erst wiederkehren, wenn die Gerichte und die Schulen Ende September geöffnet wurden. Selbst dann würden sie vernünftige Ausreden finden, den Landaufenthalt zu verlängern.
Wir hielten uns im Schatten am nördlichen Ende und gingen auf den Via-Lata-Bezirk zu.
Ich hatte ein Einführungsschreiben geschickt und eine kurze Nachricht erhalten, dass ich vorbeikommen könne. Ich vermutete, Caesius würde mich als Unhold oder Gauner betrachten. Damit konnte ich umgehen. Ich hatte genug Erfahrung.
Caesius Secundus war seit langem verwitwet, und die verschwundene Tochter war sein einziges Kind. Er wohnte in einem verblichenen Stadthaus an der Via Lata, kurz bevor sie in die Via Flaminia abbiegt. Ein Scherenschleifer hatte Teile des Erdgeschosses als Werkstatt und Verkaufsraum gemietet. Der Teil des Hauses, in dem Caesius wohnte, wirkte und klang halb leer. Eingelassen wurden wir nicht von einem Pförtner, sondern von einem Sklaven in einer Küchenschürze, der uns den Empfangsraum zeigte und dann zu seinen Kochtöpfen zurückkehrte.
Trotz meiner Befürchtung, abgewiesen zu werden, empfing uns Caesius sofort. Er war groß gewachsen und von einst wohl schwerem Körperbau. Inzwischen hing seine weiße Tunika schlapp von einem sehnigen Hals und knochigen Schultern. Der Mann hatte an Gewicht verloren, ohne bisher bemerkt zu haben, dass er neue Kleidung brauchte. Für ihn war die Zeit an jenem Tag stehengeblieben, an dem er hörte, dass seine Tochter verschwunden war. Vielleicht würde er nun nach seiner Rückkehr nach Rom an Essenszeiten und andere normale Abläufe erinnert werden. Wahrscheinlicher war jedoch, dass er jede Art von Zuwendung abwehren würde.
»Ich weiß, warum Sie gekommen sind.« Er war sehr direkt, wandte sich trotz seiner ausgemergelten Erscheinung zu schnell der Angelegenheit zu.
»Ich bin Didius Falco. Darf ich Ihnen meine Frau Helena Justina vorstellen ...« Stattlich und von erfreulichem Äußeren, verlieh sie uns Seriosität. Mit der eleganten Kleidung einer wohlerzogenen Matrone lenkte Helena stets die Aufmerksamkeit von meinen rauhen Manieren ab. Mir gelang es, die Tatsache zu verbergen, dass mich ihre Anwesenheit körperlich ablenkte.
»Sie wollen mit mir über meine Tochter sprechen. Erlauben Sie mir zuerst, sie Ihnen zu zeigen.«
Wir waren überrascht, aber Caesius führte uns nur zu einem inneren Säulengang neben einem kleinen Hof. Auf einem korinthischen Sockel stand die Halbstatue einer jungen Frau, gefertigt aus weißem Marmor von guter Qualität. Eine Porträtbüste, der Kopf leicht zur Seite geneigt, den Blick sittsam zu Boden gerichtet. Das Gesicht wies genug Charakter auf, um vom lebenden Modell abgenommen zu sein, wenngleich die Neuheit der Arbeit darauf hinwies, dass der Auftrag erst nach dem Tode erteilt worden war.
»Das ist alles, was ich jetzt noch habe.«
»Ihr Name war Marcella Caesia?«, fragte Helen, den Blick nachdenklich auf die Statue gerichtet.
»Ja. Sie wäre vor kurzem einundzwanzig geworden.« Der Vater starrte die Büste ein wenig zu lange an. In der Nähe stand ein Hocker. Vermutlich brütete er hier stundenlang vor sich hin. Für den Rest seines Lebens würde sich die Zeit darin bemessen, wie alt sein verlorenes Kind sein würde, wäre es am Leben geblieben.
Er führte uns zurück in das spärlich möblierte Empfangszimmer. Caesius bestand darauf, dass Helena auf einem bequemen Korbstuhl mit eigener Fußstütze Platz nahm, der vielleicht einst seiner Frau gehört hatte. Während sie ihre Röcke glättete, warf sie mir einen Blick zu. Ich zog eine Notiztafel heraus und übernahm die Führung der Befragung, obwohl Helena und ich sie uns teilen würden. Einer von uns würde reden, während der andere beobachtete. »Ich will Sie gleich warnen!«, platzte Caesius heraus. »Ich bin zum Opfer vieler Schwindler geworden, die mir große Versprechungen machten und dann nichts unternahmen.« Ruhig erwiderte ich: »Folgendes schlage ich Ihnen vor, Caesius. Ich bin Privatermittler, hauptsächlich in Rom. Ich habe Aufträge in Übersee ausgeführt, aber nur für den Kaiser.« Vespasian zu erwähnen könnte ihn beeindrucken, außer er hatte beim Kampf um den Kaiserthron Vespasians Gegner unterstützt – oder er war ein aufrechter Republikaner.
Politik interessierte ihn nicht. »Ich kann Sie nicht bezahlen, Falco.«
»Ich habe auch nicht um Geld gebeten.« Nun ja, bisher noch nicht. »Ich weiß, dass Sie eine faszinierende Geschichte zu erzählen haben.«
»Wie soll meine Geschichte Ihnen von Nutzen sein? Haben Sie einen Auftrag?«
Er machte es mir nicht leicht. Wenn es Ärger in einer ausländischen Provinz gab, hätte sich Vespasian bereit erklären können, mich dorthin zu schicken, wobei ihm die Kosten kaum geschmeckt hätten. Der Tod dieses Mädchens war jedoch eine Privatangelegenheit – es sei denn, Caesius war ein alter Kumpel des Kaisers, und Vespasian schuldete ihm noch einen Gefallen. Doch dann hätte Caesius den schon längst eingefordert und sich nicht drei Jahre lang vergeblich alleine mit der Sache herumgeschlagen. »Ich biete nichts an, und ich verspreche nichts. Ein Kollege hat mich gebeten, die Fakten zu überprüfen, Caesius. Ihre Geschichte könnte anderen Menschen helfen ...«
Caesius starrte mich an. »Also, wenn Sie mir auf dieser Basis erzählen möchten, was mit Ihrer Tochter passiert ist, dann tun Sie es bitte.«
Er machte eine kleine, beschwichtigende Geste. »Ich bin von Ungeheuern mit falschen Hilfsangeboten verfolgt worden. Jetzt traue ich niemandem mehr.«
»Sie müssen selbst entscheiden, ob ich anders bin – aber das haben die Trickbetrüger sicherlich auch gesagt.«
»Vielen Dank für Ihre Aufrichtigkeit.«
Trotz seiner Behauptung, niemandem zu trauen, hatte Caesius die Hoffnung nach wie vor nicht aufgegeben. Sein Schmerz veranlasste ihn, sich uns anzuvertrauen. Er holte Luft. Er hatte die Geschichte eindeutig schon oft erzählt. »Meine Frau starb vor zwanzig Jahren. Meine Tochter Caesia überlebte als einziges unserer Kinder das Säuglingsalter. Ich komme aus dem Textilimport. Wir hatten ein angenehmes Leben, Caesia war gebildet und – meiner Meinung nach, die natürlich voreingenommen ist – zu einem freundlichen, talentierten und wertvollen Menschen herangewachsen.«
»So sieht sie ihrem Porträt nach auch aus.« Nach meinem grobschlächtigen Beginn übernahm Helena den mitfühlenden Part.
»Vielen Dank.«
Ich blickte zu Helena, bezweifelte, dass sie das Lob aufrichtig gemeint hatte. Wir hatten Töchter. Wir liebten sie, machten uns aber keine Illusionen. Ich würde zwar nicht behaupten, dass ich Mädchen als Rabaukinnen betrachtete – aber ich war auf zukünftige Konfrontationen eingestellt.
»Und warum war Caesia in Griechenland?«, fragte Helena.
Der Vater wurde ein wenig rot, antwortete aber ehrlich:
»Es hatte Probleme wegen eines jungen Mannes gegeben ...«
»Sie waren nicht einverstanden?« Das war der offensichtliche Grund für einen Vater, »Probleme« zu erwähnen.
»Nein, aber das nützte nichts. Dann beschloss Caesias Tante Marcella Naevia, auf Reisen zu gehen, und bot an, ihre Nichte mitzunehmen. Das schien ein Geschenk der Götter zu sein. Ich stimmte freudig zu.«
»Und Ihre Tochter?« Helena war ein eigensinniges junges Mädchen gewesen. Ihr erster Gedanke war, dass Caesia womöglich alles andere als erfreut darauf reagiert hatte, ins Ausland abgeschoben zu werden.
»Sie war begeistert. Caesia hatte einen offenen, forschenden Geist und keinerlei Angst vor dem Reisen. Sie war entzückt, Zugang zu griechischer Kunst und Kultur zu bekommen. Ich hatte sie immer ermutigt, Bibliotheken und Galerien zu besuchen.« Ein Blick in Helenas schöne braune Augen verriet mir, dass sie wusste, das junge Mädchen sei meiner Meinung nach wohl eher von griechischen Maultiertreibern entzückt gewesen, muskulös und voller Mutwilligkeit wie die klassischen Götter.
Ich war wieder dran. »Und wie wurde die Reise organisiert?« Meine Stimme klang mürrisch. Ich kannte die Antwort bereits. Sie war unsere Verbindung zu der vor kurzem ermordeten Frau. Caesias Tante hatte sich einer Reisegesellschaft angeschlossen und spezielle Fremdenführer engagiert.
Das war die neueste Mode unserer Zeit. Straßen und Schiffspassagen waren sicher, im ganzen Imperium galt dieselbe Währung, und in den eroberten Gebieten gab es viele faszinierende Landstriche. Was unausweichlich dazu führte, dass unsere Mitbürger zu Touristen wurden. Alle Römer – all jene, die es sich leisten konnten – glaubten an ein Leben in Müßiggang. Einige reiche Müßiggänger begaben sich von Italien aus sogar auf fünfjährige Reisen. Als diese Kulturwütigen die antiken Orte der Welt überschwemmten, mit ihrer Reiseliteratur und Geschichtsbüchern, Einkaufslisten und Zeitplänen herumfuchtelten, hatte sich eine Reiseindustrie entwickelt, um daraus Profit zu schlagen.
Ich hatte gehört, dass Vergnügungsreisen der letzte Dreck waren. Allerdings sagt man jedem erfolgreichen Geschäftszweig Übles nach. Mir war sogar zu Ohren gekommen, dass die Öffentlichkeit Ermittler verabscheut.
»Alles fing fachkundig an«, fuhr Caesius fort. »Veranstalter mit dem Namen Sieben-Stätten-Reisen bereiteten die Tour vor. Sie erklärten, dass es billiger, sicherer und viel praktischer wäre, wenn Gruppen zusammen reisen.«
»Aber für Caesia war es nicht sicherer. Was ist denn nun passiert?«, wollte ich wissen.
Wieder atmete der Vater durch. »Mir wurde gesagt«, betonte er, »dass sie während des Aufenthalts in Olympia verschwand. Nach einer ausgedehnten Suche – zumindest wurde es so beschrieben – setzte der Rest der Gruppe die Reise fort.« Seine Stimme war kalt. »Das könnte Ihnen, wie mir, überraschend vorkommen.«
»Wer hat es Ihnen mitgeteilt?«
»Ein Angestellter von Sieben-Stätten-Reisen kam zu mir nach Hause.«
»Name?«
»Polystratus.« Ich schrieb ihn mir auf. »Er war mitfühlend, erzählte eine gute Geschichte, sagte, Caesia hätte die Gruppe plötzlich verlassen, keiner wisse, warum. Ich war zu entsetzt, um ihn näher zu befragen, und außerdem war er ja nur ein Bote. Er schien anzudeuten, Caesia hätte ihnen durch kapriziöses Verhalten Unannehmlichkeiten bereitet. Anscheinend wären die anderen Reisenden eines Morgens aufgewacht und wollten zum nächsten Ziel aufbrechen, aber man konnte sie nicht finden.« Caesius wurde ungehalten. »Es klang fast, als wollte Sieben Stätten finanzielle Entschädigung für die Verzögerung fordern.«
»Haben die sich wieder beruhigt?«
»Nachdem sie nun tot ist ...«
»... haben die Angst, dass Sie den Reiseveranstalter verklagen könnten!«
Caesius schaute verblüfft. Auf die Idee war er gar nicht gekommen. Ihm ging es darum, die Wahrheit herauszufinden, um mit seiner Trauer fertig zu werden. »Der Reiseleiter der Tour hieß Phineus. Falco, es hat einige Zeit gedauert, bis ich herausbekam, dass Phineus die Gruppe verlassen hatte, nachdem Caesia verschwand. Er kehrte sofort nach Rom zurück. Ich finde sein Verhalten äußerst verdächtig.« Nun würden wir seine wütenden Theorien zu hören bekommen.
»Überlassen Sie es mir, Verdächtige zu identifizieren«, wies ich ihn an. »Gab es irgendwelche Informationen von der Tante des Mädchens?«
»Sie blieb in Olympia, bis sie dort anscheinend nichts mehr ausrichten konnte. Dann brach sie die Reise ab und kehrte nach Hause zurück. Sie war am Boden zerstört, als ich schließlich herausfand, was meiner Tochter zugestoßen war.«
»Können Sie für uns eine Verbindung zu dieser Dame herstellen?«
»Leider nicht. Sie ist wieder im Ausland.« Meine Augenbrauen hoben sich. »Sie genießt das Reisen. Ich glaube, sie ist nach Alexandria gefahren.« Tja, das ist das Problem mit dem Urlaub. Jedes Mal, wenn man einen gemacht hat, braucht man zur Erholung einen weiteren. Allerdings waren seit dem Tod ihrer Nichte drei Jahre vergangen, und Marcella Naevia hatte jedes Recht, ihr Leben wieder aufzunehmen. Man musste Caesius wohl gesagt haben, dasselbe zu tun; er blickte gereizt.
Während ich mir Notizen über die Tante machte, übernahm Helena. »Sie waren demnach so unzufrieden mit der offiziellen Version der Ereignisse, Caesius, dass Sie nach Olympia reisten, um selbst nachzuforschen?«
»Zu Anfang vergeudete ich viel Zeit. Ich ging davon aus, dass die Behörden Ermittlungen aufnehmen und mich benachrichtigen würden.«
»Und es kam nichts?«
»Nur Schweigen. Daher verging fast ein Jahr, bis ich die Reise unternahm. Ich war es meinem Kind schuldig zu ergründen, was ihm zugestoßen war.«
»Natürlich. Vor allem, wenn Sie Zweifel hatten.«
»Ich habe keine Zweifel!«, blaffte Caesius. »Jemand hat sie ermordet! Dann hat jemand – der Mörder, die Reiseagentur, irgendein anderes Mitglied der Reisegruppe oder die Einheimischen – das Verbrechen vertuscht. Sie hofften alle, dass der Vorfall in Vergessenheit gerät. Aber ich werde es sie nie vergessen lassen!«
»Sie reisten also nach Griechenland«, unterbrach ich ihn besänftigend. »Sie haben lange Zeit damit verbracht, sich mit den Behörden von Olympia herumzuschlagen.
Schließlich haben Sie selbst menschliche Überreste außerhalb des Ortes gefunden, mit Hinweisen, die bestätigten, dass es sich um Ihre Tochter handelte?«
»Der Schmuck, den sie an jenem Tag trug.«
»Wo befand sich die Leiche?«
»An einem Hang. Auf dem Kronoshügel oberhalb des Zeus-Heiligtums.« Jetzt bemühte sich Caesius, vernünftig zu klingen, damit ich ihm glaubte. »Die Einheimischen behaupteten, sie müsse umhergestreift sein, vielleicht aus einer romantischen Laune heraus, um den Sonnenuntergang – oder Sonnenaufgang – zu bewundern oder in der Nacht den Göttern zu lauschen. Die Unverschämtesten meinten, sie hätte sich bestimmt mit einem Liebhaber getroffen.«
»Was Sie aber nicht glauben.« Ich äußerte keine Kritik an seinem Glauben an seine Tochter. Einen unvoreingenommenen Eindruck von Caesia konnten wir durch andere erhalten.
»Die Frage könnte Sie hart ankommen«, bohrte Helena sanft nach, »aber konnten Sie von der Leiche Ihrer Tochter irgendetwas ableiten?«
»Nein.«
Wir warteten. Der Vater blieb stumm.
»Sie war auf dem Hügel den Unbilden der Natur ausgesetzt.« Ich behielt einen neutralen Ton bei. »Gab es Anzeichen dafür, wie sie gestorben war?«
Schaudernd führte sich Caesius die schreckliche Entdeckung wieder vor Augen. »Als ich sie fand, hatte sie seit einem Jahr dort gelegen. Ich habe mich gezwungen, nach Anzeichen eines Kampfes zu suchen. Ich wollte wissen, was mit ihr geschehen war, wie ich schon sagte. Aber ich fand nur Knochen, teilweise durch Tiere verstreut. Wenn ihr etwas angetan worden war, ließ sich das nicht mehr erkennen. Das war das Problem«, knurrte er wütend. »Das war der Grund, warum die Behörden darauf bestehen konnten, Caesia sei eines natürlichen Todes gestorben.« »Kleidung?«, fragte ich.
»Es sah aus, als sei sie ... bekleidet gewesen.« Ihr Vater blickte mich an, als wollte er von mir die Beruhigung, dass es sich nicht um ein sexuelles Verbrechen gehandelt hatte.
Nach den Beweisen aus zweiter Hand ließ sich das schwer beurteilen.
Helena fragte dann leise: »Sie haben sie bestattet?«
Die Stimme des Vaters klang abgehackt. »Ich will sie zu den Göttern schicken, aber erst muss ich Antworten finden. Ich habe sie eingesammelt, wollte dort in Olympia eine Feier abhalten, doch dann habe ich mich dagegen entschieden. Ich habe für sie einen Bleisarg anfertigen lassen und sie mit nach Hause gebracht.«
»Oh!« Mit dieser Antwort hatte Helena nicht gerechnet.
»Wo ist sie jetzt?«
»Sie ist hier«, antwortete Caesius nüchtern. Unwillkürlich sahen Helena und ich uns im Empfangszimmer um. Caesius ging nicht näher darauf ein. Irgendwo in seinem Haus musste ein Sarg mit den drei Jahre alten Gebeinen stehen. Eine makabre Kühle legte sich über den bisher so häuslichen Raum. »Sie wartet darauf, jemandem etwas Wichtiges mitzuteilen.«
Mir. Große Götter, das würde meine Rolle sein.
»Also ...« Fröstelnd arbeitete ich mich durch den Rest der Geschichte. »Selbst Ihre traurige Entdeckung auf dem Hügel brachte die Einheimischen nicht dazu, die Sache ernst zu nehmen. Dann haben Sie die Beamten des Statthalters in der Hauptstadt Korinth unter Druck gesetzt, die aber alles abblockten wie echte Diplomaten. Sie haben sogar die Reisegruppe aufgespürt und Antworten verlangt. Schließlich gingen Ihnen die Geldmittel aus, und Sie waren gezwungen, nach Hause zurückzukehren?«
»Ich wäre dort geblieben. Aber ich hatte den Statthalter mit meinen ständigen Gesuchen verärgert.« Caesius sah beschämt aus. »Mir wurde befohlen, Griechenland zu verlassen.«
»Na toll!« Ich schenkte ihm ein schiefes Lächeln. »Ich bin ganz versessen darauf, in eine Ermittlung hineingezogen zu werden, bei der mein Klient gerade auf die schwarze Liste der Administration gesetzt worden ist.«
»Hast du denn einen Klienten?«, fragte Helena, obwohl ihr Blick mir sagte, dass sie die Antwort erraten hatte.
»In diesem Stadium noch nicht«, erwiderte ich, ohne zu blinzeln.
»Was hat Sie nun eigentlich zu mir geführt?«, fragte Caesius mit zusammengezogenen Brauen.
»Eine mögliche Entwicklung. Vor kurzem ist eine weitere junge Frau unter verdächtigen Umständen in Olympia gestorben. Mein Assistent Camillus Aelianus wurde gebeten, Nachforschungen anzustellen ...« Das war leicht übertrieben. Er war nur neugierig. »Ich habe Sie befragt, weil das Schicksal Ihrer Tochter in Zusammenhang mit diesem neuesten Todesfall stehen könnte. Ich möchte eine neutrale Neubewertung vornehmen.«
»Ich habe in Griechenland die richtigen Fragen gestellt!« Besessen von seiner eigenen Misere, ließ Caesius erkennen, wie verzweifelt er war. Er hatte kaum wahrgenommen, was ich über diesen neuen Todesfall gesagt hatte, wollte sich seine Überzeugung nicht rauben lassen, für seine Tochter alles getan zu haben. »Glauben Sie etwa, die Antworten würden anders ausfallen, wenn ein anderer die Fragen stellt?«
Ich glaubte jedenfalls, dass inzwischen jeder Verdächtige seine Geschichte feinst abgestimmt hatte. Meine Chancen standen äußerst schlecht. Der Fall war längst erkaltet, und der nörgelnde Vater lag mit seinen wilden Theorien möglicherweise vollkommen daneben. Selbst wenn tatsächlich ein Verbrechen geschehen war, hatten die Täter im ersten Fall drei Jahre Zeit gehabt, jeden Beweis zu vernichten, und kannten beim zweiten alle Fragen, die ich stellen würde.
Es war hoffnungslos. Genau wie die meisten miesen Ermittlungen, auf die ich mich einließ.
Verspätet reagierte Caesius darauf, dass ein weiteres Mädchen ermordet worden war und eine weitere Familie litt.
»Ich muss zu ihnen ...«
»Bitte nicht!«, drängte ich. »Bitte überlassen Sie das mir.« Er würde den Rat nicht beherzigen, das war deutlich zu erkennen. Caesius Secundus wurde von der Hoffnung befeuert, dass ein weiterer Mord – wenn es denn wirklich einer gewesen war – weitere Hinweise, weitere Fehler oder konfuse Geschichten und vielleicht eine neue Chance ergeben würde.
Kapitel III
Der Sarg von Marcella Caesia stand in einem dunklen Nebenraum. Der Deckel wurde mühsam mit einem Stemmeisen geöffnet. Der mürrische Sklave, der die gebogenen Bleiecken hochdrückte, hielt mich eindeutig für einen weiteren gefühllosen Betrüger, der sich am Leid seines Herrn weidete.
Erwarten Sie nicht, dass ich mich über den Inhalt verbreite. Das tote Mädchen war auf dem Hügel zwölf Monate lang von der Sonne ausgebleicht worden, und Tiere hatten sich über sie hergemacht. Da lagen viele kleine Knochen und ein paar Stofffetzen. Die Überreste einzusammeln musste schwierig gewesen sein. Danach hatte der Sarg eine Seereise hinter sich gebracht. Wenn Sie jemals eine Leiche in diesem Zustand gesehen haben, wissen Sie, wie das ist. Wenn nicht, seien Sie dankbar.
»In welcher Stellung lag die Leiche, Caesius? Konnten Sie das erkennen?«
»Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie lag auf dem Rücken. Aber das ist nur ein Gefühl. Alles war weit verstreut.«
»Gab es Anzeichen, dass sie vergraben worden war? Konnten Sie ein flaches Grab erkennen?«
»Nein.«
Unter dem grimmigen Blick von Caesius Secundus stand ich die Sache durch, ging um den Sarg herum, betrachtete ihn aus jedem Blickwinkel. Ich entdeckte nichts Hilfreiches. Aus Schicklichkeit ließ ich mir Zeit und schüttelte dann den Kopf. Ich bemühte mich, Ehrerbietung zu zeigen, was mir wahrscheinlich nicht gelang. Dann ließ ich Caesius mit zum Gebet erhobenen Armen zurück, während die Überreste seiner Tochter von dem schmallippigen Sklaven wieder verschlossen wurden, wobei er den verbogenen Bleideckel regelrecht zuhämmern musste.
Eines kam dabei für mich heraus: Meine Neugier verwandelte sich in eine wesentlich unnachgiebigere Stimmung.
In dieser wütenden Gemütsverfassung wandte ich mich dem neuen Fall zu, dem zweiten römischen Mädchen, das in Olympia gestorben war. Ich begann meine Nachforschungen über sie in Rom.
Aulus hatte ein paar Fakten mitgeteilt. Dieses Opfer hieß Valeria Ventidia. Mit neunzehn hatte sie Tullius Statianus geheiratet, den mittleren Sohn einer wohlhabenden Familie, einen aufrechten jungen Mann. Die Familie Tullius unterstützte den älteren Sohn bei der Wahl zum Senat. Für Statianus war nichts dergleichen vorgesehen. Daher hatten die Eltern dem Bräutigam und der Braut vielleicht zum Ausgleich eine lange Auslandsreise geschenkt.
Valerias Verwandte aufzuspüren gelang mir nicht. Bisher gab es keinen Forumtratsch über diesen Fall. An die Tullii kam ich nur durch den anderen Sohn, der zur Wahl stand. Ein Schreiber in der Kurie ließ sich widerwillig bestechen, mir seine Adresse aufzuschreiben. Doch als ich sie dann aufsuchte, war mir Caesius zuvorgekommen. Er hatte meine Bitte missachtet und sich selbst an die Eltern des Bräutigams gewandt.
Das war keine Hilfe. Er bildete sich ein, die Trauer würde ihm Zugang verschaffen, und die neuen Schwiegereltern würden, falls die Braut ebenfalls unter unnatürlichen Umständen gestorben war, seine Entrüstung teilen. Ich hätte ihm sagen können, wie unwahrscheinlich das war. Aber ich war seit fast zwei Jahrzehnten Ermittler und wusste, wie mies die Menschen sind.
Trauer hebt die Moral nicht. Sie verschafft nur weitere Ausreden, den ethisch Höherstehenden die Tür vor der Nase zuzuknallen. Solchen wie Caesius Secundus. Solchen wie mir.
Die Tullii wohnten an der Argiletum. Die hektische Durchgangsstraße nördlich der Kurie galt zwar als beste Adresse, hatte jedoch durch Krawalle und Diebstähle einen schlechten Ruf bekommen, und die privaten Haushalte dort hatten sicher unter Straßenschlägereien und nächtlichem Gebrüll zu leiden. Was uns verriet, dass die Familie entweder hochtrabende Vorstellungen hatte oder über geerbtes Geld verfügte, das zur Neige ging. So oder so täuschten sie über ihre Wichtigkeit hinweg.
Die Mutter des Bräutigams hieß Tullia, Tullia Longina. Da sie den Familiennamen ihres Mannes trug, musste es sich um eine Ehe zwischen nahen Verwandten handeln, vermutlich aus Geldgründen. Sie erklärte sich bereit, uns zu empfangen, wenn auch widerstrebend. Klopft man unangekündigt an die Tür eines Privathauses, ist man stets im Nachteil. Ich konnte mir gewaltsam Zugang zu fast allen Häusern verschaffen, aber eine römische Matrone, Mutter von drei Kindern, erwartet traditionsgemäß weniger Grobheit. Verärgert man sie, wird man rasch von einem bulligen Sklaven rausgeworfen.
»Mein Mann ist geschäftlich unterwegs ...« Tullia Longina beäugte uns kritischer, als es Caesius getan hatte. Ich sah kaum vertrauenswürdiger aus als ein Gladiator. Wenigstens schien Helena, gekleidet in sauberes Weiß mit glitzerndem Gold an der Kehle, beruhigender zu wirken. Wieder hatte ich sie mitgenommen. Ich war in gereizter Stimmung und brauchte ihren bändigenden Einfluss.
»Wir könnten zu einem geeigneteren Zeitpunkt wiederkommen«, bot Helena an, ohne es ernst zu meinen.
Uns fiel der wachsame Blick der Frau auf. »Sie sprechen besser mit mir. Tullius ist bereits verärgert. Ein Mann namens Caesius war hier. Haben Sie etwas mit ihm zu tun?«
Wir schnalzten mit der Zunge und gaben uns bekümmert ob seiner Einmischung. »Sie wissen demnach, was mit seiner Tochter passiert ist?«, fragte Helena, bemüht, die Freundschaft der Frau zu gewinnen.
»Ja, aber mein Mann sagt, was hat das mit uns zu tun?« Ein Fehler, Tullia. Helena hasste Frauen, die sich hinter ihren Männern versteckten. »Valerias ... Unfall ... ist sehr bedauerlich und eine Tragödie für meinen armen Sohn, doch welchen Zweck soll es haben, sich mit dem aufzuhalten, was passiert ist?«
»Vielleicht, um Ihren Sohn trösten zu können?« Meine Stimme war schroff. Ich dachte an den modrigen Inhalt des Bleisargs in Caesius’ Haus.
Tullia bemerkte unsere Grobheit nach wie vor nicht. Wieder tauchte ihr wachsamer Gesichtsausdruck auf und änderte sich rasch. »Nun ja, das Leben muss weitergehen ...«
»Und Ihr Sohn ist nach wie vor im Ausland?« Helena hatte ihre Fassung wiedergefunden.
»Ja.«
»Sie möchten ihn doch bestimmt daheim haben.«
»Allerdings! Aber ich muss gestehen, dass ich mich auch davor fürchte. Wer weiß, in welchem Zustand er sein wird ...« Im nächsten Augenblick teilte uns die Mutter mit, dass sein Zustand erstaunlich stabil war. »Er hat beschlossen, seine Reise fortzusetzen, um Zeit zu haben, mit der Sache ins Reine zu kommen.«
»Hat Sie das nicht überrascht?« Ich hielt es für erstaunlich und ließ sie das sehen.
»Nein, er hat uns einen langen Brief geschrieben und es erklärt. Er sagte, die anderen aus der Reisegruppe würden ihn trösten. Er will bei seinen neuen Freunden bleiben.
Sonst müsste er völlig allein nach Rom zurückreisen, wo er doch so aufgewühlt und unglücklich ist ...«
Ich unterbrach sie, wenig überzeugt. »Was sagt er denn über den Todesfall?«
Wieder blickte die Mutter beklommen. Sie war intelligent genug zu wissen, dass wir die Fakten auch auf andere Weise erfahren konnten, also spuckte sie es aus. »Valeria wurde eines Morgens tot vor der Unterkunft gefunden.« Da ich Statianus bereits nicht ausstehen konnte, fragte ich mich, welcher frischgebackene Ehemann wohl eine ganze Nacht getrennt von seiner Braut verbringt, ohne Alarm zu schlagen. Vielleicht einer, der einen Streit mit ihr hatte?
»Gab es irgendwelche Überlegungen, wer so etwas getan haben könnte?« Helena übernahm, bevor ich die Geduld verlor.
»Anscheinend nicht.« Die Mutter von Statianus kam mir etwas zu verschlossen vor.
»Zweifellos haben die örtlichen Behörden gründlich ermittelt?«
»Eine Frau aus der Gruppe wandte sich an einen Magistrat. Machte eine Menge Theater.« Tullia schien diesen vernünftigen Schritt für übereifrig zu halten. Dann erfuhren wir auch, wieso: »Statianus fand die Ermittlung schwer zu verkraften. Der Magistrat hatte etwas gegen ihn. Es hieß, mein Sohn müsse etwas mit dem zu tun haben, was mit Valeria passiert ist – dass sie sich vielleicht gestritten hätten – dass sie entweder das Interesse an ihm verloren oder sein Verhalten sie von ihm fortgetrieben hätte ...«
Die Mutter hatte zu viel gesagt und wusste das. Helena bemerkte: »Man kann sich vorstellen, wie es zu einem Bruch zwischen einem frisch verheirateten Paar kommt, junge Leute, die sich vorher kaum gekannt haben und nun unter der Belastung des Reisens stehen ...«
Ich warf eine Frage ein. »War es eine arrangierte Eheschließung?« Alle Ehen werden von jemandem arrangiert, sogar unsere, insofern als wir zwei einfach beschlossen hatten zusammenzuleben. »Kannte sich das Paar vorher? Waren sie seit ihrer Kindheit befreundet?«
»Nein. Sie hatten sich als Erwachsene mehrmals getroffen und waren einverstanden, die Partnerschaft einzugehen.«
»Wie lange liegt die Hochzeit zurück?«
»Nur vier Monate ...« Tullia wischte eine unsichtbare Träne weg. Wenigstens hatte sie sich diesmal die Mühe gemacht.
»Valeria war neunzehn. Und Ihr Sohn?«, drängte ich.
»Fünf Jahre älter.«
»Und wer hat die Sache für Valeria arrangiert? Hatte sie Familie?«
»Einen Vormund. Ihre Eltern sind beide tot.«
»Ist sie eine Erbin?«
»Nun ja, sie hat – hatte – ein wenig Geld, aber um ehrlich zu sein, für uns war es eine Art Abstieg.« Also hatten die Tullii nur eine kleine Mitgift eingesackt. Geld schien daher ein unwahrscheinliches Motiv für die Ermordung Valerias zu sein.
Ich fragte nach Einzelheiten über Valerias Vormund und bekam sie zu meinem Erstaunen auch. Doch es brachte uns nicht weiter. Es handelte sich um einen bejahrten Großonkel, der auf Sizilien lebte und nicht mal zur Hochzeit gekommen war. Valeria zu verheiraten schien nur eine Pflichtaufgabe gewesen zu sein.
»Sie standen sich nicht nahe«, erzählte uns Tullia. »Ich glaube, sie hatten sich nicht mehr gesehen, seit Valeria ein kleines Kind war. Trotzdem nehme ich an, dass ihr Großonkel untröstlich ist.«
»Ihr Sohn nicht?«, fragte ich kühl.
»Natürlich ist er das!«, rief Tullia Longina empört. »Selbst der Magistrat konnte schließlich erkennen, dass Statianus unschuldig ist. Die ganze Gruppe wurde entlastet und durfte die Reise fortsetzen.«
»Was ist mit Valerias Leiche geschehen?«
»In Olympia wurde eine Bestattungsfeier abgehalten.«
»Einäscherung?«
»Selbstverständlich.« Tullia blickte mich erstaunt an. Den Göttern sei Dank. Das bewahrte mich davor, an weiteren Knochen herumzuschnüffeln.
Helena bewegte sich leicht, um die Spannung zu mindern. »Wie haben Sie reagiert, als Caesius Secundus kam und Ihnen erzählte, dass seiner Tochter etwas Ähnliches zugestoßen ist?«
»Oh, die Umstände waren ganz andere!« Nach den begrenzten Informationen, die wir hatten, konnte ich das nicht erkennen. Caesius hatte keine Ahnung, wie seine Tochter gestorben war. Entweder wussten die Tullii mehr über Valeria, als sie zugaben, oder sie waren entschlossen, die Sache als »Unfall« abzutun, obwohl Aulus geschrieben hatte, dass es in Olympia keinen Zweifel an ihrer Ermordung gab. Die Tullii wischten Valerias Tod eindeutig beiseite – genau wie es laut Caesius’ Ansicht alle mit dem seiner Tochter getan hatten. Ihr Sohn hatte hingegen überlebt, seinen beiden Brüdern ging es gut, und die Tullii wollten einfach mit ihrem Leben fortfahren.
»Gibt es eine Möglichkeit, die Briefe zu sehen, die Statianus geschrieben hat?«, wollte Helena wissen.
»O nein, nein, nein. Ich habe sie nicht mehr.«
»Eine Familie, die nichts von Andenken hält?« Helena konnte ihren Sarkasmus kaum verbergen.
»Nun ja, ich habe Erinnerungsstücke aus der Kindheit all meiner Söhne – ihre ersten winzigen Sandalen, Kinderbecher, aus denen sie ihre Brühe tranken, aber nichts sonst. Wir heben keine Briefe über Tragödien auf.« Tullias Gesicht verdüsterte sich. »Sie sind fort«, sagte sie beinahe flehend. »Ich kann den Kummer des anderen Vaters verstehen. Es tut uns allen sehr leid, sowohl für ihn als auch für uns. Natürlich tut es das. Valeria war so ein liebes Mädchen ...« Meinte sie das ehrlich, oder war sie bloß höflich? »Aber jetzt ist sie von uns gegangen, und wir müssen uns alle wieder beruhigen.«
Vielleicht hatte sie recht. Nach dem Gespräch beschlossen Helena und ich, dass es keinen Zweck hatte, den Tullii weiter zuzusetzen. Vermutlich hatten wir in Tullias letzter Aussage die Ansicht ihres Mannes vernommen: »... ist sie von uns gegangen, und wir müssen uns alle wieder beruhigen.« Zwei Monate nach einem Todesfall war das nicht besonders herzlos, nicht von Schwiegereltern, die das Mädchen kaum gekannt hatten.
»Hat überhaupt jemand Valeria gekannt?«, fragte mich Helena nachdenklich. »Sie wirklich gekannt?«
Ich hielt Statianus ebenfalls für ein Rätsel. Wie nichtssagend die Ausreden auch waren, ich fand es immer noch unglaublich, dass er seine frisch Angetraute verlor und trotzdem die Reise mit einer Gruppe Fremder fortsetzte, als wäre nichts geschehen.
»Die Tour durch Griechenland war als Hochzeitsreise gedacht«, stimmte Helena zu. »Wenn aber die Ehe beendet war, wozu die Reise dann noch fortsetzen?«
»Weil sie bezahlt war?«
»Meine Eltern würden das Geld zurückverlangen!« Sie verzog das Gesicht und fügte dann brutal hinzu: »Oder Papa würde rasch für eine neue Partie sorgen und dann für eine Wiederholung der Tour mit Ehefrau Nummer zwei.«
Ich machte bei der Satire mit. »Direkt von Rom aus oder von dem Ort, wo die erste Braut abhandengekommen ist?«
»Natürlich von Olympia aus. Der Bräutigam muss ja nicht noch mal die Orte sehen, die schon abgehakt sind!«
Ich grinste. »Und mich hält man für ungehobelt.«
»Realistisch«, konterte Helena. »Die Reise muss die Tullii eine Menge gekostet haben, Marcus.«
Ich nickte. Sie hatte recht. Morgen würde ich mit den Agenten sprechen, die dieses teure Paket geschnürt hatten.
Kapitel IV
Ich trug die Toga, die ich von meinem Bruder geerbt hatte. Ich wollte wohlhabend aussehen, aber überhitzt und ausgelaugt. Ich behängte mich mit Schmuck, den ich für Gelegenheiten aufhebe, bei denen ich mich als ungeschlachter Neureicher ausgebe – einen torquesförmigen Armreif und einen großen Ring mit einem roten Stein, geschliffen als Abbild eines Mannes mit griechischem Helm. Beides stammte von einem Stand in den Saepta Julia, der darauf spezialisiert war, Idioten auszustatten. Auf Hochglanz poliert, sah es fast wie echtes Gold aus – aber nicht so echt wie mein schlichter Goldring, welcher der Welt verkündete, dass ich tatsächlich ein neues Mitglied des mittleren Ranges war. Vespasian hatte mich dazu beschwatzt, den Rang eines Ritters anzunehmen – also war ich wirklich leicht zu übertölpeln.
Neben dem antiken Forum Romanum liegt das moderne Forum des Julius, daneben das Forum des Augustus, und danach kommt man in das berüchtigte Viertel, das einst Subura hieß. Angeblich lebte Caesar hier, falls er sich gerade nicht mit der minderjährigen Kleopatra im Bett wälzte oder Gallien zerstückelte. Der legendäre Julius hatte einen halbseidenen Geschmack. Wenn er in der Subura wohnte, konnte er von Glück sagen, die Iden des März überlebt zu haben, glauben Sie mir.
Diese gefährliche Drecksgegend war jetzt in den Alta-Semita-Bezirk umbenannt worden, wobei sich wenig verändert hatte. Selbst ich hätte in meiner Junggesellenzeit vor einer Wohnung in Alta Semita haltgemacht. Man stirbt nur einmal und möchte davor ja auch ein wenig leben.
Hier befand sich das Reisebüro von Sieben Stätten – nicht allzu weit entfernt von der Argiletum, wo die Tullii wohnten, und dem Haus von Caesius an der Via Lata. Das Ganze war ein Einraumladen in einer dunklen Gasse, die von einer Straße abging, in der eine Messerstecherei stattfand, unbeachtet von ein paar kleinen Jungen, die neben einem toten Bettler einen Hahnenkampf veranstalteten. Kein Wunder, dass die Anwohner von hier wegwollten. Als ich über die Schwelle trat, blickte ich nervös, und das war nicht gespielt. Der Mann im Laden beachtete mich nicht, während ich ausgebleichte Wandkarten von Achaea und Ägypten betrachtete und vor der Zeichnung eines jämmerlichen Trojanischen Pferdes stehen blieb.
»Der arme Bursche. Sieht aus, als hätte er sich von seinen Stallgefährten die Druse eingefangen. Oder hat er nur Holzwürmer?«
»Sie planen eine Reise, mein Herr?« Der gelangweilte Verkäufer rächte sich für diesen schlechten Witz durch das Zeigen seiner größtenteils fehlenden Zähne. Ich bemühte mich, nicht in diesen zahnlosen Schlund zu starren. »Da sind Sie bei uns am richtigen Platz. Wir organisieren alles zu Ihrer besten Zufriedenheit.«
»Wie viel würde es kosten?«
Nun schon begieriger, näherte er sich mir. Er war ein dunkelhäutiger, beleibter Gauner mit einem kurzen krausen Bart und pomadisiertem Haar. Seine kurze Tunika war kotzgelb und spannte über dem Bauch. »Wie viel Zeit haben Sie, und wohin wollen Sie reisen?« Ich würde nicht behaupten, dass er meinem Blick absichtlich auswich, aber er betrachtete eine unsichtbare Fliege, die er sich links von meinem Ohr erträumt hatte.
»Vielleicht nach Griechenland. Meine Frau will ihren Bruder besuchen. Mir ist ein wenig bange vor den Kosten.«
Der Agent spitzte mitfühlend die Lippen. Mit geübter Leichtigkeit verbarg er die Tatsache, dass das Ausnehmen verängstigter Touristen der einzige Grund für die Existenz von Sieben-Stätten-Reisen war. »Es muss nicht unerschwinglich sein.«
»Nennen Sie mir einen Preisrahmen.«
»Das ist schwierig. Sind Sie erst einmal unterwegs, werden Sie schnell süchtig. Dann möchte ich nicht, dass Sie an ein Paket gebunden sind, das keine Extratouren erlaubt – angenommen, Sie haben den Koloss von Rhodos bestaunt und hören dann von einem Dorf im Landesinneren, das legendären Käse herstellt ...« Ich dachte, der Koloss sei bei einem Erdbeben vom Sockel gekippt, aber ich liebe Käse. Mein Gesicht erhellte sich. Was wiederum ihn strahlen ließ. »Bei unserem individuell gestaltbaren, zeitlich unbegrenzten Reiseplan ist jedoch alles möglich – bis zu dem Augenblick, in dem Sie beschließen heimzukehren, damit Sie vor all Ihren Freunden angeben können. Ich sag Ihnen was, Legat, wie wär’s, wenn ich mit Ihnen nach Hause komme, damit wir es in Ruhe durchsprechen können?«
Ich blickte immer noch nervös. Ich war nervös. »Na ja, wir denken noch darüber nach ...«
»Gar kein Problem. Keine Verpflichtung. Ich heiße übrigens Polystratus. Man nennt mich den Vermittler der Sieben-Stätten-Reisen.«
»Falco.«
»Hervorragend. Falco, lassen Sie mich mit ein paar Landkarten und Reiserouten vorbeikommen, sie in der bequemen Umgebung Ihres eigenen Heims ausbreiten, damit Sie in Ruhe wählen können. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Frau dabei ist. Sie wird begeistert sein von dem, was wir anzubieten haben.«
»Oh, sie ist ganz verrückt darauf, Geld auszugeben«, bestätigte ich niedergeschlagen. Während er sein Entzücken verbarg, trafen wir eine Verabredung für denselben Abend. Sieben Stätten ließ ein Opfer nie kalt werden.
Unsere momentane Adresse war ein Stadthaus am Tiberufer im Schatten des Aventin. Ehemals hatte es meinem Vater gehört, Didius Geminus, dem berüchtigten Auktionator. Zwei Räume waren nach wie vor mit ausladenden, unverkäuflichen Möbeln vollgestopft, deren Abtransport Papa ständig »vergaß«. Einer dieser Salons eignete sich bestens dafür, Polystratus glauben zu machen, wir seien wohlhabender, als wir waren. Er stolperte mit einem Arm voller Schriftrollen herein, die er auf einen niedrigen Marmortisch fallen ließ. Helena bot ihm an, sich auf einer Metallliege zu entspannen, die noch mit verknautschten Kissen bedeckt war. Lächelnde Löwenköpfe an den Knäufen des Kopfendes sahen aus wie echt vergoldet.
Polystratus blickte sich bewundernd in Papas Spezialdekor um. Dieser Raum gehörte zu denen, die gelegentlich überflutet wurden. Wenigstens die fleckigen Fresken würden den Vermittler davon abhalten, Nullen an seinen Kostenvoranschlag anzuhängen. Millionäre hätten die Wände neu streichen lassen.
Ich stellte mich als Prokurator der Heiligen Gänse der Juno vor. Was nicht stimmte, da mich der geizige Kaiser »entlassen« hatte. Mein Posten war überflüssig geworden, aber dennoch ging ich hin und wieder zu ihnen hinauf und ließ mich um der alten Zeiten willen ein wenig zwicken. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass die Heiligen Gänse und die Hühner der Auguren vernachlässigt wurden. Außerdem waren wir an die kostenlosen Eier gewöhnt.
Helena Justina hatte ihrem Schmuck diese Woche schon einiges zu tun gegeben. Heute trug sie eine prächtige Bernsteinkette, dazu lächerliche Goldohrringe in Form von Kronleuchtern, die sie sich von einer uns bekannten Zirkusartistin geliehen haben musste. Sie musterte Polystratus verstohlen, während ich unseren Auftritt als einnehmende Touristen perfektionierte.
Der Mann roch aus dem Mund nach seiner letzten Mahlzeit, hatte das aber extra für uns durch das Lutschen von Lavendelpastillen überdeckt; der Geruch strömte durch seine Zahnlücken heraus. Vielleicht hatte er gehofft, mit meiner Frau flirten zu können. Die kotzgelbe Tunika des Morgens hatte er gewechselt und sich feingemacht. Jetzt trug er eine recht annehmbare lange Tunika in der Farbe getrockneten Blutes mit einem bestickten Saum. Vermutlich hatte er die aus dem Kostümfundus einer reisenden Theatergruppe erworben. Sie sah wie etwas aus, das ein König in einer sehr langweiligen Tragödie tragen würde. »Begeben Sie sich in meine Hände, gnädige Frau!«, rief Polystratus mit öliger Stimme. Helena konnte ihn bereits nicht leiden, und auch er schien von ihr nicht begeistert zu sein, da sie den Eindruck vermittelte, als würde sie mich jederzeit vom Unterzeichnen teurer Verträge abhalten. Ich merkte, wie er sich bemühte, unsere Beziehung einzuschätzen. Aus Spaß hatten wir die Plätze im Spiel getauscht. Ich gab jetzt vor, ganz verrückt aufs Reisen zu sein, während Helena die Sauertöpfische spielte. Das passte nicht zu dem, was ich im Reisebüro gesagt hatte, also fühlte sich Polystratus etwas überrumpelt.
»Mir gefällt diese Idee des unbegrenzten Reiseplans«, sagte ich zu Helena. »Zu unternehmen, was wir wollen, uns nicht festzulegen, ganz nach Lust und Laune herumzustreifen ...«
»Hervorragend!« Polystratus strahlte, nur zu bereit, mich die Arbeit für ihn tun zu lassen. »Darf ich fragen, was Ihre Profession ist, Falco?« Er klopfte meine Kreditsicherheit ab. Wie weise. Wenn ich nur welche zum Abklopfen gehabt hätte. »Sind Sie im Handel tätig? Import-Export? Vielleicht begünstigt durch eine Erbschaft?« Sein Blick schweifte durch den Raum, immer noch auf der Suche nach Beweisen für Geld. Da stand eine schimmernde Silberetagere, die wohl für einen Ausflug zu ein paar arkadischen Tempeln gut sein dürfte. Hinten war sie verbogen, doch das konnte er von seinem Platz aus nicht sehen.
»Marcus ist Dichter!«, warf Helena boshaft ein.
»Nicht sehr gewinnbringend ...« Ich feixte. Alle Geschäftsleute behaupten das.
Polystratus beäugte immer noch die Silberetagere. Familiengewohnheiten schlugen durch. Ich fragte mich, ob ich sie ihm wohl verkaufen konnte. Aber dann müsste ich mich mit Papa wegen des Anteils an der Provision herumstreiten ...
Helena bemerkte meinen Tagtraum und trat mir gegen das Schienbein. »Ich will wirklich nur meinen kleinen Bruder besuchen, Polystratus, mehr nicht. Mein verrückter Mann ist derjenige, der an maßgeschneiderten Reisen interessiert ist. Erst neulich wollte er unbedingt nach Ägypten.«
»Ein klassischer Romantiker!«, gluckste der Vermittler.
»Wir bieten einen hübschen Frühlingsausflug zu den Pyramiden von Giseh an. Alexandria liegt besonders hoch im Kurs. Bestaunen Sie die Pharaonen. Leihen Sie sich eine Schriftrolle aus der Bibliothek, eine Schriftrolle, die vielleicht einst neben Kleopatras Bett gelegen hat, während sie mit Antonius herumtollte ...«
Helena, die Informationen sammelte, schüttelte den Kopf. »Wusstest du, Marcus, dass Augustus dem Grabmal von Alexander dem Großen Tribut zollte? Er bedeckte den Leichnam mit Blumen und brach dabei versehentlich ein Stück von Alexanders Nase ab.«
»Was für eine erstaunliche Dame!« Polystratus war der Meinung, Frauen mit einem Sinn für Humor sollten in der Speisekammer eingeschlossen werden, wusste jedoch, dass das nicht in Frage kam, falls das Geld in unserem Bankfach aus ihrer Mitgift stammte.
»Sie ist ein Schatz!« Das meinte ich ernst. Und ihn entnervte es. Er war nur an klischeehafte Ehefrauen gewöhnt. »Erzählen Sie uns von diesen maßgeschneiderten Reisen«, beharrte ich, immer noch der starrköpfige Ehemann, der sich nach Abenteuern sehnte. »Es muss Griechenland sein, wegen ihres Bruders.«
»Überhaupt kein Problem«, versicherte mir Polystratus.
»Wir können Ihnen eine spektakuläre Python-und-Phidias-Rundreise anbieten ...«
»Ich möchte am liebsten im nächsten Sommer fahren, um die Olympischen Spiele mitzubekommen.« Mein Blick zu Helena ließ durchscheinen, dass sie die Erlaubnis verweigert hatte.
»Oh, zu schade! Unsere Sport-und-Tempel-Tour ist momentan dort.« Zum ersten Mal stellte ich mir die Frage, warum ausgerechnet jetzt, wenn die Spiele doch erst im nächsten Jahr stattfanden. Allerdings besitzt Olympia auch ein uraltes Heiligtum, dessen Zeus-Statue eines der sieben Weltwunder ist. »Seltsamerweise«, vertraute uns Polystratus an, »habe ich gerade heute einen Brief von dieser Gruppe bekommen. Sie finden es wunderbar und sind alle total begeistert.« Alle, nahm ich an, bis auf die verstorbene Valeria Ventidia und möglicherweise ihr Bräutigam. Polystratus konnte nicht ahnen, dass wir von dem Mord wussten.
»Wie funktioniert das denn nun im Einzelnen?«, wollte Helena wissen. »Haben Sie jemanden, der die Leute begleitet, sich um gute Unterkünfte kümmert und den Transport organisiert?«
»Ganz genau! Für unsere griechischen Abenteuer übernimmt das Phineus. Unser bester Reiseleiter. Eine Legende auf diesem Gebiet, da können Sie jeden fragen. Er übernimmt die ganze Laufarbeit, während Sie die Reise genießen.« Und wenn ein Kunde verschwand, wie ich von Caesius wusste, haute dieser Phineus nach Rom ab. Helena runzelte nervös die Stirn. »Wenn nun etwas furchtbar schiefgeht ...«
»Nicht auf unseren Reisen!«, blaffte Polystratus.
»Was ist, wenn ein schrecklicher Unfall passiert und jemand auf der Reise stirbt?«
Polystratus sog die Luft durch seine Zahnlücken ein. Ich sinnierte darüber nach, wie viele Kneipenschlägereien ein Mann hinter sich bringen musste, um solche Gebissverwüstungen anzurichten. »Es kann passieren.« Er änderte seine Taktik und senkte die Stimme. »Für die äußerst seltene Eventualität eines tragischen Unfalls verfügen wir über Erfahrung mit der Rückführung, sowohl der Lebenden als auch der weniger Glücklichen.«
»Wie tröstlich! Man hört von solchen Geschichten«, murmelte Helena kleinlaut.
»Glauben Sie mir«, bekräftige Polystratus, »ich weiß von Reiseveranstaltern, die sich in solchen Fällen schändlich verhalten. Irgendein alter Herr schluckt einen Traubenkern und erstickt, und die schluchzende Witwe bleibt ohne Geld und ohne Esel zurück, Hunderte Meilen von irgendwo. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, was da für schreckliche Dinge passieren. Aber wir«, verkündete er, »haben schon seit zwei Jahrzehnten glückliche Reisen organisiert. Tja, sogar Kaiser Nero wollte mit uns nach Griechenland fahren, aber leider war die Tour ausgebucht. Wir behaupten stets, er müsse sich die Kehle mit dem Rasiermesser aufgeschnitten haben, weil er so enttäuscht war, dass wir keinen Platz für ihn hatten.«
Ich schenkte dem Agenten ein mattes Lächeln. »Ich bin Neros Barbier begegnet. Seine Rasuren sind superb. Xanthus heißt er. Ein echtes Original. Jetzt arbeitet er für einen im Ruhestand lebenden germanischen Rebellenhäuptling ... Es brach ihm das Herz, dass Nero mit einem seiner besten Rasiermesser Selbstmord beging.«
Polystratus wusste nicht, wie er das aufnehmen sollte. Er dachte, ich wollte ihn verarschen. »Niemand, der mit uns reist, gerät je in Schwierigkeiten, das kann ich Ihnen versprechen.«
Der Nero-Spruch war sein offizieller Witz. Bedauerlicherweise für Polystratus wussten wir bereits, dass sein Versprechen eine Lüge war.
Kapitel V
Wir wimmelten Polystratus mit der Behauptung ab, wir würden sein Akropolis-Abenteuer in Erwägung ziehen, ganz bestimmt, sehr bald. Es gelang mir sogar, ihm eine Kopie der Reiseroute von Sport-und-Tempeln abzuluchsen, wobei ich durchblicken ließ, dass ich sie unter meiner Matratze verstecken würde, um im nächsten Jahr für mich eine sportliche Männereskapade zu buchen.
Das wäre eine Möglichkeit gewesen, in Olympia zu ermitteln. Sieben Stätten war die Verbindung zwischen den Todesfällen zweier junger Frauen. Caesia und Valeria waren beide mit diesem aufdringlichen Veranstalter gereist. Also hätten wir uns bis zur nächsten Olympiade zurücklehnen, selbst mit Sieben Stätten reisen und einfach abwarten können, welche Touristin ein Abenteuer zu viel erleben würde ...
Falco und Partner waren nicht so verantwortungslos. Außerdem wurde ich dieses Jahr nach Griechenland geschickt – vorausgesetzt, ich ließ mich darauf ein –, um Aulus auf den Weg nach Athen zu schubsen. Die edle Julia Justa wollte, dass sich ihr kleiner Liebling bei einem Rhetoriker einschrieb, und zwar jetzt! Falls mir das nicht gelang, wäre ich in einem Jahr wahrscheinlich geschieden.
Warum sich an einen Sponsor halten, wenn man zwei haben kann? Ich machte mich auf den Weg zum Palatin. Dort wurde ich mit der üblichen Ausrede abgespeist, die ich längst kannte: Der Kaiser besuche sein sabinisches Landgut. Außerdem hätte Vespasian den Olympia-Trip wahrscheinlich höhnisch beiseitegewischt und mir eine grausige politische Mission im nebeligen Norden aufs Auge gedrückt (wie diejenige, bei der er mir den kaiserlichen Barbier Xanthus aufgehalst hatte).