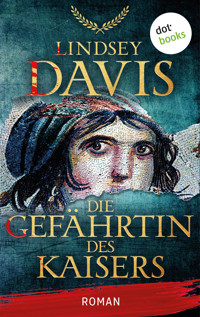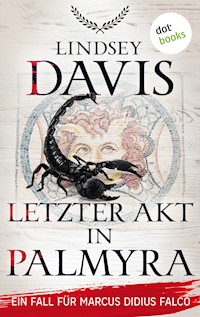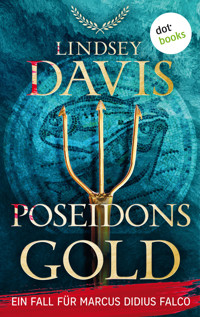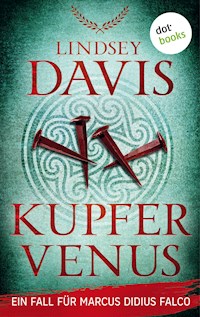6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
In gefährlichen Gewässern: Der fesselnde historische Kriminalroman »Das Geheimnis des Scriptors« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Ostia, 76 nach Christus. Die Geißel des Mittelmeers ist seit hundert Jahren Geschichte – denn die berüchtigten Seeräuber scheinen sich in die Schatten zurückgezogen zu haben … Das alles interessiert Marcus Didius Falco, den begabtesten Privatermittler Roms, allerdings wenig, als ihn ein Auftrag hierher an den Hafen führt: Er soll die Fährte eines berühmt-berüchtigten Skandalautors aufnehmen, der unter dem Decknamen »Infamia« immer wieder Unglaubliches enthüllt. Aber befindet sich der Scriptor wirklich nur auf einer langen Sauftour, wie seine Kollegen vermuten? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter – und kündigt sein Verschwinden die Rückkehr einer viel größeren Bedrohung in der Hafenstadt an? »Eine Reihe mit einer großen Fangemeinde. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum.« The Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Das Geheimnis des Scriptors« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der 16. Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ostia, 76 nach Christus. Die Geißel des Mittelmeers ist seit hundert Jahren Geschichte – denn die berüchtigten Seeräuber scheinen sich in die Schatten zurückgezogen zu haben … Das alles interessiert Marcus Didius Falco, den begabtesten Privatermittler Roms, allerdings wenig, als ihn ein Auftrag hierher an den Hafen führt: Er soll die Fährte eines berühmt-berüchtigten Skandalautors aufnehmen, der unter dem Decknamen »Infamia« immer wieder Unglaubliches enthüllt. Aber befindet sich der Scriptor wirklich nur auf einer langen Sauftour, wie seine Kollegen vermuten? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter – und kündigt sein Verschwinden die Rückkehr einer viel größeren/alten Bedrohung in der Hafenstadt an?
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Die Website der Autorin: www.lindseydavis.co.uk
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
Ebenfalls bei dotbooks erscheint der historische Roman »Die Gefährtin des Kaisers«.
***
eBook-Neuausgabe April 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »Scandal Takes a Holiday« bei Century, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2004 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2009 bei Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/lenisecalleja.photography, RinArte
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-057-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Marcus Didius Falco 16« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Das Geheimnis des Scriptors
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Zum Gedenken an Sara Ann Freed
»Fremdlinge, sagt, wer seid ihr? Von wannen trägt euch die Woge? Habt ihr wo ein Gewerb’, oder schweift ihr ohne Bestimmung hin und her auf der See: wie küstenumirrende Räuber, die ihr Leben verachten, um fremden Völkern zu schaden?«
Homer, Odyssee, 10. Jh. v. Chr.
»In der Piraterie gibt es, genau wie bei Verbrechen an Land, große Syndikate und Kleinkriminelle. Auf hoher See sind beide schwer zu fangen ... Niemand, abgesehen von den Schiffseignern, ihren Besatzungen und den Versicherungen, scheint zu bemerken, dass Piraten Schiffe in beispielloser Zahl angreifen, wie es das seit den glorreichen Tagen, als Piraten noch unter dem Schutz ihrer jeweiligen Regierung stehende ›Freibeuter‹ waren, nicht mehr gegeben hat ... Piraterie ist ein historisches Problem ... Sie ist in den Gesellschaften der Seeräuber verankert ... Trotz aller heute verfügbarer Informationen über Piratenangriffe ist kaum ein Fall bekannt, bei dem diese Angreifer verhaftet und vor Gericht gestellt wurden. Piraterie ist eine mit hohem Gewinn und geringem Risiko verbundene Tätigkeit.«
Charles Glass, The New Piracy, 2003 n. Chr.
Dramatis Personae
Verwandte
M. Didius Falco: Privatermittler im Sommerurlaub
Helena Justina: holt ihre Sommerlektüre nach
Julia Junilla und Sosia Favonia: ihre um Aufmerksamkeit rangelnden Kinder
Albia: ihr britannisches Pflegekind, ein Schatz
Nux, Ajax, Argos: pelzige Freunde mit mangelnder Erziehung
Mama: wächst gelegentlich über sich hinaus
Papa (M. Didius Geminus): sinkt diesmal noch viel tiefer
Junia: Falcos Schwester, die nervende
Gaius Baebius: der zu ihr passende Ehemann
Maia: noch eine Schwester, die praktische, fürsorgliche
Fulvius: ein Rätsel, über das niemand spricht
Cassius: ein Geheimnis, von dem niemand weiß
D. Camillus Verus Julia Justa: Helenas Vater, ein dienstfreier Senator ihre Mutter, stets wachend über:
A. Camillus Aelianus und
Q. Camillus Justinus: ihre Söhne, die dringend bewacht werden müssen
Angestellte des Tagesanzeigers in Rom
Holconius: der Politikberichterstatter
Mutatus: der Sportkommentator
Diocles: der Klatschkolumnist; ein Familienmensch
Vestina: seine einzige Familie
Die Vigiles
L. Petronius Longus: zeitweilig freigestellt (ein Querdenker?)
Brunnus: Anführer der nach Ostia abgeordneten VI. Kohorte; ein Rivale
Marcus Rubella: Tribun der IV. Kohorte; ein denkender Mensch
Fusculus, Passus: Mitglieder der IV, regelrecht nette Kerle
Virtus: ein Staatssklave; Amtsschreiber der Vigiles von Ostia
Rusticus: Anwerber der Vigiles
Menschen aus Ostia
Vermieterin: mit Doppelbelegung
Titus: ihr Sklave; eine Belastung
Caninus: Marineattaché; ein Schluckspecht
Privatus: Präsident der Bauhandwerkerkorporation; verbrüdert sich mit Petro
Angestellte: der Pflaumenblüte, der Venus, der Muschel, des Delphin, des Aquarius und anderer Etablissements
Chaeron: ein Bestattungsflötist, der sich mit allem anlegt
Schillernde Geschäftsleute aus fernen Provinzen
Damagoras: ein alter Kilikier, nicht unbedingt ein Pirat
L*BO: sein Heckenschneider, der’s übertrieben hat
Cratidas: ein gewalttätiger Kilikier, aber unschuldig, ehrlich
Lygon: ein weiterer Kilikier, aber ehrlich, wirklich
Pullia: eine Mutter (aus Kilikien) mit schlechten Angewohnheiten
Zeno: ein vernachlässigter Junge (aus Kilikien)
Cotys: ein Illyrier, zu anständig, um Pirat zu sein, sagt er
Theopompus: ein weiterer Illyrier, verliebt – ja, ehrlich
Der Illyrier: ein Vermittler
Antemon : ein Schiffskapitän, der nie einem Piraten begegnet ist
Banno, Aline: Schiffseigner, zu verängstigt zuzugeben, dass Piraterie passiert
Posidonius: ein Importeur, nicht so verängstigt – was er jetzt bedauert
Rhodope: seine Tochter, die einen Illyrier hinreißend findet
Lemnus aus Paphos: nur ein Betonmischer
Ostia, Italien: August 76 n. Chr.
Kapitel I
»Wenn der mit Steinen schmeißt, lernt er mich kennen«, grummelte Petronius. »Ich schnapp mir den kleinen Lümmel ...«
Es war ein heißer Tag am Ufer der Tibermündung in Ostia. Petro und ich hatten dringend was zu trinken gebraucht. Wegen der Hitze hatten wir uns nur aus der Vigiles-Kaserne bis in die erste geöffnete Kneipe schleppen können. Eine üble Spelunke. Wir waren stets dem Motto gefolgt: »Geh nie in die erste Kneipe, die du siehst, weil sie bestimmt nichts taugt.« In den letzten fünfzehn Jahren, seit wir uns in einer Anwerbeschlange für die Legionen begegnet waren, hatten wir uns auf der Suche nach was zu trinken immer ein ganzes Stück von zu Hause und von der Arbeit entfernt, für den Fall, dass man uns verfolgte und fand. Tatsächlich waren wir dabei in zahllose üble Kaschemmen geraten, aber nicht viele, in denen Kollegen herumsaßen, denen wir aus dem Weg gehen wollten, und nur sehr wenige, von denen unsere Frauen wussten.
Verstehen Sie mich nicht falsch, wir zwei sind aufrechte Römer mit traditionellen Wertvorstellungen. Natürlich bewundern wir unsere Kollegen und beten unsere Frauen an.
Genau wie der alte Brutus hätte jeder Redner von uns sagen können, dass Marcus Didius Falco und Lucius Petronius Longus ehrenwerte Männer seien. Und ja, der Redner hätte die Behauptung mit einer Ironie unterlegt, die selbst die dämlichste Volksmenge kapiert hätte ...
Wie Sie sehen, hatte ich in der Hitze zu schnell getrunken. Ich schwafelte bereits. Petronius, der erfahrene Ermittlungschef der Vierten Kohorte der Vigiles in Rom, war ein bedächtiger Mann. Er hielt den Weinbecher mit seiner großen linken Hand umklammert, aber sein schwerer rechter Arm ruhte momentan auf unserem Tisch vor der Kneipe, während er sich dem langsamen Abgleiten in die Trunkenheit hingab.
Er hatte sich hierher zum Dienst versetzen lassen und führte ein angenehmes Leben – vor allem, da der Gangster, auf den er wartete, überhaupt nicht auftauchte. Ich war hier, um nach jemand anderem zu suchen – was ich Petro allerdings nicht erzählt hatte.
Ostia, der Hafen von Rom, war eine pulsierende Stadt, aber die Kaserne der Vigiles war baufällig und die Kneipe daneben einfach schrecklich, kaum mehr als ein Schuppen, der an der Wand der Kaserne lehnte. Nach jedem Feuerlöschen blockierten die Vigiles-Mannschaften die enge Seitengasse, standen mit ihren Weinbechern herum, erpicht darauf, sich das Kratzen aus den rauhen Kehlen zu spülen, und für gewöhnlich genauso erpicht darauf, sich über ihre Offiziere zu beschweren. Im Moment war die Straße fast leer, und so konnten wir mit ausgestreckten Beinen auf zwei niedrigen Hockern an einem winzigen Tisch sitzen. Andere Gäste gab es nicht. Die Tagesschicht machte ein Nickerchen im Wachlokal und hoffte, niemand würde in einer überfüllten Wohnung durch Unachtsamkeit Feuer auslösen oder, wenn doch, dass niemand Alarm schlagen würde.
Petro und ich plauderten über unsere Arbeit und unsere Frauen. Nach wie vor in der Lage, zwei Dinge gleichzeitig zu tun, behielt Petronius Longus dabei auch den Jungen im Auge. Der Kleine wirkte zu angespannt, schien etwas im Schilde zu führen. Ein kicherndes Grüppchen wäre irritierend genug. Aber falls dieser Einzelgänger einen Stein durch das Tor der Kaserne werfen, dann Schmähungen rufen und wegrennen sollte, würde er meinem alten Freund direkt in die Arme laufen.
Allerdings war der Kleine höchstens sieben. Petronius würde ihm vermutlich nicht die Arme oder Beine brechen.
Nachdem Petronius die Augen zusammengekniffen und den Jungen eine Weile beobachtet hatte, setzte er unsere Unterhaltung fort. »Na, wie gefällt dir deine Bude, Falco?«
Ich schnaubte verächtlich über seine Frotzelei. »Mir ist schon klar, warum du da nicht bleiben wolltest.«
Petro war ein Raum in der Kaserne von Ostia zugewiesen worden. Er hatte sich geweigert, ihn zu beziehen, hatte mir die düstere Zelle aber für diese Woche überlassen. Wir hatten genug Erfahrung mit dem Kasernenleben aus der Zeit bei der Zweiten Augusta, unserer Legion in Britannien. Selbst Feldlager in abgelegenen Provinzen waren besser organisiert als dieser Saftladen. Der Dienst in Ostia war auf vier Monate beschränkt und wechselte im Turnus zwischen den sieben Kohorten Roms. Diese Regelung stand unter ständiger Kritik, und das merkte man.
In einer Seitenstraße des Decumanus Maximus kurz hinter der Porta Romana gelegen, waren die Gebäude vor drei Jahrzehnten hastig errichtet worden, als Claudius seinen neuen Hafen baute. Zuerst hatte der Kaiser einige der ungehobelten Stadtkohorten zur Bewachung der funkelnagelneuen Lagerhäuser eingesetzt. Brände in den Getreidespeichern hatten zu einem Umdenken geführt. Die Regelung wurde verschärft, und die Städtischen, einfache Soldaten, wurden von den besser geschulten Vigiles abgelöst, die ausgebildete Feuerwehrmänner waren. Roms lebenswichtiger Getreidenachschub sollte bei ihnen in sicheren Händen sein, das Volk würde nicht hungern müssen, die Stadt wäre frei von Krawallen, und jeder würde den Kaiser lieben, der für all das gesorgt hatte.
Hier geschah jedoch dasselbe wie in Rom. Während die Vigiles auf Feuerwache waren, vor allem bei Nacht, griffen sie nicht nur Brandstifter auf, sondern jede Art von Kriminellen. Jetzt überwachten sie den Hafen und behielten die Stadt im Auge. Die Bewohner Ostias versuchten immer noch sich daran zu gewöhnen.
Petronius, der wusste, wie man seine Vorgesetzten in den Sack steckte, mischte sich in das Tagesgeschehen nur ein, wenn es ihm passte. Sein Spezialeinsatz war zeitlich unbegrenzt, und so hatte er seine Familie mitgebracht. Inzwischen lebte Petro mit meiner Schwester Maia zusammen, die vier Kinder hatte, und er selbst hatte in Ostia eine noch junge Tochter, mit der er in Kontakt bleiben wollte. Um sie alle unterzubringen, war es ihm gelungen, sich eine Villa zu ergaunern, geliehen von einer sehr wohlhabenden örtlichen Kontaktperson der Vigiles. Wie das vonstattengegangen war, hatte ich noch nicht spitzbekommen. Aber aufgrund dessen stand mir sein ungemütlicher Raum in der Kaserne zur Verfügung. Was war ich doch für ein Glückspilz.
»Dieser miese Schuppen hat seine Nützlichkeit längst überlebt«, grummelte ich. »Er ist zu klein, er ist dunkel, er ist vollgestopft und außerdem angefüllt mit schlechten Erinnerungen all der Gauner, die durchs Tor hereingezerrt und nie wieder gesehen wurden. Die Latrine stinkt. Es gibt kein Kochhaus. Ausrüstungen liegen über den gesamten Exerzierhof verstreut, weil jede Einheit denkt, dass sie, wenn sie nur vier Monate hier ist, alles zum Verrotten rumliegen lassen kann, damit die nächste Gruppe es aufräumt.«
»Ja, und die große Zisterne hat Schimmel angesetzt«, stimmte Petronius hämisch zu.
»Oh, vielen Dank. Erzähl bloß meiner Mutter nicht, dass du mich über einer Senkgrube untergebracht hast.«
»Mach ich nicht«, versicherte er mir, »wenn du mir versprichst, es deiner Frau nicht zu erzählen.« Er hatte Angst vor Helena Justina. Zu Recht. Meine hochwohlgeborene Liebste hatte viel strengere Moralvorstellungen als die meisten Senatorentöchter, und sie wusste ihre Ansichten darzulegen. Petronius gab sich zerknirscht. »Tja, der Raum ist ungemütlich, und es tut mir leid, Marcus. Aber du bleibst ja nicht lange, oder?«
»Natürlich nicht, Lucius, alter Kumpel.«
Das war gelogen. Lucius Petronius hatte mich willkommen geheißen, als hätte ich ihn nur besucht, um mich nach seinem Wohlergehen zu erkundigen. Ich verschwieg ihm meinen eigenen Auftrag in Ostia. Letztes Jahr, als mich Kaiser Vespasian wegen irgendwelcher undurchsichtiger Palastangelegenheiten nach Britannien geschickt hatte, war Petro mir dorthin gefolgt. Nur durch Zufall hatte ich erfahren, dass er die Hauptfigur bei einer ernsthaften Jagd nach einem Großgangster war. Mich wurmte immer noch, dass er mir das verschwiegen hatte. Jetzt zahlte ich es ihm heim.
Er trank von seinem Wein. Dann zuckte er zusammen. Ich nickte. Ein abscheulicher Jahrgang.
Ohne ein Wort erhob sich Petronius. Ich blieb sitzen. Langsam ging er auf den Jungen zu, der immer noch reglos vor dem Tor stand. Sie waren etwa fünf Schritte von mir entfernt.
»Hallo, Kleiner.« Petro klang ganz freundlich. »Was willst du denn hier?«
Der Junge hatte einen dünnen Körper unter einer abgetragenen Tunika. Sie war recht sauber, von schlammiger Farbe, eine Nummer zu groß für ihn, und aus einem Ärmel schaute eine weiße Untertunika hervor. Er sah nicht wie ein gebürtiger Ostianer aus. Seine Nationalität ließ sich nicht bestimmen, aber die Kleiderschichten deuteten auf einen Anwohner des Mare Internum hin; nur Verrückte aus dem Norden entkleiden sich in der Hitze. Er trug keinen Gürtel, jedoch ausgetretene braune Sandalen, deren Riemen sich vor Alter wellten. Sein Haar war zu lang, und er hatte dunkle Ringe unter den Augen. Aber er war gut genährt und körperlich in guter Verfassung. Er wirkte wie ein Junge aus der Handwerkerschicht, musste vielleicht im Familienbetrieb hart arbeiten und durfte in den langen Sommernächten viel zu lange aufbleiben.
Er blickte zu Petronius Longus auf. Was der Junge da sah, war ein großer Mann, der mit freundlichem Gesichtsausdruck ruhig auf eine Antwort wartete, jemand, der sich mit den örtlichen Kindern auf der Straße Bohnensäckchen zuwarf. Der Junge schien ganz pfiffig zu sein, aber eindeutig keine Ahnung zu haben, dass er hier einen Offizier vor sich hatte, dessen brutale Verhörmethoden legendär waren. Alle Vigiles sind hart, doch Petronius konnte unverbesserliche Kriminelle dazu bringen, vernichtendes Belastungsmaterial gegen ihre Lieblingsbrüder hinauszuplärren. Dazu brachte er sie sogar, wenn die Brüder unschuldig waren, obwohl er im Allgemeinen Geständnisse echter Schuld bevorzugte.
»Wie heißt du?«, hörte ich ihn fragen.
»Zeno.« Das Schlimmste, was Zeno argwöhnen würde, war der Annäherungsversuch eines Perversen. Er sah so aus, als wisse er, wie man laut schreit und wegrennt.
»Ich heiße Petronius. Also, was ist los, Zeno?«
Zeno sagte etwas, sehr leise. Dann hielt Petro ihm die Hand hin, und der Junge griff danach. Sie kamen zu mir herüber. Ich ließ bereits Münzen auf den Tisch fallen, um für unseren Wein zu zahlen. Ich hatte die Antwort des Jungen gehört und wusste, was mein Freund tun würde.
»Falco, Zeno sagt, seine Mama will nicht aufwachen.« Petro verbarg seine Vorahnung. »Sollen wir mal hingehen und schauen, was mit ihr passiert ist?«
Aus langer Erfahrung konnten wir uns beide ausrechnen, dass wir es bereits wussten.
Kapitel II
Der Junge führte uns, seine schmuddelige kleine Hand immer noch in der großen von Petronius. Wir gingen den Decumanus Maximus entlang. Ostia war ein langgestrecktes Habitat und hatte daher eine lange und sehr heiße Hauptstraße. Als eine Hauptroute für Handelsgüter war die Straße bereits verstopft von einer endlosen Karrenreihe auf dem Weg aus der Stadt, um bei Sonnenuntergang in Rom anzukommen, wenn die tagsüber geltende Sperre für Räderfahrzeuge endete.
Wir bewegten uns gegen den Verkehr. Er rollte auf den Platz des Sieges und die Porta Romana zu. In unserer Richtung, weit vor uns und noch hinter dem Forum, lagen die Porta Marina und das offene Meer. Straßen zu unserer Linken führten durch Wohngebiete zur Porta Laurentina, dem Ausgang in die herrliche Landschaft, die unserem Ahnherrn Äneas ins Auge gefallen war. Kurze Straßen zur Rechten führten zum Tiber. Der Fluss würde von Booten und Fähren überquellen, alle unterwegs zu den Märkten und dem großen Emporium.
Jenseits des Tibers lag eine weitere Straße nach Rom, auf der sich ebenfalls schwerbeladene Transportfahrzeuge drängten, bestimmt für die Goldene Stadt auf der Trans-Tiberim-Seite.
»Du stammst nicht von hier«, forschte Petronius nach. »Wo bist du dann zu Hause, Zeno?« Zeno war beigebracht worden, sich dämlich oder blöd zu stellen. »Weit weg?« Diesmal brachte das Kind ein Nicken zustande. »Bist du auf einem Schiff hergekommen?« Zu spezifisch – Zeno versank wieder in Unbestimmtheit.
Petro warf mir über Zenos Kopf einen Blick zu und hörte zu fragen auf. Wir würden besser vorankommen, nachdem wir gesehen hatten, ob die nicht ansprechbare Mutter von ihrem Ehemann oder Liebhaber misshandelt worden oder ob sie (weniger wahrscheinlich) nur im Schlaf durch eine natürlichere Krankheit dahingeschieden war.
Wir kamen am Theater vorbei. Gegenüber der Statue des knickrigen Augustus befanden sich diverse alte Monumente und Versammlungsräume der Korporationen. Dahinter erhob sich ein Podium mit einer ordentlichen Reihe kleiner Tempel, vier an der Zahl und alle altmodisch im Stil, direkt vor der Zugangsstraße zu dem massiven, von Claudius erbauten Getreidespeicher. Bis zum Ende dieses Blocks blieben wir auf dem Decumanus Maximus. Dann bog der Junge nach rechts in Richtung des Flusses ab. Er blieb vor einem befestigten Torhaus stehen, aus einer Zeit, als Ostia viel kleiner und viel, viel älter gewesen war. Hierbei musste es sich um die Begrenzungsmauer der ursprünglichen Siedlung handeln. Sie stammte wahrscheinlich aus der Zeit der angeblichen Gründung des Hafens durch Ancus Martius, einem der traditionellen Könige Roms. Damals hatte man noch dauerhaft gebaut und massive Steinquader verwendet. Das behäbige Tor, überflüssig geworden, als sich die Stadt ausweitete, war inzwischen in Läden umgewandelt worden. Darüber gab es einige Räume, die an ausländische Gäste vermietet wurden.
Petronius ließ Zeno bei mir, erkundigte sich in einem der Läden und stieg dann allein die Außentreppe hinauf. Ich setzte mich auf den Randstein neben das Kind, das widerspruchslos bei mir hocken blieb.
»Wer hat dir gesagt, dass du Hilfe bei den Vigiles suchen sollst, Zeno?«, fragte ich leichthin, als wir die Füße vor einem schweren, mit Marmorblöcken beladenen Karren wegzogen.
»Lygon hat gesagt: ›Wenn mal jemand nicht aufwacht, werden die Vigiles das wissen wollen.‹«
Lygon wurde sofort zum Hauptverdächtigen. »Gehört er zur Familie?«
»Mein Onkel.« Das Kind schaute verlegen. Es gibt solche und solche Onkel. Manche Onkel sind keine Verwandten, wie Kinder begreifen.
»Wo ist der denn jetzt?«
»In Geschäften unterwegs.«
»Und was meinst du, wann er wiederkommt?«
Zeno zuckte mit den Schultern. Was mich nicht überraschte.
Petronius streckte den Kopf aus einem Fenster im obersten Stock. »Komm rauf, Falco.« Er klang verärgert, nicht wie ein Mann, der gerade eine häusliche Tragödie vorgefunden hat. »Du kannst den Jungen mitbringen.«
»Klingt, als ginge es deiner Mutter gut, Zeno.« Wir stiegen hinauf.
Im Torhaus befand sich ein Gewirr kleiner Räume, alle kühl gehalten durch die wuchtige Bauweise. Zeno wohnte in einem billigen Mietzimmer, ein einzelner stickiger Raum ohne Annehmlichkeiten. Die Mutter lag bewusstlos auf etwas, das als Bett durchging. Es gab nur das eine. Zeno musste entweder bei ihr oder auf dem Boden schlafen.
Sie war ein dürres Knochengestell, wie wir schon vermutet hatten. Bekleidet war sie mit mehreren Lagen – eine Reisende, die ihre gesamte Garderobe trug, um Diebe abzuwehren. Die Stoffe waren von besserer Qualität, als ich erwartet hatte, wirkten aber an der völlig weggetretenen Frau schmuddelig und zerknittert. Auf dem Rücken ausgestreckt, sah sie verdrießlich und gealtert aus, doch ich schätzte, dass sie viel jünger und mit Zeno schon als Jugendliche schwanger geworden war. Das wäre typisch gewesen. »Onkel« Lygon war vermutlich ihr neuester Liebhaber. Wir konnten uns vorstellen, wie er war – irgendein schnorrendes Schwein, das jetzt den großen Macker in einer Hafenkneipe spielte. Wahrscheinlich nahmen sie beide gern einen zur Brust. Zenos Mutter hatte so viel gepichelt, dass sie aus den Latschen gekippt war. Vermutlich gestern, nahm ich an.
»Besoffen wie ein Hund.« Petronius (der es eher mit Katzen hatte) schloss ihr mit dem Daumen den sabbernden Mund. Durch diese Geste wollte er ihrem kleinen Sohn den Anblick ersparen. Mit einem angeekelten Ausdruck wischte er sich den Daumen in Hüfthöhe an der Tunika ab. Den größten Teil seines Arbeitslebens hatte er auf dieser traurigen Stufe der Gesellschaft verbracht, und er verzweifelte schier daran.
Wäre das Kind älter gewesen, hätte unser Interesse damit geendet. Da sich aber meine Schwester nur um die Ecke in dem geliehenen Haus befand, ließ Petro mich im Torhaus warten, während er Maia holte, um bei der Mutter zu bleiben, bis sie aufwachte. Wir würden uns um Zeno kümmern.
Maia war wütend, dass man ihr diese Aufgabe zumutete – aber sie hatte selber Kinder. Wir nahmen Zeno zu ihrer Brut mit. Petro und ich behaupteten, wir würden beide benötigt, um auf die Gören aufzupassen. Fluchend blieb Maia zurück. Zwei Stunden später wurde die Frau wach. Maia kam mit einem dicken blauen Auge nach Hause, gab Zeno eine Ohrfeige, schickte ihn mit der Anweisung heim, in Zukunft besser auf seine Mutter aufzupassen, und machte uns dann den ganzen Abend ein schlechtes Gewissen.
»Eure Säuferin nennt sich Pullia. Die Familie stammt aus Soli, wo immer das ist. Es gibt einen Mann, von dem niemand viel zu sehen bekommt. Pullia bleibt sich selbst überlassen, während er ausgeht und sich vergnügt. Sie langweilt sich, verlässt aber nie die Wohnung. Das Kind treibt sich auf den Straßen herum. Eine Nachbarin aus dem Kissenladen hat mir das erzählt.«
»Das ist mehr, als ich herausgefunden habe«, beschwichtigte Petro sie bewundernd. »Ich habe nicht mal bemerkt, dass es da einen Kissenladen gibt.«
»Sehvermögen braucht man bei der Bewerbung für die Vigiles nicht? Hör auf mit der Schmeichelei.« Maia und Petro waren ineinander verliebt. Glücklichsein hatte nicht dazu beigetragen, das Hauen und Stechen ihres Schlagabtausches sanfter zu machen. Maia misstraute Männern, die sich einzuschmeicheln versuchten, und Petro würde schnell herausfinden, auf was er sich da eingelassen hatte. Sie waren füreinander bestimmt, doch das bedeutete nicht, dass ihre Beziehung halten würde. Petronius war bisher immer auf Blonde geflogen – abgesehen von seine Ex-Frau. Arria Silvia ähnelte Maia, die dunkelhaarig und gescheit war und ein hitziges Temperament und eine barsche Art besaß, selbst wenn niemand sie beleidigt hatte. Meine Helena meinte, Petro habe Silvia geheiratet, weil Maia zu der Zeit bereits vergeben war und sich geweigert hatte, ihn auch nur eines Blickes zu würdigen. Ich kannte Petro und konnte das nicht glauben, doch auch ich sah die Ähnlichkeit.
»Bezahlt die Säuferfamilie ihre Miete?«, fragte er Maia und tat so, als würde er nur Konversation machen.
»Find’s doch selber raus«, knurrte Maia, während sie ihre geschwollene Wange betastete.
Sie war meine Lieblingsschwester. Ich veranlasste, dass Petronius lindernde Salbe auf das Auge auftrug, sobald Maia sich genügend beruhigt hatte, um ihr nahe zu kommen. Ich selbst hätte das nicht gewagt.
Das nutzlose Gesindel aus Soli war ein typischer Farbklecks in der hektischen Seefahrergemeinschaft von Ostia. Der Ort wurde überflutet von kurzzeitigen Besuchern aus allen Ecken des Imperiums. Alle hatten in irgendeiner Weise mit dem Seehandel zu tun, blieben Wochen oder Monate, warteten auf eine Ladung, warteten auf Bezahlung, warteten auf einen Freund, auf eine Schiffspassage. Manche fanden Arbeit, doch die meisten Stellen waren von Einheimischen besetzt, die sich fest daran klammerten. Nachdem Pullia jetzt eine Begegnung mit der Obrigkeit gehabt hatte, würde sich ihre kleine Gruppe vermutlich aus dem Staub machen.
Ich machte mich auch aus dem Staub und kehrte in die Kaserne zurück. Ich hätte zum Essen bleiben können. Der Geldsack, in dessen Haus Petro untergekommen war, hatte seine Sklaven dagelassen, wie es sich nach den Gastgeberregeln der Reichen gehörte. Sie servierten regelmäßige Mahlzeiten von ausgezeichneter Qualität, für die Petro nichts bezahlen musste. »Das Essen ist da, greift zu, lasst es nicht verkommen!«, drängte der Haushofmeister. Das brauchte er keinem zweimal zu sagen.
Mir war das jedoch nicht vergönnt. Ich hoffte, dass Helena an diesem Abend eintreffen würde. Die Kaserne war kein Ort, an dem sich eine gut erzogene junge Dame allein würde aufhalten wollen.
Kapitel III
Ein Eselskarren stand vor dem Tor – Helena war bereits da. Sie war gerade eingetreten und hielt den Mantel fest um sich geschlungen. Ende Juli war es viel zu heiß für Mäntel, aber ehrbare Frauen haben die Pflicht, sich in der Öffentlichkeit unbehaglich zu fühlen. Die diensthabenden Jungs von der Sechsten Kohorte hätten sie nicht belästigt, doch es hieß sie auch niemand willkommen. Die Vigiles bestehen aus ehemaligen Sklaven, die ihre grauenhafte Arbeit als rasche Möglichkeit sehen, Bürgerrechte zu erwerben. Ihre Vorgesetzten sind Bürger, normalerweise ehemalige Legionäre, die jedoch nur selten anwesend sind.
Helena sah sich in dem rechteckigen Innenhof mit den vielen im Schatten liegenden Eingängen um. Sie führten zu den Lagerräumen für die Gerätschaften, den nackten Zellen, in denen die Männer schliefen, und den Verhörräumen, wo geschickt Druck auf Zeugen ausgeübt wurde. Als schroffe Stimmen laut herausschallten, zuckte sie zusammen. Helena Justina war ein hochgewachsenes, beherztes Mädchen, das jeden Ärger durch Angabe ihrer Stellung als Senatorentochter abwehren konnte, doch sie zog es vor, Ärger von vornherein zu vermeiden. Ich hatte ihr ein paar Taktiken beigebracht. Sie verbarg ihre Nervosität, war aber froh, mich zu sehen.
»Zum Glück schreien im Moment keine Verdächtigen vor Schmerzen«, neckte ich sie und spielte damit auf die Atmosphäre an, die über dem Hof hing, vor allem in der Dämmerung. Wir gingen in den Raum, den ich benutzt hatte, vorgeblich, um meine Sachen zu holen, in Wirklichkeit jedoch, um die Dame meines Herzens in Ruhe begrüßen zu können. Ich hatte sie seit einer Woche nicht gesehen. Da jeder, den ich kannte, schwor, sie würde mich eines Tages verlassen, musste ich meinen Gefühlen deutlich Ausdruck geben. Außerdem ließ ich mich gerne erregen, wenn Helena ihre Zuneigung zu mir zeigte.
Selbst wir fühlten uns unbehaglich, dort zu turteln. Ich versprach ihr größere Entspannung in der Wohnung, die ich für uns gefunden hatte.
»Wohnen wir nicht bei Lucius und Maia?« Helena hatte die beiden gern.
»Wohl kaum. Petro hat sich von so einem verdammten Baulöwen eine schicke Villa geborgt.«
»Was spricht dagegen?« Helena lächelte. Sie kannte mich.
»Ich hasse Almosen.« Sie nickte. Ich wusste, auch sie zog für unsere Familie ein ruhiges Leben vor, ohne Verpflichtungen gegenüber einem Patron. In Rom läuft das meiste über Gefälligkeiten, doch wir beide hatten unseren Weg stets alleine gemacht. »Aber wir können bei ihnen kostenlos essen.« Selbst mein Edelmut hat Grenzen.
In der pompösen Villa saßen Petro und Maia bereits beim Essen in einem der mit Fresken verzierten Speisezimmer ihres Gastgebers. Er hatte mehrere. Dieses wurde luftig gehalten durch Falttüren, momentan geöffnet zu einem kleinen Garten, in dem eine türkis geflieste Nische die Statue eines Meergottes beherbergte. Auf seiner Nautilusmuschel hing ein Kinderhut. Kleine Sandalen, Tiere aus Ton und ein selbstgebastelter Streitwagen lagen im Garten verstreut.
Auf den großen, mit Kissen bedeckten Liegen wurde rasch für uns Platz gemacht. Maia warf uns einen berechnenden Blick zu, nachdem sie die Kinder umgesetzt hatte – Marius, Cloelia, Ancus und die kleine Rhea, im Alter zwischen zwölf und sechs, alle vier blitzsauber geschrubbt, und Petros stille Tochter Petronilla, die etwa zehn sein musste.
»Bleibt ihr hier oder was?«, wollte meine Schwester wissen. Sie und ich stammten aus einer großen, lauten, streitsüchtigen Familie, deren Mitglieder sich alle Mühe gaben, einander aus dem Weg zu gehen.
»Nein, wir haben eine Ferienwohnung gemietet, gleich auf der anderen Seite des Decumanus«, beruhigte ich sie.
Maia wollte nicht, dass wir noch mehr Durcheinander in ihren bereits hektischen Haushalt brachten, schnaubte aber trotzdem beleidigt. »Macht doch, was ihr wollt.«
Petronius hatte Helenas Gepäckkarren untergestellt und kam zu uns zurück. »Sieht ja aus, als wolltet ihr für den Rest der Saison hierbleiben, bei all dem Gepäck, das du mitgebracht hast«, sagte er zu ihr.
»Ach, das ist nur Urlaubslektüre.« Helena lächelte ruhig.
»Ich war ziemlich in Verzug mit dem Tagesanzeiger, und deshalb hat mir mein Vater seine alten Abschriften geliehen.«
»Drei Säcke mit Schriftrollen?«, fragte Petro sie ungläubig. Er hatte eindeutig und ohne Scham in Helenas Gepäck herumgeschnüffelt. Jeder wusste, dass das seltsame Mädchen, das ich mir geangelt hatte, lieber seine Nase in Literatur steckte, statt sich mit den zwei kleinen Töchtern zu beschäftigen oder auf den Markt an der Ecke zu gehen, um eine Meeräsche zu kaufen und ein wenig zu tratschen, wie jede normale Ehefrau vom Aventin. Helena Justina würde mich eher vernachlässigen, weil sie in ein neues griechisches Theaterstück vertieft war, und nicht wegen einer Tändelei mit einem anderen Mann. Sie kümmerte sich auf ihre eigene Weise um unsere Töchter. Julia wurde mit ihren drei Jahren bereits das Alphabet beigebracht. Zum Glück mochte ich exzentrische Frauen und fürchtete mich nicht vor frühreifen Kindern. Wenigstens hatte ich das bisher geglaubt.
Helena richtete den Blick auf mich. »Momentan sind die Nachrichten ziemlich öde. Die kaiserliche Familie hat sich für den Sommer auf ihre Landsitze begeben – und selbst Infamia macht Urlaub.«
Infamia war das Pseudonym desjenigen, der die schlüpfrigen Skandale über Senatorenfrauen und deren Affären mit Wagenlenkern zusammenstellte. Zufällig wusste ich, dass Infamia durchtrieben und unzuverlässig war, und wenn er tatsächlich Urlaub machte, hatte er vergessen, die Termine mit seinen Arbeitgebern abzusprechen.
»Wenn’s keine Skandale gibt«, verkündete Maia kategorisch, »dann lohnt es sich überhaupt nicht, den Tagesanzeiger zu lesen.«
Helena lächelte. Sie hasste es, wenn ich ihr etwas verheimlichte, und wollte mich zwingen, damit rauszurücken. »Infamia muss irgendwo eine tolle Villa haben. Denk doch nur an all die Schmiergelder von den Leuten, die nicht wollen, dass ihre Geheimnisse veröffentlicht werden. Was meinst du, Marcus?«
»Ist uns etwas entgangen?« Maia hasste es, außen vor gelassen zu werden. Sie klang gereizt. Was nichts Neues war.
»Falco, du Ratte. Führst du hier etwa eine deiner verrückten Ermittlungen durch?«, knurrte Petronius, der ebenfalls etwas witterte.
»Lucius, mein liebster und ältester Freund, wenn ich einen Auftrag erhalte, verrückt oder nicht, werde ich dir sofort Bericht erstatten ...«
»Du hast einen Auftrag!«
»Das habe ich gerade abgestritten, Petro.«
Petro wandte sich an Maia. »Dein zugeknöpfter Mistkerl von Bruder verbirgt einen Auftrag unter seiner haarigen Achsel.« Er blickte mich finster an, dann richtete er seine Aufmerksamkeit darauf, sich eine mit Ingwer zubereitete Fischterrine zu schnappen, auf die sich die Kinder wie hungrige Möwen gestürzt hatten. Er musste ihr erbostes Kreischen über sich ergehen lassen, während sie zuschauten, wie er sich die besten Happen in seine Essschale löffelte.
»Was für ein Auftrag?«, fragte Maia grob.
»Geheim. Eine Klausel in meinem Vertrag besagt: ›Erzähl es nicht deiner neugierigen Schwester oder ihrem aufdringlichen Freund.‹« Ich befreite Petro von seiner Trophäe und kredenzte Helena und mir die letzten Garnelen.
Maia schnappte sich eine aus meiner Schale. »Werd endlich erwachsen, Marcus!«
Ach, das Familienleben. Ich fragte mich, ob der Mann, den ich hier suchte, nahe Verwandte besaß. Wenn man nach Motiven sucht, sollte man nie das Naheliegende missachten.
Kapitel IV
Helena und ich hatten diesen einen Abend für uns. Wir nützten ihn weidlich aus. Morgen würde Albia eintreffen, ein junges Mädchen aus Britannien, das sich um unsere Kinder kümmerte, während wir versuchten uns um Albia zu kümmern. Sie hatte es im Leben nicht einfach gehabt. Hinter Julia und Favonia herzulaufen lenkte sie davon ab – theoretisch. Sie hatte Erfahrung mit Familienreisen aus der Zeit, als wir sie von Londinium nach Italien gebracht hatten, aber ein Kleinkind und eine Dreijährige auf einer zweistündigen Karrenfahrt unter Kontrolle zu halten würde eine Herausforderung sein.
»Sind wir sicher, dass Albia alleine hierherfindet?« Ich ließ es skeptisch, aber nicht zu kritisch klingen.
»Beruhige dich, Falco. Mein Bruder bringt sie her.«
»Quintus?«
»Nein, Aulus. Quintus bleibt bei Claudia und dem Kleinen.« Gaius Camillus Rufius Constantinus, unser zwei Monate alter Neffe, stand seit neuestem im Mittelpunkt. Die Welt und alle Planeten drehten sich um ihn. Das war wohl der Grund, warum Helenas anderer Bruder so erpicht darauf war, dem Heim der Familie zu entfliehen. »Aulus kommt auf dem Weg zur Universität hier vorbei. Er hat Interesse an der Jurisprudenz gezeigt. Papa hat die Gelegenheit ergriffen, und Aulus wird nach Athen geschickt.«
»Griechenland! Und studieren? Sprechen wir von Aelianus?« Aulus Camillus Aelianus war der unverheiratete Sohn eines Senators, mit Geld in der Tasche und einer sorgenfreien Zukunftsperspektive. Ich konnte ihn mir nicht vorstellen, wie er unter einem Feigenbaum an einer antiken Universität an Juravorlesungen teilnahm. Zudem war sein Griechisch grausig. »Kann er nicht in Rom Advokat werden?« Das wäre viel nützlicher für mich. Expertenwissen, für das ich nichts bezahlen musste, war immer willkommen.
»Athen ist der beste Ort.« Nun ja, es war traditionell der Ort, an den man lästige Römer schickte, die sich nicht recht anpassen wollten.
Ich kicherte. »Sind wir uns sicher, dass er tatsächlich abreist? Müssen du und ich nachprüfen, ob er an Bord geht?« Mit nicht ganz dreißig Jahren bestand der bevorzugte Zeitvertreib des edlen Aulus Camillus Aelianus aus Jagen, Trinken und Leibesübungen – alle bis zum Exzess ausgeführt. Es musste auch noch andere, gleichermaßen tatkräftige und anrüchige Gewohnheiten geben, die ich lieber nicht zu entdecken versuchte. Auf diese Weise konnte ich seinen Eltern versichern, dass ich von keinen üblen Geheimnissen wusste.
»Das ist ein schwerer Schock für meine Eltern«, wies Helena mich zurecht. »Eines ihrer Kinder kann endlich bei honorigen Festmahlen erwähnt werden.«
Ich verkniff mir weitere Witze. Ihre Tochter hatte das elterliche Heim verlassen, um mit einem Taugenichts zusammenzuleben – mit mir. Jetzt, da Helena und ich selber Töchter hatten, verstand ich, was das bedeutete.
Als Eltern hatten wir bessere Dinge zu tun, als über Aulus zu reden. Endlich einmal befreit von der Bedrohung kleiner Besucher im Schlafzimmer, probierten wir unsere Wohnung mit Leidenschaft aus. Ich hatte eine der identisch gestalteten Ferienwohnungen in einem kleinen, um einen Innenhof mit Brunnen gebauten Häuserblock gemietet. Zur Straße hinaus gab es Balkone, nur zur Schau; die Mieter konnten sie nicht betreten. Rund um uns herum waren andere Familien untergebracht. Wir hörten ihre Stimmen und das Scharren von Möbeln, aber da wir sie nicht kannten, musste es uns nicht kümmern, ob die Leute uns belauschten.
Es gelang uns, nicht mit dem Bett zusammenzubrechen. Ich hasse es, im Nachteil zu sein, wenn der Vermieter Inventar und Zubehör überprüft, bevor er einen abreisen lässt.
Nach einem kurzen, tiefen Schlaf wachte ich mit einem Ruck auf. Helena lag mit dem Gesicht nach unten träumend neben mir, eng an mich geschmiegt. Mein rechter Arm war über ihren langen nackten Rücken gestreckt, die Finger leicht gespreizt. Falls es ein Kissen gegeben hatte, war es verschwunden. Mein Kopf war nach hinten gebeugt, mein Kinn ragte nach oben. Wie immer zu Beginn einer Ermittlung war mein Hirn mit emsigen Gedanken angefüllt.
Ich hatte den Auftrag erhalten, den abwesenden Scriptor des Tagesanzeigers zu finden. Es war dämlich gewesen, die Sache anzunehmen, doch das gilt für fast all meine Aufträge. Der einzige Vorteil bei diesem war, dass es keine Leichen gab – redete ich mir zumindest ein.
Während ich still dalag, dachte ich daran, wie alles begonnen hatte. Die Anfrage hatte mich in Rom zuerst indirekt durch die kaiserlichen Sekretariate erreicht. Dort gab es einen hohen Palastbeamten namens Claudius Laeta, der mir manchmal Arbeit verschaffte, die aber immer schiefging. Daher war ich froh, dass Laetas Name in diesem Zusammenhang nicht fiel. Nun ja, wenigstens nicht offen. Allerdings konnte man sich bei diesem aalglatten Schweinehund nie sicher sein.
Vor zwei Wochen hatte jemand vom Palatin den Schreiberlingen vom Tagesanzeiger meine Ermittlerfähigkeiten empfohlen. Ein verängstigter kleiner Staatssklave wurde geschickt, um bei mir auf den Busch zu klopfen. Er erzählte mir nicht viel, weil er nichts wusste. Ich war fasziniert. Wenn es ein bedeutungsvolles Problem war, hätte Claudius Laeta als oberster Korrespondenzsekretär davon unterrichtet werden müssen – der Tagesanzeiger war das offizielle Sprachrohr der Regierung.
Ja, als der Sklave in meinem Büro erschien und so geheimnisvoll tat, kam mir die köstliche Idee, dass die Scriptoren des Anzeigers versuchen könnten, Laeta eins reinzuwürgen.
Nur eines hätte mich noch glücklicher gemacht, als etwas hinter Laetas Rücken zu tun – Anacrites, dem Oberspion, eins über die Rübe zu geben. Diese glorreiche Hoffnung schien eine Möglichkeit zu sein. Wenn beim Tagesanzeiger etwas faul war, dann hätte Anacrites genau wie Laeta davon erfahren müssen. Seine Rolle bestand darin, den Kaiser zu beschützen, und der Anzeiger war heutzutage dazu bestimmt, den Namen des Kaisers erstrahlen zu lassen.
Anacrites weilte in seiner Villa an der Bucht von Neapolis. Das hatte er meiner Mutter erzählt, deren Untermieter er zeitweise gewesen war, und sie hatte es an mich weitergetratscht, damit ich neidisch auf seinen Wohlstand würde. Scheiß auf seinen Wohlstand. Anacrites machte mich allein schon dadurch wütend, dass er mit Mama sprach, und das wusste er. Doch anscheinend wusste er nicht, dass die Scriptoren, die den Anzeiger herausbrachten, um die Hilfe eines Experten baten. Er war nicht da, also waren sie zu mir gekommen. Das gefiel mir.
Zunächst wurde mir von dem Boten nur mitgeteilt, es gebe ein Problem mit einem Angestellten. Trotzdem packte mich die Neugier. Ich teilte dem kleinen Sklaven mit, dass ich gerne helfen und am selben Nachmittag beim Anzeiger vorbeikommen würde.
In Rom hatte ich ein Büro in meinem eigenen Haus am Tiberufer, direkt unter dem steilen Hang des Aventins. Zu dieser Zeit meiner Privatermittlertätigkeit besaß ich nominell zwei jüngere Assistenten, Helenas Brüder Aulus und Quintus. Beide waren anderweitig beschäftigt, und deswegen übernahm ich die Ermittlung für den Anzeiger allein. Ich ging die Sache ganz entspannt an, da sie alle Anzeichen einer netten kleinen Eskapade aufwies, die ich mit verbundenen Augen erledigen konnte.
An jenem schönen Tag vor zwei Wochen hatte ich daher nach meinem üblichen Mittagsmahl mit Helena einen angenehmen Spaziergang zum Forum unternommen. Dort erledigte ich vorbereitende Hausaufgaben. Die meisten Aufträge wurden mir ohne Vorwarnung erteilt. Diesmal war es gut, nicht wie gewöhnlich spontan entscheiden zu müssen, ob ich die Arbeit annehmen wollte.
Bei der Säule, an der die Nachrichten täglich ausgehängt wurden, brabbelte eine Handvoll Müßiggänger vollkommenen Blödsinn über Wagenrennen. Diese Nichtsnutze konnten sich nicht entscheiden, in welche Richtung die vier Pferde rannten, ganz zu schweigen davon, sich die Gewinnchancen für die Blauen und ihren Wiedereinstieg mit dem schnöseligen Wagenlenker auszurechnen, den sie unklugerweise eingekauft hatten, zusammen mit ihrem neuen Quartett X-beiniger Grauschimmel. Vor der Säule war ein einsamer Sklave mit dem Abschreiben der Schlagzeilen beschäftigt, in großen Buchstaben, um seine Tafel zu füllen und gut dazustehen. Sein Herr war vermutlich der übergewichtige Faulpelz in der Sänfte, der das Zeug sowieso nicht lesen würde. Wenn ich »lesen« sage, meine ich damit, dass es ihm vorgelesen wurde.
Es war schon spät am Tag, sich an der Säule zu informieren. Leute, die sich auf dem Laufenden halten mussten, hätten die Nachrichten schon vor Stunden bekommen. Politische Opportunisten, die ihre Rivalen ausmanövrieren wollten, bevor diese aus dem Bett gestiegen waren und ihre Netze gesponnen hatten. Ehebrecher, die sich ein gutes Alibi zurechtlegen mussten, bevor ihre Gemahlinnen wach waren. Selbst unschuldige Hausväter hielten gern Schritt mit den Edikten – Helena Justinas Vater schickte immer rechtzeitig seinen Sekretär, damit er sich während des Frühstücks in seine Abschrift vertiefen konnte. Was, da war ich mir sicher, nichts damit zu tun hatte, dass Decimus Camillus einer Unterhaltung mit seiner edlen Ehefrau ausweichen wollte, während er mit verquollenen Augen seine hübschen weißen Morgenbrötchen mümmelte.
Ich überprüfte die heutigen Familiennachrichten. Das meiste ließ mich gähnen. Wer interessiert sich schon für die Anzahl der Geburten und Todesfälle, die am vorherigen Tag der Stadt gemeldet worden waren, oder die beim Schatzamt eingezahlten Steuerschulden und die Statistiken über den Getreidevorrat? Die Wahllisten haben einen üblen Geruch. Gelegentlich fand ich interessante Brocken bei den Magistratsedikten, den Testamenten berühmter Leute und den Gerichtsberichten – allerdings nicht oft. Die Acta Diura war instituiert worden, um die Tätigkeiten des Senats aufzulisten – ermüdende Dekrete und kriecherische Akklamationen, die ich automatisch übersprang. Manchmal zog ich das Hof-Zirkular zu Rate, wenn ich mit dem Kaiser sprechen musste und keine Zeit damit verschwenden wollte, auf dem Palatin rumzuhängen, nur um zu erfahren, dass er für ein Fest in die Villa seines Großmütterchens gereist war.
Jetzt kam ich allmählich zum Ende, dem beliebtesten Teil. Hier fand man: Wunderkinder und Staunenswertes (die üblichen Blitzeinschläge und dreiköpfigen Kälber), Ankündigungen über die Errichtung neuer öffentlicher Gebäude (hm), Feuersbrünste (jeder liebt einen ordentlichen Brand in einem Tempel), Beerdigungen (für alte Frauen), Opferungen (dito), das Programm sämtlicher öffentlichen Spiele (für alle; der am meisten gelesene Teil) und Privatanzeigen von Wichtigtuern, die aller Welt mitteilen wollten, dass ihre Tochter sich mit einem Tribun verlobt hatte (langweilig! Na ja, langweilig, außer man hatte mit ebendieser Tochter getändelt – oder mit dem Tribun). Endlich kam ich zum besten Teil, den die Scriptoren diskret als »amouröse Abenteuer« bezeichneten. Skandale – mit den Namen der Beteiligten vollmundig enthüllt, denn wir sind eine offene Stadt. Betrogene Ehemänner müssen erfahren, was da vorgeht, damit sie nicht der stillschweigenden Duldung bezichtigt werden, was gesetzlich als Zuhälterei gilt. Und wir anderen haben auch gern ein wenig Spaß.
Ich war enttäuscht. Wo die Klatschspalte hätte sein sollen, stand nur, dass Infamia, der Kolumnist, im Urlaub sei. Er war oft »im Urlaub«. Alle machten sich darüber lustig. Sagen wir es ungeschminkt: Man ging davon aus, dass die Senatorenfrauen, hinter deren Affären er gekommen war, ihm einen freien Ritt erlaubten, damit er die Schnauze hielt, aber die Senatoren, die davon erfuhren, heuerten Schläger an, um Infamia aufzuspüren – und gelegentlich erwischten sie ihn auch. »Im Urlaub« bedeutete, unser Lästermaul leckte mal wieder seine Wunden.
Ohne saftige Geschichten, die mein Weitergehen hätten verzögern können, wurde ich bald von den recht mürrischen Scriptoren des Nachrichtendienstes befragt. Dachten sie zumindest. Ich hatte mehr Erfahrung. In Wirklichkeit befragte ich sie. Sie waren zu zweit – Holconius und Mutatus. Sie wirkten wie um die fünfzig, ausgelaugt vom jahrelangen Beklagen des modernen Lebens. Holconius, älter und anscheinend der Vorgesetzte, war ein düsterer, dünngesichtiger Stilusschubser, der zum letzten Mal gelächelt hatte, als die Geschichte über Kaiserin Messalina hereinkam, die ihre Dienste in einem Bordell feilbot. Mutatus blickte noch grimmiger. Ich wette, der hat nicht mal gekichert, als der Vergöttlichte Claudius sein Edikt verkündigte, Furzen sei bei Festmahlen legal.
»Erzählen Sie mir von Ihrem Problem«, fasste ich nach und zog eine Schreibtafel heraus. Das machte sie nervös, und so legte ich die gewachsten Seiten auf mein Knie und ließ den Stilus ruhen. Sie berichteten mir, sie hätten den »Kontakt verloren« mit jemandem aus ihren Reihen, dessen Name, wie sie sagten, Diocles sei. Ich nickte und versuchte mir den Anschein zu geben, davon gehört und solche Mysterien natürlich schon zuvor aufgeklärt zu haben. »Seit wann wird er vermisst?«
»Vermisst wird er eigentlich nicht«, wendete Holconius ein. Ich hätte schnauben können: Warum habt ihr mich dann herbestellt? Aber jene, die für den Kaiser arbeiten, imperialen Glanz auf alles schmieren – alles verdrehen, damit es gut aussieht –, haben eine besondere Art im Umgang mit Worten. Holconius musste alles, was er schrieb, zur Freigabe an den Palatin schicken, selbst wenn es eine einfache Liste der Markttage war. Dann wurde jeder himmlische Satz von irgendeinem Idioten so lange umgemodelt, bis jede Wirkung dahin war. Also ließ ich ihn pedantisch sein – diesmal. »Wir wissen, wohin er gereist ist«, murmelte er.
»Und das wäre?«
»Zu einer Verwandten in Ostia. Einer Tante, sagte er.«
»Das hat er Ihnen erzählt?« Ich nahm an, »Tante« sei ein neuer Ausdruck für tolles Weib, aber Schlimmeres nicht. »Und er ist nicht zurückgekommen?« Also war das tolle Weib wohl zum Anbeißen. »Ist das ungewöhnlich?«
»Er ist ein bisschen unzuverlässig.«
Da keine weiteren Einzelheiten geliefert wurden, schmückte ich es selber aus. »Er ist faul, er säuft, ist nutzlos, vergisst, wo er sein sollte, und enttäuscht die Leute dauernd ...«
»Ach, Sie kennen ihn?«, unterbrach Mutatus erstaunt.
»Nein.« Ich kannte viele wie ihn. Vor allem Scriptoren.
»Meine Aufgabe wäre also, nach Ostia zu reisen, den munteren Diocles zu finden, ihn nüchtern zu machen, falls er mich lässt, und ihn dann hierher zurückzubringen?« Die beiden Scriptoren nickten. Sie wirkten erleichtert. Ich hatte auf meine Notiztafel geschaut, jetzt blickte ich auf. »Ist er in Schwierigkeiten?«
»Nein.« Holconius ließ sich nicht aus der Ruhe bringen.
»In irgendwelchen Schwierigkeiten?«, fragte ich noch mal.
»Bei der Arbeit, bei etwas, das mit der Arbeit zu tun hat, Frauenprobleme, Geldprobleme, Gesundheitsprobleme?«
»Nicht, dass wir wüssten.«
Ich erwog die Möglichkeiten. »Arbeitete er an einer bestimmten Geschichte?«
»Nein, Falco.« Ich schätzte, dass mir Holconius einen Bären aufband. Kein Wunder, sein Resort war Politik. Holconius war, wie ich wusste, »Noten-Scriptor« im Senat, notierte also in tironischer Kurzschrift all die Unwahrheiten, die dort verbreitet wurden. Mutatus listete nur die monatlichen Programme für die Spiele auf. Er konnte mühelos die dämlichsten Ungenauigkeiten produzieren, war aber schwächer bei direkten Lügen.
»Und für welches Resort des Anzeigers liefert Diocles normalerweise seine Beiträge?«
»Spielt das eine Rolle?«, fragte Mutatus rasch.
Daraus schloss ich, dass es bedeutungsvoll war, sagte aber liebenswürdig: »Wahrscheinlich nicht.«
»Wir wollen wirklich helfen.« Widerstreben erfüllte seine Stimme.
»Ich wäre gerne umfassend informiert.« Unschuldiger Charme erfüllte die meine.
»Diocles schreibt über die unbeschwerteren Themen«, erklärte Holconius. Er wirkte noch düsterer als zuvor. Als der Berichterstatter für Edikte missbilligte er alles Unbeschwerte.
Ich merkte, dass Holconius und Mutatus vor meiner Ankunft ein ausführliches Gespräch darüber geführt hatten, wie viel sie mir verraten wollten. Daraus zog ich meine Schlüsse. »Ihr Verschwundener verfasst also die Schock-und-Horror-Gesellschaftsnachrichten?«
Die beiden Scriptoren blickten resigniert. »›Infamia‹ ist das Pseudonym von Diocles«, gestand Holconius.
Schon bevor sie das zugaben, wollte ich den Auftrag haben.
Kapitel V
Die erste Woche meiner Ermittlungen in Ostia hatte ich langsam angehen lassen. Am Morgen nach Helenas Ankunft berichtete ich ihr von meinen mangelnden Fortschritten.
»Wenn Diocles’ Vermieterin seine echte Tante ist, dann bin ich das Hinterbein eines syrischen Kamels.«
Helena und ich saßen auf einem Ballen in der Nähe einer Fähre, die Arbeiter zwischen der Stadt und dem neuen Hafen hin und her beförderte, und aßen frisches Brot und Feigen. Wir waren recht früh aufgestanden. Es war unterhaltsam, den Strom der Schauerleute, Negotiatoren, Zollbeamten und Langfinger zu beobachten, die zu ihrer Morgenarbeit im Hafen fuhren. Schließlich kam eine ganze Gruppe frisch gelandeter Kaufleute mit der Fähre herüber, zusammen mit anderen Ausländern in unterschiedlichsten Farbschattierungen, alle mit verwirrtem Blick. Die Kaufleute, die sich besser auskannten, stürmten sofort zu den Miet-Mulis. Nachdem die anderen Reisenden festgestellt hatten, dass für sie keine Transportmöglichkeiten mehr zur Verfügung standen, irrten sie ziellos umher. Einige wollten von uns den Weg nach Rom wissen, wovon wir vorgaben, nie gehört zu haben. Wenn sie beharrlich blieben, wiesen wir sie auf die Straße hin, die sie nehmen mussten, und versicherten ihnen, dass man den Weg gut zu Fuß zurücklegen konnte.
»Du bist kindisch, Marcus.«
»Ich bin auch schon von grässlichen Einheimischen in fremden Ländern auf fünfzehn Meilen lange Wanderungen geschickt worden.« Selbst Straßenfeger in Rom hatten mich absichtlich in die Irre geführt. »Du hast als Erste dran gedacht.«
»Hoffentlich sehen wir sie nie wieder.«
»Mach dir keine Sorgen. Ich werde dann behaupten, du seist eine Senatorentochter, die in Unwissenheit und Luxus groß geworden ist und keine Ahnung von Entfernungen, Richtungen oder Zeit hat.«
»Und ich werde sagen, dass du ein Schwein bist.«
»Oink.«
Zu unserer Ferienwohnung gehörte weder Frühstück noch ein Sklave, um es zu servieren. Sie verfügte über einen Eimer für den Brunnen und zwei leere Öllampen, aber nicht mal über eine einzige Essschale. Einer der Gründe, warum wir unterwegs waren, bestand darin, die Zutaten für Picknicks zu besorgen, bevor Albia und die Kinder eintrafen. Meine kleinen Töchter konnte man vielleicht mit einem »Lasst uns aus Spaß in diesem Urlaub mal alle hungrig bleiben« abspeisen, aber Albia war eine ausgehungerte Jugendliche, die unleidlich wurde, wenn sie nicht alle drei Stunden etwas zu essen bekam.
Wenigstens befanden wir uns am Hauptumschlagplatz für die Handelsgüter des Imperiums. Das erleichterte den Einkauf. Importierte Waren lagen überall aufgehäuft, und hilfreiche Negotiatoren waren nur zu bereit, Dinge aus den Ballen zu ziehen und sie billig zu verkaufen. Einige hatten tatsächlich mit den Ladungen zu tun; ein, zwei würden vielleicht sogar das Eingenommene an den Besitzer weiterreichen. Ich hatte bereits vor einer Stunde zwei Weinbecher erstanden und hielt meinen Anteil am Einkauf für erledigt. Amphoren zu bestellen war nicht nötig, ich hatte schon für Vorräte gesorgt. Helena wies mich darauf hin, dass ich innerhalb einer einzigen allein verbrachten Woche in die Gewohnheiten des klassischen Privatschnüfflers zurückgefallen war. Ich hielt einen Raum jetzt für vollkommen ausgestattet, wenn er ein Bett und etwas zu trinken enthielt, mit einer Frau als Extrazugabe. Essen war etwas, das man sich an einer Straßen-Caupona holte, während man auf Beobachtungsposten war.
Bisher hatte ich niemanden zu beobachten. Mein Fall steckte fest.
»Du hast aber doch herausgefunden, wo Diocles wohnte, oder?«, fragte Helena, nachdem sie ihr Brot fertiggekaut hatte.
Ich fischte mir Oliven aus einer Tüte, die aus altem Schriftrollenpapyrus gedreht war. »Ein Mietzimmer in der Nähe der Porta Marina.«
»Also war der ›Besuch der Tante‹ eine Erfindung. Er ist nicht bei seiner Familie?«
»Nein. Geschäftsmäßige Vermieterin der abschreckenden Art.«
»Und wie hast du sie gefunden?«
»Die Scriptoren wussten den Straßennamen. Dann habe ich an Türen geklopft. Die Vermieterin tauchte prompt aus ihrem Schlupfloch auf, weil Diocles ihr Miete schuldig war und sie sie haben wollte. Ihre Geschichte stimmt mit dem überein, was die Scriptoren mir bereits erzählt hatten – Diocles kam hier vor zwei Monaten an, schien den Sommer über bleiben zu wollen, verschwand aber ohne Vorwarnung nach etwa vier Wochen und ließ all sein Zeug zurück. Das kam ans Licht, weil der Anzeiger vereinbart hatte, einmal pro Woche einen Boten zu schicken, der das Manuskript abholen sollte. Der Bote konnte Diocles nicht finden.«
Helena gluckste fröhlich. »Ein wöchentlicher Bote? Also gibt es jede Menge Skandale in Ostia?«
»Ich würde sagen, Diocles sitzt kichernd am Meer und denkt sich das Zeug aus. Die Hälfte der Leute, die er verleumdet, ist ebenfalls in Urlaub und wird nie davon erfahren, zum Glück für ihn.«
Helena leckte sich die Finger ab. »Du hast die geschuldete Miete gezahlt und sein Gepäck mitgenommen?«
»Im Leben nicht! Ich zahle doch nicht die Miete für irgendeinen Faulenzer, schon gar nicht für ein Zimmer, das er nicht bewohnt hat.«
»Die Frau hat das Zimmer nicht weitervermietet?«
»Natürlich hat sie das. Ich hab die Zahlung verweigert und den Anzeiger benachrichtigt.«
»Wegen des Geldes? Sie sollte nicht doppelt bezahlt werden.« Ich erklärte Helena, dass Vermieterinnen in Hafenstädten ihre Zimmer traditionell doppelt belegen, nach einem Edikt, das auf die Zeit zurückgeht, als Äneas hier landete und für einen haarsträubenden Preis in dem unbenutzten Zimmer eines Fischers untergebracht wurde. Helena blickte immer noch missbilligend, aber jetzt missbilligte sie mich. »Hör doch auf mit dem Quatsch. Ich versuche ein Interesse an deiner Arbeit zu zeigen, Marcus.«
Ich schaute sie an. Ich liebte sie sehr. Ich zog sie näher, hielt inne, wischte ihr sorgfältig Olivenöl von den Lippen und küsste sie zärtlich. »Ich habe um ein sehr strenges Schriftstück ersucht, in dem steht, dass ich berechtigt bin, Diocles’ Besitztümer an mich zu nehmen, da sie Eigentum des Staates sind.«
»Die Vermieterin wird sie bereits durchsucht haben und wissen, dass sie nur aus dreckigen Untertuniken bestehen«, wendete Helena ein. Sie lag noch an meine Brust gedrückt. Vorbeigehende Schauerleute pfiffen.
»Dann wird sie beeindruckt sein, dass der Staat ein solches Interesse an der Unterwäsche dieses Mannes hat.«
»Du glaubst, es könnte etwas Brauchbareres bei seinem Gepäck sein?«
»Ich bin unter rauhen Bedingungen groß geworden«, sagte ich, »und ich gestehe einige Fetische ein, aber ich bin noch nicht so tief gesunken, dass ich an alten Flecken in den Tuniken anderer Leute schnüffle.«
»Du willst Notiztafeln.« Helena Justina schmiegte sich an meine Schulter, schwieg eine Weile und beobachtete die Fähre. »Seitenweise hilfreich gekritzelter Hinweise.« Schließlich, weil sie wusste, dass ich darauf wartete, murmelte sie mit höflicher Neugier: »Mein Liebling, welche Fetische?«
Kapitel VI
Das Eintreffen unserer Kinder nahm den Rest des Morgens in Anspruch. Aulus und ich plauderten scherzhaft über seine geplante Reise nach Athen, während Helena und Albia ein ernstes Gespräch darüber führten, warum die Hündin so kränklich wirkte. Die Mädchen tapsten und krochen allein herum und hielten Ausschau nach Sachen, die sich in ihrem neuen Heim zerstören ließen. Die Hündin Nux rannte eine Weile mit ihnen herum, wurde dann der Aufregung müde und versteckte sich unter einem Bett.
Es gab eine Menge auszupacken. Alle bemühten sich, nicht der Trottel zu sein, der es schließlich tun musste. Demjenigen, der bei der Ankunft das Gepäck auspackt, wird immer die Schuld für alles zugeschoben, was andere vergessen haben.
Ja, natürlich ist das ungerecht. Das Leben ist ungerecht. Nach zehn Jahren als Privatermittler war das die einzige philosophische Gewissheit, an die ich mich nach wie vor hielt.
Was Aulus betraf, zwei Stunden in einem heißen Karren mit einem störrischen Maultier und der Aufgabe, mein Gefolge zu beaufsichtigen, hatten ihn vollkommen erledigt.
Als durchtrainierter und kompakter Bursche hätte er über endlose Energie verfügen sollen, doch er legte bald die Beine auf ein Fensterbrett und schlief ein. Bevor er wegdämmerte, reichte er mir noch das Schriftstück von den Scriptoren, das mir die Befugnis gab, Diocles’ Besitztümer an mich zu nehmen. Aulus lehnte es ab, Interesse an der Herausgabe der Beute zu zeigen.
Ich hätte annehmen können, dass er zurückblieb, weil er ein Auge auf Albia geworfen hatte, aber sie war viel zu jung für ihn, und ihre Vergangenheit war zu voll an Ungewissheiten für einen Konservativen wie Aulus. Sie kam aus Britannien und war als Säugling während der Rebellion im Rinnstein gefunden worden. Sie mochte ehrbarer römischer Abstammung sein – oder vielleicht auch nicht. Niemand würde das je erfahren, und daher war sie nicht gesellschaftsfähig. Aulus wiederum hatte eine Erbin verloren, als seine ehemalige Verlobte Claudia Rufina stattdessen seinen Bruder heiratete. Jetzt war der Sitzengelassene entschlossen, seine großen braunen Augen ausschließlich auf eine erstklassige Jungfrau mit einer formidablen Ahnenreihe und den entsprechenden Geldsäcken zu werfen. Albia hätte in ihn verknallt sein können, wenn sie nicht grausig missbraucht worden wäre, bevor wir sie gerettet hatten. Jetzt wich sie Männern aus. Zumindest redete ich mir das ein, denn wer wusste, ob ihre Vergangenheit sie nicht zu einem leichten Mädchen gemacht hatte. Helena glaubte an sie. Das reichte mir aus.
Häusliche Sorgen hätten mir früher nie zugesetzt. Einst hatte ich keine Bindungen gehabt. Meine einzigen Sorgen hatten darin bestanden, wie ich die Miete zahlen sollte und ob meine Mutter meine neue Freundin entdeckt hatte. Ehemann und Vater zu werden hatte mich zur Ehrbarkeit verdammt. Alleinstehende Ermittler sind stolz darauf, einen anrüchigen Ruf zu haben, aber ich war inzwischen so domestiziert, dass ich zwei unverheiratete Personen nicht ohne Gewissenserforschung allein lassen konnte.
Helena hatte da keine Skrupel. »Wenn sie miteinander schlafen wollten, hätten sie das auf dem Weg hierher längst getan.«
»Was für ein schockierender Gedanke.« Ich verbarg ein Grinsen.
»Du bist doch bloß verblüfft, dass ich mich noch daran erinnere, was du und ich getan hätten, Marcus.«
Ich schwelgte in nostalgischen Erinnerungen. Dann tröstete ich mich: »Na ja, Albia hasst Männer.«
»Albia glaubt, dass sie Männer hasst.«
Da konnte es also noch Ärger geben.
»Er ist zu dick«, bemerkte Albia selbst, als sie unerwartet hereinkam. Wie lange hatte sie gelauscht? Sie war ein schlankes junges Mädchen mit dunklem Haar, das mediterran sein konnte, und blauen Augen, die keltisch sein konnten. Ihr Latein war noch stockend, doch Helena hatte das in die Hand genommen. Bald würde Albia als Freigelassene durchgehen, und die Fragen würden aufhören. Mit etwas Glück sollte es uns gelingen, für sie einen Ehemann mit einem soliden Handwerk zu finden, und vielleicht würde sie sogar glücklich werden. Na ja, wenigstens der Ehemann könnte glücklich werden. Albia hatte ihre Kindheit an Einsamkeit und Verwahrlosung verloren, das würde immer durchscheinen.
»Wer ist zu dick?«, fragte Helena unaufrichtig.
»Dein Bruder«, stichelte Albia.
»Mein Bruder ist nur schwer gebaut.«
»Nein.« Albia kehrte zu ihrer üblichen verletzenden Direktheit zurück. »Und er nimmt sein Leben nicht ernst. Er wird ein schlimmes Ende nehmen.«
»Wer?«, fragte Aulus, der wie aufs Stichwort im Türrahmen erschien.
»Du«, sagten wir alle im Chor.
Aulus bleckte die Zähne. Er trank zu viel Rotwein und versuchte die Flecken mit Schmirgelpulver von seinen Hauern zu entfernen. Die Zähne würden ausfallen, aber er glaubte zweifellos, dass sie in der Abfallschale des Zahnarztes hübsch aussehen würden. Er besaß die normale Eitelkeit eines Lebemannes – und genug Zaster, sich jedes Mal zum Narren zu machen, wenn er den Laden eines Apothekers betrat. Im Moment stank er nach Kassienöl. »Ein schlimmes Ende? Das hoffe ich doch sehr«, meinte er und grinste anzüglich. »Mit ein wenig Glück in Griechenland!«
Wenn Aulus Camillus sich herabließ zu lächeln, sah er plötzlich richtig gut aus. Das hätte mir in Bezug auf Albia Sorgen bereiten können. Aber wir ließen die beiden trotzdem allein. Denn jemanden zu haben, der auf unsere Kinder aufpasste, wenn wir gemeinsam ausgingen, war für Helena und mich eine zu gute Gelegenheit, um sie zu verpassen.
Der Tag war wieder heiß, und wir brauchten lange, bis wir die Porta Marina erreichten. Wir blieben im Schatten, wichen vom Decumanus ab und hielten uns so oft wie möglich an schattige Seitenstraßen. Für eine vorrepublikanische Stadt besaß Ostia ein gutes Grundraster, und wir fanden recht leicht den Weg durch stille Gassen. Es war Nachmittag, Siesta-Zeit. In ein paar Kneipen wurden noch ausgedehnte Mittagsmahlzeiten an Stammgäste serviert, während verstohlene Spatzen die Krümel vorheriger Gäste aufpickten. Dünne Hunde schliefen an Türschwellen, und angeleinte Mulis standen mit den Köpfen in Wassertrögen, verscheuchten lustlos Fliegen und taten so, als wären sie von ihren Besitzern verlassen worden. Die Besitzer, wie die meisten Bewohner, hatten sich in das Innere der Häuser verzogen. Sie genossen das normale Mittagsleben – ein rascher Imbiss mit Brot und Wurst oder ein schnelles Vögeln mit der Frau ihres besten Freundes, ziellose Plaudereien mit einem Kumpel, ein Würfelspiel, ein weiterer Darlehensantrag bei einem Kredithai oder der tägliche Besuch bei einem alten Vater.