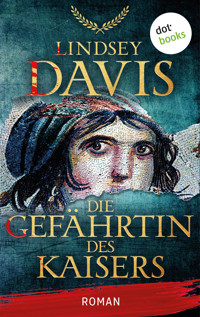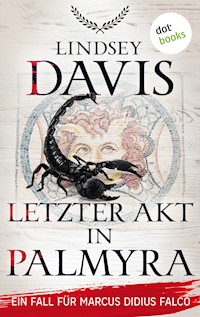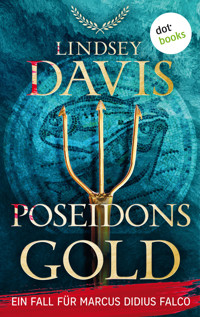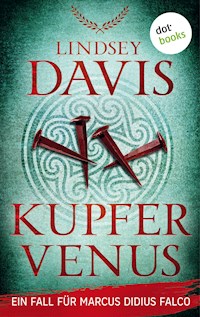6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Ein römischer Detektiv unter germanischen Barbaren: Der fesselnde historische Kriminalroman »Eisenhand« von Lindsey Davis als eBook bei dotbooks. Rom, 71 nach Christus. Als bester Privatermittler der Stadt am Tiber wird er sogar vom Kaiser geschätzt – doch bei seinem neuen Auftrag helfen Marcus Didius Falco weder seine guten Kontakte noch sein unfehlbares Wissen um die »Ewige Stadt«: Im fernen Germanien soll er sich an die Spur eines römischen Generals heften, der seit einer Mission in den bedrohlichen Wäldern vermisst wird. Hinter vorgehaltener Hand raunt man, dass der General die Seiten gewechselt haben könnte, denn die brutalen Barbarenstämme haben eine Flamme der Rebellion entfacht, die selbst die Herzen der römischen Legionäre erfasst. Falco muss all seine Schläue aufbieten, um in einem Netz aus Lügen und Ränke zu bestehen – während seine Feinde in Rom bereits die Gelegenheit ergreifen, gegen ihn zu intrigieren ... »Ein Meisterwerk der Kriminalliteratur.« Daily Telegraph Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Eisenhand« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der vierte Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 71 nach Christus. Als bester Privatermittler der Stadt am Tiber wird er sogar vom Kaiser geschätzt – doch bei seinem neuen Auftrag helfen Marcus Didius Falco weder seine guten Kontakte noch sein unfehlbares Wissen um die »Ewige Stadt«: Im fernen Germanien soll er sich an die Spur eines römischen Generals heften, der seit einer Mission in den bedrohlichen Wäldern vermisst wird. Hinter vorgehaltener Hand raunt man, dass der General die Seiten gewechselt haben könnte, denn die brutalen Barbarenstämme haben eine Flamme der Rebellion entfacht, die selbst die Herzen der römischen Legionäre erfasst. Falco muss all seine Schläue aufbieten, um in einem Netz aus Lügen und Ränken zu bestehen – während seine Feinde in Rom bereits die Gelegenheit ergreifen, gegen ihn zu intrigieren ...
»Ein Meisterwerk der Kriminalliteratur.« Daily Telegraph
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman Silberschweine wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der mittlerweile 20 Bände umfassenden Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittler Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »The Iron Hand of Mars« bei Hutchinson, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1994 Vito von Eichborn GmbH & Co. Verlag KG, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/RInArte, Kolonko, ju_see
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-751-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eisenhand« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Eisenhand
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Christa E. Seibicke
dotbooks.
Für Rosalie,
in Erinnerung an zwei römische
Legionäre auf der A 29
»Das Werk, das ich beginne, enthält eine Fülle von Unglück, berichtet von blutigen Kämpfen, von Zwietracht und Aufständen, ja sogar von einem grausamen Frieden.«
TACITUS, Historien, I, 2.
Dramatis Personae
(von denen aber nicht alle aus der Kulisse treten)
Kaiser Vespasian: braucht einen Kurier, dem er vertrauen kann, z. B.:
M. Didius Falco: ein Privatermittler mit Auftragssorgen; er will:
Helena Justina: die das Unmögliche will, aber nicht:
Titus Cäsar: der Falco aus seinem Revier fernhalten will
Ferner in Rom und Umgebung
Eine Witwe in Veii: eine bloße Ablenkung (ehrlich!)
Canidius: ein ungewaschener Archivbeamter, der streng auf Zensur hält
Balbillus: ein einbeiniger Ex-Legionär, der kein Blatt vor den Mund nimmt
Xanthus: ein scharfer Barbier, der die Welt sehen möchte
Silvia: die Frau von Petronius (der durch Abwesenheit glänzt)
D. Camillus Verus: Helenas Vater, ein Muster an Rücksichtnahme; auch Erzeuger von:
Camillus Älianus: ein hocherfahrener Jüngling (in Spanien)
Und aus dem Buch der Geschichte
P. Quinctilius Varus: eine Katastrophe von einem General (schon lange tot)
Petilius Cerialis: ein berühmter General (nicht so katastrophal wie Varus)
Claudia Sacrata: eine Kurtisane (vorzugsweise für Generäle)
Munius Lupercus: ein vermißter Offizier (vermutlich tot)
Julius Civilis: ein Rebellenführer, der dringend einen Haarschnitt braucht
Veleda: eine germanische Seherin, die allein mit ihren Gedanken lebt, und:
ein paar Verwandte von ihr, die auch dort hausen
In Gallien
ein gallischer Töpfer: der bald weit fort sein wird von Lugdunum
zwei germanische Töpfer: die wohl nie mehr nach Hause kommen
In Germanien
Dubnus: ein Hausierer, der mehr verkauft, als die Pietät erlaubt
Julius Mordanticus: ein Töpfer, der ein, zwei Dinge weiß
Regina: Kellnerin in der Medusa; ein jähzorniges Mädchen
Augustinilla: Falcos Nichte, krank vor Liebe und Zahnweh
Arminia: ihre flachsblonde kleine Freundin
Angehörige der berühmten Vierzehnten Legion
Florius Gracilis: ihr Legat (noch ein Offizier, der vermißt wird)
Mänia Priscilla: seine Frau, die ihn nicht vermißt
Julia Fortunata: seine Geliebte, die ihn zu vermissen vorgibt
Rusticus: sein Page, der selbst vermißt wird
der Primipilus: der Hauptmann der XIV. (ein Menschenverächter)
der Cornicularius: der hochnäsige Schreiber von der Intendantur
A. Macrinus: ihr arroganter Erster Tribun
S. Juvenalis: ihr aufmüpfiger Präfekt
und in der berühmten Ersten Legion
Q. Camillus Justinus: Helenas zweiter Bruder, ein Tribun und Träumer
Helvetius: ein Zenturio mit Problemen, u. a.: sein Diener, der Heimweh nach Moesia hat, und:
zwanzig etwas beschränkte Rekruten, darunter:
Lentullus: einer, der rein gar nichts kann
Komparsen
der Auerochse: Bos primigenius – ein Wildrind, das man nicht reizen sollte, und:
Tigris: ein Hund mit einem interessanten Knochenfund
Buch I
Ich fahre nicht!
Rom, im September 71 n. Chr.
»Daß ich unter Vespasianus in Amt und Würden eingesetzt, unter Titus befördert … worden bin, das möchte ich nicht abstreiten.«
TACITUS, Historien, I, 1.
Kapitel 1
»Damit eins klar ist«, sagte ich zu Helena Justina, »nach Germanien fahre ich nicht!«
Sofort begann sie zu planen, was ich für die Reise benötigen würde.
Wir waren im Bett – hoch oben in meiner Wohnung auf dem Aventin. Ein richtiges Wanzenloch, diese Bruchbude im sechsten Stock; bloß daß den meisten Wanzen beim Treppensteigen vorzeitig die Puste ausging. Manchmal überholte ich sie auf halbem Wege, wenn sie abgeschlafft, mit hängenden Fühlern und matten Beinchen, auf einem Treppenabsatz Rast machten …
Meine Mansarde war so schäbig, daß man sich darüber nur mit Humor hinwegretten konnte. Sogar das Bett wackelte. Und das, nachdem ich ihm ein neues Bein verpaßt und die Matratzengurte frisch gespannt hatte.
Ich probierte gerade eine neue Position aus, die ich mir ausgedacht hatte, damit unsere Liebesspiele nicht womöglich in öde Routine abglitten. Ich kannte Helena seit einem Jahr, hatte mich nach sechs Monaten heftigen Nachdenkens von ihr verführen lassen und sie vor etwa zwei Wochen endlich überreden können, mit mir zusammenzuziehen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Frauen würde sie nun bald anfangen, mir zu predigen, daß ich zuviel trinken und zu lange schlafen würde und daß ihre Mutter sie daheim dringend bräuchte.
Meine sportlichen Bemühungen, ihr Interesse wachzuhalten, waren nicht unbemerkt geblieben. »Didius Falco … wo um alles in der Welt … hast du den Trick her?«
»Marke Eigenbau …«
Helena war die Tochter eines Senators. Zu erwarten, daß sie sich länger als vierzehn Tage mit meinem mickrigen Lebensstil abfinden würde, war mehr als tollkühn. Nur ein Trottel würde in ihrer Liaison mit mir mehr sehen als ein letztes Austoben, ein kleines Abenteuer, bevor der Ernst des Lebens begann und sie einen spitzbäuchigen jungen Gockel mit Patrizierstreifen heiratete, der ihr Smaragdohrringe und eine Sommervilla in Surrentum bieten konnte.
Ich für mein Teil betete sie an. Aber schließlich war ich auch der Trottel, der sich der Hoffnung hingab, die Kaprize könnte von Dauer sein.
»Es macht dir keinen Spaß.« Für einen Privatermittler waren meine deduktiven Fähigkeiten knapp ausreichend.
»Ich glaube nicht …«, keuchte Helena, »daß das funktioniert!«
»Warum denn nicht?« Mehrere Gründe waren auch für mich unübersehbar. Ich hatte einen Krampf in der linken Wade, spürte einen stechenden Schmerz unter einer Niere, und meine Begeisterung erlahmte wie ein Sklave, der am Feiertag im Haus eingesperrt ist.
»Einer von uns«, mutmaßte Helena, »fängt bestimmt gleich an zu lachen.«
»Als Skizze auf der Rückseite eines alten Dachziegels sah’s ganz passabel aus.«
»Ach, das ist wie bei Soleiern. Das Rezept liest sich kinderleicht, aber das Ergebnis ist enttäuschend.«
Ich antwortete, wir seien schließlich nicht in der Küche, worauf Helena sich sittsam erkundigte, ob ich mir von einem solchen Szenenwechsel denn etwas versprechen würde. Da meine aventinische Bleibe über derartigen Komfort nicht verfügte, nahm ich die Frage als rhetorisch.
Ach, falls es jemanden interessiert: Wir lachten beide.
Dann enthedderte ich uns und liebte Helena so, wie wir es beide am liebsten hatten.
»Sag mal, Marcus, woher weißt du überhaupt, daß der Kaiser dich nach Germanien schicken will?«
»Auf dem Palatin gehen böse Gerüchte um.«
Wir lagen noch immer im Bett. Als ich meinen letzten Fall mit Ach und Krach und einem blauen Auge zum Abschluß gebracht hatte, versprach ich mir eine Woche Erholung am häuslichen Herd, was ich mir aufgrund der Auftragslage auch locker leisten konnte. Um ehrlich zu sein: Ich hatte im Moment überhaupt keinen Fall. Wenn mir danach war, konnte ich den ganzen Tag im Bett bleiben. Was ich an den meisten Tagen auch tat.
»Demnach« – Helena war vom hartnäckigen Schlag –, »demnach hast du dich umgehört?«
»Jedenfalls genug, um zu wissen, daß der Kaiser sich für seinen Auftrag einen anderen Dummen suchen kann.«
Da ich manchmal zwielichtige Geschäfte für Vespasian besorgte, war ich in den Palast gegangen, um herauszufinden, wie die Chancen stünden, ihm wieder mal einen faulen Denar abzuluchsen. Doch ehe ich im Thronsaal vorstellig wurde, hatte ich vorsichtshalber erst mal auf den Hintertreppen rumgeschnüffelt. Ein kluger Schachzug, denn nach einer kleinen Plauderei zur rechten Zeit mit einem alten Freund namens Momus trabte ich schleunigst wieder heim.
»Na, viel zu tun?« hatte ich Momus gefragt.
»Ach, nur Kinkerlitzchen, nichts, was sich rentiert. Aber du bist, wie man hört, für die Germanienreise im Gespräch.« Sein spöttisches Lachen verriet mir, daß es hier um eine Sache ging, vor der man sich tunlichst drücken sollte.
»Worum geht’s denn da?«
»Genau die Art Desaster, auf die du spezialisiert bist«, feixte Momus. »Irgendeine Untersuchung bei der Vierzehnten Legion …«
An dem Punkt hatte ich mir den Mantel bis zu den Ohren hochgezogen und war verduftet – bevor mich jemand offiziell informieren konnte. Ich wußte genug von der Vierzehnten, um näheren Kontakt unter allen Umständen zu vermeiden, und auch umgekehrt gab es (die peinlichen Hintergründe können wir uns sparen) keinen Grund, warum diese aufgeblasenen Angeber sich über meinen Besuch hätten freuen sollen.
»Hat der Kaiser dich denn persönlich darauf angesprochen?« hakte meine Herzensdame nach.
»Helena, dazu lasse ich’s gar nicht erst kommen. Ich will ihn doch nicht unnötig verärgern, indem ich sein wunderbares Angebot ablehne …«
»Das Leben wäre wesentlich einfacher, wenn du ihn ruhig fragen und dann schlicht nein sagen würdest!«
Mein süffisantes Lächeln, welches besagte, daß Frauen (selbst kluge, gebildete Senatorentöchter) die Feinheiten der Politik einfach nicht verstehen, beantwortete sie mit einem beidhändigen Schubs, der mich rücklings aus dem Bett beförderte. »Wir müssen essen, Marcus. Geh und such dir eine Arbeit!«
»Und was machst du inzwischen?«
»Ich werde mir stundenlang das Gesicht anmalen, für den Fall, daß mein Liebhaber zu Besuch kommt.«
»Wenn das so ist, dann verschwinde ich und überlasse ihm das Feld.«
Das mit dem Liebhaber war natürlich nur Frotzelei. Ich hoffte es wenigstens.
Kapitel 2
Auf dem Forum ging das Leben seinen gewohnten Gang. Unter den Anwälten herrschte Panik. Der letzte Augusttag ist auch der letzte Termin zur Vorlage neuer Fälle vor der Winterpause; folglich ging es in der Basilika Julia zu wie in einem Bienenstock. Wir schrieben mittlerweile die Nonen des September, und die meisten Advokaten – noch rosig angehaucht vom Urlaub in Baiae – beeilten sich, rasch ein paar drängende Fälle zu klären, um ihr Image aufzupolieren, bevor die Gerichte dichtmachten. Überall auf der Rostra hatten sie ihre lärmenden Schlepper verteilt, die Stimmungsmacher anheuerten, in die Basilika zu stürmen und die Gegenpartei auszupfeifen. Ich drängte sie beiseite. Im Schatten des Palatin folgte eine gemächliche Prozession von Funktionären eines Priesterkollegiums einer ältlichen, weißgewandeten Jungfrau ins Haus der Vestalinnen. In ihrem Blick lag der Hochmut einer schwachsinnigen Alten, der Männer, die es besser wissen sollten, den lieben langen Tag Respekt zollen. Auf den Stufen der Tempel von Saturn und Kastor drängten sich derweil sexbesessene Faulenzer und verschlangen alles (nicht nur das Weibervolk), was ein paar kesse Pfiffe wert schien, mit ihren Blicken. Ein wutschnaubender Ädil hetzte seine Meute auf einen Betrunkenen, der den Fehler begangen hatte, ausgerechnet auf der Sonnenuhr vor dem Goldenen Meilenstein umzukippen. Das Wetter war noch ganz sommerlich. Es roch scharf nach dampfendem Eselskot.
Vor kurzem hatte ich ein kleines Stück Wand auf dem Tabularium erobert. Ich war mit einem Schwamm bewaffnet angerückt, und ein paar geschickte Säuberungsmaßnahmen löschten alsbald die Wahlpropaganda aus, die bislang das antike Gemäuer verunziert hatte (Mit voller Unterstützung der Maniküre-Mädchen aus den Agrippaschen Bädern … dann folgte der Name eines distinguierten Kandidaten). Die Tilgung dieses aufdringlichen Schwachsinns von unserem architektonischen Erbe gab mir, genau in Augenhöhe, reichlich Platz für meine eigenen Graffiti!
DIDIUS FALCO
FÜR JEGLICHEDISKRETENACHFORSCHUNGENBEI GERICHTODERFAMILIENINTERN
AUSGEZ.REFERENZENGÜNSTIGE TARIFE
ADR.:WÄSCHEREI ADLERBRUNNENPROMENADE
Verlockend, was?
Ich wußte, wer wahrscheinlich auf so eine Annonce reagieren würde: zwielichtige Zollbeamte, die reichen Witwen den Hof machten und genaueren Einblick in deren Finanzlage wünschten, oder der Wirt einer Ecckneipe, dem seine Kellnerin abhanden gekommen war.
Beamte zahlen lausig oder nie, aber Wirte können ganz nützlich sein. Ein Privatermittler kann wochenlang nach einem verlorenen Frauenzimmer fahnden, und wenn er es leid wird, sich in Weinschenken rumzudrücken (falls es je soweit kommt), braucht er dem Klienten bloß zu flüstern, daß man vermißte Kellnerinnen in der Regel mit eingeschlagenem Schädel unter den Dielenbrettern ihres Liebsten versteckt findet. Daraufhin wird die Rechnung ultrafix beglichen, und manchmal verläßt der fragliche Wirt obendrein noch für längere Zeit die Stadt – ein Gewinn für Rom. Mir gefällt der Gedanke, daß meine Arbeit auch dem Gemeinwohl dient.
Natürlich kann man sich mit so einem Wirt auch viel Ärger einhandeln, nämlich dann, wenn das Mädchen wirklich durchgebrannt ist, auf und davon mit einem Gladiatoren vielleicht. Man sucht womöglich wochenlang, bringt es aber am Ende vor lauter Mitleid mit dem armen Tropf, der seinem billigen Turteltäubchen nachtrauert, nicht übers Herz, ihm das fällige Honorar abzuknöpfen.
Ich ging in die Thermen, um mit meinem Trainer ein bißchen Gymnastik zu machen, für den Fall, daß ich einen Auftrag ergattern sollte, der körperlichen Einsatz verlangte. Dann machte ich mich auf die Suche nach meinem Freund Petronius Longus. Der kam als Hauptmann der Aventinischen Wache mit allen möglichen Typen zusammen, nicht zuletzt mit jenen gewissenlosen Individuen, die vielleicht meiner Dienste bedurften. Petro vermittelte mir öfter mal einen Fall, und sei es nur, um dadurch lästige Kunden loszuwerden.
Da er in keinem seiner Stammlokale war, ging ich schließlich zu ihm nach Hause. Aber dort begegnete ich bloß seiner Frau – eine unwillkommene Freude. Arria Silvia war ein zierliches, hübsches Persönchen; sie hatte schmale Hände, ein reizendes Näschen und dazu die zarte Haut und die feinen Brauen eines Kindes. Innerlich allerdings war Silvia ganz und gar nicht zartbesaitet, was ihre herzhaft schlechte Meinung von mir bewies.
»Wie geht es Helena, Falco? Hat sie dich schon verlassen?«
»Noch nicht, nein.«
»Kommt schon noch«, versprach Silvia.
Das war Flachserei, wenn auch recht bissige, weshalb ich mich tunlichst bedeckt hielt. Ich bat sie, Petro auszurichten, daß ich gegenwärtig nicht gerade ausgebucht sei, dann verdrückte ich mich schleunigst.
Da ich schon mal in der Gegend war, schaute ich gleich noch bei meiner Mutter vorbei; Ma machte Besuche. Ich war nicht in der Stimmung, mir die Klagen meiner Schwestern über ihre Männer anzuhören; deshalb beschloß ich, meine Verwandten für heute abzuschreiben (was mir nicht schwerfiel), und ging heim.
Dort empfing mich eine alarmierende Szene. Ich hatte eben das stinkende Gäßchen von Lenias Wäscherei überquert, der diebischen Billigreinigung, die sich im Erdgeschoß unseres Hauses befand, als ich einen Trupp hartgesottener Flegel bemerkte, die, in schimmernder Brustwehr, an der Treppe herumlungerten – offenbar sehr bemüht, nicht aufzufallen. Eine schwere Aufgabe, denn allein die Schlachtszenen auf ihren Harnischen waren so auf Hochglanz, poliert, daß eine Wasseruhr davor stehengeblieben wäre, von Passanten ganz zu schweigen. Zehn neugierige Kinder hatten schon einen Kreis um sie gebildet, begafften ihre scharlachroten Federbüsche und forderten sich gegenseitig zu der Mutprobe heraus, den mächtigen Männern einen Stecken zwischen die Schnürsenkel zu bohren. Es waren Prätorianer, die kaiserliche Leibwache. Der ganze Aventin wußte bestimmt schon, daß sie vor meiner Tür standen.
Ich konnte mich nicht entsinnen, in letzter Zeit beim Militär angeeckt zu sein; deshalb setzte ich eine Unschuldsmiene auf und ging weiter. Außerhalb ihrer gewohnten vornehmen Umgebung wirkten die Helden ziemlich nervös. Es überraschte mich daher nicht, als ich am Eingang barsch von zwei gekreuzten Speeren angehalten wurde.
»Ruhig, Jungs, daß ihr mir nur ja keinen Faden zieht – diese Tunika soll noch ein paar Jahre halten …«
Ein Wäschereimädchen, das aus dem dampfenden Verschlag gestürmt kam, trug auf dem Gesicht ein spöttisches Lächeln und im Arm einen Korb voll besonders widerlicher, ungewaschener Klamotten. Das höhnische Lächeln galt mir.
»Na, Freunde von dir?« fragte sie spitz.
»Beleidige mich nicht! Die Herren wollen sicher einen Übeltäter verhaften und haben sich verlaufen.«
Die Wache war offenbar nicht hier, um jemanden festzunehmen. Nein, irgendein Glückspilz in diesem verkommenen Winkel der Stadt hatte Besuch von einem Mitglied der kaiserlichen Familie, und zwar inkognito – abgesehen von der auffallenden Entourage natürlich.
»Was ist denn hier los?« fragte ich den kommandierenden Zenturio.
»Streng vertraulich – gehen Sie gefälligst weiter!«
Inzwischen hatte ich erraten, wer das Opfer war (ich) und was hinter dem hohen Besuch steckte (man wollte mich überreden, den Auftrag in Germanien anzunehmen, vor dem Momus mich gewarnt hatte). Mir schwante alles mögliche. Wenn der Auftrag so speziell oder so dringend war, daß er einen derartigen personellen Aufwand rechtfertigte, dann würde er bestimmt auch Anstrengungen erfordern, wie sie mir verhaßt waren. Wer von den Flaviern mochte es wohl gewagt haben, seine fürstlichen Zehen in den stinkenden Morast unserer Gasse zu stecken?
Kaiser Vespasian stand zu hoch im Rang und war sich dessen auch zu sehr bewußt, um sich einfach unters Volk zu mischen. Außerdem war er schon über sechzig und hätte die vielen Treppen in meinem Haus bestimmt nicht mehr geschafft.
Seinem jüngeren Sohn Domitian war ich einmal flüchtig begegnet, als ich ein schmutziges Geschäft des jungen Cäsar aufgedeckt hatte. Seither wäre es ihm am liebsten, wenn ich von der Erdoberfläche verschwinden würde, und ich wünschte ihm umgekehrt von Herzen das gleiche, aber offiziell und auf gesellschaftlichem Parkett ignorierten wir einander.
Blieb nur Titus.
»Titus Cäsar zu Besuch bei Falco?« Impulsiv genug war er dafür. Um dem Offizier klarzumachen, daß ich solche Geheimnistuerei verabscheute, schob ich die eindrucksvoll polierten Speerspitzen behutsam auseinander und sagte: »Ich bin Marcus Didius. Ihr solltet mich passieren lassen, damit ich erfahre, welche Freuden die Bürohengste auf dem Palatin sich jetzt wieder für mich ausgedacht haben …«
Sie ließen mich durch, wenn auch mit spöttischem Blick. Vielleicht hatten sie ja angenommen, ihr heroischer Feldherr habe sich zu einer schlüpfrigen Liebschaft mit einer aventinischen Maid herabgelassen.
Ohne jede Eile – schließlich war ich ein glühender Republikaner – begab ich mich nach oben.
Als ich eintrat, unterhielt sich Titus mit Helena. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Der Blick, den ich die Prätorianer hatte wechseln sehen, ergab auf einmal durchaus einen Sinn. Mir kam der Verdacht, ich sei bis jetzt ein rechter Narr gewesen. Helena saß draußen auf dem Balkon, einem winzigen Ding, das gefährlich wackelig am Gemäuer klebte und dessen bröckelige Steinstützen vor allem die zwanzig Jahre alte Schmutz- und Rußschicht an der Hauswand festhielten. Für einen ungeschliffenen Kerl wie mich war auf der Bank zwar genügend Platz neben ihr, aber Titus war höflich neben der Falttür stehengeblieben. Von hier oben bot sich ihm ein prächtiger Blick auf die herrliche Stadt, die sein Vater regierte, aber Titus hatte kein Auge für das Panorama. Meiner Meinung nach würde das jedem so gehen, der sich statt dessen an Helenas Anblick ergötzen konnte. Offensichtlich teilte Titus meine Meinung.
Er war so alt wie ich, ein krauslockiger Optimist, der sich das Leben von nichts und niemandem würde vergällen lassen. In meinem unfürstlichen Quartier war seine mit vergoldeten Palmblättern bestickte Tunika gründlich fehl am Platz. Gleichwohl gelang es Titus, hier nicht deplaziert zu wirken. Er hatte ein anziehendes Wesen und fühlte sich rasch überall zu Hause. Eigentlich war er ganz nett und, für eine so hochgestellte Persönlichkeit, gebildet bis zu den Sandalenriemen. Als Politiker war er Spitze und hatte praktisch alles erreicht: Er war Senator, General, Prätorianerführer, Schirmherr staatlicher Einrichtungen und Kunstmäzen. Und obendrein sah er auch noch gut aus. Ich hatte das Mädchen (auch wenn wir das noch nicht bekanntgeben konnten); Titus Cäsar hatte alles übrige. Als ich ihn jetzt mit Helena plaudern sah, wirkte er so hingerissen und jungenhaft, daß ich nur mit den Zähnen knirschen konnte. Er lehnte mit verschränkten Armen an der Tür, ohne zu merken, daß die Scharniere jeden Moment nachzugeben drohten. Ich hoffte, sie würden es tun, und zwar so gründlich, daß Titus in seiner prächtigen purpurnen Tunika rücklings auf meinen morschen Fußboden plumpsen würde. Ja, in dem Augenblick, als ich ihn so ins traute Gespräch mit meiner Freundin vertieft sah, überkam mich eine Stimmung, die fast jede Art von Verrat zur glänzenden Idee machte.
»Hallo, Marcus«, sagte Helena. Das harmlose Gesicht, das sie dabei machte, konnte mich nicht täuschen: alles Theater.
Kapitel 3
»Tag«, würgte ich hervor.
»Marcus Didius!« Dem jungen Cäsar fiel es sehr leicht, umgänglich zu sein. Ich ließ mich davon nicht beirren, sondern schmollte weiter.
»Ich wollte Ihnen sagen, wie leid es mir tut, daß Sie Ihre Wohnung verloren haben!« Titus sprach von der, die ich vor kurzem erst gemietet und die alle Vorzüge hatte – außer daß sie, im Gegensatz zu dieser Bruchbude, die allen Konstruktionsgesetzen zum Trotz immer noch stand, in einer Wolke von Staub eingestürzt war.
»Nette Hütte. Für die Ewigkeit gebaut«, sagte ich. »Das heißt, für die Ewigkeit von einer Woche!«
Helena kicherte. Was Titus den Vorwand lieferte, das Thema zu wechseln. »Ich traf zufällig auf Camillus Verus’ Tochter, die hier auf Sie gewartet hat, und habe sie inzwischen unterhalten.« Bestimmt wußte er, daß ich versuchte, Ansprüche auf Helena Justina geltend zu machen, aber es gefiel ihm, sie als ein Muster an Sitte und Anstand hinzustellen, eine Dame, die nur darauf wartete, daß ein müßiger Fürst daherkam und ihr die Zeit vertrieb.
»Na, besten Dank auch!« versetzte ich bitter.
Titus warf Helena einen bewundernden Blick zu, der mich glatt aussperrte. Er hatte sie von jeher verehrt, und ich hatte ihm das schon immer verübelt. Immerhin stellte ich erleichtert fest, daß sie, ungeachtet ihrer Ankündigung, sich nicht in Erwartung eines Galans geschminkt hatte. Sie sah freilich auch so zum Anbeißen aus, in einem roten Kleid, das ich besonders gern mochte, mit hauchdünnen, achatbesetzten Goldohrringen und das dunkle Haar schlicht mit Kämmen aufgesteckt. Sie hatte ein markantes, gescheites Gesicht und war in der Öffentlichkeit eher zu selbstbeherrscht und kühl, wogegen sie privat dahinschmelzen konnte wie Honig an der Sonne. Ich fand das wunderbar, solange ich der einzige war, für den sie schmolz.
»Ich vergesse immer wieder, daß ihr beide euch ja kennt!« bemerkte Titus.
Helena schwieg und wartete darauf, daß ich Seiner Majestät erklärte, wie gut wir uns kannten. Ich hielt mich eigensinnig zurück. Titus war mein Gönner und Kunde; wenn er mir einen Auftrag gab, würde ich den ordnungsgemäß erledigen – aber kein kaiserlicher Playboy sollte je über mein Privatleben befehlen.
»Was kann ich für Sie tun?« Jedem anderen gegenüber hätte ich jetzt einen gefährlichen Ton angeschlagen, aber keiner, dem sein Leben lieb ist, droht dem Sohn des Kaisers.
»Mein Vater hätte Sie gern gesprochen, Falco.«
»Streiken die Witzbolde im Palast? Na, wenn Vespasian niemanden hat, der ihn zum Lachen bringt, will ich sehen, was ich tun kann.« Zwei Meter weiter glänzten Helenas braune Augen in unversöhnlicher Würde.
»Danke schön«, erwiderte Titus leichthin. Seine weltmännische Art gab mir immer das Gefühl, er habe gerade Spuren von der gestrigen Fischtunke auf meiner Tunika entdeckt. Ein Gefühl, das ich in meinem eigenen Haus sehr, sehr übelnahm. »Wir möchten Ihnen nämlich einen Vorschlag machen …«
»Na fein!« antwortete ich düster. Er sollte ruhig wissen, daß ich vorgewarnt war.
Er löste sich von der Falttür, die gefährlich schlingerte, aber nicht aus den Angeln sprang. Mit eleganter Geste deutete er Helena gegenüber an, daß er nicht länger stören wolle, da wir gewiß Geschäfte zu besprechen hätten. Als er zur Tür ging, stand sie höflich auf, überließ es aber mir, ihn hinauszubegleiten. Als wäre ich der alleinige Wohnungsinhaber. Ich kam wieder herein und machte mich an der windschiefen Tür zu schaffen. »Jemand sollte Seiner Hochwohlgeboren mal flüstern, daß er seine illustre Figur lieber nicht an plebejisches Mobiliar lehnt …« Helena blieb stumm. »Liebste, warum schaust du so vornehm? War ich etwa unhöflich?«
»Titus ist vermutlich dran gewöhnt«, antwortete Helena ruhig. Ich hatte versäumt, sie zu küssen, und wußte, daß ihr das aufgefallen war. Ich hätte das gern nachgeholt, aber jetzt war es zu spät. »Titus ist so umgänglich. Die Leute vergessen leicht, daß sie mit dem Partner des Kaisers, ja mit einem leibhaftigen künftigen Kaiser sprechen.«
»Titus Vespasian vergißt nie wirklich, wer er ist!«
»Sei nicht ungerecht, Marcus.«
Ich knirschte mit den Zähnen. »Was hat er gewollt?«
Sie machte ein erstauntes Gesicht. »Na, dich zum Kaiser einladen – vermutlich, um über Germanien zu sprechen.«
»Dafür hätte er auch einen Boten schicken können.« Helena schien langsam ärgerlich zu werden, und das machte mich natürlich nur noch sturer. »Aber da er schon mal hier war, hätte er auch gleich selbst über Germanien reden können. Und zwar viel ungestörter als im Palast – wenn es denn schon ein so heikler Auftrag ist.«
Helena faltete die Hände vor der Taille und schloß die Augen, zum Zeichen, daß sie sich nicht mit mir streiten würde. Da sie normalerweise schon beim geringsten Anlaß auf mich losging, war das ein schlechtes Zeichen.
Ich ließ sie auf dem Balkon sitzen und schlurfte zurück ins Zimmer. Auf dem Tisch lag ein Brief. »Ist die Schriftrolle da für mich?«
»Nein, das ist meine! Älianus hat mir aus Spanien geschrieben.« Sie meinte den älteren ihrer zwei Brüder. Ich hatte den Eindruck, daß Camillus Älianus ein segelohriger junger Windhund war, mit dem ich mich nicht gern an derselben Theke hätte erwischen lassen; aber da ich ihn noch nicht persönlich kennengelernt hatte, behielt ich das für mich. »Du kannst den Brief ruhig lesen.« Sie zeigte die weiße Fahne.
Aber ich blieb hart: »Es ist dein Brief«
Ich ging ins Hinterzimmer und setzte mich aufs Bett. Ich wußte genau, warum Titus bei uns gewesen war. Sein Besuch hatte nichts mit irgendeinem Auftrag für mich zu tun. Ja, er hatte überhaupt nichts mit mir zu tun.
Früher als erwartet kam Helena herein und setzte sich still neben mich. »Laß uns nicht streiten!« Sie sah selbst ganz niedergeschlagen aus, als sie meine Finger auseinanderbog und mich nötigte, ihre Hand zu halten. »Ach, Marcus! Warum muß das Leben so kompliziert sein?«
Ich war nicht in Stimmung für Philosophie, machte aber meinen Griff doch ein bißchen liebevoller. »Was hat dir dein königlicher Bewunderer denn erzählt?«
»Wir haben bloß über meine Familie geredet.«
»Ach, nein!« Ich ging im Geiste Helenas Stammbaum durch, so wie Titus es wohl vor mir getan hatte: Generationen von Senatoren (was er von sich nicht behaupten konnte – mit seinen sabinischen Vorfahren, Pächtern aus dem Mittelstand); ihr Vater ein getreuer Anhänger Vespasians; ihre Mutter eine Frau von untadeligem Ruf. Ihre Brüder beide im diplomatischen Dienst und mindestens einer davon sicherer Anwärter auf einen Senatssitz.
Jedermann hatte mir versichert, daß in den edlen Älianus große Erwartungen gesetzt würden. Und Justinus, den ich persönlich kannte, machte einen guten Eindruck.
»Titus schien die Unterhaltung ja großen Spaß zu machen. Hat er auch über dich gesprochen?« Helena Justina: lebhaftes Temperament; attraktiv auf eine extravagante, unmoderne Art; keine Skandale (mich ausgenommen). Sie war schon einmal verheiratet gewesen, aber einverständlich geschieden worden; außerdem lebte der Mann inzwischen nicht mehr. Titus hatte selbst zwei Ehen hinter sich – einmal verwitwet und einmal geschieden. Ich war immer noch Junggeselle und trotzdem nicht mehr so naiv wie die beiden.
»Er ist ein Mann – er hat von sich gesprochen«, spottete sie. Ich brummelte. Sie war eine junge Frau, mit der die Leute sich gern unterhielten. Ich auch. Sie war der einzige Mensch, mit dem ich so ziemlich über alles reden konnte, woraus ich ein Vorrecht auf sie ableitete.
»Weißt du, daß er die Königin Berenike von Judäa liebt?«
Helena lächelte kühl. »Dann hat er mein Mitgefühl!« Das Lächeln war nicht besonders nett und kaum für mich gedacht. Im nächsten Moment setzte sie freundlicher hinzu: »Was macht dir eigentlich Sorgen?«
»Nichts«, sagte ich.
Titus Cäsar würde Berenike niemals heiraten, denn mit der Judenkönigin verband sich eine abenteuerlich exotische Geschichte. Und Rom würde niemals eine fremdländische Kaiserin akzeptieren – oder einen Kaiser dulden, der den Versuch machte, eine solche zu importieren.
Titus war zwar romantisch, aber er war auch Realist. Berenike war er angeblich ernsthaft zugetan, doch einen Mann in seiner Stellung hinderte das nicht, trotzdem eine andere zu heiraten. Er war immerhin der Erbe des Römischen Reiches. Sein Bruder Domitian besaß zwar auch einige der Familientalente, aber eben längst nicht alle. Titus hatte eine Tochter gezeugt, doch noch keinen Sohn. Da sich der Anspruch der Flavier auf den Purpur hauptsächlich auf das Versprechen gründete, dem Reich Stabilität zu garantieren, würde das Volk vermutlich erwarten, daß Titus sich ernsthaft nach einer salonfähigen römischen Gemahlin umsah. Und sehr viele Frauen, salonfähige und auch andere, hofften gewiß schon sehnsüchtig darauf.
Was sollte ich also davon halten, wenn ich diesen hochgestellten Kerl im Gespräch mit meinem Mädchen überraschte? Helena Justina war eine rücksichtsvolle, anschmiegsame und liebenswürdige Gefährtin (wenn ihr der Sinn danach stand); sie besaß Verstand, Takt und ein hehres Pflichtgefühl. Wenn sie sich nicht in mich verliebt hätte, wäre Helena genau die Frau, die Titus brauchte.
»Marcus Didius, ich habe mich für ein Leben mit dir entschieden.«
»Wie kommst du plötzlich darauf?«
»Weil du aussiehst, als hättest du das vielleicht vergessen«, sagte Helena.
Selbst wenn sie mich morgen verlassen sollte, würde ich das niemals vergessen. Das hieß aber noch lange nicht, daß ich großes Vertrauen in eine gemeinsame Zukunft setzte.
Kapitel 4
Die nächste Woche war merkwürdig. Der Gedanke an die gräßliche Reise nach Germanien, die mir drohte, bedrückte mich. Sicher, es war ein Auftrag – den abzulehnen ich mir nicht leisten konnte –, aber ein Besuch bei den wilden Stämmen im europäischen Grenzland rangierte nun mal ganz oben auf meiner Liste von Vergnügungen, die ich tunlichst meiden wollte.
Dann suchte ich die Wohnung nach Indizien dafür ab, daß Titus wiedergekommen sei. Ich fand keine; aber Helena erwischte mich beim Schnüffeln, und das machte die Dinge nicht einfacher.
Meine Annonce auf dem Forum hatte zuerst einen Sklaven angelockt, der offensichtlich nie imstande sein würde, mich zu bezahlen. Außerdem suchte er nach seinem vor langer Zeit verschollenen Zwillingsbruder, was ein zweitklassiger Dramatiker vielleicht für ein gutes Forschungsthema halten mochte, mir aber als langweilige Plackerei erschien. Als nächstes meldeten sich zwei Beamte auf der Jagd nach einer lohnenden Mitgift; eine Verrückte, die überzeugt war, Nero sei ihr Vater (daß ich das beweisen sollte, brachte mich darauf, daß die Ärmste plemplem war); und ein Rattenfänger. Er war der interessanteste Kunde, aber er brauchte ausgerechnet einen Staatsbürgerschaftsnachweis. Das hätte zwar nur einen leichten Arbeitstag im Büro des Zensors bedeutet, aber selbst für faszinierende Persönlichkeiten wollte ich mich auf keine Fälschung einlassen.
Petronius Longus schickte mir eine Frau, die wissen wollte, ob ihr Mann, der vorher schon einmal verheiratet gewesen war, womöglich aus erster Ehe Kinder habe, die er ihr verschwieg. Ich konnte ihr mitteilen, daß im Geburtenregister keine eingetragen waren, stieß aber in den Unterlagen auf eine weitere Ehefrau, von der der Mann meiner Klientin nie offiziell geschieden worden war. Diese Frau lebte inzwischen glücklich mit einem Geflügelkoch (»glücklich« meine ich hier im landläufigen Sinn; in Wirklichkeit war sie vermutlich genauso vom Leben enttäuscht wie alle anderen). Ich beschloß, meiner Klientin nicht die Augen zu öffnen. Ein guter Privatermittler beantwortet genau die Fragen, die man ihm gestellt hat – und verschwindet dann diskret von der Bildfläche.
Petros Fall brachte immerhin so viel ein, daß wir uns eine Seebarbe zum Abendessen leisten konnten. Vom restlichen Geld kaufte ich Rosen für Helena, in der Hoffnung, dadurch als aussichtsreichster Kandidat dazustehen. Es wäre ein schöner Abend geworden, hätte sie mir nicht gerade bei der Gelegenheit eröffnet, daß ihr anscheinend selbst vielversprechende Aussichten winkten: Titus hatte sie in den Palast eingeladen, mit ihren Eltern, aber ohne mich.
»Laß mich raten – ein romantisches Diner, das im staatlichen Haushaltsplan nicht verbucht wird? Wann soll’s denn stattfinden?«
Ich spürte ihr Zögern. »Am Donnerstag.«
»Und hast du vor hinzugehen?«
»Ich möchte eigentlich nicht.«
Ihr Gesicht wirkte angespannt. Falls ihre stinkvornehme Familie je Wind bekam von einer möglichen Verbindung zwischen ihrer Tochter und dem Star des Kaiserhofes, dann würde Helena unter schier unerträglichen Druck geraten. Daß sie zu Hause ausgezogen war, solange ihre Eltern keine anderen Pläne mit ihr hatten, war eine Sache. Ihr Vater hatte mir ja offen gesagt, daß er sie, die schon eine gescheiterte Ehe hinter sich hatte, nicht zu einer zweiten Heirat drängen wolle. Camillus Verus war eine Ausnahmeerscheinung: ein zartbesaiteter, gewissenhafter und rührender Vater. Bestimmt gab es trotzdem Ärger daheim, nachdem Helena durchgebrannt war. Sie hatte zwar das meiste von mir ferngehalten, aber ich habe schließlich kein Brett vor dem Kopf. Ihre Familie wollte sie zurückhaben, bevor ganz Rom erfuhr, daß sie sich mit einem armen Schlucker von Privatermittler eingelassen hatte, und bevor die Satiriker diesen Skandal zu ebenso schlüpfrigen wie verkaufsträchtigen Oden verarbeiteten.
»Marcus, o Marcus, ich möchte gerade diesen Abend mit dir verbringen …« Helena schien durcheinander. Ihrer Meinung nach hätte ich offenbar ein Machtwort sprechen sollen, aber gegen diesen Rivalen konnte ich nichts unternehmen; den Korb mußte sie Titus schon selbst geben.
»Schau mich nicht so an, Liebste. Ohne Einladung gehe ich nirgends hin.«
»Das ist ja ganz was Neues!« Ich hasse ironische Frauen.
»Marcus, ich werde Papa sagen, daß ich schon ein Rendezvous habe, das ich unmöglich absagen kann – mit dir.«
Für mich war das ein reines Ausweichmanöver. »Bedaure«, sagte ich kurz angebunden. »Aber ich muß am Donnerstag nach Veii. Einer von den Mitgiftjägern hat mich beauftragt, für ihn eine Witwe zu überprüfen.«
»Kannst du das nicht verschieben?«
»Wir brauchen das Geld. Nutze du nur deine Chance!« höhnte ich. »Geh in den Palast und amüsier dich. Titus Cäsar ist der harmlose Sprößling einer langweiligen Bauernfamilie. Du wirst schon mit ihm fertig, mein Schatz – vorausgesetzt, daß du das auch willst!«
Helena wurde noch bleicher. »Marcus, bitte, bleib hier bei mir!« Etwas in ihrem Ton machte mich stutzig. Aber inzwischen hatte ich mich schon so ins Selbstmitleid hineingesteigert, daß ich nicht mehr zurückkonnte. »Mir liegt sehr viel daran«, warnte Helena, und es klang gefährlich ernst. »Ich werd’s dir nie verzeihen, wenn …«
Das gab den Ausschlag. Die Drohungen einer Frau bringen das Schlimmste in mir zum Vorschein. Ich fuhr nach Veii. Veii war eine Sackgasse. Irgendwie hatte ich mir so was gedacht.
Die Witwe war leicht zu finden, denn ganz Veii kannte sie. Vielleicht war sie vermögend, vielleicht auch nicht, jedenfalls war sie eine kesse Brünette mit funkelnden Augen, die freimütig bekannte, daß sie vier oder fünf unterwürfige Kavaliere gleichzeitig am Gängelband führte – Herren, die sich als Freunde ihres verstorbenen Mannes ausgaben und glaubten, sie könnten sich jetzt erst recht mit ihr anfreunden. Einer davon war ein Weinexporteur, der den Galliern jede Menge ungenießbaren sauren Etrusker andrehte – offenkundig der Favorit, falls das Frauenzimmer überhaupt noch einmal ans Heiraten dachte. Woran ich freilich zweifelte, denn sie genoß den gegenwärtigen Zustand einfach zu sehr.
Übrigens entnahm ich gewissen Andeutungen der Witwe, daß ich selbst von einem längeren Aufenthalt in Veii hätte profitieren können, aber die Erinnerung an Helenas flehende Miene hatte mich schon auf der Hinfahrt verfolgt. Also eilte ich fluchend und mittlerweile auch ziemlich reumütig nach Rom zurück.
Helena war nicht in der Wohnung. Bestimmt war sie schon auf dem Weg zum Palast. Ich ging aus und betrank mich mit Petronius. Als Familienvater hatte er auch sein Päckchen zu tragen und war immer froh, sich einen Abend freizunehmen, um mich aufzuheitern.
Ich kam absichtlich erst sehr spät nach Hause. Was Helena aber nicht übelnehmen konnte, weil sie überhaupt nicht heimkam.
Ich nahm an, sie habe die Nacht bei ihren Eltern verbracht. Das war schon schlimm genug. Als sie aber auch am nächsten Morgen nicht in der Brunnenpromenade erschien, geriet ich in Panik.
Kapitel 5
Jetzt saß ich wirklich in der Tinte.
Den Gedanken, Titus könne sie entführt haben, verwarf ich gleich wieder. Dazu war er zu anständig. Außerdem hatte Helena einen starken Willen und würde sich so etwas nie gefallen lassen.
Ich konnte unmöglich zum Senator gehen und ihn um Aufklärung bitten. Schon deshalb nicht, weil ihre erhabene Familie mir die Schuld geben würde, ganz gleich, was passiert war.
Verschwundene Frauen wiederzufinden war mein Beruf. Bei meiner eigenen sollte es kinderleicht sein. Falls man sie ermordet und unter den Dielen festgenagelt hatte, wußte ich zumindest, daß diese Dielen nicht mir gehörten. Gut kombiniert, aber leider nicht besonders tröstlich.
Ich fing da an, wo man immer beginnt: Man durchsucht die Wohnung, um festzustellen, was sie zurückgelassen hat. Als ich erst mal meinen eigenen Müll weggeräumt hatte, blieb nicht viel übrig. An Kleidern und Schmuck hatte sie ohnehin nur sehr wenig mitgebracht; das meiste davon war jetzt verschwunden. Ich fand eine ihrer Tuniken, die sie offenbar mit einem von meinen Lumpen verwechselt hatte; eine Jetthaarnadel, die auf meiner Bettseite unterm Kissen lag; einen Specksteintopf mit ihrer Lieblingscreme, der hinter die Vorratskiste gekollert war … Sonst nichts. Widerstrebend kam ich zu dem Schluß, daß Helena Justina ihre Sachen aus meiner Wohnung geräumt haben und beleidigt abgezogen sein mußte. Es sah schlimm aus – bis ich auf eine Spur stieß. Der Brief ihres Bruders Älianus lag immer noch auf dem Tisch, wie vorgestern, als sie mir anbot, ihn zu lesen. Das holte ich jetzt nach. Hinterher wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Aber dann war ich doch froh, daß ich Bescheid wußte.
Älianus war der lässige Faulenzer, der sich normalerweise nicht die Mühe machte, an seine Familie zu schreiben, obwohl er regelmäßig Post von Helena bekam. Sie war das älteste der drei Camillus-Kinder und verwöhnte ihre jüngeren Brüder mit jener altmodischen Zuneigung, die aus anderen Familien mit dem Ende der Republik verschwunden ist. Ich hatte schon spitzgekriegt, daß Justinus ihr Liebling war; nach Spanien schrieb sie mehr aus Pflichtgefühl. Es schien typisch für Camillus Älianus, daß er, sobald durchsickerte, daß seine Schwester sich an einen Plebejer mit Schmuddelberuf gehängt habe, plötzlich doch zur Feder griff – und einen so haßerfüllten Schmähbrief verfaßte, daß ich die Rolle angewidert fallen ließ. Älianus war fuchsteufelswild, weil Helena angeblich den noblen Namen der Familie befleckt hatte. Und mit der Gefühlsroheit eines Zwanzigjährigen machte er aus dieser seiner Meinung auch nicht den geringsten Hehl.
Helena, die doch so an ihrer Familie hing, mußte dieser Brief tief verletzt haben. Sicher hatte sie pausenlos darüber nachgegrübelt, ohne daß ich es bemerkte. Und dann war Titus aufgetaucht, und eine Katastrophe drohte … Daß sie nicht viele Worte darüber verlor, sah ihr ähnlich. Und daß ich, als sie endlich doch um Hilfe bat, sie im Stich gelassen hatte, war typisch für mich.
Sowie ich diesen Brief gelesen hatte, wollte ich sie in die Arme schließen. Zu spät, Falco. Zu spät, sie zu trösten. Zu spät, sie zu beschützen. Offenbar in jeder Beziehung zu spät. Ich war nicht überrascht, als ich eine kurze, bittere Nachricht erhielt, in der nur stand, Helena habe es in Rom nicht mehr ausgehalten und sei ins Ausland gegangen.
Kapitel 6
So kam es, daß ich mich doch nach Germanien schicken ließ. Ohne Helena hielt mich nichts in Rom. Sie einholen zu wollen war sinnlos. Sie hatte es so eingerichtet, daß ich ihre Nachricht erst bekam, als die Spur schon kalt war. Ich wurde es bald leid. Mir von meiner lieben Verwandtschaft sagen zu lassen, sie hätten ja schon die ganze Zeit darauf gewartet, daß Helena mich fallenlassen würde. Ich hatte ja selbst auch damit gerechnet. Ihr Vater ging oft in das gleiche Bad wie ich, und ihm aus dem Weg zu gehen war nicht einfach. Irgendwann entdeckte er mich hinter einer Säule; er schüttelte den Sklaven ab, der ihm mit einer Stielbürste den Rücken schrubbte, und eilte in einer Wolke von Duftöl auf mich zu.
»Ich vertraue darauf, Marcus, daß du mir sagen wirst, wo meine Tochter steckt!«
Ich schluckte. »Sie kennen doch Helena Justina, Senator …« »Du weißt es also auch nicht!« rief ihr Vater. Und sofort entschuldigte er sich für Helena, als wäre ich derjenige, den ihre Extravaganzen gekränkt hätten.
»Beruhigen Sie sich doch, Senator!« Ich legte ihm besänftigend ein Handtuch um. »Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, anderen Leuten ihren verschwundenen Augapfel zurückzuholen. Ich werde sie schon finden.« Ich bemühte mich, angesichts meiner Lüge nicht allzu verlegen dreinzublicken. Er folgte meinem Beispiel.
Mein Freund Petronius versuchte nach Kräften, mich aufzumuntern, aber selbst er war einigermaßen verblüfft.
»Ins Ausland! Falco, du hast ein Hirn wie ’n minderbemittelter Katzenfisch. Warum konntest du dich nicht in ein normales Mädchen verlieben? Eine, die heim zur Mutter läuft, wenn du sie gekränkt hast, aber die Woche drauf mit einer neuen Halskette wiederkommt, die du bezahlen mußt?«
»Weil nur ein Mädchen, das auf sinnlose dramatische Auftritte steht, sich in mich verlieben würde.«
Er knurrte ungeduldig. »Willst du sie suchen?«
»Wie denn? Sie könnte überall sein, in Lusitanien oder der Nabatäischen Wüste. Hör auf, Petro, ich hab’ die Witzeleien satt.«
»Tja, eine Frau allein verreist nicht weit …« Petronius selbst hatte immer einfältige, schüchterne Miezen bevorzugt – oder jedenfalls Frauen, die ihm weismachten, solche zu sein.
»Frauen sollten nicht allein reisen. Aber eine so simple Vorschrift würde Helena nicht abschrecken.«
»Warum ist sie dir ausgerückt?«
»Das kann ich dir nicht sagen.«
»Ah, ich verstehe: Titus!« Einer seiner Männer hatte offenbar die Prätorianergarde gesehen, als sie vor meinem Haus rumlungerte. »Das heißt, du bist aus dem Rennen, Falco!«
Ich sagte ihm, daß mir der Optimismus anderer Leute zum Hals raushinge, dann zockelte ich davon.
Als ich das nächste Mal in den Palast gerufen wurde, angeblich zu Vespasian persönlich, da wußte ich, daß Titus dahinterstecken mußte, der wohl einen Plan ausgeheckt hatte, um mich vom Schauplatz zu entfernen. Ich unterdrückte meinen Zorn und schwor mir insgeheim, das höchstmögliche Honorar herauszuschlagen.
Für meine Unterredung mit dero Gnaden warf ich mich so in Schale, wie Helena das gern gesehen hätte. Ich zog eine Toga an. Ich ließ mir die Haare schneiden. Ich preßte die Lippen fest zusammen, um mein republikanisches Knurren zu unterdrücken. Das war das Äußerste, was je ein Palast von mir erwarten durfte.
Vespasian und sein ältester Sohn regierten das Imperium gemeinsam. Ich fragte nach dem alten Herrn, aber der Empfangsbeamte hatte Gummipfropfen in den Ohren. Der schriftlichen Einladung seines Vaters zum Trotz war es an diesem Abend offenbar Titus’ Aufgabe, von der Rostra herab Bittgesuche und Gnadenerlasse zu verhandeln oder sich um Subjekte wie mich zu kümmern.
»Falscher Thronsaal!« sagte ich entschuldigend, als der schwerhörige Lakai mich bei ihm abgeliefert hatte. »Cäsar, ich höre, das Wohl des Reiches erfordert es, daß ich reise. Jedenfalls geht das Gerücht, Ihr edler Vater habe mir diesbezüglich einen schrecklichen Vorschlag zu machen, auf den ich schon sehr gespannt bin.«
Titus merkte natürlich, daß ich mich über seine persönlichen Motive lustig machte. Als er hörte, daß ich eventuell bereit sei, Rom zu verlassen, stieß er ein kurzes Lachen aus, in das ich freilich nicht einstimmte. Er winkte einem Sklaven, vermutlich, damit der mich zum Kaiser führen sollte, doch im letzten Augenblick hielt er uns zurück. »Ich versuche schon eine ganze Weile, eine gewisse Klientin von Ihnen aufzuspüren«, räumte er – gar zu nebenbei bemerkt – ein.
»Dann ist sie also uns beiden entwischt! Was hat sie Ihnen erzählt?« Darauf antwortete er nicht; wenigstens zornige Botschaften hatte Helena für mich reserviert. Schon wieder mutiger, riskierte ich eine spöttische Bemerkung. »Sie ist auf Reisen. Offenbar ein Besuch beim Herrn Bruder. Kürzlich erhielt sie einen Brief vom ehrenwerten Älianus, in dem er sich sehr empört über eine angebliche Kränkung ausließ.« Ich sah keine Veranlassung, Titus mit dem Geständnis zu verwirren, daß ich Gegenstand dieser aufgebrachten Epistel gewesen war.
Titus runzelte argwöhnisch die Stirn. »Wenn ihr Bruder böse auf sie ist, wäre es dann nicht logischer, ihm aus dem Weg zu gehen?«
»Helena Justina reagiert da anders – sie würde auf der Stelle zu ihm wollen.« Titus sah immer noch skeptisch drein. Ich glaube, er hatte selbst mal eine Schwester, ein untadeliges Mädchen, das einen Vetter geheiratet hatte und blutjung im Kindbett gestorben war, wie man das von einer Römerin aus guter Familie erwarten durfte. »Helena sieht den Dingen gern ins Auge, Senator.«
»Was Sie nicht sagen!« bemerkte er, vielleicht ein bißchen ironisch. Und dann fragte er etwas aufmerksamer: »Camillus Älianus ist doch derzeit in Baetica, der spanischen Südprovinz? Komisch – ist er nicht eigentlich noch zu jung für ein Quästorenamt?« Angehende Senatoren schickt man normalerweise als Finanzbeamte in die Provinz, bevor sie mit fünfundzwanzig offiziell in den Senat gewählt werden. Helenas Bruder hatte bis dahin noch zwei oder drei Jahre Zeit. »Seine Familie hält große Stücke auf ihren Sohn Älianus.« Wenn Titus Helena kriegen wollte, würde er ihre Familienverhältnisse aber erst mal gehörig pauken müssen. Mit der Lässigkeit des Eingeweihten erklärte ich ihm die Lage. »Der Senator überredete einen Freund in Corduba, dem jungen Herrn vorzeitig einen Posten zu besorgen, damit Älianus so früh wie möglich Auslandserfahrung sammeln kann.« Nach dem Stil des Briefes an seine Schwester zu urteilen, war dieser Plan, Älianus Diplomatie zu lehren, reine Zeit- und Geldverschwendung gewesen.
»Und? Zeigt der junge Mann besondere Qualitäten?«
Ich antwortete feierlich: »Camillus Älianus scheint wohlgerüstet für eine glänzende Karriere im öffentlichen Dienst.« Titus Cäsar sah mich an, als hege er den Verdacht, ich hielte einen Hauch von Misthaufen für das gängige Kriterium für einen raschen Aufstieg in den Senat. »Sie scheinen ja gut unterrichtet zu sein!« Er beäugte mich und rief dann einen Überlandboten herein. »Falco, wann ist Helena Justina abgereist?«
»Keine Ahnung.« Er raunte seinem Boten etwas zu, wovon ich bloß »Ostia« verstand. Dennoch sah Titus mir an, daß ich etwas aufgeschnappt hatte. »Die Dame entstammt einer Senatorenfamilie. Ich kann ihr verbieten, das Reich zu verlassen«, sagte er trotzig.
Ich zuckte die Achseln. »Schön, sie macht ohne Erlaubnis Ferien. Warum nicht? Sie ist schließlich weder Vestalin noch Priesterin des Kaiserkultes. Ihre Amtsvorgänger hätten sie für soviel eigenmächtiges Handeln womöglich auf eine Insel verbannt, gewiß, aber von den Flaviern hat Rom sich was Besseres erhofft!« Trotzdem, wenn er sie finden sollte – ich hatte selbst vergeblich einen Tag lang die Kais von Ostia abgegrast –, dann sollte es mir recht sein, wenn Titus meine Herzensdame nach Rom zurück eskortieren ließ. Ich wußte ja, daß man sie, aufgrund ihres Ranges, respektvoll behandeln würde. Und ich wußte auch, daß Titus Flavius Vespasianus charybdische Turbulenzen drohten, wenn er den Befehl dazu gab. »Helena Justina wird sich dagegen verwahren, daß man sie mit Gewalt vom Schiff holt. Wenn Sie wollen, bleibe ich«, bot ich an. »Denn wenn die Dame erst einmal in Fahrt ist, können auch Ihre Prätorianer sie vielleicht nicht ohne Hilfe bändigen.«
Titus machte freilich keine Anstalten, seinen Boten zurückzurufen. »Ich bin sicher, daß ich Helena Justina werde besänftigen können …« Keine Frau, die er ernsthaft begehrte, wäre je imstande, ihm die kalte Schulter zu zeigen. Richtig hoheitsvoll sah er aus, wie er so dastand und die üppigen Falten seiner purpurfarbenen Tunika glattstrich. Ich pflanzte mich mit gespreizten Beinen ihm gegenüber auf und schaute einfach nur knallhart. Dann fragte er unvermittelt: »Sie und Camillus Verus’ Tochter stehen sich wohl sehr, sehr nahe?«
»Glauben Sie?«
»Lieben Sie Helena Justina?«
Ich lächelte einfach. »Cäsar, wie könnte ich mich erdreisten.«
»Sie ist die Tochter eines Senators, Falco!«
»Das sagt man mir immer wieder, ja.«
Uns beiden war nur allzu bewußt, welche Macht sein Vater hatte und wieviel Autorität schon auf Titus übergegangen war. Er war zu höflich, als daß er Vergleiche angestellt hätte, aber ich tat es.
»Billigt Verus diese Liaison?«
»Wie könnte er, Cäsar?«
»Hat er seine Erlaubnis gegeben?«
Ich sagte ruhig: »Helena Justina ist eine reizende Exzentrikerin.« Ich konnte ihm am Gesicht ablesen, daß Titus dies schon selbst festgestellt hatte. Ich überlegte, was er wohl zu ihr gesagt haben mochte; noch viel mehr plagte mich allerdings die Frage, was sie zu ihm gesagt hatte.
Er rutschte auf seinem Sessel herum zum Zeichen, daß die Audienz beendet sei. Er konnte mich aus seinem Thronsaal weisen; er konnte mich aus Rom wegschicken; aber wir waren uns beide nicht so sicher, ob er mich aus Helenas Leben verbannen konnte. »Marcus Didius, Sie sollen im Auftrag meines Vaters eine Reise machen. Ich denke, das wird für alle Beteiligte das beste sein.«
»Könnte es vielleicht nach Baetica gehen?« fragte ich hinterhältig.
»Falsche Richtung, Falco!« parierte er genüßlicher als angebracht. Doch faßte er sich rasch wieder und fuhr fort: »Ich hatte gehofft, die Dame letzten Donnerstag hier bewirten zu dürfen. Und ich habe es sehr bedauert, daß sie nicht kommen wollte – die meisten Menschen feiern allerdings ihre ganz privaten Feste vorzugsweise im Kreise ihrer Lieben …« Das war eine Art Test. Ich sah ihn an, ohne eine Miene zu verziehen. »Ich spreche von Helena Justinas Geburtstag!« rief er triumphierend wie einer, der mit beschwerten Würfeln eine Doppelsechs geworfen hat.
Ich hatte es nicht gewußt. Und das sah er mir an.
Mühsam unterdrückte ich den spontanen Wunsch, seinem tadellos rasierten Kinn einen Haken zu versetzen, der die schönen Zähne des jungen Cäsar in seine Schädeldecke verpflanzen würde.
»Viel Spaß in Germanien!«
Titus unterdrückte seinen Triumph ritterlich. Trotzdem wurde mir in diesem Moment das Dilemma klar, in dem Helena und ich steckten. Für sie war die Lage peinlich geworden, für mich aber regelrecht gefährlich. Und egal, welche miese Mission man mir diesmal zugedacht hatte – Titus Cäsar wäre es gewiß am liebsten, wenn ich sie nicht beenden würde.
Er war der Sohn des Kaisers und konnte viel tun, um sicherzugehen, daß ich, hatte er mich erst einmal aus Rom fortgeschickt, auch nicht mehr zurückkehren würde.
Kapitel 7
In düstere Gedanken versunken wurde ich durch die parfümierten Amtszimmer dreier Kammerherren geschleust. Ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Nach zehn Jahren eines in meinen Augen erfolgreichen Liebeslebens vertraute ich darauf, den Geburtstag einer neuen Freundin im Nu herauszukriegen. Ich fragte Helena; sie ging lachend darüber hinweg. Ich bohrte bei ihrem Vater nach, aber da der Sekretär mit der Liste der Familienfeste nicht zur Hand war, konnte er der Frage listig ausweichen. Ihre Mutter hätte es mir sofort sagen können, aber Julia Justa kannte wirkungsvollere Wege, sich aufzuregen, als den, mit mir über ihre Tochter zu sprechen. Schließlich suchte ich sogar stundenlang im Büro des Zensors nach Helenas Geburtsurkunde. Ohne Erfolg. Entweder hatte den Senator bei der Ankunft seiner Erstgeborenen die Panik ergriffen (verständlicherweise) und er hatte es versäumt, sie ordnungsgemäß registrieren zu lassen, oder aber er hatte sie unter einem Lorbeerbusch gefunden und konnte sie nicht als römische Bürgerin eintragen. Eins stand jedenfalls fest. Ich hatte eine üble Tat begangen. Helena Justina mochte viele Kränkungen übersehen, aber einen Fauxpas wie den, daß ich mich an ihrem Geburtstag nach Veii absetzte, bestimmt nicht. Daß ich ja nicht wußte, daß es ihr Geburtstag war, tat nichts zur Sache. Ich hätte es eben wissen müssen.
»Didius Falco, mein Cäsar …« Noch ehe ich soweit war, mich auf die hohe Politik zu konzentrieren, hatte ein Haushofmeister, der nach langjähriger Eitelkeit und jüngst geschmorten Zwiebeln stank, mich dem Kaiser gemeldet.
»Sie ziehen aber ein langes Gesicht. Was ist denn los, Falco?«
»Ärger mit dem schwachen Geschlecht«, gestand ich.
Vespasian war einer, der gern herzhaft lacht. Jetzt warf er den Kopf in den Nacken und wieherte los. »Darf ich Ihnen einen Rat geben?«
»Aber gern, Cäsar.« Ich grinste. »Wenigstens ist dieser Schwarm nicht mit meiner Achselbörse abgehauen oder mit meinem besten Freund durchgebrannt …«
Einen Augenblick blieb es auffallend still, als ob dem Kaiser eben eingefallen sei, wer mein jüngster Schwarm war.
Vespasian Augustus war ein vierschrötiger Bourgeois, ein Mann, der mit beiden Beinen auf der Erde stand. Er war im Durcheinander eines brutalen Bürgerkrieges an die Macht gekommen und hatte dann den Beweis dafür angetreten, daß man auch ohne protzige Vorfahren Talent zum Regieren haben kann. Er und sein ältester Sohn Titus hatten Erfolg – weshalb die Snobs im Senat sie garantiert niemals akzeptieren würden. Allein, Vespasian hatte sich sechzig Jahre lang gegen Widerstände durchgesetzt; nach so langer Zeit erwartet man nicht mehr ohne weiteres Anerkennung – selbst wenn man den Purpur trägt.
»Sie haben es aber nicht eilig, Näheres über Ihren Auftrag zu erfahren, Falco.«
»Ich weiß jetzt schon, daß ich ihn nicht haben will.«
»Das ist ganz normal.« Vespasian räusperte sich und sagte dann zu einem Sklaven: »Hol Canidius herein.« Ich zerbrach mir nicht erst den Kopf darüber, wer dieser Canidius war. Wenn er hier arbeitete, dann war er mir nicht so sympathisch, als daß ich ihn hätte kennenlernen wollen. Der Kaiser winkte mich näher heran. »Was wissen Sie über Germanien?«
Ich machte schon den Mund auf und wollte das Schlagwort: »Chaos!« in die Debatte werfen, dann fiel mir ein, daß Vespasians eigene Anhänger das Chaos heraufbeschworen hatten, und ich klappte den Mund wieder zu.
Geographisch betrachtet ist das, was Rom als Germanien bezeichnet, die Ostflanke Galliens. Vor sechzig Jahren hatte Augustus beschlossen, nicht über die natürliche Grenze des Rheins hinaus vorzurücken – ein Entschluß, den ihm das Quinctilius-Varus-Fiasko abgerungen hatte, jenes tragische Unglück, bei dem drei römische Legionen in einen Hinterhalt gelockt und von den Germanen vernichtet wurden. Augustus hatte das nie verwunden. Vermutlich war es just dieser Thronsaal, in dem er damals, ruhelos auf und ab gehend, ächzte: »Varus, Varus, gib mir meine Legionen wieder …« Auch wenn das Massaker nun schon so lange zurücklag, war mir der Gedanke an eine Reise in dieses Unglücksland äußerst zuwider.
»Na, Falco?«
Es gelang mir, unvoreingenommen zu klingen. »Cäsar, ich weiß, daß Gallien und unsere rheinischen Provinzen im Bürgerkrieg eine entscheidende Rolle gespielt haben.«
Der Aquitanier Vindex, der Legat in Gallien war, hatte mit seiner Revolte Neros Sturz ausgelöst und damit die Lawine ins Rollen gebracht. Der Statthalter von Obergermanien schlug dort den Aufstand zwar nieder, aber als man ihn nach Rom zurückberief, weil Galba unterdessen Ansprüche auf den Thron erhob, da verweigerten ihm seine Truppen den Treueeid. Nach Galbas Tod übernahm Otho in Rom die Regierung, wurde aber von den Rheinlegionen nicht anerkannt, die beschlossen, sich ihren eigenen Kaiser zu küren. Ihre Wahl fiel auf Vitellius, den Statthalter von Untergermanien. Er galt als brutaler, herumhurender Säufer – nach den Maßstäben der Zeit hatte er also offenkundig das Zeug zum Kaiser. Noch von Judäa aus forderte ihn Vespasian heraus. Um die Legionen in Germanien, die Anhänger seines Rivalen, niederzuzwingen, ermunterte Vespasian einen einheimischen Stammesfürsten, doch die Besatzungstruppen ein bißchen aufzumischen. Das klappte – nur leider zu gut. Zwar eroberte Vespasian die Kaiserwürde, aber der Aufstand in Germanien ließ sich nicht mehr eindämmen.
»Eine Rolle«, fuhr ich fort, »die in der Revolte des Civilis ihren dramatischen Höhepunkt fand, Cäsar.«
Der Alte schmunzelte über meine vorsichtige Neutralität.
»Demnach kennen Sie sich aus?«
»Ich lese den Tagesanzeiger.« Ich paßte mich seinem düsteren Ton an. Schließlich ging es hier ja auch um einen wirklich trostlosen Augenblick in der römischen Geschichte.
Das Fiasko in Germanien war komplett gewesen. Rom selbst war damals eine zerrissene Stadt, aber die schockierenden Szenen am Rhein übertrafen sogar unsere Probleme mit Feuersbrünsten, Seuchen und Panik. Der Rebellenführer – ein batavischer Heißsporn mit Namen Civilis – hatte versucht, alle europäischen Stämme zu einem unabhängigen Gallien zu vereinen, eine hoffnungslose Utopie. In dem Chaos, das er heraufbeschwor, wurden eine ganze Reihe römischer Festungen gestürmt und niedergebrannt. Unsere Rheinflotte, die mit einheimischen Ruderknechten bemannt war, ruderte zum Feind über. Vetera, die einzige Garnison, die halbwegs ehrbar standhielt, wurde durch eine unerbittliche Belagerung ausgehungert; als die Besiegten unbewaffnet vor die Tore wankten, stürzte der Feind sich auf die wehrlosen Männer und schlachtete sie buchstäblich ab.
Während bei den Eingeborenen in ganz Europa die Rebellion tobte, verfiel auch die Moral unserer Truppen zusehends. Allenthalben kam es zu Meutereien. Offiziere, die nur etwas schneidig auftraten, wurden von ihren eigenen Männern angegriffen. Es kursierten abenteuerliche Geschichten über Legionskommandeure, die gesteinigt werden sollten, sich im letzten Moment retten konnten und sich dann, als Sklaven verkleidet, in Mannschaftszelten versteckten. Einer wurde von einem Deserteur ermordet. Zwei ließ Civilis hinrichten. Der Statthalter von Obergermanien wurde vom Krankenlager gezerrt und umgebracht. Ein besonders schauriges Schicksal ereilte den Legaten von Vetera: Den legte Civilis nach der Kapitulation der Festung in Ketten und schickte ihn in den barbarischen Teil Germaniens – als Geschenk für eine einflußreiche Seherin; bis auf den heutigen Tag wußte man nicht, was aus ihm geworden war. Auf dem Höhepunkt des Aufruhrs schließlich verkauften vier unserer rheinischen Legionen ihre Dienste, und wir mußten zusehen, wie römische Soldaten den Barbaren Treue schworen.
Ja, das klingt phantastisch. Und zu jeder anderen Zeit wäre es auch ganz undenkbar gewesen. Aber im Vierkaiserjahr, als das ganze Reich in Trümmer fiel, während die Thronanwärter sich aneinander die Zähne ausbissen, war dies nur eine besonders grelle Facette im allgemeinen Wahnsinn.
Ich überlegte düster, wie sich die turbulenten Szenen an der Rheingrenze wohl auf mein langweiliges Leben auswirken würden.
»Wir haben Germanien im Griff«, erklärte der Kaiser. Aus dem Munde der meisten Politiker wäre das bestenfalls frommer Selbstbetrug gewesen. Nicht so bei ihm. Vespasian war selbst ein guter General, der es verstand, starke Untergebene zu halten. »Annius Gallus und Petilius Cerialis haben eine dramatische Wende erkämpft.« Gallus und Cerialis waren mit neun Legionen ausgesandt worden, um Germanien zu unterwerfen. Das war vermutlich die größte Sondereinheit, die Rom jemals mobilisiert hatte, und der Erfolg stand von vornherein fest, aber als loyaler Staatsbürger wußte ich, wann ich mich beeindruckt zu zeigen hatte. »Zur Belohnung mache ich Cerialis zum Statthalter von Britannien.« Eine schöne Belohnung! Cerialis hatte während des Aufstandes der Britannierfürstin Boudicca auf der Insel gedient und würde also wissen, was für ein schäbiger Preis ihm da angedreht wurde.
Zum Glück fiel mir gerade noch rechtzeitig ein, daß der ehrenwerte Petilius Cerialis ein naher Verwandter Vespasians war. Also verkniff ich mir meine geistreiche Erwiderung und fragte statt dessen lammfromm: »Wenn Sie Cerialis entbehren und ihn für höhere Aufgaben einsetzen können, Cäsar, dann ist die Grenzregion also wieder unter Kontrolle?«
»Bis auf ein paar unerledigte Kleinigkeiten – aber darauf komme ich noch.« Was immer offiziell behauptet wurde, in Wahrheit war das Rheinland bestimmt nach wie vor gefährlich. Jedenfalls derzeit denkbar ungeeignet für eine lauschige Kahnpartie stromabwärts mit einem Weinschiff. »Petilius Cerialis hat sich mit Civilis getroffen und …«
»O ja, davon habe ich gehört!« Ein bühnenreifer Auftritt: Zwei feindliche Feldherrn stehen sich an einem tosenden Flußbett gegenüber und brüllen sich von den Enden einer zerstörten Brücke aus ihre Forderungen zu. Es klang wie eine Szene aus den Ursprüngen der Heldengeschichte Roms, wie man sie den Schulknaben eintrichtert.