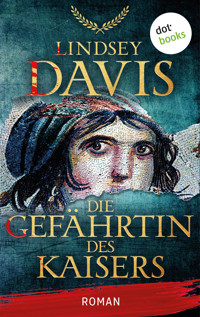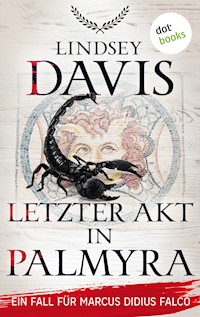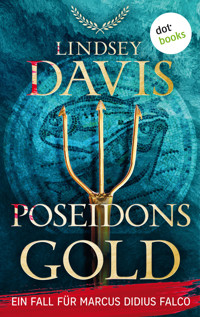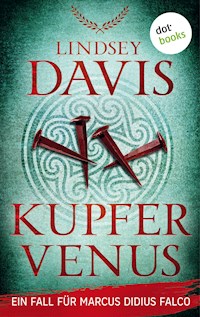
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Ein Dolch im Rücken ist der Verräter Lohn: Der historische Kriminalroman »Kupfervenus« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 71 nach Christus: Als bester Privatermittler der »Ewigen Stadt« wird Marcus Didius Falco überall geschätzt, doch sein Erfolg ruft auch Neider auf den Plan: Anacrites, oberster Spion des Kaisers, sorgt dafür, dass Falco im Kaiserpalast zur persona non grata wird. Seines bisherigen Gönners beraubt, ist Falco gezwungen, den Auftrag des Hyacinthus anzunehmen: Der freigelassene Sklave ist zu schwindelerregendem Reichtum gelangt und steht kurz vor der Hochzeit. Seine junge Verlobte ist allerdings bereits das dritte Mal verwitwet … Was zunächst wie Routinearbeit aussieht, entwickelt sich bald zu einem mörderischen Abenteuer – denn während Falco noch die Verlobte beschattet, muss er feststellen, dass Anacrites immer noch eine tödliche Rechnung mit ihm begleichen will … »Ein weiterer fesselnder Ausflug in das Rom Vespasians, faszinierend und unterhaltsam!« Sunday Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Kriminalroman »Kupfervenus« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der dritte Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 71 nach Christus: Als bester Privatermittler der »Ewigen Stadt« wird Marcus Didius Falco überall geschätzt, doch sein Erfolg ruft auch Neider auf den Plan: Anacrites, oberster Spion des Kaisers, sorgt dafür, dass Falco im Kaiserpalast zur persona non grata wird. Seines bisherigen Gönners beraubt, ist Falco gezwungen, den Auftrag des Hyacinthus anzunehmen: Der freigelassene Sklave ist zu schwindelerregendem Reichtum gelangt und steht kurz vor der Hochzeit. Seine junge Verlobte ist allerdings bereits das dritte Mal verwitwet … Was zunächst wie Routinearbeit aussieht, entwickelt sich bald zu einem mörderischen Abenteuer – denn während Falco noch die Verlobte beschattet, muss er feststellen, dass Anacrites immer noch eine tödliche Rechnung mit ihm begleichen will …
»Ein weiterer fesselnder Ausflug in das Rom Vespasians, faszinierend und unterhaltsam!« Sunday Times
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman Silberschweine wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der mittlerweile 20 Bände umfassenden Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe November 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1991 unter dem Originaltitel »Venus in Copper« bei Hutchinson, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1991 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 Vito von Eichborn GmbH & Co. Verlag KG, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/RInArte, Kolonko, Danny Smithe
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-745-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: info@dotbooks.de. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Kupfervenus« an: lesetipp@dotbooks.de (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Kupfervenus
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Christa E. Seibicke
dotbooks.
Meinen Eltern
Willkommen in Kent!
Dramatis Personae
Freunde, Feinde & Familie
M. Didius Falco: Ein Privatermittler, der versucht, in einem ausgesprochen lausigen Job einen ehrbaren Denar zu verdienen
Helena Justina: Seine haushoch über ihm stehende Freundin
Falcos Mutter: (Kein Wort mehr über sie!)
Maia & Junia: Zwei von Falcos Schwestern (die Spinnerte & die Überkandidelte)
Famia & Gaius: Seine Schwäger, über die man am besten
Baebius & Mico: schweigt (weil sich nichts Gutes über sie sagen läßt)
D. Camillus Verus & Julia Justa: Helenas patrizische Eltern, die Falco an so manchem die Schuld geben …
L. Petronius Longus: Falcos treuer Freund; Hauptmann der Aventinischen Wache
Smaractus: Der Vermieter, den Falco gar zu gern los wäre
Lenia: Inhaberin der Wäscherei Adler und scharf auf Falcos Vermieter (oder auf dessen Geld)
Rodan & Asiacus: Zwei Schlägertypen in Smaractus’ Diensten; als Gladiatoren die größten Flaschen von Rom
Titus Caesar: Ältester Sohn und Mitkaiser Vespasians; Falcos Gönner, sofern ihm das gestattet wird von:
Anacrites: Oberspion im Palast, kein Freund unseres jungen Helden
Quadratlatsche,Knirps & derMann auf dem Faß: Unterlinge von Anacrites
Eine Gefängnisratte: Vermutlich dito
Verdächtige und Zeugen
Severina Zotica: Eine berufsmäßige Braut (posiert für Idylle am häuslichen Herd)
Severus Moscus: (Der Perlenhändler) Severinas erster Mann (verstorben)
Eprius: (Der Apotheker) Ihr zweiter Mann (verstorben)
Grittius Fronto: (Der Importeur wilder Tiere) Ihr dritter Mann (verstorben)
Chloe: Ihr feministischer Papagei
Hortensius Novus: Ein Freigelassener, jetzt Geschäftsmann im großen Stil; Severinas Verlobter (wird er’s überleben?)
Hortensius Felix & Hortensius Crepito: Geschäftspartner von Novus (natürlich allesamt dicke Freunde)
Sabina Pollia & Hortensia Atilia: Ihre Gattinnen, die finden, Hortensius Novus habe Grund, sich zu ängstigen (eine Fürsorge, die so manchem beängstigend erscheinen mag)
Hyacinthus: Ein Laufbursche der Hortensii
Viridovix: Ein gallischer Küchenchef, angeblich ein verkrachter Fürst
Anthea: Eine Dienstmagd
Cossus: Ein Makler, Bekannter von Hyacinthus
Minnius: Lieferant verdächtig leckerer Kuchen
Lusius: Sekretär eines Prätors (ein gerissener Typ, der jeden verdächtigt)
Tyche: Eine mit allen Wassern gewaschene Wahrsagerin
Thalia: Eine Tänzerin, die kuriose Dinge mit Riesenschlangen veranstaltet
Eine vorwitzigeSchlangeScaurus: Ein Steinmetz – Spezialität Grabsteine – mit vollen Auftragsbüchern
Appius Priscillus: Ein Immobilienmagnat (noch eine Ratte)
Gaius Cerinthus: Jemand, den der Papagei kennt; glänzt verdächtig durch Abwesenheit
»Nun, riesige Butten
und Schüsseln
bringen dir außer dem Schaden
noch Schande …«
Horaz, Satiren II/2
»Ich will das Meine nutzen
für mich, statt mit Steinbutt
als Großhans Schmarotzer
zu atzen …«
Persius, 6. Satire
»Ich habe keine Zeit,
mich mit Gedanken an Butten
zu verlustieren:
Ein Papagei
zerschnäbelt mein Haus …«
Falco, Satiren I/1
Rom
August–September
71 n. Chr.
Kapitel 1
Sie glauben gar nicht, wie groß so eine Ratte ist.
Zuerst hörte ich sie bloß: das gruselige Rascheln eines ungebetenen Gastes, alles andere als angenehm in einer engen Gefängniszelle. Ich hob den Kopf.
Meine Augen hatten sich an das Fast-Dunkel gewöhnt, und als das Tier sich wieder bewegte, konnte ich es sehen: ein aschgraues Männchen, dessen rosa Pfoten bestürzende Ähnlichkeit mit Kinderhändchen hatten. Der Ratz war so groß wie ein Karnickelbock. Ich kenne genug Billiglokale in Rom, wo der Koch es nicht so genau nehmen und diesen fetten Aasfresser ohne große Skrupel in den Suppentopf stecken würde. Ordentlich Knoblauch dazu, und keiner würde was merken. Die Kesselheizer aus den Slums hinterm Circus Maximus wären froh, wenn ihnen in ihrer Stammkneipe überhaupt mal ein Knochen mit echtem Fleisch dran die Suppe würzte …
Mir knurrte vor lauter Elend der Magen, aber alles, was ich runterschlucken konnte, war meine Wut darüber, hier festzusitzen. Die Ratte durchstöberte angelegentlich den Abfall in einer Ecke, monatealter Müll von früheren Häftlingen, den anzurühren es mich zu sehr geekelt hatte. Das Tier bemerkte mich wohl, als ich mich aufrichtete, nahm aber weiter keine Notiz von mir. Wenn ich ganz still liegenblieb, würde es mich vielleicht für einen Haufen alter Lumpen halten und zur späteren Untersuchung vormerken. Zog ich dagegen schützend die Beine an, würde die Bewegung es garantiert aufscheuchen.
Egal, was ich tat, über die Füße laufen würde das Vieh mir so oder so.
Ich saß in den Lautumiae, zwischen lauter kleinen Gaunern, die sich keinen Anwalt leisten konnten, und harmlosen Taschendieben vom Forum, die ein Weilchen Ruhe haben wollten vor ihren Frauen. Es hätte mich schlimmer treffen können, wenn ich nämlich im Mamertin gelandet wäre, der Durchgangsschleuse für politische Gefangene, wo die Kerker zwölf Fuß tief unter der Erde liegen und einem armen Schlucker ohne Beziehungen nur der direkte Ausgang in den Hades bleibt. Hier bei uns war wenigstens immer was los: Alte Knastbrüder sorgten mit scharfen Subura-Flüchen für Stimmung, Sturzbetrunkene führten Veitstänze auf. Im Mamertin dagegen herrscht ununterbrochene Monotonie, bis der Henker kommt und Maß nimmt.
Bestimmt gibt es im Mamertin auch keine Ratten. Kein Kerkermeister verwöhnt einen zum Tode Verurteilten noch mit Speis und Trank, also können dort kaum Reste für das Nagervolk abfallen. Ratten kriegen so was schnell spitz. Außerdem muß der Mamertin streng auf Sauberkeit achten, denn man weiß nie, wann ein aufstrebender Senator hereinschaut, um seinen Freunden, die so töricht waren, den Kaiser zu beleidigen, das Neueste vom Forum zu berichten. Darum also boten sich einem Häftling nur hier in den Lautumiae, diesem Sammelbecken für den Abschaum der Gesellschaft, so spannende Abenteuer wie das, abzuwarten, wann sein schnurrbärtiger Zellengenosse ihm die Zähne ins Schienbein schlagen würde …
Die Lautumiae sind ein Riesenbau, groß genug für ganze Schwadronen von Häftlingen. Die Stammgäste hier sind durch die Bank Ausländer, arme Teufel aus aufsässigen Provinzen. Aber auch ein Römer, der dem falschen Beamten auf die Füße trat, konnte jederzeit hier landen – so wie ich jetzt – und bitteren Gedanken über das Establishment nachhängen, während er seinen Zehennägeln beim Wachsen zusah. Bestes Beispiel dafür war die Klage gegen mich – oder vielmehr, was der Mistkerl, der mich hinter Gitter brachte, dafür ausgab: Ich hatte den folgenschweren Fehler begangen, den Oberspion des Kaisers zu blamieren. Dieser Anacrites, ein rachsüchtiger Drahtzieher, war im Frühsommer mit einer Mission in der Campania betraut worden; als er die Sache verbockte, gab Kaiser Vespasian mir den Auftrag, sie wieder ins reine zu bringen, was ich denn auch mit Bravour erledigte. Anacrites reagierte wie jede zweitklassige Amtsperson, wenn der Nachwuchs sich profiliert: In der Öffentlichkeit gratulierte er mir, aber bei nächster Gelegenheit würgte er mir eine rein.
Ein harmloser Buchungsfehler hatte mich zu Fall gebracht: Anacrites behauptete, ich hätte Bleibarren aus kaiserlichem Besitz gestohlen – dabei hatte ich mir das Zeug bloß für eine Tarnaktion in Staatsdiensten ausgeborgt. Das Geld, das ich im Tausch gegen das Blei einnahm, hätte ich ohne weiteres zurückerstattet, falls ich jemals dazu aufgefordert worden wäre. Aber Anacrites gab mir keine Chance; ich landete in den Lautumiae, und bislang hatte sich noch keiner die Mühe gemacht, einen Anwalt zu engagieren, der meine Rechte hätte vertreten können. Dabei nahte mit Riesenschritten der September, in dem die meisten Richter Urlaub zu nehmen und zuvor alle neuen Fälle bis auf Neujahr zu vertagen pflegen …
Im Grunde war ich selbst schuld. Früher wäre ich gescheiter gewesen und hätte mich gar nicht erst aufs schlüpfrige Parkett der Politik locken lassen. Eigentlich bin ich nämlich Privatermittler. Fünf Jahre lang hatte ich mich auf nichts Gefährlicheres eingelassen als Ehebruch und Unterschlagungen. Eine schöne Zeit war das: viel frische Luft und Bewegung, und obendrein half ich noch manch kleinem Geschäftsmann aus der Klemme. Ab und zu hatte ich auch weibliche Klienten (manche davon nicht unansehnlich). Überdies bezahlen Privatkunden ihre Rechnungen (im Gegensatz zum Palast, mit dem man um jeden läppischen Spesenposten feilschen muß). Sollte ich je wieder freikommen, dann würde ich mich von niemandem mehr einspannen lassen, sondern nur noch selbständig arbeiten.
Meine Frohnatur hatte unter diesen drei Tagen Haft sehr gelitten. Ich langweilte mich und ließ die Flügel hängen. Außerdem laborierte ich an den Folgen einer Verletzung: Ich hatte einen Schwerthieb in die Seite bekommen, eine jener leichten Fleischwunden, die aber bekanntlich gern eitern. Meine Mutter schickte mir zur Kräftigung warme Mahlzeiten ins Gefängnis, aber der Wärter fischte sich, ehe er sie ablieferte, immer zuerst die Fleischstücke aus der Schüssel. Bisher hatten zwei Personen versucht, mich freizubekommen; beide vergeblich. Zuerst ein wohlmeinender Senator, der bei Vespasian um Verständnis für meine Misere werben wollte; unter dem Einfluß des heimtückischen Anacrites verwehrte der Kaiser die Audienz. Dann mein Freund Petronius Longus. Petro, ein Hauptmann der Aventinischen Wache, war mit einem Weinkrug unterm Arm ins Gefängnis gekommen und hatte es beim Aufseher mit der alten Masche von Kameradschaft und Zusammenhalt probiert. Man warf ihn, samt seiner Amphore, in hohem Bogen wieder raus: Selbst unsere grundlegendsten Loyalitäten hatte Anacrites vergiftet! Womöglich würde dieser Neidhammel von einem Oberspion verhindern, daß ich je wieder auf freien Fuß kam … Die Tür ging auf. Eine Stimme krächzte: »Didius Falco, irgendwo hat doch einer ein Herz für dich! Stemm deinen Hintern hoch und scher dich raus hier!«
Als ich mich taumelnd hochrappelte, huschte die Ratte über meinen Fuß.
Kapitel 2
Mein Elend war ausgestanden – zum Teil jedenfalls.
Als ich in die Rezeption (oder das, was hier dafür herhalten mußte) hinausgestolpert kam, zurrte der Wärter gerade eine schwere Geldkatze zu und feixte dabei, als hätte er Geburtstag. Sogar seine schmutzigen Handlanger schienen von einer Bestechungssumme in dieser Höhe beeindruckt. Ich blinzelte ins ungewohnte Tageslicht und erblickte eine kleine, verhärmte, aber kerzengerade Gestalt, die mir naserümpfend entgegensah. Wir hier in Rom sind eine faire Gesellschaft. Es gibt ja jede Menge rückständiger Provinzen, wo der Präfekt seine Verbrecher angekettet als Folteropfer in petto hält, für den Fall, daß anderweitige Zerstreuungen einmal ihren Reiz verlieren. Nicht so in Rom. Hier darf jeder Verdächtige, sofern er nicht etwas ganz Furchtbares angestellt hat – oder so dumm ist und gesteht –, einen Gönner beibringen, der für ihn bürgt.
»Tag, Mutter!« Es wäre undankbar gewesen, mich in meine Zelle mit der Ratte zurückzuwünschen.
Ich konnte es ihr am Gesicht ablesen: sie hielt mich für einen ebensolchen Filou wie meinen Vater – obwohl nicht einmal Papa (der mit einer Rothaarigen durchbrannte und die arme Mama mit sieben Kindern sitzenließ) je im Kittchen gelandet war … Zum Glück hatte meine Mutter zuviel Familiensinn, als daß sie diesen Vergleich vor Fremden angestellt hätte. Also begnügte sie sich damit, dem Wärter für die Betreuung ihres Sohnes zu danken.
»Anacrites hat dich anscheinend vergessen, Falco!« Der Aufseher grinste mich an.
»Vermutlich mit Absicht.«
»Er hat übrigens nichts von einer Kaution vor dem Prozeß gesagt …«
»Er hat auch nichts von einem Prozeß gesagt«, knurrte ich wütend. »Mich ohne richterliche Anhörung in Haft zu behalten, verstößt ebenso gegen das Gesetz wie eine Kautionsverweigerung!«
»Also, wenn er klagen sollte …«
»Brauchen Sie nur zu pfeifen!« beruhigte ich ihn. »Und so geschwind, wie eine Bacchantin zweimal das Tamburin schlägt, sitze ich wieder ganz harmlos in meiner Zelle.«
»Kann ich mich darauf verlassen, Falco?«
»Aber sicher«, log ich vergnügt.
Draußen tankte ich einen tiefen Atemzug Freiheit und bereute es augenblicklich. Es war August. Wir standen am Rande des Forums. Rings ums Rostrum war die Luft fast so stickig wie in den Tiefen der Lautumiae. Der Großteil des Adels hatte sich in seine luftigen Sommervillen zurückgezogen, aber arme Schlucker wie unsereins schleppten sich weiter träge und matt durch den römischen Alltag. Diese Hitze machte jede Bewegung unerträglich.
Meine Mutter musterte ganz ungerührt ihren Galgenstrick.
»Bloß ein Mißverständnis, Mama …« Ich versuchte, mir nicht anmerken zu lassen, wie unverzeihlich demütigend es für einen Ermittler mit markigem Ruf war, von seiner Mutter gerettet zu werden. »Wer hat denn das hübsche Lösegeldsümmchen aufgebracht? Helena vielleicht?« Meine Frage bezog sich auf die unerhört vornehme Freundin, bei der ich vor einem halben Jahr hatte landen können; ich, der bis dahin nur mit Zirkuskünstlerinnen voller Flohbisse und mit Blumenmädchen gegangen war. »Nein, die Kaution habe ich gestellt; Helena hat sich dafür um deine Miete gekümmert …« Angesichts dieser plötzlichen Beistandsorgie der Frauen in meinem Leben sank mir der Mut. Ich wußte, dafür würde ich bezahlen müssen, wenn auch vielleicht nicht in barer Münze. »Mach dir nur keine Sorgen wegen des Geldes.« Der Tonfall meiner Mutter verriet, daß sie – bei einem Sohn wie mir – ihre Ersparnisse stets in Bereitschaft hielt. »Komm mit nach Hause, und ich koch dir was Gutes …«
Sie hatte offenbar vor, mich unter ihre Fuchtel zu nehmen; ich dagegen hatte vor, mein gewohntes, ungebundenes Leben wieder aufzunehmen.
»Mama, ich muß zu Helena …«
Normalerweise sollte ein Junggeselle, den sein altes Mütterchen eben erst freigekauft hat, lieber nicht gleich wieder den Weibern nachsteigen. Aber meine Mutter nickte. Zum einen war Helena Justina die Tochter eines Senators, und der Besuch bei einer so hochgestellten jungen Dame gereichte einem Stoffel wie mir zur besonderen Ehre; kein Vergleich also mit den üblichen Lasterhaftigkeiten, über die Mütter sich ereifern. Außerdem hatte Helena eben erst unser Kind verloren. Ein unglücklicher Treppensturz war mit für diese Fehlgeburt verantwortlich gewesen, aber eben nur zum Teil. Meine gesamte weibliche Verwandtschaft sah in mir den unverbesserlichen Bruder Leichtfuß. Trotzdem hätten die meisten, um Helenas willen, eingeräumt, daß es gegenwärtig meine Pflicht war, sie so oft wie möglich zu besuchen.
»Komm doch mit, Mutter!«
»Sei nicht albern! Helena will schließlich dich sehen!«
Ich war da leider nicht so zuversichtlich.
Mama wohnte hinter dem Emporium, nicht weit vom Fluß. Langsam (um zu unterstreichen, wie sehr die Sorgen um mich sie niederdrückten) überquerten wir das Forum. Bei meinem Lieblingsbad, gleich hinter dem Castortempel, ließ sie mich dann von der Leine. Ich spülte mir in den Thermen den Kerkergestank vom Leib, streifte eine Reservetunika über, die ich für Notfälle im Gymnasium hinterlegt hatte, und ging zu einem Barbier, dem es gelang, mich wieder halbwegs gesellschaftsfähig zu machen (trotz des Bluts, das er dabei vergoß).
Hinterher hatte ich zwar immer noch einen ungesunden sträflingsgrauen Teint, fühlte mich aber schon merklich wohler. Auf dem Weg zum Aventin kämmte ich mir mit den Fingern die noch feuchten Locken und versuchte, mich auf den Typ Charmeur zu trimmen, der Helenas Herz erweichen würde. In dem Augenblick ereilte mich das Unheil. Zu spät bemerkte ich die beiden Schläger, die sich so an einem Portikus aufgebaut hatten, daß sie vor jedem, der auf ihrer Straßenseite vorbei mußte, die Muskeln spielen lassen konnten. Mit Lendenschurz und Lederriemen um Knie, Hand- und Fußgelenke machten sie ganz auf harte Jungs. Ihr arrogantes Getue kam mir unheimlich bekannt vor.
»Oh, guck mal – das ist ja Falco!«
»Nein so was – Rodan und Asiacus!«
Im nächsten Augenblick hatte einer der beiden meine Oberarme nach hinten gebogen und zwischen seine Ellbogen geklemmt – eine Prozedur, bei der er so heftig an meinem Handgelenk zerrte, daß mir der Arm bis rauf zur Schulterpfanne schlingerte wie die Pißpötte auf einer Galeere im Orkan. Der Geruch der Kerle, eine Mischung aus abgestandenem Schweiß und frischem Knoblauch, trieb mir die Tränen in die Augen. »Schluß jetzt, Rodan, meine Arme sind schon lang genug …«
Diese beiden »Gladiatoren« zu nennen, wäre selbst für jene abgehalfterten Kolosse eine Beleidigung gewesen, die normalerweise in diesem Gewerbe auftreten. Rodan und Asiacus trainierten in einer Gladiatorenschule, die von meinem Vermieter Smaractus geführt wurde, und wenn sie sich nicht gegenseitig mit Übungsschwertern die Birne weichschlugen, schickte er sie los, die Straßen noch unsicherer zu machen, als diese ohnehin schon waren. In der Arena kamen sie kaum zum Einsatz; ihre Rolle in der Öffentlichkeit bestand darin, die Pechvögel einzuschüchtern, die von Smaractus eine Wohnung gemietet hatten. Den einen Vorteil hatte das Gefängnis immerhin gehabt: Ich war dort sicher gewesen vor meinem Hausherrn und seinen beiden Lieblingsschlägern.
Asiacus stemmte mich in die Luft und schüttelte mich kräftig durch. Ich ließ ihn meine Eingeweide provisorisch umschichten und wartete ab, bis ihm das zu langweilig wurde und er mich wieder aufs Pflaster stellte – dann duckte ich mich, rammte ihm den Kopf in die Kniekehlen, daß er den Halt verlor, und schleuderte ihn Rodan vor die Füße.
»Olympus! Erzählt Smaractus euch beiden denn gar nichts?« Ich brachte mich flink außer Reichweite. »Ihr hinkt mächtig nach. Meine Miete ist bezahlt!«
»Dann ist das Gerücht also wahr!« Rodan grinste hämisch. »Wir haben schon gehört, daß du dich neuerdings aushalten läßt!«
»Der Neid macht dich ganz schieläugig, Rodan! Deine Mutter hätte dich warnen sollen, so was wirkt abstoßend auf die Mädchen!« Angeblich haben Gladiatoren ja immer ganze Scharen liebestoller Frauen im Schlepptau. Rodan und Asiacus waren vermutlich in Rom die einzigen, die vor lauter Schäbigkeit keine einzige Verehrerin fanden. Asiacus rappelte sich hoch und wischte sich die Nase. Ich schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, ich vergaß: Ihr beide könntet ja nicht mal bei einem alten Fischweib landen, selbst wenn sie auf beiden Augen blind wäre und keinen Funken Schamgefühl hätte …«
Da stürzte Asiacus sich auf mich. Und nun strengten sich beide gewaltig an, mir ins Gedächtnis zu rufen, warum ich Smaractus so inbrünstig haßte.
»Das ist fürs letzte Mal, als du mit der Miete im Rückstand warst!« knurrte Rodan, der ein gutes Gedächtnis hatte.
»Und das ist fürs nächste Mal!« fügte Asiacus hinzu – ein Realist mit erstaunlichem Weitblick.
Wir hatten diesen schmerzlichen Tanz schon so oft geprobt, daß ich wußte, wie ich den beiden entwischen konnte. Eilig machte ich mich aus dem Staub, nicht ohne über die Schulter noch ein, zwei Beleidigungen abzulassen. Die beiden waren entschieden zu faul, mich zu verfolgen.
Seit einer Stunde erst war ich auf freiem Fuß, und schon hatte man mich übel zugerichtet; direkt entmutigend. In einer Stadt der Hausbesitzer ist die Freiheit kein ungetrübtes Vergnügen.
Kapitel 3
Helena Justinas Vater, der Senator Camillus Verus, hatte ein Haus nahe der Porta Capena. Eine sehr schöne Wohngegend, gleich hinter der Via Appia, beim Abzweig von der republikanischen Stadtmauer. Auf dem Weg dorthin machte ich abermals in einem Badehaus halt und ließ mir die neuen Blessuren verarzten. Zum Glück zielten Rodan und Asiacus immer auf den Brustkorb ihrer Opfer, und so war mein Gesicht unverletzt geblieben; wenn ich mir das Stöhnen verbeißen konnte, brauchte Helena nichts von dem Zwischenfall zu erfahren. Ein blasser syrischer Apotheker verkaufte mir für die Schwertwunde in der Leiste eine Salbe. Leider schlug die als bläulicher Fettfleck auf die Tunika durch. Wie Schimmel an einem Mauerverputz sah das aus; nichts, womit man bei den feinen Herrschaften von der Porta Capena würde Eindruck schinden können.
Der Pförtner des Senators kannte mich zwar, verweigerte mir jedoch den Zutritt. Nun, ich hielt mich gar nicht lange mit diesem Windbeutel auf, sondern borgte mir an der nächsten Ecke den Hut eines Straßenarbeiters, flitzte zurück und klopfte, die Krempe tief in die Stirn gezogen, abermals. Als der Pförtner auf den Trick hereinfiel und dem vermeintlichen Lumpenhändler aufsperrte, drängte ich mich blitzschnell an dem Tölpel vorbei und verpaßte ihm dabei als Denkzettel einen saftigen Tritt gegen den Knöchel.
»Dich würde ich für einen Quadrans aussperren! Ich bin Falco, du Schafskopf! Wenn du mich jetzt nicht unverzüglich bei Helena Justina meldest, werden deine Erben sich eher als du denkst darüber streiten, wer deine besten Sandalen kriegt!«
Nachdem ich erst einmal drin war, behandelte er mich mit mürrischem Respekt – will sagen, er schlurfte zurück in seine Nische und aß einen Apfel zu Ende, indes ich mich auf eigene Faust nach meiner Prinzessin umsah.
Ich fand sie in einem Gesellschaftszimmer. Helena war blaß, schwang aber schon wieder fleißig die Feder. Sie war drei-, inzwischen vielleicht auch schon vierundzwanzig; ich wußte nämlich nicht, wann sie Geburtstag hatte. Ja, selbst nachdem ich mit ihrem Liebling im Bett gewesen war, luden der Senator und seine Frau mich noch immer nicht zu ihren Familienfesten ein. Daß sie mich überhaupt zu Helena ließen, lag an deren Eigensinn, vor dem sogar ihre Eltern kapitulierten. Als ich Helena kennenlernte, hatte sie bereits eine Ehe hinter sich, die auf ihr Betreiben geschieden worden war; als Grund hatte sie damals – wie exzentrisch! – angegeben, daß ihr Mann nie mit ihr reden wolle. Ihre Eltern wußten also aus Erfahrung, was für ein Quälgeist ihre älteste Tochter war.
Helena Justina war eine hochgewachsene, vornehme Erscheinung, deren glattes, dunkles Haar man mit der Lockenschere gemartert hatte, wogegen es sich jedoch gut behauptete. Sie hatte hübsche braune Augen, für die Kosmetik eigentlich überflüssig war, aber Helenas Zofen schminkten sie grundsätzlich. Schmuck trug sie daheim kaum, aber das kam ihrer Ausstrahlung eher zugute. In Gesellschaft war sie schüchtern; sogar zu zweit mit einem so engen Freund, wie ich es war, hätte man sie für scheu halten können – bis sie den Mund aufmachte und ihre Meinung kundtat. Dann allerdings stob sogar eine wilde Hundemeute auseinander und suchte mit eingezogenem Schwanz Deckung. Ich bildete mir ein, es mit ihr aufnehmen zu können – aber ich hatte es noch nie drauf ankommen lassen.
Ich blieb in der Tür stehen und setzte mein gewohntes freches Grinsen auf. Helenas liebes, natürliches Begrüßungslächeln war das Schönste, was ich seit einer Woche gesehen hatte. »Warum sitzt ein schönes Mädchen wie du allein im Zimmer und schreibt Rezepte auf?«
»Ich übersetze einen griechischen Historiker«, erklärte Helena wichtigtuerisch. Ich linste ihr über die Schulter. Es war ein Rezept für gefüllte Feigen.
Ich beugte mich vor und gab ihr einen Kuß auf die Wange. Seit dem Verlust unseres Babys, den wir beide noch nicht verwunden hatten, war unser Verhältnis quälend steif und verkrampft gewesen. Jetzt aber tastete ihre Rechte nach meiner, und unser beider Hände umklammerten sich mit einer Inbrunst, die den verknöcherten alten Juristen in der Basilica Julia womöglich für eine Anzeige gereicht hätte.
»Ich freue mich so, daß du gekommen bist!« flüsterte Helena.
»Um mich von dir zu trennen, braucht es schon mehr als Kerkermauern.« Ich hob ihre Hand an meine Wange. Helenas damenhafte Finger dufteten nach einer ausgefallenen Mischung indischer Essenzen und Gallapfeltinte – kein Vergleich mit den schweren Parfumwolken der Flittchen, die ich früher gekannt hatte. »Herzensdame, ich liebe dich«, gestand ich ihr (immer noch im Überschwang meiner neugewonnenen Freiheit). »Und das nicht nur, weil ich rausgekriegt habe, daß du meine Miete bezahlt hast!« Sie rutschte von ihrem Stuhl und barg den Kopf in meinem Schoß. Die Tochter eines Senators würde sich bestimmt nicht von einem Haussklaven erwischen lassen, wie sie sich bei einem Sträfling ausweint – aber ich streichelte ihr trotzdem tröstend den Hals, nur zur Sicherheit. Außerdem bot Helenas Nacken ein reizvolles Betätigungsfeld für eine müßige Hand.
»Ich weiß gar nicht, warum du dich mit mir abgibst«, sagte ich nach einer Weile. »Ich bin doch ein Versager, hause in einem elenden Loch, habe kein Geld. Sogar die Ratte in meiner Zelle hatte nur ein spöttisches Grinsen für mich übrig. Und jedesmal, wenn du mich brauchst, lasse ich dich hängen …«
»Hör auf zu jammern, Falco!« Als Helena aufblickte, sah ich den Abdruck meiner Gürtelschnalle auf ihrer Wange, doch sonst hatte sie sich wieder ganz gefangen.
»Ich habe einen Beruf, der den meisten Leuten zu anrüchig wäre«, klagte ich unbeirrt weiter. »Mein eigener Auftraggeber wirft mich ins Gefängnis und vergißt mich dann einfach …«
»Man hat dich aber doch freigelassen …«
»Nicht direkt«, gestand ich.
Helena regte sich nie unnötig über etwas auf, das ich ihrer Meinung nach selbst ins reine bringen mußte. »Also, was hast du jetzt vor?«
»Ich werde wieder freiberuflich arbeiten.« Helena schwieg. Jetzt wußte sie, warum ich so niedergeschlagen war. Mein famoser Plan hatte nämlich einen großen Haken: Als Selbständiger würde ich nie soviel verdienen wie im Dienst des Kaisers – obwohl das reine Theorie war, da Vespasians Lohnbuchhalter mich monatelang auf mein Geld warten ließen. »Glaubst du, daß ich eine Dummheit mache?«
»Nein, du hast ganz recht mit deiner Entscheidung!« Helena pflichtete mir ohne Zögern bei, obwohl sie genau wußte, daß ich mir als Freischaffender die Einheirat in den Patrizierstand nie und nimmer würde leisten können.
»Du hast für den Staat dein Leben aufs Spiel gesetzt. Vespasian hat dich engagiert, weil er genau wußte, was du wert bist. Marcus, du hast es nicht nötig, dich von einem knauserigen Arbeitgeber mit Almosen abspeisen und von häßlichen Palastintrigen schikanieren zu lassen …«
»Aber Herzblatt, du weißt, was es bedeutet, wenn …«
»Ich habe dir doch gesagt, daß ich auf dich warten werde!«
»Und ich habe dir gesagt, daß ich das nicht zulasse.«
»Du weißt doch, ich tue nie, was du sagst.«
Ich grinste, und dann saßen wir noch ein paar Minuten schweigend beisammen.
Nach dem Gefängnis war dieser Raum im Hause ihres Vaters der reinste Hort der Geborgenheit. Teppiche und quastengesäumte Kissen sorgten für unsere Bequemlichkeit; dickes Mauerwerk dämpfte die Straßengeräusche, indes an der Gartenseite durch hohe Fenster das Licht hereinströmte und die imitierten Marmorwände mit dem goldenen Schimmer reifen Weizens übergoß. Es war ein kultiviertes Heim, auch wenn hier und da der Putz ein wenig bröckelte. Helenas Vater war Millionär (das hatte nicht etwa meine Spürnase rausgekriegt, nein, es war einfach die Voraussetzung für die Aufnahme in den Senat); gleichwohl mußte er sich einschränken in einer Stadt, wo Wählerstimmen nur den Multimillionären zuflogen.
Natürlich war ich noch viel schlechter dran. Ich besaß weder Geld noch Rang. Um Helena einen angemessenen Lebensstil bieten zu können, würde ich vierhunderttausend Sesterzen aufbringen und den Kaiser dazu überreden müssen, mich in die Liste von Jammerlappen aufzunehmen, die den Mittelstand bilden. Selbst wenn ich das je schaffen sollte, wäre ich für Helena immer noch eine schlechte Partie.
Helena erriet meine Gedanken. »Du, Marcus, ich habe gehört, dein Pferd hätte das Rennen im Circus Maximus gewonnen.« O ja, das Leben sorgt hin und wieder für einen Ausgleich: Besagten Gaul, der auf den Namen Goldschatz hörte, verdankte ich einer unverhofften Erbschaft. Ich konnte mir zwar kein Pferd leisten, doch bevor ich Goldschatz verkaufte, hatte ich ihn noch für ein einziges Rennen angemeldet – das er wider Erwarten gewann. »Das stimmt schon, Helena. Ich habe bei diesem Rennen ein schönes Stück Geld verdient. Vielleicht leiste ich mir damit eine anständige Wohnung, die besser situierte Klienten anlockt.« Helena, den Kopf an mein Knie geschmiegt, nickte beifällig. Sie hatte das Haar mit einem Pantheon elfenbeinerner Nadeln aufgesteckt: Jeder Knauf war als streng dreinblickende Göttin geschnitzt.
Ganz vertieft in den Gedanken an meine Geldnöte, hatte ich eine Nadel herausgezogen. Die steckte ich mir wie einen Jagddolch in den Gürtel und machte dann, aus lauter Übermut, auch Jagd auf die übrigen. Helena wehrte sich leicht gereizt und hielt mich an den Handgelenken fest, womit sie schließlich nur erreichte, daß ich meine Handvoll Haarnadeln am Boden verstreute. Ich überließ es Helena, sie einzusammeln, während ich meinen Plan systematisch weiterverfolgte.
Als ich ihre Frisur ganz gelöst hatte, war Helena auch wieder im Besitz ihrer Haarnadeln – die eine, die ich in den Gürtel gesteckt hatte, ließ sie mich allerdings behalten. Ich habe sie immer noch: Flora, mit Rosen bekränzt, von denen sie offenbar Heuschnupfen kriegt; sie fällt mir manchmal in die Hände, wenn ich in meinem Pult nach verlegten Schreibfedern krame.
Fächerförmig, so wie ich es mag, breitete ich Helenas Haar aus. »Schon besser! Jetzt siehst du eher aus wie ein Mädchen, das sich vielleicht küssen läßt – ja, du siehst sogar aus wie eine, die mich womöglich wiederküßt …« Ich nahm ihre Arme und legte sie um meinen Hals.
Es war ein langer, sehr inniger Kuß. Und nur weil ich Helena sehr gut kannte, spürte ich, daß meine Leidenschaft bei ihr auf ungewohnten Widerstand stieß.
»Nanu? Liebst du mich etwa nicht mehr, Spatzenfuß?«
»Marcus, ich kann einfach nicht …«
Ich begriff. Die Fehlgeburt war ein seelischer Schock gewesen, wie sie ihn nicht noch einmal erleben wollte. Vielleicht hatte sie auch Angst davor, mich zu verlieren. Wir kannten beide mehr als einen flotten, charakterfesten Jungrömer, der eine verzweifelte Freundin in diesem Zustand glatt sitzenlassen würde.
»Verzeih …« Es war ihr peinlich, und sie wollte sich losmachen. Aber sie war immer noch meine Helena. Sie sehnte sich ebenso sehr nach meiner Umarmung, wie ich mich danach, sie zu halten. Und sie brauchte Trost – auch wenn sie mir das ausnahmsweise einmal nicht zeigen konnte.
»Mein Liebes, das ist doch ganz natürlich.« Ich lehnte mich zurück und sah ihr in die Augen. »Es wird schon alles wieder gut …« Ich mußte ihr Mut machen und versuchte mein Bestes, auch wenn es schwer war, die Enttäuschung wegzustecken. Im stillen fluchte ich, und Helena muß das gespürt haben.
Äußerlich gefaßt, blieben wir noch einige Zeit sitzen und sprachen über Familienangelegenheiten (von Haus aus kein gutes Thema), bis ich mich mit dringenden Geschäften entschuldigte. Helena brachte mich zur Tür. Der Pförtner schien sich inzwischen in Luft aufgelöst zu haben, darum schob ich selbst den Riegel zurück. Plötzlich schlang sie die Arme um mich und vergrub ihr Gesicht an meinem Hals. »Jetzt wirst du wohl anderen Frauen nachlaufen!«
»Natürlich!« Den scherzhaften Ton kriegte ich ganz gut hin, aber ihre großen, schmerzgetrübten Augen schafften mich. Ich küßte ihre Lider, und dann, wie um mich selbst zu quälen, preßte ich sie an mich und hob sie in meinen Armen hoch. »Laß uns zusammenziehen!« Es war mir einfach so rausgerutscht. »Allein die Götter wissen, wie lange es noch dauert, bis ich genug verdiene, um dir ein ehrbares Leben bieten zu können. Aber ich will dich immer bei mir haben. Und wenn ich eine größere Wohnung nehme …«
»Marcus, ich fürchte nur …«
»Vertrau mir.«
Helena lächelte und zupfte mich am Ohrläppchen, die sicherste Methode, unser Problem zum Dauerzustand zu machen. Aber sie versprach wenigstens, sich meinen Vorschlag zu überlegen. Auf dem Heimweg zum Aventin wurde mein Schritt zusehends leichter. Auch wenn meine Herzensdame noch nicht bei mir einziehen wollte, eine schönere Wohnung mieten konnte ich mit meinem Renngewinn jedenfalls schon mal … Angesichts dessen, was mich daheim erwartete, war schon der Gedanke ans Umziehen eine Wohltat.
Und dann fiel es mir wieder ein. Bevor sie mich einsperrten, hatte meine dreijährige Nichte die uneingelösten Wettmarken verschluckt.
Kapitel 4
Die Wäscherei Adler an der Brunnenpromenade.
Von sämtlichen trostlosen Mietskasernen in all den garstigen Hinterhöfen Roms ist gewiß keine so heruntergekommen wie die Brunnenpromenade. Sie liegt nur fünf Minuten von der Ausfallstraße nach Ostia, einer der belebtesten Verkehrsadern des Reiches, und doch scheint dieser Eiterherd in der Achselhöhle des Aventin in eine andere Welt zu gehören. Hoch oben auf dem Zwillingsgipfel thronen die Tempel von Venus und Diana, aber wir sind zu dicht dran, um aus dem tiefen, finsteren Labyrinth bis hinauf zu diesen stolzen Bauten sehen zu können. Es ist eine preiswerte Wohngegend – jedenfalls für römische Verhältnisse. Mancher von uns hätte dem Hausherrn gern einen Aufpreis dafür gezahlt, daß er ein paar tüchtige Gerichtsvollzieher anheuern und unsere Zwangsräumung in eine bessere Gegend mit frischer Luft veranlassen würde.
Meine Wohnung lag im obersten Stock eines verwinkelten, baufälligen Hauses. Das ganze Erdgeschoß war von einer Wäscherei belegt; die abholfertigen Tuniken waren das einzig Saubere in der Nachbarschaft. Aber kaum hatte man sie angezogen, genügte oft schon ein kurzer Gang über die verdreckte, einspurige Gasse, die uns zugleich als Verkehrsweg und provisorischer Abwasserkanal diente, und ihre fleckenlose Reinheit war wieder dahin. Dafür sorgten die Rußflocken aus dem Lampenschwarzkessel, in dem der einäugige Schreibwarenlieferant seine übelriechende Tinte kochte, ebenso wie der Rauch der wabenartigen Backöfen, in denen Cassius, unser Stammbäcker, einen Laib Brot so gründlich verkohlen konnte wie kein zweiter seiner Zunft.
Das hier war ein gefährliches Pflaster: Nur ein Moment der Unachtsamkeit, und schon versank ich knöcheltief in zähem braunen Mist. Während ich mir fluchend den Schuh am Bordstein säuberte, streckte Lenia, die Besitzerin der Wäscherei, den Kopf hinter einer Leine voll Tuniken hervor. Mich sehen und spottbereit hervorstürzen war eins. Sie war eine schlecht frisierte Schlampe und kam so ungraziös angewatschelt wie ein Schwan beim Landgang: mit wirr zerzausten, schmutzigrot gefärbten Haaren, wäßrigen Augen und einer Stimme, die heiser war von zu vielen Krügen schlecht vergorenen Weins.
»Falco! Wo hast du denn die ganze Woche gesteckt?«
»Ich war auswärts.«
Merkte sie, daß ich auf die Lautumiae anspielte? Nicht, daß Lenia das etwas ausgemacht hätte. Sie war zu träge, um Neugier zu entwickeln, außer auf streng geschäftlichem Sektor. Zum Beispiel interessierte es sie brennend, ob mein mieser Vermieter Smaractus sein Geld bekam – und selbst darauf war sie erst wirklich neugierig geworden, nachdem sie sich Smaractus als Ehemann ausgeguckt hatte. Eine Entscheidung, die auf rein finanziellen Motiven beruhte (Smaractus, der jahrzehntelang die Armen auf dem Aventin geschröpft hatte, war nämlich dabei reich wie Crassus geworden). Und nun plante Lenia ihre Hochzeit kühl und besonnen wie ein Chirurg (also in der Gewißheit, daß der Patient sie reichlich für ihre Dienste entlohnen würde, wenn sie ihn erst einmal aufgeschlitzt hätte …).
»Wie ich höre, bin ich ausnahmsweise schuldenfrei.« Ich grinste sie an.
»Endlich hast du kapiert, worauf’s bei einer Frau ankommt, und dir die richtige geangelt.«
»Stimmt. Ich verlaß mich dabei ganz auf mein Gesicht – ebenmäßig wie parischer Marmor …«
Lenia, eine gestrenge Kritikerin der schönen Künste, lachte spöttisch. »Aber Falco, du bist höchstens eine billige Fälschung!«
»Ich doch nicht – ich kann die Expertise einer Dame von untadeligem Ruf vorweisen! Ihr macht es Freude, mich zu verwöhnen. Was ich natürlich auch verdient habe … Wieviel hat sie übrigens beigesteuert?«
Als Lenia den Mund aufmachte, sah ich, daß sie drauf und dran war, mich zu beschwindeln. Doch dann fiel ihr ein, daß Helena Justina mich aufklären würde, sollte ich je den Anstand aufbringen, meine Schulden zu erwähnen. »Drei Monatsmieten, Falco.« »Beim Jupiter!« Der Schock brachte meinen ganzen Organismus durcheinander. Das Höchste, was ich bereit war, für die Pensionskasse meines Vermieters zu spenden, waren drei Wochen (selbstverständlich rückwirkend). »Smaractus muß sich ja vorkommen wie auf einem Regenbogen im Olymp!«
Lenias Miene umwölkte sich, woraus ich schloß, daß Smaractus noch gar nichts von seinem Glück wußte. Sie wechselte hastig das Thema. »Übrigens hat dauernd einer nach dir gefragt.«
»Etwa ein Klient?« Ich überlegte fieberhaft, ob der Oberspion wohl schon entdeckt hatte, daß ich ausgeflogen war. »Hast du seinen Auftrag notiert?«
»Also, da hab ich wirklich Besseres zu tun, Falco! Nein, er schaut jeden Tag rein, und jedesmal sag ich ihm, daß du nicht da bist …« Ich seufzte erleichtert. Anacrites hätte vor heute nachmittag keinen Grund gehabt, nach mir zu suchen.
»Tja, nun bin ich ja wieder da!« Ich war zu müde zum Rätselraten. Ich stiefelte die Treppe hoch in den sechsten Stock, den billigsten im ganzen Haus. Der Weg nach oben bot reichlich Gelegenheit, mich wieder mit dem Geruch von Urin und alten Kohlstrünken vertraut zu machen; mit dem verkrusteten Taubendreck auf jeder Stufe; den Graffiti – nicht alle in Kinderhöhe – von brünstigen Wagenlenkern; mit den Flüchen gegen Buchmacher und den pornographischen Kleinanzeigen. Von meinen Nachbarn kannte ich kaum jemanden, aber ihre zänkischen Stimmen waren mir vom Vorbeigehen im Treppenhaus vertraut. Manche Türen waren dauernd geschlossen, so daß man bedrückende Geheimnisse dahinter vermutete; andere Familien hängten nur einen Vorhang vor den Eingang, so daß die Nachbarn notgedrungen an ihrem trostlosen Leben teilhatten. Eine verrückte alte Dame im dritten Stock saß immer auf ihrer Schwelle und brabbelte hinter jedem Vorbeikommenden her; ich grüßte sie ausgesucht freundlich, was sie prompt mit einem Schwall giftiger Verwünschungen quittierte.
Ich war aus der Übung; als ich endlich meinen Adlerhorst erklommen hatte, schlackerten mir die Knie. Einen Augenblick lang blieb ich stehen und lauschte: eine Berufskrankheit. Dann schob ich den einfachen Schnappriegel zurück und stieß die Tür auf.
Daheim. Die Sorte Wohnung, die man betritt, um seine Tunika zu wechseln und die Mitteilungen seiner Freunde zu lesen, bevor man sie unter dem erstbesten Vorwand wieder verläßt. Aber heute hätte ich die Schreckgespenster auf der Treppe kein zweites Mal ertragen, also blieb ich da.
Mit vier Schritten konnte ich mein ganzes Reich durchmessen: das Büro mit dem billigen Tisch und der wackligen Bank, dahinter das Schlafzimmer mit der windschiefen Konstruktion, die mir als Bett diente. In beiden Räumen herrschte jene beunruhigende Ordnung, die sich einstellte, wenn meine Mutter drei Tage lang ungestört und nach Herzenslust hatte aufräumen können. Ich blickte mich argwöhnisch um, aber es sah nicht so aus, als wäre außer ihr noch jemand hier gewesen. Dann schickte ich mich an, die Wohnung wieder gemütlich zu machen. Rasch hatte ich die spärlichen Möbel schief gerückt, die Bettwäsche zerwühlt, beim Wiederbeleben meiner Balkonpflanzen überall Wasser verschüttet und alles, was ich am Leibe trug, auf dem Fußboden verstreut.
Danach ging es mir besser. Jetzt fühlte ich mich wirklich daheim.
Auf dem Tisch war, so auffallend, daß selbst ich sie nicht übersehen konnte, eine griechische Keramikschale plaziert, die ich einmal für zwei Kupfermünzen und ein verwegenes Lächeln an einem Antiquitätenstand ergattert hatte. Sie war halb voll mit zerkratzten beinernen Plättchen, von denen manche eine ganz merkwürdige Färbung aufwiesen. Mir stockte der Atem. Das letzte Mal hatte ich diese Dinger bei jener gräßlichen Familienfeier gesehen, wo meine kleine Nichte Marcia sie sich als Spielzeug erkoren und zum größten Teil verschluckt hatte: meine Wettmarken.
Wenn ein Kind etwas gegessen hat, worauf man eigentlich nicht verzichten möchte, dann gibt es – vorausgesetzt, man hängt an dem Kind – nur einen Weg, das Zeug zurückzubekommen. Ich kannte diese ekelhafte Prozedur von damals, als mein Bruder Festus den Ehering unserer Mutter verschluckt hatte und ich hinterher das Vergnügen hatte, ihm suchen zu helfen. (Bis er in Judaea ums Leben kam, was meinen brüderlichen Pflichten ein Ende setzte, war es Tradition in unserer Familie, daß Festus immer wieder in irgendeine Klemme geriet und ich mich jedesmal dazu breitschlagen ließ, ihm rauszuhelfen.) Der Verzehr von Familienpretiosen war offenbar erblich bei uns; und ich hatte gerade drei Tage im Gefängnis dafür gebetet, daß das liebe, aber beschränkte Kind meines beschränkten Bruders Durchfall kriegen möge …
Ich hätte mir die Mühe sparen können. Irgendeine dickköpfige Verwandte – wahrscheinlich meine Schwester Maia, die als einzige von uns Organisationstalent besaß – hatte meine Spielmarken heldenmütig gerettet. Zur Feier des Tages lüpfte ich ein Dielenbrett, unter dem ich einen halbvollen Weinkrug vor Gästen versteckt hielt, setzte mich damit auf den Balkon, legte die Füße auf die Brüstung und widmete mich in aller Ruhe dem stärkenden Trunk.
Kaum, daß ich’s mir gemütlich gemacht hatte, kam schon Besuch.
Ich hörte ihn eintreten, denn nach dem langen Aufstieg schnaufte er vernehmlich. Obwohl ich nicht muckste, fand er mich. Er stieß die Flügeltür auf und sprach mich ganz frech an: »Sind Sie dieser Falco?«
»Schon möglich.«
Seine Arme waren spindeldürr, und sein dreieckiges Gesicht lief spitz in einem Winzlingskinn aus. Ein schmaler schwarzer Schnurrbart reichte fast von einem Ohr bis zum anderen. Dieser Schnurrbart sprang ins Auge. Er halbierte das Gesicht, das zu alt war für den dazugehörigen Jünglingskörper und eher zu einem Flüchtling aus einer Provinz gepaßt hätte, die seit zwanzig Jahren unter Hungersnöten und Stammesfehden litt. Die Wirklichkeit war weit weniger dramatisch. Mein Besucher war ganz einfach ein Sklave.
»Wer fragt denn nach Falco?« Inzwischen hatte mich die Nachmittagssonne so wohlig aufgewärmt, daß es mir eigentlich egal war.
»Ein Bote aus dem Hause des Hortensius Novus.«
Er sprach mit leicht fremdländischem Akzent, aber beileibe nicht das Kauderwelsch, mit dem sich die Kriegsgefangenen unweigerlich auf dem Sklavenmarkt infizieren. Der hier hatte sein Latein vermutlich schon als Kind gelernt und konnte sich kaum noch an seine Muttersprache erinnern. Er hatte blaue Augen, und ich hielt ihn für einen Kelten.
»Darf ich fragen, wie du heißt?«
»Hyacinthus!«
Der ruhige, feste Blick, mit dem er seinen Namen nannte, warnte mich, ihn nur ja nicht deswegen zu verspotten. Als Sklave hatte er genug Probleme, auch ohne daß jeder sich über ihn lustig machte, bloß weil irgendein verkaterter Aufseher ihm den Namen einer griechischen Blume verpaßt hatte.
»Sehr erfreut, Hyacinthus.« Ich hatte keine Lust, mir die Retourkutsche einzufangen, die er bestimmt schon parat hatte. »Dein Herr, dieser Hortensius, ist mir gänzlich unbekannt. Was hat er denn für Kummer?«
»Wenn Sie ihn selbst fragten, würde er sagen, keinen.«
Leute, die einen Detektiv engagieren, sprechen oft in Rätseln. Kaum ein Klient scheint Manns genug, geradeheraus zu fragen: Was muß ich zahlen, damit Sie beweisen, daß meine Frau mit meinem Kutscher schläft?
»Warum hat er dich dann hergeschickt?« fragte ich geduldig. »Seine Verwandten schicken mich«, korrigierte Hyacinthus. »Hortensius Novus hat keine Ahnung, daß ich hier bin.«
Die Antwort schien dafür zu bürgen, daß bei dem Fall Denare winkten, und schon bedeutete ich Hyacinthus, sich zu mir auf die Bank zu setzen: Heimlichkeiten bedeuten ein höheres Honorar, und das möbelt mich immer auf.
»Danke, Falco, Sie sind ein feiner Mann!« Hyacinthus bezog meine Einladung nicht nur auf einen Sitzplatz, sondern, sehr zu meinem Verdruß, auch auf meinen Weinkrug. Er trottete zurück in die Wohnung und suchte sich einen Becher. Als er sich schließlich unter meiner Rosenlaube niederließ, wollte er wissen: »Ist das in Ihren Augen ein geschmackvoller Rahmen, um Klienten zu empfangen?«
»Meine Klienten sind leicht zu beeindrucken.«
»Aber so eine Absteige! Oder ist das bloß einer der Schlupfwinkel, die Sie sich in Rom halten?«
»So was in der Art, ja.«
»Es war die einzige Adresse, die wir hatten.« Es war auch die einzige, die ich hatte. Er probierte einen Schluck Wein, spuckte ihn aber gleich wieder aus. »Parnassus!«
»Das Geschenk eines dankbaren Klienten.« Nicht dankbar genug. Ich goß mir nach, ein Vorwand, um den Weinkrug aus seiner Reichweite zu manövrieren. Er musterte mich eingehend. Meine Ungezwungenheit machte ihn skeptisch. Die Welt ist wirklich voll von glatthaarigen Schnöseln, die glauben, ein Lockenkopf mit einem gewinnenden Lächeln könne kein guter Geschäftsmann sein.
»Meinen Ansprüchen genügt die Bude.« Daraus sollte er schließen, wer es in einem solchen Rattenloch aushielt, müsse ein zäher Bursche sein, auch wenn er nicht so aussah. »Die Leute, an denen mir was liegt, wissen, wo sie mich finden – während die vielen Treppen die abschrecken, denen ich lieber aus dem Weg gehe … Also schön, Hyacinthus, ich gehe zwar sonst nicht mit meinen Dienstleistungen hausieren, aber hier hast du mein Angebot: Ich beschaffe Informationen vornehmlich privater Natur …«
»Scheidungen?« übersetzte er feixend meinen Euphemismus.
»Genau! Außerdem nehme ich für besorgte Väter angehende Schwiegersöhne unter die Lupe oder kläre frischgebackene Erben darüber auf, ob man ihnen vielleicht bloß einen Berg Schulden aufhalsen will. Ich erledige Laufereien für Anwälte, die noch nicht genügend Beweise haben – auf Wunsch inklusive Auftritt vor Gericht. Ich habe Beziehungen zu Auktionshäusern und bin spezialisiert auf die Wiederbeschaffung wertvoller gestohlener Kunstwerke. Dagegen lasse ich die Finger von Deserteuren und treibe keine Schulden ein. Und ich arrangiere niemals Gladiatorenkämpfe.«
»Zimperlich?«
»Lebenserfahren.«
»Wir werden Referenzen einholen müssen.«
»Ich auch! Ich übernehme nur einwandfreie Aufträge.«
»Wie hoch sind Ihre Sätze, Falco?«
»Das hängt davon ab, wie kompliziert der Fall ist. Generell berechne ich Erfolgshonorar plus Tagesspesen. Und ich gebe keinerlei Garantie, abgesehen von dem Versprechen, mein Bestes zu tun.«
»In welcher Sache ermitteln Sie eigentlich für den Palast?« platzte Hyacinthus plötzlich heraus.
»Ich arbeite im Augenblick nicht für den Palast.« Das klang sehr nach höchster Geheimhaltungsstufe, ein vorteilhafter Effekt.
»Bist du deshalb hier?«
»Meine Herrschaft meinte, ein Palastdetektiv sei von Haus aus eine gute Empfehlung.«
»Ihr Fehler! Aber wenn sie mich engagieren, werde ich anständige Arbeit leisten und diskret sein. Also, Hyacinthus, was ist – sind wir im Geschäft?«
»Ich muß Sie bitten, zu uns zu kommen. Dort wird man Ihnen den Fall erläutern.«
Ich hatte ohnehin vorgehabt, hinzugehen. Ich nehme die Leute, die mich bezahlen sollen, gern vorher unter die Lupe. »Aha, und wo wohnt deine Herrschaft?«
»In der Nähe der Via Lata. Auf dem Pincio.«
Ich stieß einen Pfiff aus. »Beneidenswert! Demnach sind Hortensius und seine Familie Leute von Stand?«
»Freigelassene.«
Ex-Sklaven! Das war Neuland für mich, aber mal was anderes als die rachsüchtigen Beamten und das scheinheilige Getue mancher Senatoren, mit denen ich mich bislang hatte herumschlagen müssen.
»Irgendwelche Einwände?« erkundigte sich Hyacinthus neugierig. »Warum, wenn sie zahlen können?«
»Oh … war nur ’ne Frage«, sagte der Sklave.
Er trank seinen Becher aus, in der Annahme, ich würde ihm nachschenken, aber da hatte er sich getäuscht.
»Sie finden uns auf der Seite der Via Flaminia, Falco. Jeder im Viertel kann Ihnen das Haus zeigen.«
»Wenn Hortensius Novus nichts von meiner Mission erfahren darf – wann soll ich dann am besten kommen?«
»Tagsüber. Er ist Geschäftsmann und verläßt das Haus für gewöhnlich gleich nach dem Frühstück.«
»In welcher Branche ist er denn?« Es war eine reine Routinefrage, aber die Art, wie Hyacinthus sie achselzuckend überging, machte mich stutzig. »Na schön, und nach wem soll ich fragen?«
»Sabina Pollia – oder wenn die nicht da ist, wenden Sie sich an Hortensia Atilia –, aber die Initiative geht von Pollia aus.«
»Die Gattin?«
Er lächelte verschmitzt. »Novus ist nicht verheiratet.«
»Halt, du brauchst mir nichts weiter zu erklären! Die Damen des Hauses wollen mich also engagieren, damit ich ein Frauenzimmer verscheuche, das es nur auf Novus’ Geld abgesehen hat?« Hyacinthus schien beeindruckt. »Wenn ein Junggeselle schon das Haus voll gefährlicher Weiber hat – und behaupte ja nicht, daß es bei Hortensius anders wäre, denn schließlich bist du hinter seinem Rücken in ihrem Auftrag hier –, warum fällt ihm dann eigentlich nichts Besseres ein, als sein Dilemma durch eine Heirat zu lösen? Wie kann man bloß so naiv sein?«
»Soll das heißen, Sie ermitteln nicht gegen Bräute, die ihre Kavaliere ausnehmen?«
»Aber andauernd!« versicherte ich unwirsch. »Solche Brieftaschenbräute sind geradezu der goldene Boden meines Gewerbes!«
Beim Abschied sagte er noch: »Falls Sie mal daran denken sollten, sich eine anständige Wohnung zu nehmen …«
»Möglich, daß ich schon eine suche.« Ich begleitete ihn nur bis zur Balkontür.
»Dann wenden Sie sich an Cossus«, empfahl Hyacinthus hilfsbereit. »Das ist ein Makler auf dem Vicus Longus – ein bißchen schlafmützig zwar, aber dafür reell. Er hat eine Menge netter Objekte an der Hand, speziell für Geschäftsleute. Berufen Sie sich auf mich, dann wird er sich Ihrer bestimmt annehmen …« »Danke. Vielleicht komme ich darauf zurück.« Ich dachte mir, daß Hyacinthus für seinen Tip sicher ein Trinkgeld erwartete. Nun trage ich, eingenäht im Saum meiner Tunika, immer einen halben Golddenar bei mir, aber den hätte ich um nichts in der Welt einem Sklaven geopfert. Leider fand sich sonst nichts als ein abgegriffener Kupferas, und den hätte kein Latrinenwärter, der etwas auf sich hielt, als Trinkgeld angenommen.
»Danke, Falco, das dürfte meinen Freikauffonds gehörig aufstocken!«
»Tut mir leid, aber ich konnte die letzten Tage nicht auf die Bank!«
Ich versuchte, ihm meinen Aufenthalt in den Lautumiae als eine Art Geheimmission im Süden Partheniens unterzujubeln, damit er meinen potentiellen Klienten auch etwas Zufriedenstellendes über mich berichten konnte.
Kapitel 5
Der Freigelassene Hortensius Novus wohnte im Norden der Stadt, an den duftenden Hängen des Pincio. Die schlichte, schmucklose Mauer, die das Anwesen umgab, war hoch genug, um das Haus vor neugierigen Blicken zu schützen, falls denn einer der betuchten Nachbarn so nahebei gewohnt hätte. Was aber nicht der Fall war. In dieser Gegend sind nämlich die Gärten der Privatvillen noch größer als die öffentlichen Parks, denen man gnädigerweise die unbedeutenden Zwischenräume überließ. Und wenn ich Ihnen verrate, daß von letzteren einer der Garten des Lukull war, den Kaiserin Messalina so schön fand, daß sie seinen Besitzer zum Selbstmord zwang, als der partout nicht verkaufen wollte, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie erst die privaten Herrensitze auf dem Pincio aussehen.
Ich quasselte mich am Pförtnerhaus der Hortensius-Sippe vorbei und stiefelte die breite, kiesbestreute Auffahrt hoch. Unterwegs gab’s jede Menge Gartenkunst zu bestaunen. Zum Glück hatte ich vorher bei einem Zuckerbäcker haltgemacht und ein paar Erkundigungen eingeholt, so daß ich nun nicht ganz unvorbereitet auf den Luxus beim Herrn Freigelassenen war. Buchsbaum, zu geflügelten Greifen gestutzt, in Stein gehauene, lichte Göttinnen mit hehrer Denkerstirn, rosen- und weinumrankte, lauschige Pergolen, wuchtige Urnen aus rosig geädertem Alabaster, Taubenschläge, Fischteiche und Marmorbänke in verschwiegenen Laubengängen mit Blick auf sauber geschorene Rasenflächen – was für eine Augenweide!
Bronzesphinxen bewachten die Freitreppe aus weißem Marmor, über die ich in eine von mächtigen schwarzen Säulen gesäumte Empfangshalle kam. Dort tappte ich so lange mit dem Fuß auf ein weiß-graues Schachbrettmosaik, bis ein abgekämpfter Diener erschien. Er fragte nach meinem Namen und führte mich dann, vorbei an zierlichen Farnen und Springbrunnen, in einen eleganten Innenhof, den einer der drei Freigelassenen durch sein Standbild verschönt hatte. Imposant stand er da, der steinerne Hortensius, in seiner besten Toga und mit einer Schriftrolle in der Hand. Genau das fehlte dem Flur meiner Falco-Residenz: meine Wenigkeit in Carraramarmor, wie ein feiner Pinkel mit einem Haufen Geld, der mit sich und der Welt zufrieden ist. Ich nahm mir vor, so ein Standbild in Auftrag zu geben – eines schönen Tages.
Ich fand mich allein in einem Empfangssalon wieder. Auf dem Weg dorthin waren mir die vielen ausgebrannten Fackeln und Wachslichter aufgefallen. In den Gängen roch es noch schwach nach welken Blumengirlanden, und wenn ab und zu eine Tür ging, hörte ich die Mägde mit dem Geschirr vom Vorabend klappern. Sabina Pollia ließ mir ausrichten, ich möge mich noch etwas gedulden. Vermutlich war die Dame noch nicht mal angezogen. Ich beschloß, den Fall abzulehnen, wenn sie sich als reiche Schlampe entpuppen sollte, die nichts als Partys im Kopf hatte.
Nach einer halben Stunde begann ich mich zu langweilen und unternahm einen Streifzug durchs Haus. Überall hingen kostbar eingefärbte, aber leicht derangierte Vorhänge; die Möbel waren ausgesucht schön, jedoch wahllos in den Zimmern verteilt, und die Raumgestaltung schien ebenso willkürlich: Weiße Stuckdecken mit hauchzartem Dekor wölbten sich über Wandgemälden mit derb-erotischen Motiven. Es sah aus, als hätten sich die Herrschaften von jedem geschickten Handlungsreisenden etwas aufschwatzen lassen, ohne Rücksicht auf Sinn und Zweck, von Geschmack ganz zu schweigen. Der einzig gemeinsame Nenner dieses Sammelsuriums war vermutlich der horrende Preis.
Ich schätzte gerade, nur so zum Zeitvertreib, den möglichen Auktionsertrag für einen Phidias (»Aphrodite schnürt ihre Sandale«), der im Gegensatz zu fast jedem Phidias, der einem sonst in Rom unterkommt, verdächtig nach einem Original aussah, als hinter mir eine Tür aufflog und eine Frauenstimme rief. »Also hier finde ich Sie!«
Schuldbewußt fuhr ich herum. Bei ihrem Anblick blieb mir die Entschuldigung im Halse stecken.
Sie war zum Anbeißen. Den vierzigsten Geburtstag hatte sie zwar nicht mehr vor sich, aber falls sie mal ins Theater kam, würde sie bestimmt mehr Aufmerksamkeit erregen als das Stück. Kajal betonte ihren schmachtenden Blick, doch selbst im Naturzustand hätten Augen wie diese der Tugend eines Mannes von meiner Sensibilität arg zugesetzt. Die Augen gehörten zu einem ebenmäßigen Gesicht, und das wiederum zu einem Körper, gegen den die Phidias-Aphrodite sich ausnahm wie eine marode Eierfrau, der vom langen Stehen die Füße weh tun. Sie kannte ihre Wirkung ganz genau. Mir brach augenblicklich der Schweiß aus.
Da ich nach Sabina Pollia gefragt hatte, mußte sie das wohl sein. Zwei stämmige Burschen in leuchtend blauer Livree traten hinter ihr vor und rückten mir auf die Pelle.
»Rufen Sie Ihre Wachhunde zurück!« verlangte ich. »Die Dame des Hauses hat mich persönlich hergebeten.«
»Dann sind Sie der Schnüffler?« Ihre unverblümte Art verriet, daß diese Dame bei Bedarf auch ganz undamenhaft werden konnte.
Ich nickte. Sie bedeutete den beiden Flügelmännern, sich zurückzuziehen. Die gingen daraufhin zwar außer Hörweite, blieben aber nahe genug, um mich Mores zu lehren, falls ich Arger machen sollte. Was ich nicht vorhatte – es sei denn, man würde mir Grund dazu geben. »Wenn Sie mich fragen«, erklärte ich dreist, »sollte eine Dame im eigenen Haus keinen Leibwächter brauchen.«
An meiner ausdruckslosen Miene konnte die Gnädige nicht ablesen, ob ihr Verdacht berechtigt war und ich sie soeben tatsächlich als ordinäre Person abgestempelt hatte. »Ich bin Didius Falco. Habe ich die Ehre mit Sabina Pollia?« Betont lässig streckte ich ihr die Flosse entgegen. Es schien ihr nicht zu gefallen, aber sie nahm die dargebotene Hand. Die ihre war schlank, mit kurzen Fingern und den hellen, ovalen Nägeln eines jungen Mädchens; sie trug einen Haufen juwelenblitzender Ringe.
Sabina Pollia besann sich und entließ die beiden Burschen in der adriatischen Uniform. Eine Dame hätte jetzt nach einem Anstandswauwau geschickt, aber das vergaß sie. Sie fläzte sich so auf einen Diwan, daß die anmutige Aphrodite wieder Punkte gewann.
»Erzählen Sie mir was über sich, Falco!« Leidiges Berufsrisiko: Sie wollte sich amüsieren, den Spieß umdrehen und mich ausfragen. »Sie sind also Privatermittler – wie lange denn schon?«
»Fünf Jahre. Seit ich als Invalide aus der Legion entlassen wurde.«
»Doch hoffentlich nichts Ernstes?«
Mein Lächeln war kühl, souverän. »Nichts, was mich nennenswert beeinträchtigen könnte.«
Unsere Blicke trafen sich, verweilten. Es würde ein hartes Stück Arbeit werden, bis ich diese Schönheit soweit hatte, daß wir sachlich über meinen Auftrag reden konnten.
Sie war eine von diesen klassischen Miezen: wohlproportioniertes Gesicht, gerade Nase genau am rechten Fleck, klarer Teint und ungewöhnlich ebenmäßige Zähne – ein vollkommenes Profil, wenn auch etwas ausdrucksschwach, da Menschen mit sehr schönen Gesichtern nie Charakter zeigen müssen, um sich durchzusetzen; außerdem könnte durch zuviel Mimik ja die Schminke brüchig werden, die Frauen wie sie nicht nötig haben, aber immer tragen. Sie war zierlich und kokettierte damit – auffallende, mit Schlangenköpfen verzierte Reifen betonten die zarten Arme, die geschürzten Lippen imitierten einen Kleinmädchenschmollmund. Alles Theater, um einen Mann zum Schmelzen zu bringen. Da ich nie krittelig bin, wenn eine Frau sich wirklich ins Zeug legt, schmolz ich gehorsam.
»Ich höre, Sie arbeiten für den Palast, Falco – aber mein Diener hat mir schon gesagt, daß Sie darüber nicht sprechen dürfen …«
»So ist es.«
»Diese Detektivarbeit muß ja faszinierend sein!«
Sie hoffte offenbar auf ein paar skandalträchtige Enthüllungen über ehemalige Klienten.
»Manchmal«, gab ich ungefällig zurück. Meine verflossenen Klienten sind zumeist Leute, an die ich mich lieber nicht mehr erinnere.
»Man hat mir auch erzählt, daß ein Bruder von Ihnen als Held gefallen ist.«
»Didius Festus. Ihm wurde in Judaea das Palisadenkreuz verliehen.« Mein Bruder Festus hätte sich schiefgelacht bei dem Gedanken, daß die Verwandtschaft mit ihm einmal mein Prestige erhöhen würde. »Haben Sie ihn gekannt?«
»Nein – sollte ich?«
»Nun, viele Frauen kannten ihn.« Ich lächelte. »Sabina Pollia, sollte ich Ihnen nicht in einer gewissen Angelegenheit behilflich sein?«
Diese zarten Püppchen lassen sich von keinem den Schneid abkaufen. »Tja, Falco – wo liegen denn Ihre Stärken?«
Ich fand es an der Zeit, ihr die Stirn zu bieten. »In meinem Beruf, Gnädigste, da bin ich stark! Können wir also zur Sache kommen?«
»Nicht so hastig!« tadelte Sabina Pollia.
Warum bin am Ende immer ich schuld?
»Wenn ich Hyacinthus recht verstanden habe, dann handelt es sich um ein Familienproblem?« fragte ich etwas muffig.
»Nicht ganz!« Pollia lachte. Und dann kam wieder die Masche mit dem hilflosen Schmollmündchen. Aber darauf war ich von Anfang an nicht reingefallen; die Dame konnte was einstecken. »Sie sollen nämlich das Problem grade aus der Familie raushalten!«
»Dann wenden wir uns doch gleich mal dieser ›Familie‹ zu. Also, Hortensius Novus wohnt hier; und wer noch?«
»Wir wohnen alle hier. Ich bin mit Hortensius Felix verheiratet; Hortensia Atilia ist die Frau von Hortensius Crepito …«
Sklaven, die untereinander heiraten: nichts Ungewöhnliches.
»Und Novus ist in diesem brüderlichen Triumvirat der letzte fidele Junggeselle?«
»Bis jetzt«, antwortete sie gepreßt. »Aber die drei sind keine Geschwister, Falco! Wie kommen Sie nur darauf?«
Jetzt war ich ein bißchen aus dem Konzept. »Nun, die ganze Situation hier, der gleiche Name, Sie selbst bezeichnen sich als eine Familie …«
»Wir sind nicht blutsverwandt, stammen aber aus einer Familie. Unser Herr hieß Hortensius Paulus, verstehen Sie?«
Als ob es nicht schon lästig genug wäre, daß man jedem Römer nebst Brüdern und Söhnen zum Zeichen der Ehrfurcht den Vaternamen anhängt, hatte ich es hier also mit einer ganzen Bande von Ex-Sklaven zu tun, die allesamt das Patronymikum ihres früheren Herrn trugen. Sogar die Frauen! »Hortensia Atilia ist demnach eine Freigelassene aus demselben Haushalt?«
»Ja.«
»Aber Sie gehörten nicht dazu?«
»O doch.«
»Wieso heißen Sie dann anders?« Sabina Pollia, die zu stolzen Halbmonden gezupften Brauen leicht gehoben, amüsierte sich auf meine Kosten. »Da komme ich nicht ganz mit«, gestand ich freimütig.
»Ich habe für die Dame des Hauses gearbeitet«, erklärte sie hoheitsvoll. Fakten wie »ich habe ihr gehört« oder »sie hat mich freigelassen« blieben wohlweislich unausgesprochen. »Darum habe ich ihren Namen angenommen. Aber ist das denn wichtig, Falco?«
»Sagen wir hilfreich.« Vor allem dabei, eventuelle Fettnäpfchen zu umrunden. Ich mag meine Klientel nicht kränken – aus Angst, daß sie sonst weniger zahlt. »Fassen wir also zusammen: Sie fünf wurden zum Dank für treue Dienste in die Freiheit entlassen …« Sicher hatte Paulus das in seinem Testament verfügt. »Seitdem wohnen und arbeiten Sie zusammen, ja haben sogar untereinander geheiratet.« Da das Mindestalter für die Freilassung eines Sklaven dreißig Jahre beträgt, mischte Pollia seit gut und gern zehn Jahren in der feinen Gesellschaft mit. Eher noch länger, dachte ich, den gebotenen Takt gegenüber einer Dame und ihrem Alter vergessend. »Sie führen ein angesehenes Haus, leben in Wohlstand. Na, und den Rest kann ich mir zusammenreimen: Da kommt plötzlich eine Fremde daher, die vielleicht ein Flittchen ist, aber darauf kommen wir gleich –, und verdreht Ihrem einzigen noch ungebundenen Familienmitglied den Kopf. Und nun möchten Sie, daß ich diese Person verscheuche.«
»Sie sind auf Draht, Falco.«
»Davon lebe ich … Wie weit ist die Romanze denn schon gediehen?«
»Hortensius Novus hat sich offiziell verlobt.«
»Wie unbesonnen! Doch bevor ich den Fall übernehme«, fuhr ich nachdenklich fort, »nennen Sie mir einen
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: