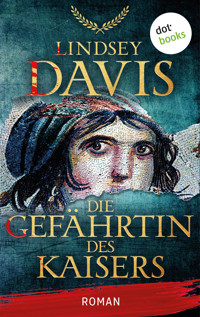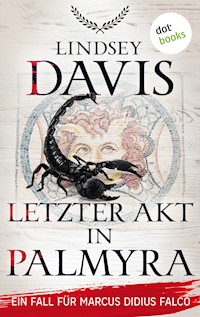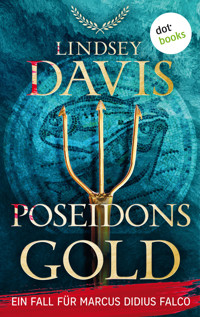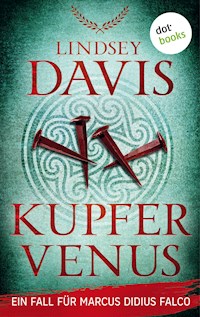5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Tod und Spiele: Der fesselnde historische Kriminalroman »Den Löwen zum Frass« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 73 nach Christus. Er ist der brillanteste Privatermittler der Stadt – doch statt Mörder hinter Gitter zu bringen und Staatsaffären abzuwenden, muss Marcus Didius Falco diesmal für den Kaiser die größten Steuersünder zwischen Aventin und Quirinal jagen. Sein Auftrag führt ihn ins Kolosseum, wo kampfgestählte Gladiatoren Tag für Tag ihr Leben zur Belustigung der Massen riskieren. Als es zu zwei ungewöhnlichen Todesfällen in den Quartieren der Schaukämpfer kommt, ist Falcos Spürsinn geweckt. Er ahnt, dass das wahre tödliche Geschäft nicht vor den Augen der johlenden Zuschauer stattfindet – sondern hinter den Kulissen! Die Spur der Verbrecher führt ihn schließlich bis nach Afrika … »Lindsey Davis’ witzige und wortgewandte Falco-Romane sind wahre Vorbilder des Genres.« The Times Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Den Löwen zum Frass« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der zehnte Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 73 nach Christus. Er ist der brillanteste Privatermittler der Stadt – doch statt Mörder hinter Gitter zu bringen und Staatsaffären abzuwenden, muss Marcus Didius Falco diesmal für den Kaiser die größten Steuersünder zwischen Aventin und Quirinal jagen. Sein Auftrag führt ihn ins Kolosseum, wo kampfgestählte Gladiatoren Tag für Tag ihr Leben zur Belustigung der Massen riskieren. Als es zu zwei ungewöhnlichen Todesfällen in den Quartieren der Schaukämpfer kommt, ist Falcos Spürsinn geweckt. Er ahnt, dass das wahre tödliche Geschäft nicht vor den Augen der johlenden Zuschauer stattfindet – sondern hinter den Kulissen! Die Spur der Verbrecher führt ihn schließlich bis nach Afrika …
»Lindsey Davis’ witzige und wortgewandte Falco-Romane sind wahre Vorbilder des Genres.« The Times
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe März 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1998 unter dem Originaltitel »Two for the Lions« bei Century Books, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1998 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/RInArte, Kolonko, EvenEzer
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-770-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Marcus Didius Falco 10« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Den Löwen zum Fraß
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Der zehnte Falco-Roman ist mit Zuneigung und Dankbarkeit der Autorin all den Leserinnen und Lesern gewidmet, die diese fortlaufende Serie möglich gemacht haben.
Dramatis Personae
Freunde
M. Didius Falco: Chef von Falco & Partner, Revisoren für den Zensus
Anacrites: zeitweiliger Partner von Falco & Partner, ein Beschützter
Mama: ständige Beschützerin von Anacrites
Helena Justina: ständige Partnerin von Falco
Julia Junilla: Falcos und Helenas kleine Tochter
Papa (Geminus): Expartner von und schutzbedürftig vor Mama
Maia: Falcos jüngste Schwester, auf der Suche nach ihrer Chance
Famia: Maias Mann, auf der Suche nach was zu trinken
D. Camillus Verus: ein Senator, Helenas Vater, auf der Suche nach seinem Sohn
D. Camillus Justinus: ein Idealist, auf der Suche nach einer Pflanze
Claudia Rufina: eine Erbin, enttäuscht von der Liebe
A. Camillus Aelianus: ein Hoffnungsträger, enttäuscht vom Geld
Lenia: versucht ihren Mann loszuwerden
Smaractus: versucht sich an das Geld seiner Frau zu klammern
Rodan & Asiacus: kaputte Typen, regelmäßig geschlagen und meist mehr als kaputt
Thalia: eine exotische Zirkusdirektorin
Römer
Vespasian Augustus: Kaiser und Zensor, Erbauer des Flavischen Amphitheaters
Antonia Caenis: Geliebte und langjährige Partnerin des Kaisers
Claudius Laeta: hoher Palastbeamter, ein Einzelgänger
Rutilius Gallicus: Sonderbeauftragter in Tripolitanien
Romanus: ein Unbekannter
Scilla: ein ungestümes Mädchen auf der Suche nach Rechtsmitteln
Pomponius Urtica: ein Prätor, der nie etwas Gesetzwidriges getan hat
Rumex: eine Graffiti-Berühmtheit
Buxus: ein Tierpfleger
Ein ältlicher Gänsehirt: der den ganzen Tag Vögel beobachtet
Tripolitanier
Saturninus: ein Gladiatorentrainer aus Leptis Magna
Euphrasia: seine Frau, die versprochen hat, nichts zu sagen
Calliopus: ein Venatio-Spezialist aus Oea
Artemisia: seine Frau, die nichts sagen kann, weil sie nicht da ist
Hanno: ein Mann aus Sabratha, der es sich leisten kann, seine Steuern zu bezahlen
Myrrah: die etwas sagen könnte, aber nur auf Punisch
Iddibal: ein ganz und gar nicht bestialischer Bestiarius
Fidelis: ein pflichtgetreuer Dolmetscher
Tiere
Nux: eine sympathische Hündin, Herrscherin in Falcos Haushalt
Leonidas: ein freundlicher Löwe, der einen Mörder zu Hackfleisch machen soll
Draco: ein sehr unfreundlicher Löwe
Anethum: ein Schauspieler, der perfekt den toten Hund geben kann
Weitere Mitwirkende: Borago, der Bär, Ruta, der angebliche Auerochs, Strauße, Tauben, Löwen, Steinlöwen, eine Leopardin
Auf besonderen Wunsch: Jason, der Python
Und zum ersten Mal auf der Bühne: die heiligen Gänse der Juno
Teil I
Rom, Dezember 73 – April 74 n. Chr.
Kapitel I
Mein Partner und ich waren drauf und dran, ein Vermögen zu verdienen, bis wir von der Leiche erfuhren.
Der Tod, so hieß es, sei in diesen Kreisen ein ständiger Begleiter. Anacrites und ich hatten es mit den Lieferanten wilder Tiere und Gladiatoren für die Arenen der römischen Spiele zu tun; jedes Mal, wenn wir zur Bücherrevision mit unseren Notiztafeln bei ihnen auftauchten, verbrachten wir den Tag unter jenen, die für einen baldigen Tod ausersehen waren oder ihm nur entrinnen konnten, wenn sie zuvor jemand anderen töteten. Das Leben, der Hauptpreis des Siegers, bot in den meisten Fällen bloß einen kurzfristigen Aufschub.
Aber dort, zwischen den Unterkünften der Gladiatoren und den Käfigen der großen Raubkatzen, war der Tod etwas Alltägliches. Unsere eigenen Opfer, die fetten Geschäftsleute, deren finanzielle Angelegenheiten wir als Teil unserer neuen Karriere so taktvoll überprüften, erfreuten sich selbst der Aussicht auf ein langes, angenehmes Leben – obwohl sie laut offizieller Berufsbezeichnung Schlächter waren. Ihr Warenbestand wurde nach Massenmord-Einheiten bemessen, ihr Erfolg hing davon ab, ob diese Einheiten die Menschenmenge befriedigten – was sich an der Lautstärke des Beifalls ermessen ließ – und ob es ihnen gelang, immer ausgefallenere Methoden des Blutvergießens zu ersinnen.
Wir wussten, dass es hier um das große Geld ging. Die Lieferanten und Trainer waren Freie, eine Voraussetzung zur Eröffnung eines Geschäftes. Und so unterlagen sie, wie der Rest der römischen Gesellschaft, dem Großen Zensus. Dieser war vom Kaiser bei seiner Amtseinführung angeordnet worden und diente nicht nur als einfache Volkszählung. Als Vespasian nach Neros chaotischer Regierungszeit in einem bankrotten Imperium die Macht ergriff, gab er die berühmte Erklärung ab, er brauche vierhundert Millionen Sesterzen, um die römische Welt wieder in Stand zu setzen. Da er kein persönliches Vermögen besaß, griff er auf Finanzierungsmittel zurück, die ihm als Mann aus der Mittelschicht am reizvollsten erschienen. Er ernannte sich und seinen älteren Sohn Titus zu Zensoren und forderte uns alle auf, Rechenschaft abzulegen über uns und alles, was wir besaßen. Auf Letzteres wurden schwungvolle Steuern erhoben, was der eigentliche Zweck der Übung war.
Scharfsinnige werden schließen, dass einige Haushaltsvorstände darin eine aufregende Herausforderung sahen; hirnlose Narren versuchten die Angaben über den Wert ihres Besitzes zu minimieren. Nur jene, die sich äußerst geschickte Finanzberater leisten können, kommen mit so was durch, und da der Große Zensus darauf abzielte, vierhundert Millionen Sesterzen einzubringen, war es Wahnsinn, schummeln zu wollen. Das Ziel war zu hoch gesteckt; Ausflüchte würden sofort aufgedeckt werden – von einem Kaiser, der Steuereintreiber unter seinen Vorfahren hatte.
Die Erpressungsmaschinerie bestand bereits. Der Zensus benutzte traditionsgemäß das erste Prinzip jeder Finanzverwaltung: Die Zensoren hatten das Recht zu sagen: Wir glauben dir kein Wort. Dann nahmen sie ihre eigene Einschätzung vor, und das Opfer musste entsprechend bezahlen. Widerspruch gab es nicht.
Nein, das stimmt nicht. Freie haben stets das Recht, ein Gesuch an den Kaiser zu richten. Und es ist das Privileg des Kaisers, seine Purpurrobe um sich zu werfen und den Bittstellern majestätisch zu erklären, sie sollten sich verpissen.
Solange der Kaiser und sein Sohn als Zensoren fungierten, war es auf jeden Fall Zeitverschwendung, sie zu bitten, ihr Urteil zu revidieren. Aber als Erstes mussten sie die verschärfte Neuveranlagung durchführen, und dabei brauchten sie Hilfe. Um Vespasian und Titus zu ersparen, persönlich die Grenzen der Besitzungen zu vermessen, schwitzende Bankiers auf dem Forum zu verhören oder mit dem Abakus über Geschäftsbüchern zu hocken – angesichts der Tatsache, dass sie schließlich gleichzeitig ein zerrüttetes Imperium regieren mussten –, hatten sie jetzt meinen Partner und mich eingestellt. Die Zensoren brauchten die Fälle, bei denen sie rigoros zupacken konnten. Kein Kaiser möchte der Grausamkeit bezichtigt werden. Jemand musste die Betrüger ausfindig machen, die man ohne öffentlichen Aufschrei neu veranlagen konnte. Daher hatte man Falco & Partner angeheuert – auf meinen eigenen Vorschlag und einer äußerst verlockenden Honorarbasis –, zweifelhafte Angaben zu überprüfen.
Wir hatten gehofft, dass wir in den luxuriösen Arbeitszimmern reicher Männer gemütlich Zahlenkolonnen auf feinstem Pergament durchgehen würden, aber weit gefehlt. Ich selbst war als zäher Hund bekannt und genoss als Privatermittler einen etwas anrüchigen Ruf. Also hatten Vespasian und Titus meine Pläne vereitelt und beschlossen, so viel wie möglich aus einer Anstellung von Falco & Partner herauszuschlagen (aus gutem Grund war ihnen die wahre Identität meines Partners nicht enthüllt worden). Sie befahlen uns, das bequeme Leben zu vergessen und in den wirtschaftlichen Grauzonen zu ermitteln.
Daher die Arena. Man nahm an, dass die Trainer und Lieferanten das Blaue vom Himmel herunter logen, was sie zweifellos taten, genau wie alle anderen. Doch ihr verschlagenes Aussehen hatte die Aufmerksamkeit unserer kaiserlichen Herren geweckt, und wir waren dabei, den Gladiatorenmeistern auf den Zahn zu fühlen, als man uns an jenem scheinbar ganz gewöhnlichen Morgen unerwartet aufforderte, uns eine Leiche anzusehen.
Kapitel II
Die Arbeit für den Zensor war meine Idee gewesen. Eine zufällige Unterhaltung mit dem Senator Camillus Verus vor einigen Wochen hatte mich auf die Steuerneuveranlagungen aufmerksam gemacht. Ich erkannte, dass man das nur ordentlich organisieren musste, mit einem entschlossenen Revisorenteam, das sich die verdächtigen Fälle vornahm (eine Kategorie, unter die Camillus selbst nicht fiel; er war nur ein armes dummes Huhn mit einem unglückseligen Gesicht, der einem Steuereinschätzer zum Opfer gefallen war und sich keinen aalglatten Buchhalter leisten konnte, um sich aus dem Schlamassel zu befreien).
Mich für die Leitung der Revision anzupreisen erwies sich als schwierig. Es gab immer dutzende von Intelligenzbolzen, die in ihrer besten Toga zum Palast eilten und brillante Vorschläge zur Rettung des Imperiums unterbreiten wollten. Die Palastbeamten waren darin geschult, sie abzuweisen, denn selbst brillante Ideen wurden von Vespasian nicht unbedingt begrüßt, weil er Realist war. Als ein Ingenieur beschrieb, wie man die riesigen neuen Säulen für den restaurierten Jupitertempel mit mechanischen Mitteln sehr billig auf das Kapitol bringen könnte, soll, so wurde berichtet, Vespasian den Vorschlag abgelehnt haben, weil er für die Arbeit lieber die niederen Schichten bezahlte, damit sie Geld zum Essen hatten. Der alte Mann wusste genau, wie man einen Aufstand verhindert.
Trotzdem ging ich mit meinem Vorschlag zum Palatin. Einen halben Vormittag saß ich mit anderen Hoffnungsvollen in einem kaiserlichen Salon, aber ich langweilte mich bald. Es hatte sowieso keinen Zweck. Wenn ich durch den Zensus Geld verdienen wollte, musste ich schnell damit anfangen. Ich konnte mir nicht leisten, monatelang in einer Schlange zu warten; der Zensus sollte innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein.
Mit dem Palast gab es noch ein anderes Problem. Mein derzeitiger Partner war bereits kaiserlicher Angestellter. Ich hatte mich nicht mit Anacrites zusammentun wollen, aber nach acht Jahren als Einzelkämpfer hatte ich mich dem Druck meiner Umgebung gebeugt und zugestimmt, dass ich einen Kollegen brauchte. Ein paar Wochen lang hatte ich mit meinem besten Freund Petronius Longus zusammengearbeitet, der zeitweilig vom Dienst bei den Vigiles suspendiert worden war. Gern würde ich behaupten, es sei ein Erfolg gewesen, aber seine Herangehensweise war in fast allem das genaue Gegenteil von meiner. Als Petro beschloss, sein Privatleben in Ordnung zu bringen, und von seinem Tribun wieder eingestellt wurde, war es für uns beide eine Erleichterung.
Danach hatte ich kaum noch Auswahl. Niemand will Ermittler sein. Nur wenige Männer besitzen die notwendige Schlauheit und Beharrlichkeit, die Ausdauer, stundenlang durch die Straßen zu schlurfen, oder haben gute Informationskontakte – vor allem für Informationen, die von Rechts wegen unzugänglich sein sollten. Unter den wenigen, die in Frage kamen, wollten noch weniger mit mir zusammenarbeiten, vor allem, seit Petro auf dem ganzen Aventin herumposaunte, wie furchtbar es sei, sich mit einem pingeligen Piesepampel wie mir das Büro zu teilen.
Anacrites und ich waren nie ein Herz und eine Seele gewesen. Ich hatte ihn aus Prinzip verabscheut, als er noch kaiserlicher Oberspion und ich ein kleiner Schnüffler mit ausschließlich Privatklienten war. Nachdem ich begann, selbst für Vespasian zu arbeiten, hatte sich meine Abneigung noch verstärkt, da ich bald herausfand, dass Anacrites unfähig, hinterhältig und schäbig war. (All das wirft man auch Ermittlern vor, aber das ist Verleumdung.) Und als mich Anacrites während einer Mission in Nabatäa ermorden lassen wollte, hörte ich auf, ihm Toleranz vorzuheucheln.
Die Parzen schritten ein, als er von einem Möchtegern-Attentäter angegriffen wurde. Ich war es nicht; ich hätte ganze Arbeit geleistet. Das war selbst ihm klar. Nachdem er bewusstlos mit einem Loch im Schädel aufgefunden wurde, brachte ich es aus unbegreiflichen Gründen zu Stande, meine eigene Mutter zu überreden, sich seiner anzunehmen. Wochenlang hing sein Leben am seidenen Faden, aber Mama zerrte ihn mit schierer Entschlossenheit und Gemüsebrühe vom Ufer des Lethe zurück. Nachdem sie ihn gerettet hatte und ich von einer Reise nach Baetica zurückkam, musste ich feststellen, dass zwischen ihnen eine Bindung entstanden war, als hätte Mama ein verwaistes Entlein in Pflege genommen. Anacrites’ Hochachtung vor meiner Mutter war nur geringfügig abstoßender als ihre Verehrung für ihn.
Mama hatte die Idee gehabt, ihn mir aufzuhalsen. Aber das würde nur so lange dauern, bis ich jemand anderen fand. Auf jeden Fall hatte er offiziell nach wie vor Genesungsurlaub. Daher konnte ich kaum im Palast aufkreuzen und ihn als meinen Partner angeben, denn der Palast bezahlte ihn wegen seiner schrecklichen Kopfwunde bereits fürs Nichtstun, und seine Vorgesetzten durften nicht erfahren, dass er schwarz arbeitete.
Tja, nur eine weitere all der Komplikationen, die das Leben versüßen.
Genau gesagt, hatte ich bereits eine Partnerin. Sie nahm teil an meinen Problemen und lachte über meine Fehler, half mir bei der Buchhaltung, beim Rätsellösen und führte manchmal sogar Befragungen durch. Helena. Die Liebe meines Lebens. Wenn niemand sie als meine Geschäftspartnerin ernst nahm, lag es teilweise daran, dass Frauen keinen rechtlichen Status haben. Außerdem war Helena die Tochter eines Senators; die meisten glaubten immer noch, sie würde mich eines Tages verlassen. Selbst nach drei Jahren engster Verbundenheit, gemeinsamer Reisen ins Ausland und der Geburt unseres Kindes erwartete man, dass Helena Justina meiner überdrüssig werden und zu ihrem früheren Leben zurückkehren würde. Ihr illustrer Vater war derselbe Camillus Verus, der mir die Idee eingegeben hatte, für den Zensor zu arbeiten; ihre edle Mutter Julia Justa hätte nichts lieber getan, als einen Tragestuhl zu schicken und Helena heimzuholen.
Wir lebten als Untermieter in einer grässlichen Hochparterrewohnung auf der rauen Seite des Aventin. Unser Baby mussten wir in den öffentlichen Bädern waschen, und wenn wir backen wollten, blieb uns nichts anders übrig, als den Teig zum Pastetenbäcker zu bringen. Unsere Hündin hatte uns mehrere Ratten zum Geschenk gemacht, die sie vermutlich nahe dem Haus erwischt hatte. Das war der Grund, warum ich anständige, regelmäßig bezahlte Arbeit brauchte. Der Senator wäre entzückt gewesen, dass ein paar von ihm hingeworfene Bemerkungen mir die Idee dazu eingegeben hatten. Und er würde noch stolzer sein, wenn er je erfuhr, dass Helena mir letztlich den Posten verschafft hatte.
»Möchtest du, dass Papa Vespasian bittet, dir die Arbeit beim Zensor anzubieten, Marcus?«
»Nein«, sagte ich.
»Das dachte ich mir.«
»Du meinst, ich bin dickköpfig?«
»Du machst lieber alles selbst«, erwiderte Helena ruhig. Sie war am beleidigendsten, wenn sie vorgab, gerecht zu sein.
Helena war eine große Frau mit strengem Ausdruck und stechendem Blick. Leute, die von mir erwartet hatten, dass ich mir ein dralles Püppchen mit Wolle im Hirn aussuchen würde, staunten immer noch über meine Wahl, aber nachdem ich Helena Justina kennen gelernt hatte, beschloss ich, bei ihr zu bleiben, so lange sie mich haben wollte. Sie war ordentlich, neigte zu beißendem Spott, war intelligent und auf wunderbare Weise unvorhersehbar. Ich konnte nach wie vor meinem Glück kaum glauben, dass sie mich bemerkt hatte, ganz zu schweigen davon, dass sie mit mir in einer Wohnung lebte, die Mutter meiner kleinen Tochter war und Ordnung in mein desorganisiertes Dasein gebracht hatte.
Das hinreißende Weib wusste, dass sie mich um den kleinen Finger wickeln konnte, und ich ließ es nur allzu gern geschehen. »Marcus, Liebling, wenn du heute Nachmittag nicht wieder zum Palast gehen willst, würdest du mich dann zum anderen Ende der Stadt begleiten? Ich hab da was zu erledigen.«
»Selbstverständlich«, stimmte ich großzügig zu. Alles, nur um außer Reichweite von Anacrites zu kommen.
Helenas Vorhaben machte das Anmieten eines Tragestuhls über eine Entfernung nötig, die mich zweifeln ließ, ob die wenigen Münzen in meinem Geldbeutel als Bezahlung reichen würden. Zuerst schleppte sie uns zu einem Lagerhaus, das mein Vater, ein Auktionator, in der Nähe des Emporiums besaß. Er gestattete uns, im hinteren Teil die Sachen zu lagern, die wir von unseren Reisen mitgebracht hatten und die auf den Tag warteten, an dem wir endlich ein anständiges Heim haben würden. Ich hatte eine Trennwand eingebaut, um Papa von diesem Teil des Lagers fern zu halten, da er die Art Unternehmer war, der sorgfältig ausgesuchte Schätze für einen Spottpreis verkaufen und denken würde, er hätte uns einen Gefallen getan.
Bei unserem heutigen Ausflug war ich nur ein Begleiter. Helena machte keine Anstalten, etwas zu erklären. Mehrere formlose Ballen, die mich offenbar nichts angingen, wurden eingesammelt und auf einen Esel geladen, dann umgingen wir das Forum in Richtung zum Esquilin.
Der Weg nach Norden dauerte ewig. Durch den fadenscheinigen Vorhang sah ich, dass wir uns außerhalb der alten Servianischen Mauer befanden und wohl zum Prätorianerlager wollten. Ich enthielt mich jeder Bemerkung. Wenn jemand Geheimnisse hat, soll er doch.
»Ja, ich hab einen Geliebten bei der Garde«, sagte Helena. War wohl als Witz gemeint. Ihre Vorstellung rauer Zärtlichkeit war ich: empfindsamer Liebhaber, treuer Beschützer, erfahrener Geschichtenerzähler und Möchtegern-Dichter. Jeder Prätorianer, der sie vom Gegenteil überzeugen wollte, würde von mir einen Tritt in den Arsch kriegen.
Wir umrundeten das Prätorianerlager und kamen auf die Via Nomentana. Kurz darauf hielten wir an, und Helena kletterte aus dem Tragestuhl. Ich folgte, überrascht, weil ich erwartet hatte, sie zwischen den Winterkohlpflanzen einer verödeten Handelsgärtnerei vorzufinden. Stattdessen hatten wir vor einer Villa angehalten, gleich hinter der Porta Nomentana. Die Villa war von beträchtlicher Größe, was mich erstaunte. Niemand, der genug Geld für ein vernünftiges Haus hatte, würde sich normalerweise entschließen, so weit außerhalb der Stadt zu wohnen, von der unmittelbaren Nähe zum Prätorianerlager ganz zu schweigen. Die Bewohner würden taub werden, wenn diese Volltrottel sich am Zahltag besoffen, und das ständige Trompeten und Exerzieren würde die meisten Menschen verrückt machen.
Die Gegend hier war weder Stadt noch Land. Es gab kein Bergpanorama, keinen Flussblick. Und doch hatten wir die Art hoher, nackter Mauern vor uns, die normalerweise komfortable Luxusvillen von Leuten umgeben, die nicht wollen, dass die Öffentlichkeit erfährt, was sie besitzen. Sollten wir daran zweifeln, kündeten die schwere Eingangstür mit dem antiken Delfinklopfer und die gepflegten, eingetopften Lorbeerbäumchen davon, dass hier jemand wohnte, der sich für etwas Besseres hielt (was nicht gleichbedeutend damit sein muss, dass er es tatsächlich ist).
Ich sagte immer noch nichts und durfte dabei helfen, die Ballen abzuladen, während meine Liebste zu der abschreckenden Eingangstür tänzelte und dahinter verschwand. Schließlich wurde ich von einem schweigenden Sklaven mit einer eng gegürteten weißen Tunika ebenfalls hineingeführt, durch einen traditionellen kurzen Flur zu einem Atrium geleitet, in dem ich mich aufhalten konnte, bis nach mir verlangt wurde. Ich war als überzählige Person eingestuft worden, die so lange wie nötig auf Helena warten würde – was stimmte. Abgesehen von der Tatsache, dass ich sie unter Fremden nie allein ließ, hatte ich noch nicht vor, nach Hause zu gehen. Ich wollte wissen, wo ich war und was hier geschah. Mir selbst überlassen, gehorchte ich schon bald meinen kribbeligen Füßen und machte mich auf Entdeckungstour.
Hübsch war es hier. Wirklich. Hier waren Geld und Geschmack ausnahmsweise mal eine erfolgreiche Verbindung eingegangen. Lichterfüllte Flure führten in jede Richtung zu freundlichen Räumen mit zurückhaltenden, etwas altmodischen Fresken. (Das Haus wirkte so still, dass ich dreist Türen öffnete und hineinsah.) Dargestellt waren architektonische Stadtlandschaften oder Grotten mit idyllischem Landleben. Die Räume waren mit gepolsterten Liegen und Hockern sowie in bequemer Reichweite stehenden Beistelltischen und eleganten Bronzekandelabern möbliert. Hier und da stand eine Statue, dazu ein oder zwei Büsten der alten, unnatürlich gut aussehenden kaiserlichen Familie der Julier und Claudier und ein lächelnder Kopf von Vespasian, offenbar aus der Zeit vor seiner Ernennung zum Kaiser.
Ich nahm an, dass das Gebäude zu meinen Lebzeiten gebaut worden war. Das bedeutete neues Geld. Das Fehlen gemalter Schlachtszenen, Trophäen oder phallischer Symbole, zusammen mit dem Übergewicht von Frauenstühlen, ließ mich darauf schließen, dass ich mich im Haus einer reichen Witwe befand. Die Gegenstände und Möbel waren teuer, wenn auch zum Gebrauch ausgesucht statt als reine Dekorationsstücke. Die Besitzerin hatte Geld, Geschmack und einen Sinn fürs Praktische.
Das Haus war sehr ruhig. Keine Kinder. Keine Haustiere. Keine Kohlebecken gegen die Winterkälte. Offenbar fast unbewohnt. Hier tat sich nicht viel.
Dann hörte ich das Murmeln von Frauenstimmen. Ich folgte dem Geräusch, kam in einen Peristylgarten, so geschützt, dass an den wuchernden Rosenbüschen noch die eine oder andere Blüte hing, obwohl wir bereits Dezember hatten. Vier ziemlich verstaubte Lorbeerbäume bildeten die Ecken, und in der Mitte stand ein stillgelegter Springbrunnen.
Zwanglos schlenderte ich in den Garten und traf auf Helena Justina und eine andere Frau. Ich wusste, wer sie war, hatte sie schon früher gesehen. Sie war nur eine freigelassene Sklavin, eine ehemalige Palastsekretärin – und doch die vermutlich einflussreichste Frau im jetzigen Kaiserreich. Ich richtete mich auf. Wenn die Gerüchte darüber, wie sie ihre Stellung einsetzte, wahr waren, dann wurde in dieser isolierten Villa klammheimlich mehr Macht ausgeübt als in jedem anderen Privathaus von Rom.
Kapitel III
Sie hatten leise gelacht, zwei aufrechte, zivilisierte, unbefangene Frauen, die dem Wetter trotzten, während sie über den Lauf der Welt diskutierten. Helena hatte den lebhaften Ausdruck, der besagte, dass sie das Gespräch wirklich genoss. Das war selten; sie neigte dazu, ungesellig zu sein, außer mit Menschen, die sie gut kannte.
Ihre Gefährtin war doppelt so alt wie sie, unbestreitbar eine ältere Frau mit leicht abgespanntem Aussehen. Ihr Name war Antonia Caenis. Sie war zwar eine Freigelassene, aber eine von bedeutendem Status. Einst hatte sie für die Mutter des Kaisers Claudius gearbeitet. Dadurch hatte sie langjährige und enge Verbindungen zu der alten, diskreditierten kaiserlichen Familie, und jetzt besaß sie noch intimere mit der neuen. Sie war seit langen Jahren die Geliebte Vespasians. Als ehemalige Sklavin konnte sie ihn niemals heiraten, aber nachdem seine Frau gestorben war, hatten sie offen zusammengelebt. Jeder hatte angenommen, dass er sich ihrer, sobald er Kaiser geworden war, diskret entledigen würde, aber er nahm sie mit in den Palast. In dem Alter der beiden war das kaum noch ein Skandal. Die Villa gehörte wahrscheinlich Caenis; wenn sie immer noch herkam, musste sie hier inoffizielle Transaktionen durchführen.
Ich hatte gehört, dass so etwas geschah. Vespasian gefiel sich darin, zu reell für Machenschaften hinter den Kulissen zu erscheinen – und doch musste er froh sein, jemanden zu haben, dem er vertrauensvoll diskrete Vereinbarungen überlassen konnte, während er Distanz wahrte und sich nach außen hin nicht die Hände schmutzig machte.
Die beiden Frauen saßen auf einer mit Kissen gepolsterten niedrigen Steinbank mit Löwenfüßen. Als ich näher kam, drehten sie sich um und unterbrachen ihr Gespräch. Ich merkte, dass sie wegen der Unterbrechung verärgert waren. Ich war ein Mann. Das, worüber sie gesprochen hatten, befand sich außerhalb meiner Sphäre.
Was nicht heißt, dass es frivol gewesen wäre.
»Ach, da bist du ja!«, rief Helena.
»Ich hab mich gefragt, was mir entgeht.«
Antonia Caenis senkte leicht den Kopf und begrüßte mich, ohne dass ich ihr vorgestellt worden war. »Didius Falco.«
Meine Güte, die Frau war gut! Ich hatte ihr einst bescheiden Platz gemacht, als ich Titus Cäsar im Palast besuchte, aber das war schon einige Zeit her, und es hatte nie ein formelles Treffen gegeben. Ich hatte bereits gehört, dass sie intelligent war und ein phänomenales Gedächtnis besaß. Offenbar war ich entsprechend eingeordnet worden, aber ich welches Fach?
»Antonia Caenis.«
Ich stand, die traditionelle Haltung des Servilen in Gegenwart der Großen. Den Damen gefiel es, mich wie einen Barbaren zu behandeln. Ich zwinkerte Helena zu, die leicht errötete, vor Furcht, ich könnte auch Caenis zuzwinkern. Ich nahm an, Vespasians Geliebte konnte damit umgehen, aber ich war ein Gast in ihrem Haus. Außerdem war sie eine Frau mit unbekannten Palastprivilegien. Bevor ich riskierte, sie gegen mich aufzubringen, wollte ich herausfinden, wie mächtig sie wirklich war.
»Sie haben mir ein sehr großzügiges Geschenk gemacht«, sagte Caenis. Das war mir neu. Wie mir vor ein paar Monaten in Hispanien erklärt worden war, hatte Helena Justina einen Privatverkauf purpur gefärbten Stoffs aus Baetica im Sinn, sehr gut verwendbar für kaiserliche Roben. Das sollte ihr Wohlwollen einbringen, war aber nicht als geschäftliche Transaktion gedacht. Für die Tochter eines Senators besaß Helena ein überraschendes Geschick zum Handeln; wenn sie jetzt beschlossen hatte, auf eine Bezahlung zu verzichten, musste sie einen guten Grund dafür haben. Heute wurde ein anderes Geschäft abgeschlossen. Ich konnte mir denken, um was es ging.
»Ich kann mir vorstellen, dass Sie dieser Tage regelrecht mit Geschenken überhäuft werden«, bemerkte ich kühn. »Die reinste Ironie«, erwiderte Caenis ungerührt. Sie hatte eine kultivierte Palaststimme, aber einen trockenen Ton. Vespasian und sie hatten sich bestimmt oft über die Oberschicht lustig gemacht; sie zumindest tat das immer noch.
»Man glaubt, Sie können den Kaiser beeinflussen.«
»Das wäre vollkommen unschicklich.«
»Aber warum denn nicht?«, protestierte Helena. »Mächtige Männer haben immer ihren engen Freundeskreis, der sie berät. Warum sollten dazu nicht auch Frauen gehören, denen sie vertrauen?«
»Natürlich steht es mir frei zu sagen, was ich denke«, meinte die Gefährtin des Kaisers lächelnd.
»Aufrichtige Frauen sind eine Freude«, sagte ich. Helena und ich hatten vor kurzem einen Wortwechsel über die Knackigkeit von Kohl gehabt, der mir immer noch die Haare zu Berge stehen ließ.
»Ich bin froh, dass du so denkst«, kommentierte Helena. »Vespasian legt großen Wert auf brauchbare Vorschläge.« Caenis sprach wie eine offizielle Hofbiografin, obwohl ich spürte, dass dem eine häusliche Ironie zu Grunde lag, die der unseren ähnelte.
»Bei der Bürde, das Imperium neu aufzubauen«, meinte ich, »muss Vespasian ein Partner bei seinen Bemühungen höchst willkommen sein.«
»Titus bereitet ihm große Freude«, gab Caenis gelassen zurück. Sie wusste, wie man einen heiklen Punkt missverstand. »Und er setzt bestimmt auch Hoffnungen in Domitian.« Vespasians älterer Sohn war praktisch der Mitregent seines Vaters, und obwohl der jüngere sich ein paar Taktlosigkeiten erlaubt hatte, wurde er nach wie vor für formelle Pflichten eingesetzt. Ich hegte einen tiefen Groll auf Domitian Cäsar und schwieg, düster daran denkend, wie er mir die Galle hochtrieb. Antonia Caenis bedeutete mir schließlich, Platz zu nehmen.
Seit Vespasian vor drei Jahren Kaiser geworden war, vermutete die Öffentlichkeit, dass diese Dame ihr Leben genoss. Man glaubte, dass die höchsten Posten – Tribunat und Priesterschaft – auf ihr Wort hin vergeben wurden (gegen Bezahlung natürlich). Begnadigungen wurden gekauft. Entscheidungen wurden fixiert. Man munkelte, dass Vespasian diesen Handel ermutigte, der nicht nur seine Konkubine bereicherte und ihr zu größerer Macht verhalf, sondern ihm auch dankbare Freunde verschaffte. Ich fragte mich, ob sie den finanziellen Gewinn teilten. Auf einer rein prozentuellen Basis? Oder nach einer gleitenden Skala? Machte Caenis Abzüge für ihre Ausgaben und Bemühungen?
»Falco, ich bin nicht in der Lage, Ihnen eine Gunst zu verkaufen«, verkündete sie, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Ihr ganzes Leben lang mussten sich die Leute wegen ihrer Nähe zum Hof an sie rangewanzt haben. Ihre Augen waren dunkel und wachsam. In den turbulenten, misstrauischen Zeiten der claudischen Familie waren zu viele ihrer Patrone und Freunde gestorben. Zu viele Jahre hatte sie in schmerzlicher Ungewissheit verbracht. Was immer in dieser eleganten Villa zum Verkauf stand, würde mit penibler Aufmerksamkeit behandelt werden, wobei sie den Wert genau im Auge behielt.
»Ich bin nicht in der Lage zu kaufen«, erwiderte ich offen. »Ich kann nicht mal Versprechungen machen.«
Das glaubte ich ihr nicht.
Helena beugte sich vor, um etwas sagen. Ihre blaue Stola glitt von ihrer Schulter und fiel ihr in den Schoß. Der Rand verfing sich in den Armreifen, unter denen sie die Narbe eines Skorpionstichs verbarg. Ungeduldig schüttelte sie die Stola los. Das Kleid darunter war weiß, formell. Ich bemerkte, dass sie eine alte Achatkette trug, die sie schon vor unserem Kennenlernen besessen hatte, unbewusst wieder die Senatorentochter spielte. Das würde ihr hier wenig nützen.
»Marcus Didius ist viel zu stolz, um für Privilegien zu zahlen.« Ich liebte es, wenn Helena so ernst sprach, besonders, wenn es dabei um mich ging. »Er würde es selbst nie erwähnen, aber er ist bitter enttäuscht worden – und das, nachdem ihm Vespasian persönlich angeboten hat, ihn in den Ritterstand zu erheben.«
Caenis hörte mit einem gewissen Unwillen zu, als hielte sie Klagen für schlechtes Benehmen. Zweifellos kannte sie die ganze Geschichte, wusste, was passiert war, als ich mir im Palast meine Belohnung abholen wollte. Vespasian hatte mir den gesellschaftlichen Aufstieg versprochen, aber ich wollte ihn an einem Abend einfordern, als Vespasian nicht in Rom war und Domitian über Gesuche entschied. Mir meines Erfolgs allzu sicher, hatte ich die Sache mit dem Prinzlein durchgefochten und den Preis dafür bezahlt. Ich besaß Beweise gegen Domitian in einer sehr ernsten Angelegenheit, und das wusste er. Nie hatte er gewagt, offen etwas gegen mich zu unternehmen, aber an dem Abend nahm er Rache und lehnte mein Gesuch ab.
Domitian war ein Flegel. Außerdem war er gefährlich, und ich hielt Caenis für klug genug, das zu erkennen. Ob sie allerdings den Familienfrieden mit einer entsprechenden Äußerung gefährden würde, war eine andere Sache. Doch wenn sie tatsächlich bereit war, ihn zu kritisieren, würde sie dann zu meinen Gunsten sprechen?
Caenis musste bereits wissen, was wir wollten. Helena hatte sich hier mit ihr verabredet, und als ehemalige Sekretärin des Hofes hatte sich Caenis natürlich kundig gemacht, bevor sie den Bittstellern gegenübertrat.
Sie antwortete nicht, gab immer noch vor, sich nicht in Staatsangelegenheiten einzumischen.
»Die Enttäuschung hat Marcus nie davon abgehalten, dem Imperium weiter zu dienen.« Helena sprach ohne Bitterkeit, wenn auch mit ernstem Gesicht. »Er hat gefährliche Missionen in den Provinzen durchgeführt, und Ihnen ist sicher bekannt, was er in Britannien, Germanien, Nabatäa und Spanien erreicht hat. Jetzt möchte er seine Dienste dem Zensus anbieten, wie ich es Ihnen eben beschrieben habe ...«
Das wurde mit einem kühlen, unverbindlichen Nicken bestätigt.
»Die Idee dazu kam mir im Zusammenhang mit Camillus Verus«, erklärte ich. »Helenas Vater ist natürlich ein guter Freund des Kaisers.«
Caenis ging gnädig auf diesen Wink ein. »Camillus ist Ihr Patron?« Patronate waren die Schussfäden der römischen Gesellschaft (in der die Kettfäden aus Korruption bestanden). »Und er hat sich für Sie beim Kaiser eingesetzt?«
»Ich wurde nicht dazu erzogen, jemandes Klient zu sein«, erwiderte ich.
»Papa unterstützt Marcus Didius in jeder Weise«, warf Helena ein.
»Das glaube ich gern.«
»Mir scheint«, fuhr Helena fort und wurde heftiger, »dass Marcus ohne formelle Anerkennung genug für das Imperium getan hat.«
»Was meinen Sie, Marcus Didius?«, fragte Caenis, ohne auf Helenas Verärgerung zu achten.
»Ich würde diese Arbeit für den Zensus gern in Angriff nehmen. Sie ist eine Herausforderung, und ich leugne nicht, dass sie sehr lukrativ sein könnte.«
»Ich wusste nicht, dass Vespasian Ihnen exorbitante Honorare zahlt!«
»Hat er nie getan.« Ich grinste. »Aber diesmal ist es was anderes. Nicht der übliche Akkordarbeiterlohn. Ich möchte einen prozentualen Anteil an allen Einnahmen, die der Staat mit meiner Hilfe zurückbekommt.«
»Darauf wird sich Vespasian nie einlassen«, erklärte Caenis entschieden.
»Denken Sie darüber nach.« Auch ich konnte zäh sein.
»Wieso, um welche Summen geht es hier?«
»Wenn so viele Leute, wie ich vermute, bei ihren Steuererklärungen schummeln, werden wir den Schuldigen enorme Summen abknöpfen. Die einzigen Grenzen werden meine Ausdauer und Zähigkeit sein.«
»Aber Sie haben doch einen Partner?« Das wusste sie also.
»Er ist noch ungeübt, doch ich bin zuversichtlich.«
»Wer ist der Mann?«
»Nur ein arbeitsloser Ermittlungsbeamter, den meine alte Mutter aus Mitleid unter ihre Fittiche genommen hat.« »Soso.« Antonia Caenis hatte wahrscheinlich herausgefunden, dass es Anacrites war. Möglicherweise kannte sie ihn. Vielleicht verachtete sie ihn genauso wie ich – oder betrachtete ihn als Vespasians Diener und Verbündeten. Ich hielt ihrem Blick stand.
Plötzlich lächelte sie. Ein offenes, intelligentes Lächeln voller Charakter. Nichts deutete darauf hin, dass sie eine ältere Frau war, die allmählich bereit sein sollte, auf ihren Platz in der Welt zu verzichten. Einen Augenblick lang meinte ich zu erkennen, was Vespasian immer in ihr gesehen haben musste. Sie konnte es zweifellos mit dem alten Mann aufnehmen. »Ihr Vorschlag klingt interessant, Marcus Didius. Ich werde ihn sicherlich mit Vespasian besprechen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt.«
»Ich wette, Sie führen eine offizielle Liste mit Fragen, die Sie und Vespasian täglich zu einer festgesetzten Stunde durchgehen.«
»Sie haben merkwürdige Ansichten über unseren Tagesablauf.«
Ich lächelte sanft. »Nein, ich dachte nur, dass Sie Titus Flavius Vespasianus vielleicht auf dieselbe Weise festnageln, wie Helena das mit mir macht.«
Sie lachten beide, lachten über mich. Das konnte ich ertragen. Ich war ein glücklicher Mann, wusste, dass Antonia Caenis mir den Posten verschaffen würde, den ich wollte, und hegte große Hoffnung, dass sie noch mehr für mich tun würde.
»Ich nehme an«, sagte sie, immer noch sehr direkt, »dass Sie mir erklären wollen, was mit Ihrer Beförderung schief gelaufen ist?«
»Ich gehe davon aus, dass Sie das wissen! Domitian war der Meinung, Ermittler seien verkommene Gesellen, die es nicht wert sind, in den Ritterstand erhoben zu werden.«
»Hat er Recht damit?«
»Ermittler sind längst nicht so verkommen wie einige der verstaubten Gipsköpfe mit schmieriger Moral, die die oberen Ränge bevölkern.«
»Zweifellos«, meinte Caenis mit leisem Tadel, »wird der Kaiser Ihre kritischen Ansichten im Kopf behalten, wenn er die Listen überprüft.«
»Das hoffe ich.«
»Ihre Bemerkungen könnten darauf hindeuten, Marcus Didius, dass Sie im Moment keinen Wert darauf legen, in die Ränge der verstaubten Gipsköpfe aufgenommen zu werden.«
»Ich kann es mir nicht leisten, mich überlegen zu fühlen.«
»Aber Sie können sich Unverblümtheiten leisen?«
»Das ist eines der Talente, die mir helfen werden, Kohle aus den Zensusbetrügern rauszuquetschen.«
Sie sah mich streng an. »Wenn ich ein Protokoll über dieses Treffen schreiben müsste, Marcus Didius, würde ich es als ›Wiederbeschaffung von Staatseinnahmen‹ umformulieren.«
»Wird es denn ein offizielles Protokoll geben?«, fragte Helena leise.
Caenis schaute noch strenger. »Nur in meinem Kopf.«
»Also gibt es keine Garantie dafür, dass eine Marcus Didius versprochene Belohnung eines Tages anerkannt wird?« Helena verlor ihr ursprüngliches Ziel nie aus den Augen.
Ich beugte mich vor. »Keine Bange. Es könnte auf zwanzig Schriftrollen festgehalten sein, doch wenn ich in Ungnade fiele, könnten sie unauffindbar in den Archiven verschwinden. Wenn Antonia Caenis bereit ist, mich zu unterstützen, reicht mir ihr Wort.«
Antonia Caenis war es gewohnt, wegen Gefälligkeiten gelöchert zu werden. »Ich kann nur Empfehlungen geben. Alle Staatsangelegenheiten unterliegen dem Ermessen des Kaisers.«
Na klar doch! Vespasian hatte auf sie gehört, seit sie ein Mädchen war und er ein verarmter junger Senator. Ich grinste Helena an. »Siehst du. Das ist die beste Garantie, die man sich wünschen kann.«
Zu dem Zeitpunkt glaubte ich das wirklich.
Kapitel IV
Einen halben Tag später wurde ich in den Palast gerufen. Ich sah weder Vespasian noch Titus. Ein aalglatter Beamter namens Claudius Laeta gab vor, er sei für meine Anstellung verantwortlich. Ich kannte Laeta. Er war nur für Chaos und Schmerz verantwortlich.
»Mir fehlt offenbar noch der Name Ihres neuen Partners.« Er fummelte mit den Schriftrollen rum und wich meinem Blick aus.
»Wie außerordentlich nachlässig. Ich schicke Ihnen einen Zettel mit seinem Namen und seinen vollständigen Lebenslauf.« Laeta wusste genau, dass ich nicht im Traum daran dachte.
Er gab sich liebenswürdig (ein sicheres Zeichen, dass ihn der Kaiser schwer unter Druck gesetzt hatte) und stellte mich für den Posten ein, um den ich gebeten hatte. Wir einigten uns über meinen Prozentanteil an den Einkünften. Rechnerische Fähigkeiten schienen Laetas schwacher Punkt zu sein. Er wusste alles über einfallsreiche Konzepte und schmierige Diplomatie, merkte aber nicht, wenn man ihn finanziell übers Ohr haute. Ich kam mir sehr gerissen vor.
Unser erstes Ermittlungsobjekt war Calliopus, ein halbwegs erfolgreicher Lanista aus Tripolitanien, der Gladiatoren trainierte und förderte, vor allem solche, die gegen wilde Tiere antraten. Als mir Calliopus seine Personalliste vorlegte, waren mir die Namen alle fremd. Er besaß keine erstklassigen Kämpfer, die sich mit Ruhm bekleckert hatten. Keine Frau würde sich seiner mittelmäßigen Mannschaft an den Hals werfen, und in seinem Büro waren keine goldenen Siegeskronen zur Schau gestellt. Aber ich kannte den Namen seines Löwen: Leonidas.
Der Löwe teilte seinen Namen mit einem großen General aus Sparta. Das machte ihn nicht sonderlich beliebt bei Römern wie mir, die von Kindesbeinen an gelernt hatten, sich vor allem Griechischen in Acht zu nehmen, damit wir nicht so zweifelhafte Gewohnheiten annahmen, wie Bärte zu tragen oder über Philosophie zu diskutieren. Aber ich liebte diesen Löwen, noch bevor ich ihn kennen lernte. Bei den nächsten passenden Spielen sollte er einen abscheulichen Sexualmörder namens Thurius kaltmachen. Thurius hatte jahrzehntelang Frauen aufgelauert, sie in Stücke gehackt und sich der Überreste entledigt; ich hatte ihn selbst zur Strecke und vor Gericht gebracht. Nachdem Anacrites und ich bei Calliopus eintrafen, hatte ich als Erstes um eine Führung durch die Menagerie gebeten und war sofort zu dem Löwen geeilt.
Ich sprach mit Leonidas wie mit einem verlässlichen Kollegen und erklärte ihm sehr sorgfältig das Maß an brutaler Grausamkeit, das ich an jenem Tag von ihm erwartete. »Tut mir Leid, dass wir es nicht vor den Saturnalien erledigen können, aber das ist ein Fest der Freude, und die Priester sagen, Verbrecher zu zerfleischen würde die Stimmung verderben. Na gut, kann der Drecksack noch ein bisschen länger über die entsetzlichen Schmerzen nachdenken, die du ihm zufügen wirst. Zerreiß ihn, so langsam du kannst, Leo. Lass ihn leiden.«
»Das nützt nichts, Falco.« Buxus, der Tierpfleger, hatte zugehört. »Löwen sind freundliche und höfliche Killer. Ein Schlag mit der Pranke, und man ist hin.«
»Das merk ich mir. Ich werde um eine der großen Katzen bitten, sollte ich je gegen das Gesetz verstoßen.«
Leonidas war noch jung. Er war muskulös und helläugig, stank aber aus dem Maul, weil er mit rohem Fleisch gefüttert wurde. Nicht zu viel – sie ließen ihn hungern, damit er seine Arbeit gründlich erledigte. Er lag im Halbdunkel hinten im Käfig und schlug verächtlich drohend mit dem Schwanz. Misstrauische goldene Augen beobachteten uns.
»Was ich an dir bewundere, Falco«, bemerkte Anacrites, der sich leise von hinten an mich angeschlichen hatte, »ist deine persönliche Anteilnahme an den obskursten Details.«
Das war schon besser als Petronius Longus’ ständige Nörgelei, ich würde mich in Trivialitäten verlieren, aber es bedeutete dasselbe. Genau wie der alte teilte mir mein neuer Partner mit, dass ich meine Zeit vergeudete.
»Leonidas«, stellte ich fest (und überlegte, welche Chance bestand, den Löwen zu überreden, meinen neuen Partner zu verspeisen), »ist von großer Bedeutung. Er hat viel Geld gekostet, stimmt’s, Buxus?«
»Natürlich.« Der Pfleger nickte. Er ignorierte Anacrites, hielt sich lieber an mich. »Es ist schwierig, sie lebend zu fangen. Ich war in Afrika und hab es gesehen. Die nehmen Kinder als Köder. Die Bestien dazu zu bekommen, sich auf den Köder zu stürzen und in die Grube zu fallen, ist verzwickt genug – aber dann muss man die Katzen ohne Verletzung wieder rauskriegen, während sie wie verrückt brüllen und jeden in Stücke reißen wollen, der ihnen zu nahe kommt. Calliopus benutzt einen Agenten, der manchmal Löwenjunge für uns fängt, aber da muss er zuerst die Mutter jagen und töten. Und dann hat man die Mühe, die Jungen aufzuziehen, bis sie die richtige Größe für die Spiele haben.«
Ich grinste. »Kein Wunder, dass das Sprichwort sagt, für einen erfolgreichen Politiker sei die erste Voraussetzung, eine gute Quelle für Tiger zu kennen.«
»Wir haben keine Tiger«, entgegnete Buxus düster. Sarkasmus war an ihn verschwendet. Witze über Senatoren, die Leute mit blutrünstigen Schauspielen bestachen, prallten von ihm ab. »Tiger kommen aus Asien, weswegen so wenige Rom erreichen. Wir haben nur Verbindungen zu Nordafrika, Falco. Von da kriegen wir Löwen und Leoparden. Calliopus stammt aus Oea ...«
»Stimmt. Er beschränkt seine Geschäfte auf die Familie. Zieht Calliopus’ Agent die Löwenjungen da drüben auf?«
»Hat keinen Zweck, Geld für das Verschiffen zu verschwenden – was ein Spiel in sich ist –, bevor sie groß genug sind, um für uns von Nutzen zu sein.«
»Calliopus besitzt also zusätzlich zu dieser hier noch eine Menagerie in Tripolitanien?«
»Ja.« Das musste die in Oea sein, von der Calliopus dem Zensor geschworen hatte, sie gehöre seinem Bruder. Anacrites, der endlich merkte, worauf ich hinauswollte, machte sich heimlich Notizen auf seiner Tafel. Die Tiere konnten so wertvoll sein, wie sie wollten; es war Land, ob in Italien oder den Provinzen, auf das wir aus waren. Wir hatten den Verdacht, dass dieser »Bruder« in Oea eine Erfindung von Calliopus war.
Das hatte uns für den ersten Tag zunächst gereicht. Wir sammelten die Unterlagen über die Menagerie ein, fügten sie dem Stapel Schriftrollen hinzu, auf denen die Einzelheiten über Calliopus’ zähe Kämpfer verzeichnet waren, und trotteten mit den Dokumenten zurück in unser neues Büro.
Dieser Hühnerstall war ein weiterer Streitpunkt. Während meines ganzen Berufslebens als Ermittler hatte mir eine grausige Wohnung an der Brunnenpromenade auf dem Aventin als Büro gedient. Wer wirklich was auf dem Herzen hatte, stieg die sechs Stockwerke hinauf und holte mich aus dem Bett, damit ich mir sein Leid anhörte. Zeitverschwender schreckten vor dem Aufstieg zurück. Böse Buben, die mich mit einem Schlag auf den Kopf von meinen Ermittlungen abhalten wollten, hörte ich schon beim Raufkommen.
Als Helena und ich eine geräumigere Unterkunft brauchten, zogen wir auf die andere Straßenseite, behielten aber die alte Wohnung als Büro. Ich hatte Petronius dort einziehen lassen, nachdem ihn seine Frau wegen Poussierens rausgeworfen hatte, und obwohl wir keine Partner mehr waren, wohnte er immer noch dort. Anacrites hatte darauf bestanden, dass wir jetzt etwas brauchten, wo wir die Schriftrollen unserer Arbeit für den Zensor aufheben konnten, ohne von Petro missbilligend angefunkelt zu werden. Was wir nicht brauchten, wie ich immer wieder betonte (obwohl ich mir den Atem hätte sparen können), war ein mieser Verschlag bei den Schnorrern in den Saepta Julia.
Anacrites mietete ihn ohne Rücksprache mit mir an. Das war die Art von Partner, die meine Mutter mir auf den Hals gehetzt hatte.
Die Saepta sind große Säulenhallen neben dem Pantheon und dem Diribitorium. Die inneren Arkaden waren damals – vor der großen Säuberung – der Unterschlupf der Ermittler. Der hinterhältigsten und schleimigsten. Der politischen Kriecher. Neros alten Speichelleckern und Spionen. Kein Takt und kein Geschmack. Keine Moral. Die Zierde unseres Berufsstandes. Mit denen wollte ich nichts zu tun haben, aber Anacrites hatte uns mitten in ihr verlaustes Habitat hineingepflanzt.
Der restliche Pöbel in den Saepta Julia bestand aus Goldschmieden und Juwelieren, eine lockere Clique, die sich um eine Gruppe von Auktionatoren und Antiquitätenhändlern gebildet hatte. Einer davon war mein Vater, von dem ich mich schon aus Gewohnheit so fern wie möglich hielt.
»Willkommen in der Zivilisation!«, krähte Papa, der innerhalb von fünf Minuten nach unserer Rückkehr hereinschoss.
»Verpiss dich, Papa.«
»Ach, mein guter Junge!«
Mein Vater war ein stämmiger, schwerer Mann mit struppigen grauen Locken und einem Lächeln, das selbst bei erfahrenen Frauen als charmant galt. Er hatte den Ruf, ein geriebener Geschäftsmann zu sein, was bedeutete, dass er eher log als die Wahrheit sagte. Er hatte mehr gefälschte schwarzfigurige griechische Vasen verkauft als jeder andere Auktionator in Italien. Ein Töpfer stellte sie speziell für ihn her.
Die Leute sagten, ich sei wie mein Vater, aber wenn sie meine Reaktion darauf bemerkten, sagten sie es nie wieder.
Ich wusste, warum er glücklich war. Jedes Mal, wenn ich mitten in einem schwierigen Auftrag steckte, tauchte er auf und verlangte, dass ich augenblicklich in sein Lagerhaus käme, um beim Umräumen schwerer Möbelstücke zu helfen. Jetzt, da er mich in der Nähe hatte, hoffte er zwei Träger und den Jungen entlassen zu können, der ihm seinen Borretschtee aufbrühte. Schlimmer noch, Papa würde sich augenblicklich mit jedem Verdächtigen anfreunden, den ich auf Distanz halten wollte, und ganz Rom mit Ausschmückungen meines Auftrags unterhalten.
»Darauf müssen wir einen trinken!«, rief er und eilte davon.
»Du kannst Mama selbst davon erzählen«, knurrte ich, zu Anacrites gewandt. Woraufhin der noch bleicher wurde als zuvor. Er musste kapiert haben, dass meine Mutter nicht mehr mit meinem Vater gesprochen hatte, seit der mit einer Rothaarigen durchgebrannt war und es Mama überlassen hatte, seine Kinder großzuziehen. Die Vorstellung, dass ich in Papas Nähe arbeitete, würde sie nach jemandem suchen lassen, den sie kopfüber an ihrem Räucherfleischhaken aufhängen konnte. Durch den Einzug in dieses Büro hatte Anacrites möglicherweise sein Unterkommen in Mamas Wohnung aufs Spiel gesetzt, köstliche Mahlzeiten geopfert und eine schwerere Verwundung riskiert als die, nach der sie sein Leben gerettet hatte. »Ich hoffe, du kannst schnell laufen, Anacrites.«
»Du bist herzlos, Falco! Warum dankst du mir nicht, dass ich ein so schönes Büro für uns gefunden habe?«
»Ich hab schon größere Schweinepferche gesehen.«
Das Ding war ein Besenschrank im ersten Stock, der seit zwei Jahren leer stand, nachdem der vorherige Mieter darin gestorben war. Als Anacrites dem Vermieter ein Angebot machte, hatte der sein Glück kaum fassen können. Jedes Mal, wenn wir uns bewegten, stießen wir uns die Ellbogen an. Die Tür schloss nicht, die Mäuse weigerten sich, uns Platz zu machen, man konnte nirgends pinkeln, und der nächste Imbissstand lag ganz auf der anderen Seite; dort gab es schimmlige Brötchen, von denen uns schlecht wurde.
Ich hatte mir einen Platz an einem kleinen hölzernen Pult eingerichtet, von wo aus ich die Welt vorbeiziehen sah. Anacrites nahm mit einem Hocker im dunkleren Teil des Verschlages vorlieb. Seine unauffällige austernfarbene Tunika und das ölig zurückgekämmte Haar verschwanden im Schatten, so dass nur sein glattes, bleiches Gesicht hervorlugte. Er schaute besorgt, lehnte den Hinterkopf an die Trennwand, um seine große Wunde zu verbergen. Erinnerungen und Logik spielten ihm beide einen Streich. Trotzdem wirkte er munterer, seit er die Partnerschaft mit mir eingegangen war; er vermittelte den seltsamen Eindruck, dass er sich auf sein neues, aktives Leben freute.
»Erzähl Papa bloß nicht, was wir für den Zensus machen, sonst weiß es ganz Rom noch vor der Abendbrotzeit.«
»Tja, was soll ich dann sagen, Falco?« Schon als Spion hatte ihm jede Initiative gefehlt.
»Interne Rechnungsprüfung.«
»Genau! Da verlieren die Leute gewöhnlich schnell das Interesse. Und was sagen wir den Verdächtigen?«
»Mit denen müssen wir vorsichtig sein. Wir wollen doch nicht, dass sie von unserer drakonischen Härte erfahren.«
»Nein. Dann könnten sie uns am Ende Bestechungen anbieten.«
»Die wir selbstverständlich aus Anständigkeit ablehnen.«
»Außer es sind wirklich ansehnliche Beträge«, erwiderte Anacrites zurückhaltend.
»Was sie bei einigem Glück sein werden«, gab ich kichernd zurück.
»Da bin ich wieder!« Papa kam mit einer Amphore herein. »Ich hab dem Weinhändler gesagt, du würdest später bezahlen.«
»Oh, vielen Dank!« Papa quetschte sich neben mich, gestikulierte und wartete auf die förmliche Vorstellung, die er vorher beiseite gewischt hatte. »Anacrites, das ist mein Vater, der verschlagene Geizhals Didius Favonius. Ansonsten als Geminus bekannt. Er musste seinen Namen ändern, weil zu viele wütende Menschen hinter ihm her waren.«
Mein neuer Partner dachte offensichtlich, ich hätte ihm eine faszinierende Persönlichkeit vorgestellt, einen schillernden und viel gefragten Exzentriker der Saepta. Tatsächlich kannten sie sich bereits aus einem Hochverratsfall, bei dem wir alle gemeinsam nach Kunstschätzen gesucht hatten. Beide schienen sich nicht daran zu erinnern.
»Sie sind der Untermieter!«, rief mein Vater. Anacrites schien sich über seine lokale Berühmtheit zu freuen.
Als Papa Wein in Metallbecher goss, merkte ich, dass er uns beobachtete. Sollte er doch. Solche Spielchen waren seine Vorstellung von Spaß, nicht meine.
»Jetzt heißt es also wieder Falco & Partner?«
Ich rang mir ein müdes Lächeln ab. Anacrites schniefte. Er hatte nicht bloß »& Partner« sein wollen, aber ich hatte auf Kontinuität bestanden. Schließlich hoffte ich so schnell wie möglich eine andere Partnerschaft einzugehen.
»Habt ihr euch hier schon eingerichtet?« Papa genoss die angespannte Atmosphäre.
»Es ist ein bisschen eng, aber wir werden viel unterwegs sein. Daher ist es nicht so schlimm.« Anacrites wollte mich offenbar damit ärgern, Papa ins Gespräch zu verwickeln. »Zumindest ist der Preis annehmbar. Anscheinend war es eine Zeit lang nicht vermietet.«
Papa nickte. Er liebte Klatsch. »Der letzte Mieter war der alte Pontinus. Bis er sich die Kehle durchgeschnitten hat.«
»Wenn er hier gearbeitet hat, kann ich das gut verstehen«, sagte ich.
Anacrites sah sich nervös in der Villa Pontinus um, falls da immer noch Blutflecken sein sollten. Reuelos zwinkerte mein Vater mir zu.
Dann zuckte mein Partner zusammen. »Interne Rechnungsprüfung taugt nicht als Tarnung!«, schnaubte er verstimmt. »Keiner wird uns das abnehmen, Falco. Die internen Rechnungsprüfer sind dazu da, Fehler in der Palastbürokratie aufzudecken. Sie begeben sich nie in die Öffentlichkeit ...« Er hatte begriffen, dass ich ihn verschaukelt hatte. Befriedigt stellte ich fest, dass er wütend war.
»Nur ein Versuch«, sagte ich hämisch grinsend.
»Um was geht es?«, drängte Papa, der es hasste, ausgeschlossen zu sein.
»Das ist vertraulich!«, gab ich vernichtend zurück.
Kapitel V
Am nächsten Tag, nachdem wir Calliopus’ offizielle Angaben durchgeackert hatten, begaben wir uns zurück in sein Trainingslager, um das Ganze auseinander zu nehmen.
Der Mann selbst sah kaum so aus, als hätte er geschäftlich mit Tod und Grausamkeit zu tun. Er war ein langer, dünner, gepflegter Bursche mit ordentlich geschnittenem dunklem Kraushaar, großen Ohren, breiten Nasenlöchern und einer Bräune, die auf fremdländische Abstammung hinwies, obwohl er sich gut angepasst hatte. Der Immigrant aus einer Gegend südlich von Karthago hätte genauso gut in der Subura geboren sein können, wenn man die Augen schloss. Sein Latein war fließend, der Akzent reiner Circus Maximus, unbeeinträchtigt durch Übung in der Vortragskunst. Er trug schlichte weiße Tuniken und genug Ringe an den Fingern, um ihm menschliche Eitelkeit zuzugestehen. Ein großherziger Junge, der es durch harte Arbeit zu etwas gebracht hatte und sich anständig benahm. Von der Art, die Rom zu hassen liebt.
Er war im richtigen Alter, um sich von überall hochgearbeitet zu haben. Unterwegs konnte er alle möglichen Geschäftspraktiken gelernt haben. Er kümmerte sich selbst um uns. Was darauf hindeuten sollte, dass er sich nur wenige Sklaven leisten konnte, die alle zu arbeiten und keine Zeit für uns hatten. Da ich seine Personallisten gesehen hatte, wusste ich es besser; er wollte selbst kontrollieren, was Anacrites und ich zu hören bekamen. Er wirkte freundlich und desinteressiert. Wir wussten, was wir davon zu halten hatten.
Sein Unternehmen bestand aus einer kleinen Palästra, wo seine Männer trainiert wurden, und einer Menagerie. Wegen der Tiere hatten die Ädilen ihn gezwungen, sich außerhalb von Rom niederzulassen, an der Via Portunensis, auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses. Zumindest war es für uns die richtige Seite der Stadt, aber in jeder anderen Hinsicht war es ziemlich lästig. Um die raue Gegend des Trans Tiberim zu umgehen, mussten wir den Bootsmann überreden, uns vom Emporium zur Porta Portunensis zu rudern. Von dort war es nur noch ein kurzer Weg, vorbei am Heiligtum der syrischen Götter, die uns in exotische Stimmung versetzten, und dann am Heiligtum des Herkules.
Unser erster Besuch war nur kurz gewesen. Gestern hatten wir den Mann kennen gelernt, den wir überprüfen sollten, uns seinen Löwen in dem ziemlich unsicher wirkenden angenagten Holzkäfig angesehen und Dokumente eingesammelt, um uns einen Überblick zu verschaffen. Heute würden wir eine härtere Gangart einschlagen.
Anacrites war darauf vorbereitet, die anfängliche Befragung durchzuführen. Meine Durchsicht der Unterlagen hatte ergeben, dass Calliopus momentan elf Gladiatoren besaß. Sie waren professionelle »Bestiarii«. Damit meine ich, dass sie keine simplen Verbrecher waren, die man zu zweit in den Ring schickte, damit sie sich während des morgendlichen Aufwärmtrainings gegenseitig umbrachten, wobei der Letzte von einem Helfer kaltgemacht wurde; hier handelte es sich um elf anständig trainierte und bewaffnete Tierkämpfer. Profis wie die ziehen eine gute Schau ab, versuchen aber »zurückgeschickt« zu werden – das heißt, nach jeder Runde lebendig in den Tunnel zurückzukehren. Sie müssen wieder kämpfen, doch sie hoffen darauf, dass die Menge eines Tages nach einer großen Belohnung für sie schreit oder sogar ihre Freilassung fordert.
»Es gibt nicht viele Überlebende?«, fragte ich Calliopus. Ich wollte ihm die Befangenheit nehmen, bis wir die eigentliche Befragung begannen.
»Oh, mehr als Sie denken, besonders unter den Bestiarii. Man braucht Überlebende. Die Hoffnung auf Geld und Ruhm lockt sie an. Für junge Burschen aus ärmlichen Verhältnissen ist es vielleicht die einzige Chance, im Leben Erfolg zu haben.«
»Sie wissen sicher, dass alle annehmen, die Kämpfe seien vorher abgesprochen.«
»Ich hab davon gehört«, meinte Calliopus unverbindlich. Er kannte vermutlich auch die andere Theorie, die jeder Römer, der etwas auf sich hält, vor sich hin murmelt, wenn der Schirmherr der Spiele mit seinem verflixten weißen Taschentuch wedelt und den Spaß unterbricht: Der Schiedsrichter ist blind.
Ein Grund, warum die Gladiatoren dieses Lanista als Schwächlinge galten, lag darin, dass er auf vorgetäuschte Jagden spezialisiert war – der Teil der Spiele, den man Venatio nennt. Calliopus besaß mehrere große wilde Tiere, die er in vorgefertigten Kulissen in der Arena freiließ und die von seinen Männern entweder zu Pferd oder zu Fuß verfolgt wurden, wobei sie so wenige wie möglich töteten und trotzdem das Publikum bei Laune hielten. Manchmal kämpften die Tiere gegeneinander, in eher unwahrscheinlichen Paarungen – Elefanten gegen Bullen, Panter gegen Löwen. Es gab auch Einzelkämpfe, Mann gegen Tier. Bestiarii waren allerdings wenig mehr als erfahrene Jäger. Die Menge verachtete sie im Vergleich zu den Thrakern, Murmillio und Retiarii, die alle auf verschiedene Weise kämpften und am Ende tot im Sand zu liegen hatten.
»Ach, wir verlieren hin und wieder einen Mann, Falco. Die Jagd muss gefährlich wirken.«
Da hatte ich aber anderes gesehen – widerwillige Tiere, die sich nur durch lautes Aneinanderschlagen der Schilde oder Wedeln mit brennenden Fackeln in ihr Unglück locken ließen.
»Sie haben Ihr vierfüßiges Inventar also gerne wild. Und Sie bekommen es aus Tripolitanien?«
»Zum größten Teil. Meine Agenten durchstreifen ganz Nordafrika – Numidien, die Cyrenaika, sogar Ägypten.«
»Und das Finden, Unterbringen und Füttern der Tiere ist sehr kostspielig?«
Calliopus sah mich aus schmalen Augen an. »Worauf wollen Sie hinaus, Falco?«
Wir hatten abgemacht, dass Anacrites die ersten Fragen stellen würde, aber ich konnte es nicht lassen, selbst anzufangen. Das verunsicherte Calliopus, der nicht recht wusste, ob die Befragung schon offiziell begonnen hatte oder nicht. Im Übrigen verunsicherte es auch Anacrites.
Zeit, offen zu sein. »Die Zensoren haben meinen Partner und mich gebeten, eine Überprüfung des Lebensstils vorzunehmen, wie wir es nennen.«
»Eine was?«
»Ach, Sie wissen schon. Die Zensoren wundern sich, wie Sie es schaffen, Eigentümer dieser prächtigen Villa in Surrentum zu sein und gleichzeitig zu behaupten, mit Ihrem Geschäft Verlust zu machen.«
»Die Villa in Surrentum habe ich angegeben!«, protestierte Calliopus. Das war natürlich ein Fehler gewesen. Grundstücke an der Bucht von Neapolis stehen hoch im Kurs. Villen an den Hängen mit herrlichem Blick über das blitzblaue Wasser hinüber zur Insel Capreae sind das Wahrzeichen von Millionären aus den Konsulfamilien, ehemaligen Palastsklaven aus den Büros für Bittschriften und erfolgreicheren Erpressern.
»Sehr anständig«, beruhigte ich ihn. »Natürlich sind Vespasian und Titus davon überzeugt, dass Sie nicht zu jenen üblen Gestalten gehören, die mitleiderregend greinen, sie würden in einem Geschäftszweig mit hohen Unkosten arbeiten, und gleichzeitig einen Stall mit Vollblutpferden im neronischen Circus unterhalten und Streitwagen mit Beschleunigungsspeichen und Goldverzierung fahren. Was für Wagen fahren Sie übrigens?«, fragte ich unschuldig.
»Ich besitze eine von Maultieren gezogene Familienkutsche und eine Sänfte für den persönlichen Gebrauch meiner Frau«, antwortete Calliopus gekränkt und überlegte offenbar fieberhaft, wie er schnellstens seine schicke Quadriga mit dem dazugehörigen Quartett spritziger spanischer Grauschimmel abstoßen konnte.
»Wie bescheiden. Aber Sie wissen ja, was bei der Bürokratie Aufmerksamkeit erregt. Große Kutschen, wie ich schon sagte. Hohe Wetteinsätze. Exquisite Tuniken. Lärmende Zechgenossen. Nächte mit Mädchen, die ungewöhnliche Dienste anbieten. Nichts, dessen man Sie bezichtigen könnte, das ist mir klar.« Der Lanista wurde rot. Unbekümmert fuhr ich fort: »Nackte Statuen aus pentelischem Marmor. Mätressen, die fünf Sprachen sprechen, einen Saphir mit Cabochonschliff beurteilen können und in diskreten Dachterrassenwohnungen an der Safranstraße untergebracht sind.«
Er räusperte sich nervös. Ich nahm mir vor, die Mätresse aufzuspüren. Vielleicht eine Aufgabe für Anacrites; er schien ja sonst nichts beizutragen zu haben. Die Frau konnte vermutlich nur zwei oder drei Sprachen, eine davon bloß Einkaufslistengriechisch, aber sie hatte ihrem Geliebten bestimmt eine kleine Wohnung abgeschwatzt, »für meine Mutter«, und der dusselige Calliopus hatte den Mietvertrag vermutlich mit seinem Namen unterschrieben.
Was für einen Sumpf wir im Verlauf unserer hochherzigen Bemühungen aufdecken würden! Gute Götter, wie hinterlistig und falsch meine Mitbürger doch waren (dachte ich zufrieden).
Noch gab es kein Anzeichen, dass Calliopus uns ein großzügiges Angebot zu machen beabsichtigte, damit wir ihn in Ruhe ließen. Im Moment war das Falco & Partner nur recht. Zu dieser Art Revisorenteam hatten wir uns noch nicht entwickelt. Wir wollten ihn festnageln – Pech für ihn. Wir wollten ordentlich absahnen, mit einer entsprechenden Einnahme für das Schatzamt, um Vespasian und Titus zu beweisen, dass wir unser Handwerk verstanden. Was auch die Bevölkerung darauf aufmerksam machen würde, dass eine Ermittlung unsererseits gefährlich war, woraufhin sich Kandidaten von unserer Liste vielleicht für eine frühzeitige Einigung einsetzen würden.
»Sie besitzen also elf Gladiatoren«, meinte Anacrites schließlich. »Wie erwerben Sie die, wenn ich fragen darf? Kaufen Sie sie?«
Ein verängstigter Ausdruck huschte über Calliopus’ Gesicht, als ihm aufging, dass die Frage folgen würde, woher er die Kaufsumme hatte. »Manche.«
»Sind das Sklaven?«, fuhr Anacrites fort.
»Manche.«
»Von ihren Herren an Sie verkauft?«
»Ja.«
»Unter welchen Umständen?«
»Normalerweise sind es Unruhestifter, die ihren Herrn verärgert haben – oder er glaubte, sie wären zäh, und beschließt, sie zu verscherbeln.«
»Zahlen Sie viel für die?«
»Nicht oft. Aber die Leute hoffen immer darauf.«
»Kaufen Sie auch ausländische Gefangene? Müssen Sie für die bezahlen?«
»Ja. Sie gehören ursprünglich dem Staat.«
»Sind die immer zu haben?«
»Nur in Kriegszeiten.«
»Dieser Markt könnte wegfallen, wenn unser neuer Kaiser für eine glorreiche Friedenszeit sorgt ... Wo werden Sie dann nach neuem Material suchen?«
»Die Männer melden sich freiwillig.«
»Sie wählen dieses Leben?«
»Manche sind verzweifelt auf Geld aus.«
»Zahlen Sie ihnen viel?«
»Ich zahle ihnen gar nichts – nur ihre Verpflegung.«
»Reicht das, um sie zu halten?«
»Wenn sie vorher nichts zu essen hatten, ja. Freie, die aus eigenen Stücken kommen, kriegen ein einmaliges Honorar.«
»Wie viel?«
»Zweitausend Sesterzen.«
Anacrites hob die Augenbrauen. »Kaum mehr, als der Kaiser Dichtern zahlt, die eine gute Ode bei einem Konzert vortragen! Ist das angemessen für einen Mann, der sein Leben dafür hergibt?«
»Das ist mehr, als die meisten je gesehen haben.«
»Aber keine große Summe für Sklaverei und Tod. Müssen die Männer einen Vertrag unterzeichnen?«
»Sie binden sich an mich.«
»Für wie lange?«
»Für immer. Außer sie gewinnen das hölzerne Schwert und werden freigelassen. Aber sobald sie Erfolg haben, werden selbst diejenigen, die die höchsten Preise gewinnen, ruhelos und kommen zurück.«
»Zu denselben Bedingungen?«
»Nein. Das Wiedereinstellungshonorar ist sechsmal so hoch.«
»Zwölftausend?«
»Und natürlich erwarten sie, mehr Preise einzuheimsen; sie halten sich für Gewinner.«
»Tja, das kann nicht ewig so gehen.«
Calliopus lächelte still. »Nein.«