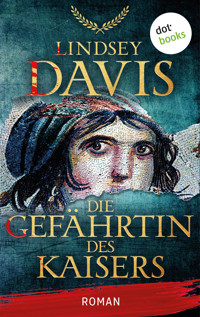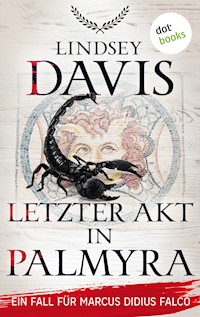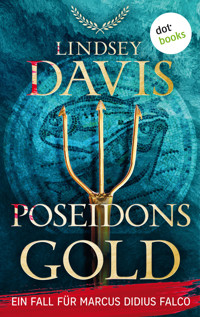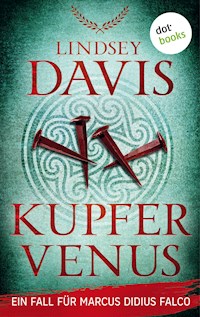5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Ein gefährliches Los: Der fesselnde historische Kriminalroman »Eine Jungfrau zu viel« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 74 nach Christus. Als erfahrenster Privatermittler in der »Stadt der sieben Hügel« weiß Marcus Didius Falco, dass es besser ist, sich aus den Ränkespielen der Oberschicht herauszuhalten. Deswegen ist er wenig begeistert, als Gaia Laelia, die jüngste Tochter einer Familie angesehener Priester, ihn um seine Hilfe bittet: Sie fürchtet um ihr Leben, denn sie ist dazu auserkoren, die nächste Vestalin zu werden – eine Position, für die einige töten würden. Als das junge Mädchen kurze Zeit später spurlos verschwindet, ist Falco alarmiert und macht sich sofort auf die Suche nach Gaia. Für ihn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Denn das ewige Licht im Tempel der Vesta darf niemals erlöschen … »Der liebenswerteste Vorläufer all der zartbesaiteten harten Kerle in der Kriminalliteratur: Falcos lebhafte Erzählung seines Abenteuers verbindet Humor mit scharfer Beobachtung.« Sunday Telegraph Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Eine Jungfrau zu viel« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der elfte Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 74 nach Christus. Als erfahrenster Privatermittler in der »Stadt der sieben Hügel« weiß Marcus Didius Falco, dass es besser ist, sich aus den Ränkespielen der Oberschicht herauszuhalten. Deswegen ist er wenig begeistert, als Gaia Laelia, die jüngste Tochter einer Familie angesehener Priester, ihn um seine Hilfe bittet: Sie fürchtet um ihr Leben, denn sie ist dazu auserkoren, die nächste Vestalin zu werden – eine Position, für die einige töten würden. Als das junge Mädchen kurze Zeit später spurlos verschwindet, ist Falco alarmiert und macht sich sofort auf die Suche nach Gaia. Für ihn beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Denn das ewige Licht im Tempel der Vesta darf niemals erlöschen …
»Der liebenswerteste Vorläufer all der zartbesaiteten harten Kerle in der Kriminalliteratur: Falcos lebhafte Erzählung seines Abenteuers verbindet Humor mit scharfer Beobachtung.« Sunday Telegraph
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman »Silberschweine« wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittlers Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Poseidons Gold«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe März 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1999 unter dem Originaltitel »One Virgin Too Many« bei Century Books, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1999 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Yurchenko Yulia, der pixto
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-979-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Marcus Didius Falco 11« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Eine Jungfrau zu viel
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Susanne Aeckerle
dotbooks.
Dramatis Personae
M. Didius Falco: der Mann, der an allem schuld ist
Helena Justina: ein Mädchen mit einem Geheimnis, das sich ein schöneres Badezimmer wünscht
Julia Junilla: ein lieber kleiner Schatz
Nux: eine Hündin, nicht ganz so lieb
Die heiligen Gänse der Juno und die heiligen Hühner der Auguren: stehen unter Artenschutz
Mama: eine nüchterne Kommentatorin
Papa (Geminus): führt wie gewöhnlich nichts Gutes im Schilde
Maia Favonia: Falcos Schwester, ungünstigerweise verwitwet
Cloelia (Maias Tochter): hofft eine Jungfrau zu werden
Marius (Maias Sohn): will in der Schule bleiben (ein Wunder)
Onkel Fabius (der doofe): ein Hühnerliebhaber, zum Glück auf dem Land
Petronius Longus: Falcos erster Partner, der sich verdrückt hat
Rubella: tölpelhafter Tribun der Vierten Kohorte der Vigiles
Vespasian: Kaiser von Rom; höher geht’s nicht
Titus Cäsar: ein römischer Prinz
Berenike: eine Herzkönigin
Rutilius Gallicus: Poet und Exkonsul, auf dem aufsteigenden Ast (holt Falco runter)
Anacrites: Falcos zweiter Partner, der rausgeschubst wurde
Laelius Numentinus: ein bedeutender Oberpriester (ein bösartiger alter Trottel)
Laelius Scaurus: ein Priester, von Rechts wegen (inaktiv)
Caecilia Paeta: eine hingebungsvolle Mutter (die ihren kleinen Liebling hergibt)
Gaia Laelia: die nächste Vestalin; ein williges Opfer?
Statilia Laelia: eine hingebungsvolle Tante (nichts daran auszusetzen)
Ariminius Modullus: ein hingebungsvoller Ehemann (der natürlich die Scheidung will)
Terentia Paulla: eine verheiratete Jungfrau; noch eine Witwe (günstigerweise?)
Meldina: ein wunderschöner Teil der Landschaft (gefährlich)
Athene: ein widerwilliges Kindermädchen (kann man ihr Kinder anvertrauen?)
Ventidius Silanus: ein Arvalbruder, zu tot, um etwas beizutragen
Der Meister der Arvalbrüder: ein Feinschmecker, zu verschlagen für jeden Kommentar
D. Camillus Verus: Helenas Vater, der sein Bestes gibt
Julia Justa: ihre Mutter, die das Schlimmste erwartet
A. Camillus Aelianus: ein vorübergehender Tatortexperte
Q. Camillus Justinus: Falcos neuer Partner (permanent abwesend)
Der camillus (nicht verwandt): ein Arvallehrling; ein pickliger Jüngling
Constantia: eine Jungfrau; ein aufregendes Wesen
Gloccus und Cotta: hervorragende Bauunternehmer (absolut schrecklich)
Rom: 27. Mai – 7. Juni, 74 n. Chr.
Kapitel I
Ich war auf dem Heimweg. Gerade hatte ich meiner Lieblingsschwester erzählen müssen, dass ein Löwe ihren Mann verspeist habe. Für einen neuen Klienten war ich nicht in der richtigen Stimmung.
Manche Privatschnüffler sind ganz wild darauf, mit ihren Fällen zu protzen. Ich wollte nur Ruhe, Dunkelheit, Vergessen. Kaum eine Chance, da wir uns auf dem Aventin befanden, um die geschäftigste Stunde eines warmen Maiabends, wo ganz Rom sich dem Handel und den Mauscheleien hingibt. Tja, wenn mir schon kein Friede vergönnt war, hatte ich mir zumindest etwas zu trinken verdient. Aber das Kind wartete in der Brunnenpromenade vor meiner Wohnung auf mich, und sobald ich es auf der Veranda entdeckte, war mir klar, dass ich mich noch gedulden musste.
Meine Freundin Helena fand jedes hübsche Täubchen verdächtig, das in einer zu kurzen Tunika bei uns aufkreuzte. Hatte sie die potenzielle Klientin draußen warten lassen? Oder hatte das gescheite kleine Mädchen einen Blick in unsere Wohnung geworfen und sich geweigert, hereinzukommen? Sie gehörte zweifellos zu dem luxuriösen Tragestuhl mit der Medusaverzierung auf der glänzenden Halbtür, der unterhalb unserer Veranda stand. Unsere kärgliche Wohnung war ihr möglicherweise zu schäbig erschienen. Ich konnte die Wohnung selbst nicht leiden.
Unter dem, was in dieser Gegend als Portikus durchging, hatte sie den Hocker gefunden, auf dem ich gern saß und die Welt an mir vorbeiziehen ließ. Als ich die ausgetretenen Stufen heraufkam, machte ich als Erstes Bekanntschaft mit zwei kleinen, sauber pedikürten weißen Füßen in goldenen Riemensandalen, die unwillig gegen das Verandageländer traten. Mit den Gedanken noch bei Maias vier verängstigten und tränenüberströmten Kindern, wollte ich über diese Füße hinaus mit nichts Bekanntschaft machen. Ich hatte selbst zu viele Probleme.
Trotzdem bemerkte ich, dass die kleine Person auf meinem Hocker Qualitäten besaß, die ich früher an Klienten sehr geschätzt hatte. Sie war weiblich. Sie sah gut aus, selbstbewusst, sauber und ordentlich gekleidet. Sie schien auch ein dickes Honorar zahlen zu können. An ihren rundlichen Armen klapperten jede Menge Armreifen. Grüne Glasperlen mit glitzernden Zwischenstücken waren in die vierfarbige Borte am Halsausschnitt ihrer fein gewebten Tunika eingearbeitet. Geschickte Dienerinnen mussten ihr geholfen haben, die dunklen Locken um ihr Gesicht zu drapieren und das Goldnetz drüber zu stülpen, das die Locken festhielt. Wenn sie viel Bein unter der Tunika zeigte, so lag das daran, dass es eine sehr kurze Tunika war. Als ihr die smaragdgrüne Stola von der Schulter glitt, schob sie sie völlig ungezwungen zurecht. Sie schien anzunehmen, mich genauso leicht rumschieben zu können.
Da gab es nur ein Problem. Meine ideale Klientin, vorausgesetzt, Helena würde mir dieser Tage noch erlauben, so jemandem zu helfen, wäre eine kecke Witwe im Alter zwischen siebzehn und zwanzig gewesen. Dieses kleine Juwel hier gehörte einer viel ungefährlicheren Gruppe an. Sie war nur fünf oder sechs Jahre alt.
Ich lehnte mich an den Verandapfosten, ein verrottetes Holzteil, das der Vermieter schon vor Jahren hätte erneuern müssen. Als ich den Mund aufmachte, klang meine Stimme müde, selbst in meinen Ohren. »Hallo, Prinzessin. Kannst du den Pförtner nicht finden, der dich einlässt?« Sie starrte mich verächtlich an, war sich durchaus bewusst, dass es in diesen schäbigen plebejischen Wohnungen keine Sklaven gab, die Besucher willkommen hießen. »Wenn dein Familientutor anfängt dich in Rhetorik zu unterrichten, wirst du feststellen, dass das ein matter Versuch war, ironisch zu sein. Kann ich dir helfen?«
»Mir wurde gesagt, dass hier ein Privatermittler wohnt.« Ihr Akzent verriet ihre Oberschichtsherkunft. Das hatte ich mir schon vorher gedacht. Ich versuchte trotzdem nicht voreingenommen zu sein. Na ja, zumindest nur ein wenig. »Wenn Sie Falco sind, möchte ich Sie konsultieren.« Das kam klar und erstaunlich selbstsicher heraus. Kinn vorgestreckt und von sich überzeugt, hatte die potenzielle Klientin die hochfahrenden Manieren einer von allen bewunderten Trapezkünstlerin. Sie wusste, was sie wollte, und erwartete, dass man ihr zuhörte.
»Tut mir Leid, ich nehme momentan keine Klienten an.« Immer noch durch meinen Besuch bei Maia aus der Fassung gebracht, sprach ich strenger, als ich es hätte tun sollen.
Die Klientin versuchte mich rumzukriegen. Sie ließ den Kopf hängen und betrachtete schmollend ihre Zehen. Sie war es gewöhnt, jemandem Süßigkeiten abzuschmeicheln. Große braune Augen bettelten um einen Gunstbeweis, überzeugt davon, ihn auch zu bekommen. Ich sah sie nur mit dem harten Blick eines Mannes an, der gerade tragische Nachrichten an Menschen überbracht hat, die daraufhin beschlossen, ihm die Schuld an der Tragödie zu geben.
Helena kam zur Tür. Sie schaute stirnrunzelnd zu der Kleinen mit den Armreifen, dann lächelte sie mich reumütig an, blieb aber hinter der Halbtür stehen, die Petronius und ich eingebaut hatten, um meine einjährige Tochter am Hinauskrabbeln zu hindern. Julia, mein athletischer Nachwuchs, drückte ihr Gesicht gegen die Bretter in Kniehöhe. Sie wollte unbedingt wissen, was hier draußen vorging, auch wenn sie sich dabei die Wangen aufschürfte und Mund und Nase breit quetschte. Sie begrüßte mich mit wortlosem Gurgeln. Nux, meine Hündin, sprang über die Halbtür und zeigte Julia damit, wie man entwischen konnte. Die Klientin wurde von dem verrückten, stinkenden Fellbündel vom Hocker geworfen und schrak zurück, als Nux ihren üblichen Freudentanz über meine Heimkehr und die Möglichkeit, nun endlich gefüttert zu werden, aufführte.
»Das ist Gaia Laelia.« Helena deutete auf meine Möchtegernklientin wie ein abgehalfterter Zauberkünstler, der ein bekanntermaßen bissiges Kaninchen aus einem fleckigen Kasten zieht. Mir war nicht ganz klar, ob die Missbilligung in ihrem Ton mir oder dem Kind galt. »Sie hat Schwierigkeiten mit ihrer Familie.«
Ich stieß ein bitteres Lachen aus. »Dann hast du dich an den Falschen gewandt. Solche Schwierigkeiten habe ich auch. Hör zu, Gaia, meine Familie betrachtet mich als Mörder, Taugenichts und einen rundherum unzuverlässigen Halunken – wozu noch kommt, dass ich, wenn ich denn endlich meine Wohnung betreten kann, meine Tochter baden, das Essen kochen und zwei frisch geschlüpfte Vögel einfangen muss, die überall hinscheißen, uns zwischen die Füße laufen und nach dem Hund picken.«
Wie auf ein Stichwort kam ein winziger knallgelber Jungvogel mit Schwimmfüßen durch eine der Lücken in der Halbtür geflitzt. Es gelang mir, ihn einzufangen, während ich mich fragte, wo der andere war. Dann packte ich Nux am Halsband, bevor sie sich auf den Vogel stürzen konnte, und schubste sie die Treppe hinunter. Sie kroch sofort wieder rauf, drängte sich an meine Beine und hoffte das Vögelchen doch noch fressen zu können.
Armreifen klirrten wütend wie Ziegenglocken, als Gaia Laelia mit ihrem kleinen goldbeschuhten Fuß aufstampfte. Sie verlor etwas von ihrer aufgesetzten Reife. »Sie sind garstig! Ich hoffe, Ihr Entchen stirbt!«
»Das Entchen ist ein Gänschen«, teilte ich ihr kühl mit. »Wenn es groß ist« – falls es mir je gelingen sollte, das Tier so weit so bringen, ohne dass Nux oder Julia es vorher zu Tode erschreckten –, »wird es Rom auf dem Kapitol bewachen. Beleidige ein Geschöpf nicht, das ein lebenslanges heiliges Schicksal hat.«
»Ach, das ist doch gar nichts«, spottete die wütende kleine Person. »Viele Menschen haben Schicksale ...« Sie hielt inne.
»Und?«, fragte ich geduldig.
»Das darf ich nicht sagen.«
Manchmal bringen einen Geheimnisse dazu, den Auftrag anzunehmen. Heute konnten Rätsel mich nicht verführen. Nach dem schrecklichen Nachmittag, den ich hinter mir hatte, war all meine Neugierde tot.
»Warum haben Sie die überhaupt hier?«, wollte Gaia wissen und deutete mit dem Kopf auf das Gänschen.
Trotz meiner Niedergeschlagenheit bemühte ich mich stolz zu klingen. »Ich bin der Prokurator des Geflügels für den Senat und die Bürger von Rom.«
Mein neuer Posten. Ich hatte ihn erst einen Tag. Er war mir immer noch fremd, aber ich wusste bereits, dass er nicht das war, was ich selbst gewählt hätte.
»Lakai fürs Federvieh«, sagte Helena kichernd hinter der Tür. Sie fand es zum Totlachen.
Auch Gaia reagierte abschätzig. »Klingt wie ein Titel, den Sie sich ausgedacht haben.«
»Nein, den hat der Kaiser erfunden, der gewitzte alte Bursche.« Vespasian hatte mich in einer Stellung haben wollen, die wie eine Belohnung aussah, ihn aber kein großes Gehalt kosten würde. Er hatte sich das ausgedacht, während ich in Nordafrika war. Auf seinen Befehl hin war ich die ganze Strecke von Tripolitanien zurückgesegelt, in der begierigen Hoffnung, einen einflussreichen Posten zu bekommen. Stattdessen halste mir der kaiserliche Spaßvogel die Gänse auf. Und ja, ich war auch noch mit den heiligen Hühnern belohnt worden. Das Leben stinkt.
Gaia, die wusste, wie man sich hartnäckig gebärdet, wollte immer noch eine Erklärung dafür, warum der gelbe Vogel in meinem Haus lebte. »Warum haben Sie den hier?«
»Nachdem ich meinen ehrenhaften Posten erhalten hatte, Gaia Laelia, eilte ich sofort, um meine Schützlinge zu begutachten. Junos Gänse dürfen ihre Eier auf dem Kapitol nicht selbst ausbrüten – ihre Nachkommen kriegen normalerweise wurmzerfressene Hühner auf irgendeinem Bauernhof als Pflegeeltern. Zwei Gänslein, die das System nicht kannten, waren einfach geschlüpft – und als ich beim Tempel der Juno Moneta eintraf, wollte der Dienst habende Priester ihnen gerade die kleinen heiligen Hälse umdrehen.«
»Warum?«
»Jemand hatte sich beschwert. Der Anblick herumflitzender Gänschen hatte einen uralten, pensionierten Flamen Dialis verärgert.« Der Flamen Dialis war der Oberpriester Jupiters, Obermotz des höchsten Gottes in der großen olympischen Triade. Diese Nervensäge, die frisch geschlüpfte Gänschen verabscheute, musste ein humorloser Traditionalist der schlimmsten Sorte sein.
Vielleicht war er auf der Scheiße ausgerutscht, die die Gänschen in großer Menge produzierten. Man kann sich vorstellen, welche Probleme wir jetzt zu Hause hatten.
Gaia blinzelte. »Den Flamen darf man nicht verärgern!«, bemerkte sie in etwas seltsamem Ton.
»Ich werde den Flamen so behandeln, wie er es verdient hat.« Bisher hatte ich den Mann noch nicht persönlich kennen gelernt; seine Beschwerde war mir von einem geplagten Priestergehilfen zugetragen worden. Ich hatte vor, dem Flamen aus dem Weg zu gehen. Sonst könnte es mir passieren, dass ich einem einflussreichen Drecksack erklärte, wohin er sich seinen Amtsstab schieben könne. Als staatlicher Prokurator konnte ich mir solche Sprüche allerdings nicht mehr erlauben.
»Er ist sehr wichtig«, beharrte das Mädchen. Irgendwas schien sie nervös zu machen. Ganz offensichtlich war der Flamen zu sehr von sich überzeugt. Ich hasse die Mitglieder der alten Priesterschaft wegen ihrer Einbildung und ihren lächerlichen Tabus. Am meisten hasse ich den versteckten Einfluss, den sie in Rom besitzen.
»Du hörst dich an, als würdest du ihn kennen, Gaia!«, meinte ich im Spaß.
Ihre Antwort haute mich glatt um. »Wenn er Laelius Numentinus heißt, ist er mein Großvater.«
Mir sank das Herz. Das war eine ernsthafte Angelegenheit. Sich mit dem bornierten König der kultischen Priesterschaft wegen ein paar falsch platzierter unerwünschter Gänschen anzulegen, war bereits ein ziemlich schlechter Anfang für meinen neuen Posten, ohne dass der Mann auch noch herausfand, dass seine geliebte Enkeltochter sich an mich um Hilfe gewandt hatte. Ich sah, wie Helena die Augenbrauen hob und alarmiert zusammenzuckte. Es wurde Zeit, sich aus der Affäre zu ziehen.
»Ah ja. Wieso bist du hier, Gaia? Wer hat dir von mir erzählt?«
»Ich habe gestern jemanden getroffen, der sagte, Sie würden Leuten helfen.«
»Olympus! Wer hat denn so was Verrücktes behauptet?«
»Das spielt keine Rolle.«
»Wer weiß, dass du hier bist?«, fragte Helena besorgt. »Niemand.«
»Geh nicht von zu Hause weg, ohne Bescheid zu sagen, wohin du willst«, wies ich das Kind zurecht. »Wo wohnst du? Ist es weit von hier?«
»Nein.«
Von drinnen ertönte plötzlich Julias lauter Schrei. Sie war weggekrabbelt und verschwunden, steckte jetzt jedoch offensichtlich in Schwierigkeiten. Helena zögerte, lief dann aber los, falls die Krise mit heißem Wasser oder scharfen Gegenständen zu tun hatte.
Es gab nichts, wofür ein sechsjähriges Kind einen Ermittler benötigte. Ich hatte mit Scheidungen und finanziellen Betrügereien zu tun, Kunstraub, politischen Skandalen, verloren gegangenen Erben, vermissten Geliebten und ungeklärten Todesfällen.
»Hör zu, ich arbeite für Erwachsene, Gaia, und du solltest heimgehen, bevor deine Mutter dich vermisst. Ist das dein Tragestuhl da auf der Straße?«
Das Kind sah etwas unsicherer aus als zuvor und schien bereit zu sein, zu ihrem schicken Transportmittel hinunterzugehen. Automatisch begann ich mich zu wundern. Ein reiches und verwöhntes Gör, das sich Mamas feine Sänfte und Träger ausborgt. Geschah das oft? Und wusste Mama, dass Gaia heute die Sänfte geklaut hatte? Wo war Mama? Wo war das Kindermädchen, das Gaia selbst im elterlichen Haus nicht von der Seite weichen sollte, ganz zu schweigen davon, wenn Gaia das Haus verließ? Wo, dachte der Vater in mir mit wenig Hoffnung auf eine ehrliche Antwort, war Gaias mit Ängsten belasteter Papa?
»Keiner hört mir zu«, bemerkte sie. Bei den meisten Kindern ihres Alters hätte das den Eindruck reiner Bockigkeit erweckt; bei ihr klang es einfach resigniert. Sie war zu jung, um sich so sicher zu sein, dass sie nicht zählte.
Ich gab nach. »Na gut. Willst du mir sagen, warum du gekommen bist?«
Sie hatte das Vertrauen verloren. Vorausgesetzt, sie hatte je welches zu mir gehabt. »Nein«, antwortete Gaia.
Ich stand mehrere Schritte unter ihr, konnte ihr aber immer noch in die Augen sehen. Ihr jugendliches Alter wäre für mich etwas Neues gewesen, hätte ich mich bereit erklärt, ihren Auftrag anzunehmen, aber für mich war die Zeit sinnloser Risiken vorbei. Durch meinen neuen mir von Vespasian verliehenen Posten, wie lächerlich er auch sein mochte, hatte sich mein gesellschaftlicher Status dramatisch verbessert; ich konnte mir keine exzentrischen Entscheidungen mehr leisten.
Es gelang mir die Geduld zu finden, die man für Kinder aufbringen soll. »Wir streiten alle hin und wieder mit unseren Verwandten, Gaia. Manchmal zu Recht, aber meistens führt es zu nichts. Wenn du dich beruhigt hast und derjenige, der dich verärgert hat, ebenfalls ruhiger geworden ist, solltest du dich einfach entschuldigen.«
»Ich habe nichts getan, wofür ich mich entschuldigen müsste.«
»Ich auch nicht, Gaia, aber glaub mir, es ist immer das Beste, nachzugeben.«
Sie stapfte an mir vorbei, den Kopf hoch erhoben. Durch Nux und das Gänschen behindert, konnte ich nur beiseite treten. Aber ich lehnte mich über die Verandabrüstung, als sie die Straße erreichte, und befahl ihr in Hörweite der Sänftenträger (die es hätten besser wissen müssen, als sie herzubringen) mit väterlichem Ton, direkt nach Hause zu gehen.
Helena Justina kam zu mir heraus, als ich der Sänfte nachsah. Sie betrachtete mich mit ihren schönen braunen Augen, Augen voll stiller Intelligenz und nur halb verstecktem Spott. Ich richtete mich auf und streichelte das Gänschen. Es stieß ein lautes, flehendes Piepsen aus, woraufhin Helena nur verächtlich schnaubte. Ich bezweifelte, dass auch ich meine Geliebte stärker beeindruckte.
»Du hast sie gehen lassen, Marcus?«
»Das hat sie selbst entschieden.« Offensichtlich wusste Helena etwas. Sie sah besorgt aus. Sofort bedauerte ich meine Abfuhr. »Was war das denn für ein wundervoller Auftrag von dieser Gaia, den ich so herzlos abgelehnt habe?«
»Hat sie dir das nicht gesagt? Sie glaubt, dass ihre Familie sie umbringen will«, verkündete Helena.
»Ach, dann ist ja alles in Ordnung. Ich dachte schon, es sei ein echter Notfall.«
Helena hob die Augenbrauen. »Du glaubst ihr nicht?«
»Enkelin von Jupiters Oberpriester? Das wäre ein Riesenskandal, so viel ist sicher.« Ich seufzte. Die Sänfte war bereits verschwunden, und es gab nichts, was ich jetzt noch tun konnte. »Sie wird sich daran gewöhnen. Meine Familie empfindet mir gegenüber die meiste Zeit genauso.«
Kapitel II
Gut, gehen wir einen Tag zurück und bringen die Dinge auf die Reihe.
Helena und ich waren gerade aus Tripolitanien heimgekehrt. Die Fahrt war überstürzt, hastig angetreten nach Famias grässlichem Tod und dem Begräbnis. Nach der Ankunft war ich als Erstes zu meiner Schwester geeilt, um ihr die schlechte Nachricht zu überbringen. Sie muss ihrem Mann das Schlimmste zugetraut haben, aber dass man ihn in der Arena einem Löwen zum Fraß vorwarf, hätte sogar Maia nicht voraussehen können.
Ich musste mich beeilen, weil ich Maia selbst in Ruhe davon berichten wollte. Da wir meinen Partner Anacrites mit zurückgebracht hatten, der bei meiner Mutter wohnte, würde Mama garantiert in kürzester Zeit alles aus ihm herausbekommen. Meine Schwester würde mir nie vergeben, wenn jemand vor ihr von den Schrecklichkeiten erfuhr. Anacrites hatte versprochen, so lange wie möglich zu schweigen, aber Mama war berüchtigt dafür, den Leuten Geheimnisse aus der Nase zu ziehen. Außerdem hatte ich Anacrites nie getraut.
Niedergedrückt von meiner Verantwortung, begab ich mich sofort nach unserer Ankunft zu meiner Schwester. Maia war ausgegangen.
Mir blieb nichts anderes übrig, als nach Hause zurückzuschlurfen, in der Hoffnung, Maia später zu finden. Wie sich herausstellte, blieb Anacrites die Gefahr erspart, sich bei Mama zu verplappern, weil wir beide wegen der Zensusergebnisse auf den Palatin zitiert worden waren. Zufällig fand ich später heraus, dass Maia nicht daheim war, weil auch sie einer Zeremonie mit kaiserlichem Hintergrund beiwohnte, was ich von meiner durch und durch republikanischen Schwester nie erwartet hätte. Allerdings fand ihr Tanderadei im Goldenen Haus auf der anderen Seite des Forums statt, während wir uns in die Niederungen der Bürokratie begeben mussten, zu den alten kaiserlichen Büros im Palast der claudischen Cäsaren.
Der Empfang, dem Maia beiwohnte, würde für alles, was später geschah, von Bedeutung sein. Was mich betraf, wäre es sehr praktisch gewesen, sie bitten zu können, sich dort für mich ein wenig umzuhören. Tja, aber so was weiß man leider selten im Voraus.
Diesmal besuchte ich Vespasian in dem vollen Bewusstsein, dass er nichts zu meckern hatte.
Ich hatte fast ein ganzes Jahr für den Zensus gearbeitet. Es war mein bisher lukrativster Auftrag gewesen, und ich war selbst auf die Idee gekommen. Anacrites, bis dahin Oberspion des Kaisers, hatte mir vorübergehend als Partner gedient. Die Zusammenarbeit war seltsamerweise erfolgreich gewesen – angesichts der Tatsache, dass er mal versucht hatte, mich umbringen zu lassen, und ich seinen Beruf insgesamt und ihn insbesondere immer gehasst hatte. Wir waren ein ausgezeichnetes Zweigespann, hatten verlogenen Steuerzahlern viel Geld abgeknöpft. Seine Niederträchtigkeit ergänzte meine Skepsis. Er setzte den Schwächlingen hart zu; ich brachte die Zähen mit meinem Charme zur Strecke. Das Sekretariat, dem wir Bericht erstatten mussten und das nicht ahnte, wie gut wir sein würden, hatte uns einen beträchtlichen Prozentsatz aller von uns nachgewiesenen Steuerhinterziehungen versprochen. Da wir wussten, dass die Zeit für den Zensus begrenzt war, hatten wir wie die Wilden geschuftet. Laeta, unser Kontaktmann, versuchte wie üblich uns übers Ohr zu hauen, aber wir besaßen jetzt eine Schriftrolle, die bestätigte, dass Vespasian sehr angetan war von unserer Arbeit und dass wir reich waren.
Irgendwie war es Anacrites und mir bis zum Ende unseres Auftrags gelungen, uns nicht gegenseitig abzumurksen. Trotzdem hatte er sich alle Mühe gegeben, ein unrühmliches Ende zu finden. In Tripolitanien war es dem Idioten gelungen, sich in der Arena fast umbringen zu lassen. Als echter Gladiator zu kämpfen, würde ihn zu gesellschaftlichem Abstieg und schwerer Bestrafung verdammen, falls Rom das jemals herausfand. Als er sich von seinen Verwundungen erholt hatte, musste er sich mit der Tatsache abfinden, dass ich sein Leben von jetzt an vollkommen in der Hand hatte.
Er war schon vor mir im Palast eingetroffen. Sobald ich den hohen, gewölbten Audienzsaal betrat, erblickte ich zu meinem Ärger sein bleiches Gesicht. Bleich war er immer, trug aber Verbände unter den langen Tunikaärmeln, und ich, der ja Bescheid wusste, konnte sehen, dass er sich sehr vorsichtig bewegte. Er hatte immer noch Schmerzen. Das heiterte mich auf.
Er wusste, dass ich heute eigentlich Maia besuchen wollte. Ob mich der liebe Anacrites über das Treffen wohl im Dunkeln gelassen hätte, wenn mir der Palastbote nicht rechtzeitig begegnet wäre?
Ich grinste Anacrites an. Er wusste nie, wie er damit umgehen sollte.
Ich machte keine Anstalten, mich zu ihm zu begeben. Anacrites hatte sich neben Claudius Laeta gehockt, den Stilusschwinger, den wir wegen unseres Honorars ausmanövriert hatten. Nachdem unsere Arbeit für den Zensus jetzt beendet war, wollte Anacrites sich wieder auf seinen alten Posten zurückmogeln. Während des ganzen Treffens wich er nicht von Laetas Seite; dauernd sagten sie sich in gedämpftem Ton kleine Nettigkeiten. In Wirklichkeit trugen sie einen erbitterten Kampf um dieselbe hohe Stellung aus. Außerhalb ihrer jeweiligen Büros, wo sie gegeneinander intrigierten, taten sie so, als wären sie die besten Freunde. Aber wenn sie sich jemals in einer dunklen Gasse begegnen sollten, würde einer von ihnen am nächsten Morgen tot in der Gosse liegen. Nur war in Rom im Allgemeinen alles ziemlich gut beleuchtet, was für sie vielleicht ein Glück war.
Im Audienzsaal waren zwei gepolsterte Thronsessel für den Kaiser und seinen Sohn Titus aufgestellt worden, die beiden offiziellen Zensoren. Zusätzlich gab es Lehnstühle, was bedeutete, dass Senatoren erwartet wurden, und harte Hocker für das Fußvolk. Schreiber standen entlang der Wände. Die meisten der hier Versammelten waren glatzköpfig und kurzsichtig. Bis Vespasian mit Titus eintrat, der in den Dreißigern war, hoben Anacrites, Laeta und ich uns von den anderen ab, weil wir sogar jünger waren als die an den Wänden aufgereihten Schreiber. Wir befanden uns unter den verbissenen Typen vom Schatzamt des Saturn, eine schrumpelige Mischung aus Priesterlichkeit und Geldeintreibern, die mit hämischer Freude die Steuereinnahmen aus dem Zensus in eisenbeschlagene Kisten im Keller ihres Tempels geschaufelt hatten. Zwischen ihnen drängten sich Abgesandte mit Senatorenstatus, von Vespasian in die Provinzen geschickt, um Steuern von den treu ergebenen Mitgliedern des Imperiums einzutreiben, die so dankbar die römische Herrschaft anerkannt und nur so widerstrebend dafür hatten zahlen wollen.
Zu einem späteren Zeitpunkt seiner Regierung sollte Vespasian diese Abgesandten offen als seine »Schwämme« bezeichnen, ins Ausland geschickt, um Geld für ihn aufzusaugen, wobei es ihm inoffiziell egal war, welche Methoden sie anwandten. Zweifellos hatten sie ihre natürlichen Neigungen zu Schikanen und Brutalität gegen seinen erklärten Wunsch eingesetzt, als »guter« Kaiser in Erinnerung zu bleiben.
Ich kannte einen der Abgesandten, Rutilius Gallicus, der die Aufgabe gehabt hatte, einen Grenzstreit zwischen Leptis Magna und Oea zu schlichten. Ich war ihm dort drüben begegnet. Irgendwie war es ihm zwischen unserem ersten Gespräch und seiner Abreise gelungen, seinen Titel hochzusetzen, bis er nicht mehr nur ein bloßer Wüstenlandvermesser war, sondern der Sonderbeauftragte des Kaisers für den Zensus in Tripolitanien. Fern sei es mir, diesen ehrenhaften Zeitgenossen zu verdächtigen, sich den Titel selbst zugeschustert zu haben. Offenbar war er als Exkonsul im Palast gut gelitten. In Leptis hatten wir die engen gesellschaftlichen Bande zweier fern von der Heimat zwischen verschlagenen Fremden gestrandeter Römer genossen, aber jetzt merkte ich, dass ich ihn mit mehr Vorsicht betrachtete. Er war einflussreicher, als mir bisher bewusst gewesen war. Ich nahm an, dass sein Aufstieg bei weitem noch nicht den Höhepunkt erreicht hatte. Er konnte ein Freund sein – aber ich würde nicht darauf bauen.
Ich grüßte ihn unauffällig. Rutilius nickte zurück. Er saß etwas abseits, hatte sich keiner Gruppe angeschlossen. Da ich wusste, dass er als Senator der ersten Generation aus Augusta Taurinorum im verachteten Norden Italiens nach Rom gekommen war, spürte ich, dass er im Ruch des Außenseiters stand. Ich nahm an, dass ihn das nicht störte.
Ein Neuling zu sein, von der Patrizierschicht verachtet, war unter Vespasian kein Hindernis mehr, nachdem dieser grobschlächtige Emporkömmling, den niemand ernst nahm, die Welt in Erstaunen versetzt und sich zum Kaiser gemacht hatte. Jetzt betrat er den Saal mit der Haltung eines neugierigen Touristen, ging aber direkt zu seinem Thron. Er trug den Purpur mit sichtbarem Vergnügen und beherrschte den Raum mühelos. Der alte Mann nahm seinen zentralen Platz ein, eine stämmige Gestalt, die Stirn in Falten gelegt wie von lebenslanger Anstrengung. Das war irreführend. Satiriker konnten sich einen Spaß aus seiner wie unter ständiger Verstopfung leidenden Erscheinung machen, aber er hatte Rom und die gesamte Oberschicht genau da, wo er sie haben wollte, und sein grimmiges Lächeln verriet, dass er das wusste.
An seiner Seite tauchte schließlich Titus auf, genauso stämmig, aber halb so alt wie sein Vater und doppelt so freundlich. Er brauchte einige Zeit, um seinen Platz einzunehmen, weil er zunächst alle leutselig begrüßte, die erst vor kurzem aus den Provinzen nach Rom zurückgekehrt waren. Titus hatte den Ruf eines netten, weichherzigen Burschen – immer ein Zeichen für einen unangenehmen Dreckskerl, der mordsgefährlich werden konnte. Er stattete den neuen flavischen Hof mit Lebenskraft und Talent aus – und mit Königin Berenike von Judäa, einer exotischen Schönheit und zehn Jahre älter als er, die sich, nachdem es ihr nicht gelungen war, Vespasian zu umgarnen, mit ihrem nachlässigen Charme den Nächstbesten geschnappt hatte. Kaum einen Tag zurück auf dem Forum, kannte ich bereits die heißeste Nachricht: Sie war ihrem hübschen Spielzeug vor kurzem nach Rom gefolgt.
Titus selbst war angeblich außer sich vor Freude über diesen zweifelhaften Glücksfall, aber ich war mir verdammt sicher, dass Vespasian damit fertig wurde. Der Vater hatte seinen kaiserlichen Anspruch auf hochgesinnten traditionellen Werten aufgebaut. Eine Möchtegernkaiserin mit einer Geschichte voller Inzest und Einmischung in die Politik eignete sich nicht als Porträt für das Schlafzimmer des nächsten jungen Cäsaren. Nicht mal, wenn sie sich dem Künstler als eine an ihrem Stilus nuckelnde, stets häusliche Jungfrau präsentierte, deren Gedanken nur auf ihr Kücheninventar gerichtet waren. Jemand sollte es ihr sagen – Berenike würde rausfliegen.
Titus, der freundliche Bursche, lächelte gütig, als er mich bemerkte. Vespasian sah Titus lächeln und runzelte die Stirn. Da ich Realist bin, war mir das Stirnrunzeln lieber.
Die Einzelheiten der nachfolgenden Sitzung unterliegen vermutlich der offiziellen Geheimhaltung. Die Ergebnisse waren jedoch für alle sichtbar. Zu Beginn seiner Regierungszeit hatte Vespasian verkündet, er brauche vier Millionen Sesterzen, um Rom wieder auf die Beine zu bringen. Kurz nach Beendigung des Zensus baute und renovierte er auf jedem nur denkbaren Grundstück, mit dem erstaunlichen Flavischen Amphitheater am Ende des Forums als Besiegelung seiner Leistungen. Dass er sein hoch gestecktes fiskalisches Ziel erreichte, ist nicht neu.
Selbst mit einem Vorsitzenden, der Bummelei hasste und zur Durchsetzung seiner Pläne über die gescheitesten Beamten der Welt verfügte, benötigte sein Imperium ein gewaltiges Budget. Wir brauchten vier Stunden zur Auswertung aller Zahlen.
Vespasian schien nicht zu bemerken, dass er äußerst zufrieden mit seinen neuen Geldmitteln sein konnte, obwohl Titus ein paarmal anerkennend die Augenbrauen hob. Selbst die Männer vom Schatzamt wirkten entspannt, was man noch nie erlebt hatte. Schließlich hielt der Kaiser eine kurze, erstaunlich huldvolle Rede, dankte allen für ihre Bemühungen und verschwand, gefolgt von Titus.
Die Sitzung war zu Ende, und ich wäre sofort abgezogen, hätte ein schmucker Sklave Anacrites und mich nicht unerwartet in ein Nebenzimmer bugsiert. Dort standen wir herum und schwitzten zwischen einer Gruppe nervöser Senatoren, bis wir Vespasian zu einer Privataudienz vorgeführt wurden. Er hätte sich zu einem Schläfchen hinlegen sollen wie ein anständiger Pensionär; stattdessen arbeitete er immer noch verbissen. Wir kapierten endlich, dass Belohnungen verteilt wurden.
Wir waren in einem viel kleineren Thronsaal gelandet. Titus fehlte, aber wie wir während der Warterei gewitzelt hatten, sah Titus müde aus. Berenike schien an seiner Kraft zu zehren. Vespasian benutzte seine beiden Söhne als öffentliche Statisten, aber das diente nur dazu, die Allgemeinheit an ihre kleinen kaiserlichen Gesichter für die Zeit nach seinem Hinscheiden zu gewöhnen. Er selbst kam ohne Kumpane aus. Er brachte es sicherlich auch allein fertig, zwei so unwichtigen Figuren wie Anacrites und mir ein paar barsche Dankesworte zu sagen.
Vespasian ließ es so aussehen, als wäre er aufrichtig dankbar. Als Anerkennung, sagte er, nehme er unsere Namen in die Liste der Ritter auf. Das kam so nebensächlich heraus, dass ich es fast überhörte. Ich hatte eine Bohrassel beobachtet, die an einem Sockel entlangkrabbelte, und wachte erst auf, als ich Anacrites’ kriecherisches Dankbarkeitsgemurmel hörte.
Um in den mittleren Rang aufgenommen zu werden, brauchte man Landbesitz im Wert von vierhunderttausend Sesterzen. Man darf jetzt aber nicht erwarten, dass unser getreuer alter Kaiser uns die Summe spendete. Mit einem Schnauben wies er uns darauf hin, wir hätten ihm so viel Geld als Honorar abgeknöpft, dass er von uns erwarte, die nötige Summe beiseite zu legen; er gewährte uns nur das formelle Recht, den Goldring des mittleren Ranges zu tragen. Eine Zeremonie gab es nicht, denn die hätte verlangt, dass Vespasian uns die Goldringe aushändigte. Er zog es natürlich vor, dass die Leute ihre Ringe selbst kauften. Ich gedachte nicht, einen zu tragen. Dort, wo ich wohnte, würde er sofort geklaut werden, wenn ich das Haus verließ.
Um eine Unterscheidung zwischen mir, dem frei geborenen Begünstigten, und Anacrites, einem im öffentlichen Dienst stehenden Exsklaven zu machen, erklärte Vespasian Anacrites dann, dass man seine Arbeit beim Geheimdienst immer noch schätze. Ich hingegen wurde mit der Art grausiger Pfründe geehrt, um die sich der mittlere Rang traditionell reißt. Während meiner Arbeit für den Zensus hatte ich bei den heiligen Gänsen auf dem Kapitol einen tödlichen Unfall abgewendet. Zur Belohnung hatte Vespasian für mich den Posten des Geflügelprokurators für den Senat und die Bürger von Rom geschaffen.
»Danke«, sagte ich. Schöntuerei wurde erwartet.
»Sie haben es verdient«, entgegnete der Kaiser grinsend. Der Posten war Schwachsinn, was wir beide wussten. Ein eingebildeter Stiesel wäre vielleicht begeistert gewesen über die Verbindung zu den großen Tempeln auf dem Kapitol, aber mir war die Vorstellung zuwider.
»Herzlichen Glückwunsch«, meinte Anacrites hämisch. Falls er vorhatte, mich noch mehr zu ärgern, und um ihn daran zu erinnern, dass ich ihn leicht zu Fall bringen konnte, bedachte ich ihn mit dem Gladiatorengruß. Er schwieg sofort. Ich beließ es dabei, hatte ihn mir schon genug zum Feind gemacht.
»Wurde ich von einem Freund für diese Stellung empfohlen, Cäsar?« Antonia Caenis, die langjährige Geliebte des Kaisers, hatte mir vor ihrem Tod zu verstehen gegeben, sie könne ihn eventuell bitten, meine Aussichten noch mal zu überdenken. Sein Blick war direkt. Nach vierzig oder fünfzig Jahren Respekt für Antonia Caenis würden ihre früher gegebenen Ratschläge für Vespasian stets zählen.
»Ich kenne Ihren Wert, Falco.« Manchmal fragte ich mich, ob er sich überhaupt noch daran erinnerte, dass ich vernichtende Beweise gegen seinen Sohn Domitian besaß. Ich hatte es bisher nie mit Erpressung versucht, obwohl er wusste, dass ich dazu in der Lage war.
»Danke, Cäsar!«
»Sie werden noch Großes vollbringen.«
Ich saß fest, und das war uns beiden klar.
Schweigend verließen Anacrites und ich den Palast.
Für ihn ergab sich vermutlich kaum eine Veränderung. Man erwartete von ihm, dass er seine Karriere im Staatsdienst fortsetzte, nur befördert durch seinen neuen Rang. Das konnte sich in materieller Hinsicht auswirken. Ich hatte immer vermutet, dass Anacrites, nach einer Karriere als Spion, bereits ein heimliches Vermögen beiseite geschafft hatte. Er besaß zum Beispiel eine Villa in der Campania. Das hatte ich von Momus erfahren, einem Spitzel, zu dem ich gute Verbindungen hatte.
Anacrites sprach nie über seine Herkunft, aber er war zweifellos ein ehemaliger Sklave. Selbst ein im Palast angestellter Freigelassener konnte eine Luxusvilla legitim nur als Belohnung für außergewöhnliche, lebenslange Dienste erwerben. Anacrites’ Alter hatte ich nie rausgekriegt, aber er sah nicht so aus, als stünde er kurz vor der Pensionierung. Er war kräftig genug, eine Kopfwunde zu überleben, die ihn hätte töten sollen, besaß noch eine Menge Zähne und den größten Teil seiner glatt zurückgekämmten schwarzen Haare. Nun gut, die andere Möglichkeit für Palastsklaven, sich hübsche Dinge anzueignen, war ganz eindeutig Bestechung. Jetzt, da er in den mittleren Rang erhoben worden war, würde er größere Bestechungssummen erwarten.
Wir trennten uns ebenfalls schweigend. Er war nicht der Typ, mich zu einem Becher Wein einzuladen, um unsere Beförderung zu feiern. Ich hätte den Wein auch nicht runtergebracht.
Für mich sah die Zukunft trübe aus. Ich war frei geboren, aber Plebejer. Heute war ich über Generationen schurkenhafter Didii erhoben worden – und wozu? Um ein Schurke zu sein, der seinen natürlichen Platz im Leben verloren hat.
Ich verließ den Palast erschöpft und trübsinnig, mit dem Wissen, dass ich mein entsetzliches Schicksal jetzt Helena Justina erklären musste. Es war auch ihr Schicksal. Als Senatorentochter hatte sie ihr Patrizierheim für den Nervenkitzel und das Risiko verlassen, mit einem aus der Gosse stammenden Gauner zusammenzuleben. Helena mochte zurückhaltend wirken, aber sie war leidenschaftlich und dickköpfig. Mit mir zusammen hatte sie Gefahren und Schmach durchgestanden. Wir hatten gegen Armut und Fehlschläge gekämpft, obwohl es uns meist gelang, unser Leben auf unsere eigene Weise zu genießen. Sie hatte eine Unabhängigkeit gewählt, um die sie manche aus ihrer Gesellschaftsschicht beneiden mochten, die sich aber nur wenige zutrauen würden. Ich glaubte, dass es sie glücklich gemacht hatte. Von mir wusste ich es.
Jetzt, nachdem mir drei Jahre lang der Ritterstand versprochen worden war, hatte ich ihn endlich bekommen – zusammen mit all seinen Einschränkungen. Ich würde mich mit kultivierteren Handelszweigen befassen müssen, mit den niederen Rängen der örtlichen Priesterschaft und zusehen, dass ich einen weniger gut bezahlten Verwaltungsposten bekam. Mit der Billigung der mir gesellschaftlich Gleichgestellten und einem Nicken der Götter war meine Zukunft festgelegt: M. Didius Falco, ehemaliger Privatermittler, würde drei Kinder haben, keine Skandale verursachen, und in vierzig Jahren würde man ihm zu Ehren eine kleine Statue errichten. Plötzlich klang das alles nicht mehr sehr spaßig.
Helena Justina war nun zu ständiger langweiliger, respektabler Mittelmäßigkeit verurteilt. Als Skandalquelle hatte ich definitiv versagt.
Kapitel III
Also war mein erster Tag in Rom anstrengend genug gewesen. Den Abend hatte ich zu Hause mit Helena verbracht. Wir hatten versucht, uns unserem neuen Status anzupassen und überlegt, was er für uns bedeuten würde.
Am nächsten Tag fand ich Maia und teilte ihr die schreckliche Nachricht mit. Die Tatsache, dass die Reise, auf der ihr Mann umgekommen war, mir besondere Belohnungen eingebracht hatte, machte die Sache nicht besser. Natürlich hatte ich Schuldgefühle.
Den größten Teil des Tages blieb ich bei meiner Schwester. Nach diesen qualvollen Stunden musste ich mich beim Heimkommen auch noch mit der Kinderklientin Gaia Laelia herumschlagen. Danach wollte ich nur noch ins Haus und die Tür hinter mir abschließen.
Die Welt hatte jedoch inzwischen gehört, dass ich zurück war. Drinnen warteten keine weiteren Klienten und zufällig auch mal keine Gläubiger oder Mitleid erregende Darlehenssuchende. Stattdessen lümmelten sich Mitglieder meines engsten Kreises an meinem einfachen Esstisch und hofften, ich würde für sie kochen – ein Freund, ein Verwandter. Der Freund war Petronius Longus, der vielleicht willkommen gewesen wäre, hätte er nicht wie ein Busenfreund mit dem Verwandten geplaudert, den ich am wenigsten ausstehen konnte, meinem Vater Geminus.
»Ich hab ihnen von Famia erzählt«, sagte Helena gedämpft. Sie meinte die bereinigte Version.
Wir hatten uns darauf geeinigt, dass nur Maia die ganze Geschichte erfuhr. Famia war von der Wagenlenkerfraktion ausgesandt worden, für die er als Pferdedoktor arbeitete, um in libyschen Gestüten nach neuem Pferdematerial zu suchen. Der abgelegene Schauplatz ermöglichte es uns, die Einzelheiten zu vertuschen. Offiziell war er bei einem »Unfall« mit einem wilden Tier zu Tode gekommen.
Es blieb Maia überlassen, wann sie, wenn überhaupt, bekannt machen wollte, dass Famia, ein lautmäuliger und bigotter Säufer, die tripolitanischen Götter und Helden auf dem Forum von Leptis Magna wüst beleidigt hatte, bis zu einem Punkt, an dem die Gastfreundschaft gegenüber Fremden ins Wanken geraten war und die Einwohner ihn zusammengeschlagen, einem durchreisenden Magistrat vorgeführt und ihn der Blasphemie beschuldigt hatten. Die traditionelle tripolitanische Strafe dafür war, von wilden Tieren zerrissen zu werden.
In der Arena von Leptis waren sowieso gerade eine Reihe von Spielen angesetzt – ganz normal für Afrika, wo Blutsport zur Beschwichtigung der Wut beleidigter Götter regelmäßig stattfindet, selbst wenn die strengen punischen Götter gar nicht beleidigt worden sind. Man hatte also bereits einen hungrigen Löwen parat. Famia wurde für den nächsten Tag eingeteilt, bevor ich überhaupt wusste, dass er in Leptis angekommen war, bevor ich begriff, was passiert war, oder versuchen konnte es zu verhindern. Ich hatte Maia gewissenhaft über den Grund und die Art der Hinrichtung ihres Mannes aufgeklärt und ihr geraten, ihren Kindern, um sie zu schützen, momentan noch nicht die ganze entsetzliche Geschichte zu erzählen. Aber selbst Maia hatte ich nicht gestanden, dass der Magistrat, der die Hinrichtung abgesegnet hatte, um den Frieden in Leptis zu bewahren, mein Zensuskollege gewesen war, Rutilius Gallicus, der Sonderbeauftragte des Kaisers. Ich hatte damals in seinem Haus gewohnt. Ich saß neben ihm, als ich mit ansehen musste, wie Famia starb. Selbst ohne das zu wissen, hatte Maia mir die Schuld gegeben.
Petronius und mein Vater betrachteten mich neugierig, als würden auch sie vermuten, dass ich bis zum Hals in der Sache steckte.
Helena nahm mir das Gänslein ab und setzte es neben sein piepsendes Geschwisterchen in einen Korb. Zum Glück lag unsere Wohnung über dem Laden eines Korbflechters, und Ennianus war immer bereit, uns einen neuen Behälter zu verkaufen. Wir hatten ihm nicht erzählt, dass ich den Pflegevater für die Gänse spielte. Die Nachbarschaft betrachtete mich bereits als Spaßvogel.
»Wo hast du denn die Viecher her?«, spottete Papa. »Bisschen mager zum Braten. Bis die in den Topf wandern, werden sie dich als ihre Mutter ansehen.«
Ich grinste lahm. Helena hatte ihm bestimmt von meinem neuen Rang und dem tollen Posten erzählt, der damit verbunden war. Er würde Tage darauf verschwenden, sich blöde Witze auszudenken.
Petronius schob Nux zwischen seine Stiefel unter den Tisch. Julia wurde ihrem vernarrten Großvater übergeben. Papa war hoffnungslos, was Kinder betraf, hatte seine eigene Brut verlassen und war mit seiner Freundin durchgebrannt. Doch er liebte Julia, bildete sich etwas auf sie ein, weil ihr anderer Großvater ein Senator war. Sie liebte ihn auch, ohne dafür einen Grund zu brauchen. Die nächste Generation schien ganz wild darauf zu sein, Papa zu verehren, sogar noch bevor sie ihn heimlich in seinem Antiquitätenemporium besuchten und mit Plunder und Süßigkeiten bestochen wurden.
Ich verdrängte meine Gereiztheit, holte mir einen Hocker und setzte mich.
»Was zu trinken?«, meinte Petronius, in der Hoffnung, dann auch etwas zu bekommen. Ich schüttelte den Kopf. Die Erinnerung an Famia hatte mir momentan den Appetit darauf verdorben. Das ist das Gefährlichste an Säufern. Sie können den Alkohol nicht mehr genießen, während der Anblick ihrer Exzesse für alle anderen den Genuss daran tötet.
Petro und Papa sahen sich mit erhobenen Augenbrauen an. »Hartes Geschäft«, bemerkte Papa.
»Dir fällt auch nie was Neues ein.«
Helena legte mir die Hand auf die Schulter, zog sie jedoch gleich wieder zurück. Ich war in miesester Laune heimgekommen, hatte Trost nötig, würde ihn aber nicht annehmen. Sie kannte die Anzeichen. »Hast du Maia diesmal angetroffen?«, fragte sie, obwohl sie sich das bereits denken konnte. »Wo war sie denn gestern?«
»Sie hat eine ihrer Töchter zu einem Empfang begleitet, auf dem junge Mädchen der Königin Berenike vorgestellt wurden.«
Helena schaute überrascht. »Das klingt gar nicht nach Maia!« Genau wie ich lehnte meine Schwester das Getue der oberen Zehntausend ab. Die Aufforderung, bei einem Empfang zu Ehren von Titus’ exotischer Gespielin zu erscheinen, hätte Maia normalerweise so rebellisch gemacht wie Spartakus.
Petronius schien mehr darüber zu wissen. »Hatte was mit der Lotterie für eine neue Vestalin zu tun.«
Auch das sah Maia nicht ähnlich.
»Ich hatte keine Gelegenheit, mit ihr darüber zu sprechen«, sagte ich. »Ihr kennt Maia. Sobald sie mich sah, war ihr klar, dass ich schlechte Nachrichten brachte. Ich war zu Hause – aber wo war Famia? Selbst er hätte normalerweise sein Gepäck daheim abgestellt, bevor er in der nächsten Weinschenke verschwand. Sie erriet, was los war.«
»Wie nimmt sie die Sache auf?«, fragte Papa.
»Zu gefasst.«
»Was soll das heißen? Sie ist sehr vernünftig. Sie würde nie Theater machen.« Er hatte keine Ahnung von seinen jüngeren Kindern, Maia und mir. Wie denn auch? Als er sich seiner Verantwortung entledigte, war ich sieben und Maia erst sechs. Er hatte uns beide zwanzig Jahre lang nicht wiedergesehen.
Als ich Maia sagte, ihr Mann sei tot, sank sie zunächst in meine Arme. Dann machte sie sich sofort wieder los und wollte die Einzelheiten wissen. Ich hatte die Geschichte auf unserer Rückfahrt lange genug eingeübt und fasste mich kurz. Dadurch wirkte mein Bericht noch düsterer. Maia wurde sehr still. Sie hörte auf, Fragen zu stellen. Sie ignorierte alles, was ich sagte. Sie dachte nach. Sie hatte vier Kinder und kein Einkommen. Es gab eine Begräbniskasse, in die Famia auf Druck der grünen Wagenlenkerfraktion eingezahlt hatte. Sie würden für eine Urne und eine Inschrift zahlen, die Maia nicht wollte, aber annehmen musste, um den Kindern ein Andenken an ihren verrufenen Erzeuger zu geben. Vielleicht würden die Grünen ihr auch eine kleine Rente zahlen. Sie war berechtigt, die Kornausgabe für die Armen in Anspruch zu nehmen. Aber sie würde arbeiten müssen.
Ihre Familie würde ihr helfen. Sie würde uns nicht darum bitten, und wenn wir es ihr anboten, würden wir immer sagen müssen, es sei für die Kinder. Die Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren waren jetzt schon verängstigt, verwirrt und untröstlich. Aber sie waren alle blitzgescheit. Nachdem Maia und ich ihnen vorsichtig erklärt hatten, ihr Vater sei gestorben, hatte ich das Gefühl, sie ahnten, dass wir ihnen etwas verheimlichten.
Meine Schwester hatte schon vorher Tragödien erlebt. Da war die erstgeborene Tochter, gestorben an einer Kinderkrankheit, etwa in dem Alter, in dem jetzt Marius, ihr ältester Sohn, war. Ich war damals in Germanien und muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die Sache immer wieder vergaß. Maia würde nie vergessen. Aber sie hatte ihren Kummer allein getragen; Famia war stets nur ein nutzloser Tölpel gewesen.
Petronius nahm Papa Julia ab und reichte sie Helena, womit er Papa zu verstehen gab, dass sie gehen sollten. Papa, typisch für ihn, reagierte nicht darauf. »Na ja, sie wird natürlich wieder heiraten.«
»Sei dir da nicht so sicher«, widersprach Helena leise. Das war ein Rüffel für Männer im Allgemeinen. Auch diesen Wink kapierte Papa nicht. Ich verbarg das Gesicht in den Händen und dachte daran, dass eine attraktive, unbeschützte Frau wie meine Schwester tatsächlich eine Menge Anträge würde abwehren müssen, viele davon widerwärtig. Das war wohl nur einer der Aspekte ihrer Verzweiflung über ihre jetzige Situation. Wenigstens konnte ich ihr helfen, diese Aasgeier loszuwerden.
»Ich wette ...« Papa war auf eine seiner entsetzlichen, boshaften Ideen gekommen. »Ich wette, deine Mutter«, meinte er bedeutungsvoll, »wird sie mit jemandem zusammenbringen, den wir kennen!«
Ich konnte mich nicht dazu durchringen, auch nur zu überlegen, wen er meinte.
»Jemand, der ebenfalls einen netten Posten bekommen hat – übrigens herzlichen Glückwunsch, Marcus, das wurde ja auch Zeit; wir müssen das feiern, mein Sohn – zu einem besseren Zeitpunkt, natürlich«, fügte er widerstrebend hinzu.
Endlich kapierte ich. »Du meinst doch nicht etwa ...«
»Er hat eine gute Stellung, einen soliden Arbeitgeber, eine Menge Knete, steht in der Blüte seines Lebens und ist uns allen wohl bekannt – ich halte ihn für den offensichtlichsten Kandidaten«, krähte Papa. »Den kostbaren Untermieter deiner Mutter!«
Ich sprang auf, stapfte ins Schafzimmer und knallte die Tür hinter mir zu wie ein beleidigtes Kind. Der Tag war schlimm gewesen, aber jetzt war mir endgültig schlecht. Wie alle unmöglichen, aus der Luft gegriffenen Bemerkungen meines Vaters, hatte auch diese etwas tödlich Wahrscheinliches. Wenn man außer Acht ließ, dass der Untermieter ein giftiger, parasitärer Fungus mit der Moral eines politisch verschlagenen Penners war, handelte es sich hier tatsächlich um einen fest angestellten, betuchten, vor kurzem beförderten Mann, der sich danach sehnte, Teil der Familie zu werden.
O ihr Götter – Anacrites!
Kapitel IV
»Was ist denn nun wirklich mit Famia passiert?«, fragte Petro, als er mich am nächsten Morgen auf der Brunnenpromenade traf. Ich zuckte nur die Schultern. Er warf mir einen angesäuerten Blick zu. Ich sah weg und verfluchte Famia wieder mal, weil er mich in diese Lage gebracht hatte. »Dreckskerl!« Trotz seiner Verärgerung freute sich Petronius darauf, mir die Einzelheiten gewaltsam zu entlocken.
»Danke, dass du mir gestern Abend Papa abgenommen hast.«
Er wusste, dass ich das Thema wechseln wollte. »Dafür schuldest du mir was. Ich hab mich von ihm zu Flora schleppen lassen und meinen halben Wochenlohn versoffen.«
»Du kannst dir also leisten, die Nächte in einer Caupona zu verbringen?«, fragte ich spitz, denn ich wollte herausfinden, wie es zwischen ihm und seiner Frau stand.
Arria Silvia hatte ihn wegen einer Sache verlassen, die Petro für einen minderen Verstoß gegen den Ehekodex hielt – seine verrückte Affäre mit der beschränkten Tochter eines Gangsterbosses, was ihm eine Suspendierung vom Dienst bei den Vigiles und viel Spott von seinen Freunden und Bekannten eingebracht hatte. Die Bedrohung für seinen Posten war nur vorübergehend, genau wie die Affäre, aber der Verlust seiner Frau – was praktisch auch den Verlust seiner drei Kinder bedeutete – sah nach einer permanenten Angelegenheit aus. Aus irgendeinem Grund hatte ihn Silvias wütende Reaktion völlig überrascht. Ich nahm an, dass Petronius schon früher untreu gewesen war und Silvia meist davon gewusst hatte, aber diesmal mit der unerträglichen Tatsache leben musste, vom halben Aventin ausgelacht zu werden.
»Ich leiste mir, was ich will.«
Wir wichen beide aus. Ich hoffte, dass das nichts mit unserer in die Hose gegangenen Partnerschaft zu tun hatte. Bevor Anacrites mein Partner wurde, hatte ich es mit Petronius versucht. Weil wir seit unserer Militärzeit befreundet waren, hatten Petro und ich erwartet, ideale Kollegen zu sein, hatten uns aber von Anfang an nur gestritten, weil jeder die Dinge nach seiner Fasson handhaben wollte. Wir trennten uns, nachdem ich eine spektakuläre Verhaftung ohne ihn durchgeführt hatte; Petro war der Meinung, ich hätte ihn absichtlich ausgeschlossen. Da er mein bester Freund war, hatte mir die Trennung sehr zugesetzt.
Als wir uns zerstritten, war Petro zu den Vigiles zurückgekehrt. Er war Ermittlungschef der Vierten Kohorte, und selbst sein bornierter, hartgesottener Tribun musste zugeben, dass Petronius seine Arbeit sehr gut machte. Petro hatte erwartet, ebenfalls zu seiner Frau zurückkehren zu können. Aber kaum hatte Arria Silvia ihn aufgegeben, war flugs ihr neuer Freund auf der Bildfläche erschienen – ein Salatverkäufer, wie Petro angeekelt feststellen musste. Ihre Kinder, drei Mädchen, waren immer noch klein, und obwohl Petronius das Recht hatte, sie für sich zu beanspruchen, wäre es blödsinnig gewesen, außer er heiratete rasch wieder. Natürlich glaubte er wie die meisten Männer, die ein glückliches Familienleben für eine Bagatelle fortwerfen, dass er unbedingt seine Frau wiederhaben wollte. Silvia hielt sich stattdessen lieber an ihren Salatverkäufer.
Helena meinte, Petronius Longus würde es bei seiner Vergangenheit genauso schwer haben, eine neue Frau zu finden, wie seine alte zurückzubekommen. Ich dachte anders darüber. Er war gut gebaut und sah nicht schlecht aus, war ein ruhiger, intelligenter, umgänglicher Mensch; er hatte eine feste Anstellung und sich als umsichtiger Haushaltungsvorstand erwiesen. Gut, momentan wohnte er in meiner schäbigen alten Junggesellenbude, trank zu viel, fluchte zu offen und flirtete mit allem, was einen Rock trug. Aber das Schicksal stand auf seiner Seite. So verbittert und gekränkt, wie er aussah, würden viele auf ihn fliegen. Frauen liebten Männer mit Vergangenheit. Na ja, bei mir hatte das doch funktioniert, oder?
Noch konnte ich ihm zwar nicht die ganze Geschichte über Famia erzählen, hatte jedoch eine Menge anderes zu berichten, was ich ihm auch sagte. Ich hatte keine Hemmungen, mich über Anacrites’ Tändelei mit dem Gladiatorenschwert zu verbreiten. Petro würde sich mit Wonne auf diesen Skandal stürzen, bis Gras über die Famia-Sache gewachsen war und ich ihm das Fiasko mit dem Löwen vertraulich erklären konnte.
»Hast du Zeit, mit mir zu essen?«, fragte er.
Ich schüttelte den Kopf. »Schwiegereltern.«
»Ach, natürlich«, gab er etwas scharf zurück. Meine Schwiegereltern, wie ich sie jetzt versuchsweise nannte, gehörten zur Senatorenschicht – eine etwas protzige Verbindung für einen Ermittler. Petronius wusste immer noch nicht so genau, ob er sich über mein Glück lustig machen oder verächtlich in den Rinnstein kotzen sollte. »Jupiter, Falco, du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Du musst ja ganz wild darauf sein, dich als Wunderknaben in kaiserlicher Gunst mit den neu erworbenen Referenzen des mittleren Rangs zu präsentieren.«
Mir erschien es taktvoll, einen Witz zu machen. »Mit meinen Stiefeln bis zu den Schnürriemen voll stinkender Gänsescheiße.«
Er ging darauf ein. »Macht sich bestimmt hübsch auf ihren teuren Marmorböden.« Ich bemerkte, dass sich seine Augen leicht verengt hatten. Er hatte etwas gesehen. Ohne den lockeren Plauderton zu ändern, sagte er: »Deine Mama ist gerade um die Ecke der Schneidergasse gebogen.«
»Danke!«, murmelte ich. »Das könnte genau der richtige Moment sein, sich zu verdrücken und der heiligen Schnäbel anzunehmen ...«
»Nicht nötig«, erwiderte Petronius, jetzt in einem Ton, der echte Bewunderung verriet. »Sieht so aus, als wäre deine neue Rolle gerade zu dir gekommen.«
Ich drehte mich um und folgte seinem Blick. Am Fuß der wackligen Treppe, die zu meiner Wohnung führte, stand eine schicke Sänfte. Ich erkannte die weiß und purpur gestreiften Vorhänge und die auf der Vorderseite angebrachte charakteristische Medusaverzierung – dieselbe Sänfte, in der gestern die kleine Gaia gekommen war.
Ein Mann stieg aus. Alles an ihm, seine hochnäsigen Diener, sein fahriges Verhalten und seine lächerliche Kleidung, erfüllte mich mit Entsetzen. Er trug einen zotteligen doppelseitigen Umhang und auf dem Kopf einen mit Wollfäden befestigten Birkenspross; dieses Ding war auf einer runden Kappe mit Ohrenklappen angebracht, die unter dem Kinn mit zwei Bändern gebunden wurde und aussah wie eine Kindermütze, die sich meine kleine Tochter vom Kopf reißen und auf den Boden schmeißen würde. Der Umhang sollte wie die Kleidung eines Helden wirken, aber mein spitzkappiger Besucher gehörte zu einer Kaste, die ich schon immer verabscheut hatte. Dank meiner neuen Stellung war ich gezwungen, ihn mit vorgetäuschter Höflichkeit zu behandeln. Er war ein Flamen, einer der engstirnigen Priester der uralten latinischen Kulte.
Kaum zwei Tage in der neuen Stellung, und der Drecksack hatte bereits herausgefunden, wo ich wohnte. Ich kannte Mieteintreiber, die einem Mann mehr Aufschub gewährten.
Kapitel V
Nach ein paar Worten mit dem Korbflechter im Erdgeschoss gingen die Diener des Flamen ihm die ausgetretene Treppe zu meiner Wohnung voraus. Draußen auf dem kleinen Vorplatz, wo Gaia mir gestern aufgelauert hatte, nagte Nux an einem großen rohen Knochen. Sie war nur ein kleiner Hund, aber bei ihrem Knurren erstarrte die ganze Kavalkade.
Es gab eine kurze Auseinandersetzung.
Nux packte den Knochen, der fast zu schwer für sie war. Ich hatte ihn gesehen – und gerochen –, als ich das Haus verließ, ein verwestes Riesending, das sie nach wochenlangem Reifen wieder ausgebuddelt haben musste. Ein paar Fliegen summten über dem Ding herum. Da die Halbtür hinter ihr geschlossen war, um Julia drinnen und fern von der Hündin zu halten, solange es gefährlich war, blieben Nux nur begrenzte Möglichkeiten. Sie legte die Ohren an und zeigte das Weiße in ihren Augen. Selbst ich hätte mich ihr jetzt nicht genähert. Unter ständigem Knurren tappte sie die Treppe hinunter, mit dem Knochen im Maul, der auf jeder Stufe aufschlug. Die Diener zogen sich hastig zurück und traten dem Flamen dabei auf die Zehen. Am Fuß der Treppe quetschten sie sich zu einem ängstlichen Haufen zusammen, während meine Hündin mit ihrer kostbaren Fracht an ihnen vorbeistolzierte und sie weiterhin wütend anknurrte.
Der Flamen raffte den Umhang um sich und schlich die Stufen hinauf. Seine Diener, vier an der Zahl, formierten sich zögernd am Fuß der Treppe, um ihn von hinten zu schützen, und als er drinnen verschwunden war, nahmen sie in lässigerer Haltung ihren Posten bei der Sänfte ein. Nuxie ließ ihren Knochen mitten auf der Straße fallen. Mit gesenktem Kopf lief sie rund um ihn herum und schob mit der Nase imaginäre Erde über den Knochen. Dann, überzeugt davon, dass ihr Schatz jetzt unsichtbar war, schlenderte sie davon, auf der Suche nach interessanteren Dingen.
Petronius, der es mehr mit Katzen hatte, lachte leise in sich hinein. Ich klopfte ihm auf die Schulter und wedelte mit den Armen, um Mama klar zu machen, dass diese offizielle Angelegenheit nicht von ihrer üblichen liebevollen Erkundigung nach der Verdauung meiner Familie unterbrochen werden sollte, und zwinkerte dann im Vorübergehen dem Korbflechter zu. Leise stieg ich die Treppe hinauf. Die Diener ignorierten mich. Mama rief mich, aber ich war daran gewöhnt, nicht auf meine Mutter zu hören, wenn sie etwas von mir wollte.
Drinnen schnappte ich mir Julia, die in großer Eile auf die vom Flamen offen gelassene Halbtür zukrabbelte. Mit meiner Tochter auf der Schulter und der Hoffnung, sie würde sich still verhalten, lehnte ich mich an die vor kurzem türkis gestrichene Flurwand, um dem Spaß zuzuhören.
Ich fragte mich, was der Flamen erwartet hatte. Was er bekam, war das Mädchen, das ich vor ein paar Minuten allein zu Hause gelassen hatte, ein recht häuslicher Schatz – mit einer impulsiven, rebellischen Ader. Sie hatte mich mit einer sinnlichen Umarmung und einem verführerischen Kuss verabschiedet. Nur ihr abwesender Blick hatte einem Mann, der sie gut kannte, verraten, dass sie ihn am liebsten von hinten sah. Sie konnte es kaum erwarten, sich in die Schriftrollen zu vertiefen, die Papa ihr gestern Abend mitgebracht hatte, abgezweigt aus einer Auktion, die er abhalten sollte. Inzwischen hatte sie sich bestimmt über den Schriftrollenkasten hergemacht und die erste glückselig aufgerollt. Die Unterbrechung durch den Priester hatte sie mit Sicherheit wütend gemacht.
Sie konnte nicht übersehen, dass er ein Flamen war. Die Kappe und der Birkenspross waren unverkennbar. Senatorentöchter wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Aber Frauen von Privatermittlern sagen, was sie denken.
»Ich will zu einem Mann namens Falco.«
»Sie befinden sich in seinem Haus. Leider ist er nicht da.« Obwohl sie freundlich sprach, merkte ich sofort, dass sie ihn nicht leiden konnte.
Helenas Akzent war kultivierter als der des Flamen. Seine Vokale klangen hässlich, obwohl er so tat, als wäre er etwas Besseres. »Ich werde warten.«
»Das kann dauern. Er ist zu seiner Mutter gegangen.« Trotz der Tatsache, dass ich Mama in der Brunnenpromenade ausgewichen war, hatte ich wirklich vorgehabt, ihr von Famia zu erzählen.
Wenn der Flamen gehört hatte, dass ich Privatermittler war, dachte er vermutlich, Helena sei ein Überbleibsel eines meiner früheren Abenteuer. Was stimmte. Er würde angenommen haben, sich mit einem harten Mann in einer verwahrlosten Unterkunft in Verbindung zu setzen, dessen Gefährtin den verknitterten Charme eines alten Schnürsenkels besaß. Ein großer Fehler.
Inzwischen musste ihm klar geworden sein, dass Helena jünger, schärfer und kultivierter war, als er erwartet hatte. Seine verkniffene Nase musste erkannt haben, dass er in einem kleinen, aber makellos sauberen Zimmer stand (täglich von Mama gewienert, während wir auf Reisen waren). Ein typisches Zimmer für den Aventin, in dem es trotz des offenen Fensterladens nach Kleinkind, Haustieren und dem Essen vom vorherigen Abend roch. Nur war es an diesem Morgen mit einem volleren, exotischeren, wesentlich teureren Parfumduft eines seltenen Balsams auf der warmen Haut unter Helenas leichtem Kleid erfüllt. Sie war in Blau gekleidet. Ungeschminkt, ohne Schmuck. Sie brauchte beides nicht. So, wie sie war, konnte sie einen unvorbereiteten Mann erschrecken und in Verwirrung stürzen.
»Ich muss mit dem Ermittler sprechen«, quengelte der Flamen. »Oh, das Gefühl kenne ich!« Ich stellte mir vor, wie Helenas große braune Augen tanzten, während sie den Priester hinhielt. »Aber seine Spezialität ist das Ausweichen. Er wird kommen, wann es ihm passt.«
»Und Sie sind?«, wollte der Mann hochnäsig wissen.
»Wer ich bin?«, sinnierte sie, immer noch in spöttischem Ton. »Die Tochter von Camillus Verus, Senator und Freund Vespasians. Die Frau und Partnerin von Didius Falco, Agent Vespasians und Prokurator des heiligen Geflügels. Die Mutter von Julia Junilla, die noch zu klein ist, um gesellschaftliche Relevanz zu haben. Das sind meine formellen Titel. Mein Name, sollten Sie ein Tagebuch über interessante Menschen führen, denen Sie begegnen, ist Helena Justina ...«
»Sie sind eine Senatorentochter – und Sie leben hier?« Er schien sich offenbar in dem spärlich möblierten Raum umzusehen. Wir kamen damit zurecht. Wir hatten einander. (Plus verschiedene kunstvolle Artefakte, die für bessere Zeiten eingelagert waren.)