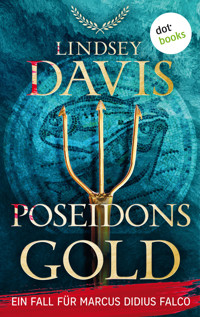
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Marcus Didius Falco
- Sprache: Deutsch
Vom Jäger zum Gejagten: Der fesselnde historische Kriminalroman »Poseidons Gold« von Lindsey Davis jetzt als eBook bei dotbooks. Rom, 72 nach Christus. Als begabtester Privatermittler im Imperium Romanum lebt Marcus Didius Falco davon, über alle Vorgänge in der »Stadt der sieben Hügel« genau informiert zu sein. Deshalb ist er fassungslos, als der zwielichtige Legionär Censorinus ihm enthüllt, dass auf dem Familienerbe der Falcos ein dunkler Schatten liegt: Sein als Held gefeierter Bruder soll vor seinem Tod mit schmutzigen Geschäften viel Geld veruntreut haben – Geld, dass er Censorinus nun schuldet. Als der Soldat kurz darauf heimtückisch ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf Falco. Für ihn beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit: Ihm bleiben nur drei Tage, um seine Unschuld zu beweisen und gleichzeitig den Familiennamen reinzuwaschen – denn der Schwertarm der Justitia kennt keine Gnade ... »Lindsey Davis malt ein lebendiges Bild des kaiserlichen Roms – laut, gedrängt und gefährlich.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende historische Roman »Poseidons Gold« von Bestsellerautorin Lindsey Davis – der fünfte Fall ihrer Reihe historischer Kriminalromane rund um den römischen Ermittler Marcus Didius Falco. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Rom, 72 nach Christus. Als begabtester Privatermittler im Imperium Romanum lebt Marcus Didius Falco davon, über alle Vorgänge in der »Stadt der sieben Hügel« genau informiert zu sein. Deshalb ist er fassungslos, als der zwielichtige Legionär Censorinus ihm enthüllt, dass auf dem Familienerbe der Falcos ein dunkler Schatten liegt: Sein als Held gefeierter Bruder soll vor seinem Tod mit schmutzigen Geschäften viel Geld veruntreut haben – Geld, dass er Censorinus nun schuldet. Als der Soldat kurz darauf heimtückisch ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf Falco. Für ihn beginnt ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit: Ihm bleiben nur drei Tage, um seine Unschuld zu beweisen und gleichzeitig den Familiennamen reinzuwaschen – denn der Schwertarm der Justitia kennt keine Gnade ...
»Lindsey Davis malt ein lebendiges Bild des kaiserlichen Roms – laut, gedrängt und gefährlich.« Publishers Weekly
Über die Autorin:
Lindsey Davis wurde 1949 in Birmingham, UK, geboren. Nach einem Studium der Englischen Literatur in Oxford arbeitete sie 13 Jahre im Staatsdienst, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Ihr erster Roman Silberschweine wurde ein internationaler Erfolg und der Auftakt der mittlerweile 20 Bände umfassenden Marcus-Didius-Falco-Serie. Ihr Werk wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Diamond Dagger der Crime Writers' Association für ihr Lebenswerk.
Bei dotbooks erscheinen die folgenden Bände der Serie historischer Kriminalromane des römischen Privatermittler Marcus Didius Falco:
»Silberschweine«
»Bronzeschatten«
»Kupfervenus«
»Eisenhand«
»Letzter Akt in Palmyra«
»Die Gnadenfrist«
»Zwielicht in Cordoba«
»Drei Hände im Brunnen«
»Den Löwen zum Fraß«
»Eine Jungfrau zu viel«
»Tod eines Mäzens«
»Eine Leiche im Badehaus«
»Mord in Londinium«
»Tod eines Senators«
»Das Geheimnis des Scriptors«
»Delphi sehen und sterben«
»Mord im Atrium«
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2021
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Originaltitel »Poseidon’s Gold« bei Century, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe 1992 by Lindsey Davis
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 Vito von Eichborn GmbH & Co. Verlag KG, Frankfurt am Main
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Kolonko, Marco Ossino, Peykev
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (fb)
ISBN 978-3-96655-752-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Poseidons Gold« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Lindsey Davis
Poseidons Gold
Ein Fall für Marcus Didius Falco
Aus dem Englischen von Christa Seibicke
dotbooks.
Zur Erinnerung an Rosemary Sutcliff,
die gestorben ist,
während dieses Buch entstand:
im Namen aller Kinder,
die wissen, wie weit es ist
von Venta bis ins Gebirge.
Dramatis Personae
T Censorinus Macer, ein Soldat, der einmal einem heißen Tip vertraut hat.
Laurentius, ein Zenturio, der den Spruch »Wie gewonnen, so zerronnen« beherzigt.
L Petronius Longus, ein Wachhauptmann, der auch in schwierigen Fällen sein Bestes gibt.
Marponius, Vertreter für Enzyklopädien und Richter (als solcher ein Alptraum).
D Camillus Verus & Julia Justa, nette Eltern mit den üblichen Problemen (ihre Kinder).
Lenia, eine Wäscherin mit Geschmacksverirrung, was Männer betrifft.
Epimandos, ein Kellner, der sich beliebt machen möchte (und sich ganz umsonst abstrampelt).
Zwirn, die Katze in der Caupona Flora.
Flora, wahrscheinlich gibt es sie gar nicht.
Manlius und Varga, zwei Maler mit Gedächtnislücken.
Orontes Mediolanus, ein sehr gefragter Bildhauer.
Rubinia, ein Modell, bei dem das Maßnehmen lohnt.
Apollonius, ein Geometrielehrer, dem der Sinn für die Realität abhanden kam.
A Cassius Carus & Ummidia Servia, anspruchsvolle Kunstmäzene (mit Vorliebe für Verschollenes).
Die Gebrüder Aristedon, Spediteure der Anspruchsvollen (segeln in stürmischen Gewässern).
Cocceius, ein »redlicher« Auktionator.
Domitian Caesar, ein Herrscher, der sich auf herrschendes Recht beruft.
Anacrites, ein Spion, der alle Schuld von sich weist.
Ajax, ein Hund mit Vorstrafen.
Jüdische Kriegsgefangene, arbeiten als Bautrupp am Kolosseum.
Rom – Capua – Rom: März – April, 72 n. Chr.
Kapitel 1
Eine finstere, stürmische Nacht auf der Via Aurelia: Unsere Heimkehr stand unter einem ungünstigen Stern, noch bevor wir Rom erreicht hatten.
Bis dahin hatten wir auf unserer Rückreise von Germanien im Februar und März gut tausend Meilen zurückgelegt. Aber die fünf, sechs Stunden, die wir für das letzte Stück von Veii her brauchten, waren die schlimmsten. Lange nachdem andere Reisende sich in Gasthöfen am Wegrand in ihren Betten verkrochen hatten, waren wir immer noch einsam unterwegs. Die Entscheidung, weiterzufahren und heute nacht noch die Stadt zu erreichen, war ausgesprochen blödsinnig gewesen. Jeder meiner Mitreisenden wußte das, und ebenso wußten alle, wer dafür verantwortlich war: ich, Marcus Didius Falco, der Mann, der das Kommando führte. Vielleicht tauschten die anderen gerade jetzt ihre Meinung über mich aus, aber ich konnte nichts hören. Sie saßen nämlich im Wagen, hatten es zwar furchtbar ungemütlich, konnten sich aber immerhin damit trösten, daß es kältere und feuchtere Alternativen gab: Ich ritt nebenher und war dem Regen und Sturm völlig ausgeliefert.
Unerwartet tauchten die ersten Häuser auf – die mehrstöckigen, überfüllten Wohnblocks, die von nun an unseren Weg durch die üblen Slums der Transtiberina säumen würden. Heruntergekommene Gebäude ohne Balkon oder Pergola standen dicht an dicht, unterbrochen nur von den dunklen Gassen, wo normalerweise Straßenräuber ahnungslose Neuankömmlinge erwarteten. Vielleicht würden sie es in einer Nacht wie dieser vorziehen, daheim im trockenen, warmen Bett zu lauern. Vielleicht hofften sie aber auch, daß das Sauwetter die Reisenden unvorsichtig machte: Ich wußte, daß die letzte halbe Stunde einer langen Fahrt die gefährlichste sein kann. In den scheinbar menschenleeren Straßen kündigten Pferdegetrappel und ratternde Wagenräder uns lautstark an. Ich ahnte überall Gefahr, packte meinen Schwertgriff fester und prüfte, ob mein im Stiefel verstecktes Messer noch an seinem Platz war. Durchweichte Lederriemen klemmten die Klinge an meiner geschwollenen Wade so fest, daß sich das Messer nur mit Mühe herausziehen ließ.
Ich wickelte mich in meinen mit Wasser vollgesogenen Mantel, bereute es aber sofort, weil die schweren Falten mich feucht umklammerten. Über uns barst eine Dachrinne; eine eisige Dusche klatschte auf mich nieder, erschreckte mein Pferd und hätte mir fast den Hut vom Kopf gerissen. Fluchend versuchte ich, den Gaul zu bändigen. Dann merkte ich, daß ich die Abzweigung verpaßt hatte, die uns zum Pons Probus und damit auf dem kürzesten Weg nach Hause gebracht hätte. Mein Hut rutschte zu Boden. Ich opferte ihn dem Wind.
Ein einzelner Lichtstrahl in einer Seitenstraße rechts von uns beleuchtete die Wache einer Kohorte der Vigiles, unserer Feuerwehr. Ansonsten konnte ich kein Lebenszeichen entdecken.
Wir überquerten den Tiber auf dem Pons Aurelia. In der Dunkelheit unter uns toste der Fluß. Die gurgelnden Wasser hatten eine unangenehme Kraft. Stromaufwärts war der Tiber sicher schon über die Ufer getreten, hatte das flache Land rings ums Kapitol überflutet und den Campus Martius – der auch zu besten Zeiten sumpfig sein kann – in einen ungesunden Teich verwandelt. Wieder einmal würde aufgequollener Schlamm von der Farbe und Konsistenz des Inhalts einer Kloake in die Keller der teuren Villen eindringen, deren gutsituierte Besitzer sich um den schönsten Tiberblick gerauft hatten.
Einer dieser wohlhabenden Bürger war mein Vater. Der Gedanke daran, wie er stinkendes Wasser aus seiner Eingangshalle befördern mußte, besserte meine Laune.
Eine stürmische Bö fegte uns auf dem Forum Boarium so ungestüm entgegen, daß mein Pferd plötzlich stehenblieb. Die Zitadelle und der Palatin über uns waren nicht zu erkennen. Auch die erleuchteten Paläste der Cäsaren sah man nicht, aber ich kannte mich hier aus und trieb mein Pferd am Circus Maximus vorbei und an den Tempeln von Ceres und Luna, an den Triumphbögen, Brunnen, Bädern und überdachten Märkten, die Roms ganzer Stolz waren. All diese Herrlichkeiten konnten warten. Ich sehnte mich nur nach meinem eigenen Bett. Regen schoß in Sturzbächen an der Statue irgendeines Konsuls herab und benutzte die Bronzefalten seiner Toga als Abfluß. Wasser schwappte von den Ziegeldächern, deren Regenrinnen diesen Fluten nicht gewachsen waren. Wahre Katarakte ergossen sich von Säulenhallen. Mein Pferd wollte unbedingt auf die überdachten Fußwege vor den Ladenfassaden, während ich versuchte, es am kurzen Zügel auf dem Pflaster zu halten.
Wir bahnten uns einen Weg hinunter zum Armilustrium. Hier unten stand in manchen der nicht kanalisierten Seitenstraßen das Wasser so hoch, daß sie unpassierbar waren, aber als wir von der Landstraße abbogen, ging es steil bergauf; nun war der Boden nicht mehr überflutet, doch dafür gefährlich rutschig. Der Regen hatte die Wege auf dem Aventin so reingewaschen, daß mir nicht einmal der übliche Gestank in die Nase stieg; ohne Zweifel würde der gewohnte Mief, ein Gemisch aus menschlichen Exkrementen und dem Abfall nachbarschaftsfeindlicher Gewerbe, morgen wieder da sein, und zwar intensiver denn je, nachdem soviel Wasser die halb kompostierten Abfallhaufen und Müllkippen umspült hatte.
Düstere Vertrautheit sagte mir, daß ich die Brunnenpromenade gefunden hatte.
Meine Straße. Auf einen Heimkehrer aus der Fremde wirkte diese öde Sackgasse trostloser denn je. Unbeleuchtet, mit geschlossenen Fensterläden und eingerollten Markisen, bot die Gasse nichts, was mit ihrer Häßlichkeit versöhnt hätte. Menschenleer – sogar die üblichen Gruppen heruntergekommener Gestalten waren verschwunden – ächzte sie trotzdem unter der Last menschlichen Elends. Der Wind pfiff und heulte die Gasse hinunter, drehte und schlug uns voll ins Gesicht. Mein Wohnblock ragte auf der einen Seite empor wie ein gesichtsloser Republikanerwall, erbaut als Festung gegen marodierende Barbaren. Als ich mein Pferd zügelte, krachte von oben ein schwerer Blumentopf herunter und verfehlte mich um höchstens einen Fingerbreit.
Ich zerrte die Wagentür auf, um den erschöpften Seelen herauszuhelfen, für die ich verantwortlich war. Zum Schutz gegen die Kälte eingehüllt wie Mumien, stiegen sie steifbeinig aus, entdeckten dann, als der Sturm sie traf, flugs ihre Beine wieder und flohen hastig in die ruhigen Gefilde des Treppenhauses: Sie, das waren meine Freundin Helena Justina, ihre Zofe, die kleine Tochter meiner Schwester und unser Kutscher, ein stämmiger Kelte, der eigentlich für unsere Sicherheit hatte sorgen sollen. Von mir persönlich als Eskorte ausgesucht, hatte er den größten Teil der Reise angstschlotternd auf dem Bock gesessen. Wie sich herausstellte, war er fern der Heimat der reine Hasenfuß. Noch nie war er außerhalb Bingiums gewesen; ich wünschte, ich hätte ihn dort gelassen.
Immerhin hatte ich Helena bei mir gehabt. Sie war die Tochter eines Senators, mit allem, was so eine Abstammung mit sich bringt, natürlich, und temperamentvoller als die meisten ihres Schlages. Sie hatte jeden Gastwirt, der uns seine besseren Zimmer vorenthalten wollte, ausgetrickst, und mit Schurken, die unerlaubten Brückenzoll kassieren wollten, hatte sie kurzen Prozeß gemacht. Jetzt machten mir ihre ausdrucksvollen dunklen Augen klar, daß sie die Absicht hatte, mich wegen der letzten Stunden der heutigen Fahrt ins Gebet zu nehmen. Als ich diesen Blick auffing, versuchte ich mein einschmeichelndes Lächeln gar nicht erst.
Noch waren wir nicht zu Hause. Meine Wohnung lag nämlich im sechsten Stock.
Schweigend und im Dunkeln nahmen wir die Treppen in Angriff. Nach einem halben Jahr in Germanien, wo selbst zweistöckige Häuser eine Seltenheit sind, protestierten meine Wadenmuskeln ziemlich bald. In diesem Wohnblock lebten nur durchtrainierte Leute. Wenn ein Invalide in Geldnöten jemals eine Wohnung über dem Brunnenhof mietete, dann kurierte ihn entweder die sportliche Betätigung rasch, oder die Treppen brachten ihn um. Wir hatten schon etliche Nachbarn auf diese Weise verloren. Smaractus, unser Hausherr, verdiente sich eine goldene Nase damit, daß er den Besitz seiner verstorbenen Mieter verscherbelte.
Oben angekommen, zog Helena eine Zunderbüchse unter ihrem Mantel hervor. Die Verzweiflung verlieh mir eine ruhige Hand; bald schlug ich einen Funken und schaffte es sogar, eine Kerze anzuzünden, bevor der Funke wieder erlosch. An meinem Türpfosten verkündete die inzwischen arg verblaßte Kachel, daß M. Didius Falco hier als Privatermittler arbeitete. Nach einem kurzen, heftigen Streit, währenddessen ich versuchte, mich zu erinnern, wo ich den Hebeschlüssel für meinen Türriegel verstaut hatte, lieh ich mir von Helena eine Kleiderspange, band sie an einem Stoffstreifen fest, den ich aus meiner Tunika gerissen hatte, schob die Spange durchs Loch und wedelte sie an dem Tuch hin und her.
Ausnahmsweise funktionierte der Trick. (In der Regel geht die Spange kaputt, man fängt sich von dem Mädel, dem sie gehört, eine Ohrfeige ein und muß sich am Ende eine Leiter borgen, um durchs Fenster einzusteigen.) Für meinen Erfolg gab es freilich einen Grund: Der Riegel war schon aufgebrochen. Voll unguter Vorahnungen stieß ich die Tür auf, hob die Kerze und musterte mein Heim.
Wenn man lange weg war, sieht die eigene Wohnung immer kleiner und vergammelter aus, als man sie in Erinnerung hat. Allerdings ist es normalerweise nicht ganz so schlimm.
Riskant ist es allemal, wenn man seine Bude monatelang leerstehen läßt. Aber die Parzen, die mit Vorliebe auf den Verlierern herumhacken, hatten diesmal alle üblen Streiche an mir ausprobiert. Die ersten Eindringlinge waren vermutlich Ungeziefer oder Mäuse gewesen, gefolgt von besonders schmutzigen nistenden Tauben, die ein Loch ins Dach gebohrt haben mußten. Ihr Kot sprenkelte die Dielen, doch das war noch gar nichts gegen die Sauerei der bösartigen menschlichen Aasgeier, die offenbar die Tauben verdrängt hatten. Deutliche Spuren, zum Teil schon etliche Monate alt, verrieten mir, daß von den Leuten, denen ich unfreiwillig ein Dach über dem Kopf geboten hatte, keiner gut erzogen war.
»Ach, mein armer Marcus!« rief Helena bestürzt. Sie mochte müde und ärgerlich sein, aber angesichts eines völlig verzweifelten Mannes wurde sie gleich zur wandelnden Caritas.
Ich überreichte ihr mit höflicher Verbeugung ihre Kleiderspange. Dann gab ich ihr die Kerze zum Halten, trat über die Schwelle und beförderte den nächstbesten Eimer mit einem Fußtritt durchs ganze Zimmer.
Der Eimer war leer. Wer immer hier eingebrochen war, hatte zumindest ab und an versucht, den Abfall in das von mir bereitgestellte Behältnis zu befördern, nur hatten die Betreffenden nicht zielen können. Und manchmal hatten sie’s auch gar nicht erst probiert. Der Müll, der daneben landete, war auf dem Fußboden liegengeblieben, bis er ins Holz der Dielenbretter hineingefault war.
»Marcus, Liebster …«
»Pst, Schatz. Sag bitte kein Wort, bis ich das verdaut habe!«
Ich durchquerte den vorderen Raum, der früher mal mein Büro beherbergt hatte. In dem, was von meinem Schlafzimmer noch übrig war, fand ich dann weitere Spuren der menschlichen Eindringlinge. Sie hatten offenbar erst heute das Weite gesucht, nachdem das alte Loch im Dach sich wieder geöffnet und eine wahre Sturzflut von Dachpfannen und Regenwasser hereingelassen hatte, das zum größten Teil noch immer mein Bett durchweichte. Schmutziges Getröpfel von oben komplettierte das Desaster. Mein armes altes Bett war unrettbar verloren.
Helena trat hinter mich. »Na ja!«
Ich machte einen grimmigen Versuch, aufgeräumt zu erscheinen. »Wenn ich ein richtiges Problem will, könnte ich den Vermieter verklagen!«
Helenas Hand schob sich sanft in meine. »Ist irgendwas gestohlen worden?«
»Ich lasse den Dieben nie was da. Mein bewegliches Vermögen habe ich samt und sonders bei Verwandten untergebracht. Wenn also was fehlt, hat sich’s die Familie unter den Nagel gerissen.«
»Wie tröstlich«, nickte sie.
Ich liebte dieses Mädchen. Sie inspizierte die Trümmer mit elegantem Ekel, doch ihre feierliche Miene sollte mich zum Lachen bringen. Sie hatte einen trockenen Humor, dem ich nicht widerstehen konnte. Ich umarmte sie stürmisch und versuchte, in ihren Armen mein bißchen Verstand zu bewahren.
Sie küßte mich. Ihr Blick war traurig, ihr Kuß dagegen voller Zärtlichkeit. »Willkommen daheim, Marcus.« Bei unserem allerersten Kuß hatte sie ein kaltes Gesicht und nasse Wimpern gehabt, und auch damals hatte ich mich gefühlt wie jemand, der aus sehr unruhigem Schlaf erwacht, weil jemand ihn mit Honigkuchen füttert.
Ich seufzte. Wäre ich allein gewesen, hätte ich vielleicht einfach ein Eckchen freigeräumt und mich in all dem Dreck schlafen gelegt. Aber Helena konnte ich das nicht zumuten. Wir würden wohl oder übel der Verwandtschaft auf die Bude rücken müssen. Helenas komfortables Elternhaus lag auf der anderen Seite des Aventin – zu weit entfernt und viel zu riskant. Nach Einbruch der Dunkelheit ist Rom eine herzlose, unmoralische Stadt. Also blieb uns entweder der göttliche Beistand vom Olymp – oder meine Familie. Jupiter und seine Kollegen mampften irgendwo seelenruhig ihr Ambrosia und ignorierten mein Flehen um Hilfe. Wir mußten also auf meine Sippschaft zurückgreifen.
Irgendwie scheuchte ich die ganze Gesellschaft wieder die sechs Treppen hinunter. Wenigstens hatte die fürchterliche Nacht dafür gesorgt, daß die üblichen Diebe ihre Chance verpaßten: Pferd und Wagen standen immer noch einsam und verlassen an der Brunnenpromenade.
Wir passierten den Schatten des Emporiums, das verrammelt und verriegelt war, aber selbst eine so ungemütliche Nacht noch mit exotischen Düften von importierten Hölzern, Fellen, Dörrfleisch und Gewürzen veredelte. Nach einer Weile hielten wir vor einem anderen Wohnblock, einem mit weniger Treppen und nicht ganz so trostloser Fassade, der aber trotzdem so etwas wie mein Zuhause war. Schon gestärkt von der Hoffnung auf eine warme Mahlzeit und ein trockenes Bett, stolperten wir hinauf bis zu der vertrauten ziegelroten Tür. Sie war nie abgeschlossen; auf dem ganzen Aventin gab es keinen Einbrecher, der mutig genug gewesen wäre, sich in diese Wohnung zu wagen.
Die anderen wollten schnell hinein, aber ich drängte mich vor. Schließlich hatte ich hier Hoheitsrecht. Ich war ein Sohn, der heimkehrt an den Ort seiner Kindheit. Ja, ich kam – mit dem unvermeidlichen schlechten Gewissen – nach Hause zu meinem alten Mütterlein.
Die Wohnungstür führte geradewegs in die Küche. Zu meinem Erstaunen brannte eine Öllampe; normalerweise begnügte Mama sich mit Einfacherem. Aber vielleicht hatte sie ja geahnt, daß wir kommen würden. Bestimmt sogar. Ich wappnete mich für ihre Begrüßung, aber sie war nicht da.
Ich trat ins Zimmer und blieb vor Überraschung wie angewurzelt stehen.
Ein wildfremder Mensch hatte es sich in der Küche bequem gemacht und die Beine mitsamt den Stiefeln auf den Tisch gelegt. Niemand durfte sich einen solchen Luxus erlauben, wenn meine Mutter in der Nähe war. Einen Moment lang glotzte er mich aus trüben Augen an, dann ließ er einen lautstarken Rülpser los, der mich offensichtlich beleidigen sollte.
Kapitel 2
Wie jede Mutter, die auf sich hält, hatte auch die meine ihre Küche zum Kommandostand erkoren, von dem aus sie das Leben ihrer Kinder zu dirigieren versuchte. Wir hatten natürlich andere Vorstellungen, und dadurch verwandelte sich Mamas Küche oft in eine turbulente Arena, wo Leute sich den Bauch vollschlugen, bis ihnen schlecht wurde, und sich gleichzeitig – in der irrigen Hoffnung, Mama abzulenken – lauthals übereinander beschwerten.
Manches war ziemlich normal hier. Da war die steinerne Kochstelle, die man ein Stück weit in die Außenmauer eingelassen hatte, um das Gewicht zu verteilen; trotzdem senkte sich vor ihr der Boden bedrohlich. Mama wohnte im dritten Stock, und zu ihrer Wohnung gehörte ein Dachboden. Dort hatten früher, als sie noch Kinder waren, meine Schwestern geschlafen, und darum wurde traditionell der Herdrauch von jedem, der gerade zu Hause rumhing, unten aus dem Fenster gefächelt; der Fächer hing am Fensterriegel.
Über dem Herd blitzten eine Reihe Kupfertöpfe, Schalen und Bratpfannen, manche davon gebraucht gekauft und mit den Beulen von Generationen verziert. Auf einem Regal standen Schüsseln, Becher, Krüge, Stößel, und in einer gesprungenen Vase steckte ein Sammelsurium von Löffeln. An Nägeln, die auch einen halben ausgeweideten Ochsen ausgehalten hätten, hingen Schöpfkellen, Reibeisen, Siebe und Fleischklopfer. Eine schiefe Reihe Haken trug eine Garnitur riesengroßer Küchenmesser; sie hatten tückische Klingen aus Eisen, die in gespaltenen Knochenheften steckten, und jedes trug Mamas Initialen: JT für Junilla Tacita.
Auf dem obersten Regalbrett standen vier jener Spezialtöpfe, in denen man Haselmäuse kocht. Damit Sie das nicht mißverstehen: Mama sagt, Haselmäuse sind widerliche Viecher, an denen außerdem kein Fleisch dran ist, also bloß was für Snobs mit schlechtem Geschmack und albernen Angewohnheiten. Aber wenn das Saturnalienfest da ist, man sowieso schon eine halbe Stunde zu spät zum Familienfest kommt und in letzter Minute noch verzweifelt nach einem Geschenk für seine Mutter sucht, das sie über zwölf Monate Vernachlässigung hinwegtrösten soll – also dann scheinen jedesmal diese Haselmaus-Kasserollen genau das Richtige zu sein. Mama bedankte sich jedesmal liebenswürdig bei demjenigen ihrer Kinder, das diesmal auf die Masche eines findigen Verkäufers reingefallen war, und ließ ihre unbenutzte Sammlung vorwurfsvoll wachsen.
Der Duft getrockneter Kräuter erfüllte den Raum. Körbe voller Eier und flache Schalen voller Hülsenfrüchte füllten jedes freie Plätzchen. Ein reicher Vorrat an Reisigbesen und Eimern machte klar, was für eine blitzblanke, von Skandalen unberührte Küche – und Familie – meine Mutter vorführen wollte.
Heute abend verdarb der unhöfliche Flegel, der mich angerülpst hatte, Mamas Szenarium. Ich starrte den Kerl an. Borstige graue Haarbüschel standen rechts und links von seinem Kopf ab. Der kahle Schädel und das unfreundliche Gesicht waren tief gebräunt und glänzten wie Mahagoni. Er sah aus wie jemand, der lange in den Wüsten des Ostens gelebt hat, und ich hatte ein ungutes Gefühl: als wüßte ich, welche glühendheiße Gegend es gewesen sein mochte. Seine nackten Arme und Beine hatten die sehnige Muskulatur, die in langen Jahren harter körperlicher Arbeit entsteht und die man selbst mit dem besten Trainingsprogramm im Gymnasium nicht so hinkriegt.
»Wer zum Hades seid ihr denn?« hatte er den Nerv, mich zu fragen.
Abenteuerliche Gedanken fuhren mir durch den Kopf: Wie, wenn meine Mutter sich zur Freude ihrer alten Tage einen Liebhaber zugelegt hatte? Aber diese wilden Spekulationen verflüchtigten sich gleich wieder. »Warum stellen Sie sich nicht erst mal vor?« erwiderte ich und funkelte ihn drohend an.
»Verzieh dich!«
»Nicht so schnell, Soldat!« Ich hatte seinen Beruf erraten. Obwohl seine Tunika ausgebleicht war zu einem faden Rosa, halfen mir die gut zwei Finger dicken Stollensohlen seiner Militärstiefel weiter. Ich kannte den Typ, kannte den Knoblauchatem, die Narben von Kasernenraufereien, die großspurige Haltung.
Seine gehässigen Augen verengten sich wachsam, aber er machte keine Anstalten, die Stiefel von der geheiligten Arbeitsplatte meiner Mutter zu nehmen. Ich ließ das Bündel fallen, das ich unter dem Arm hatte, und schlug die Kapuze zurück. Offenbar erkannte er die nassen wirren Locken der Familie Didius.
»Du bist der Bruder!« rief er anklagend. Also hatte er Festus gekannt. Das waren schlechte Nachrichten. Von mir hatte er offenbar auch schon gehört.
Ich gab mich wie ein Mann, von dem jeder Besucher selbstverständlich schon gehört hat, und versuchte so, Oberwasser zu bekommen. »Hier scheint’s ja neuerdings schlampig zuzugehen, Soldat! Mach den Tisch frei und setz dich anständig hin, sonst trete ich dir die Bank unterm Hintern weg!« Diese subtile Psychologie funktionierte. Er stellte die Stiefel auf den Boden. »Langsam«, setzte ich hinzu, für den Fall, daß er mich anspringen wollte. Er setzte sich aufrecht. Ein Vorteil meines Bruders war, daß die Leute ihn respektierten. Für mindestens fünf Minuten (das wußte ich aus Erfahrung) würde sich dieser Respekt auch auf mich übertragen.
»Du bist also der Bruder!« wiederholte er langsam, als ob er damit was Bestimmtes sagen wollte.
»Ganz recht. Ich bin Falco. Und du?«
»Censorinus.«
»Von welcher Legion?«
»Fünfzehnte Apollinaris.« Auch das noch. Meine Laune verschlechterte sich zusehends. Die Fünfzehnte war jene unglückselige Einheit, in der mein Bruder etliche Jahre geglänzt hatte – bevor er seinen schmucken Kadaver in Judäa über eine heißumkämpfte Festungsmauer in ein Dickicht von Rebellenspeeren stürzte und so berühmt wurde.
»Also daher kennst du Festus?«
»Stimmt«, feixte er herablassend.
Während wir miteinander redeten, merkte ich, wie Helena und die anderen hinter mir unruhig wurden. Sie wollten endlich ein Bett – und ich auch. »Hier wirst du Festus nicht finden, und du weißt auch, warum.«
»Wir waren gute Kumpel, Festus und ich«, erklärte er.
»Festus hatte immer ’ne Menge Freunde.« Das klang gelassener, als mir zumute war. Festus – seine Augen mögen sonstwo verfaulen – war einer, der mit jedem Stinktier Brüderschaft trank, das die Krätze und nur noch einen halben Schwanz hatte. Hinterher brachte mein Bruder, großzügig bis zum bitteren Ende, seinen neuen Freund dann mit nach Hause.
»Gibt’s Probleme?« erkundigte sich der Legionär. Seine Unschuldsmiene war per se verdächtig. »Festus hat gesagt, wenn ich mal nach Rom komme, dann kann ich jederzeit …«
»Bei seiner Mutter wohnen?«
»Das hat der Junge mir versprochen.«
Deprimierend, wie bekannt mir das vorkam. Und ich wußte, daß die Fünfzehnte Legion vor kurzem aus dem Kriegsgebiet Judäas in die Provinz Pannonia verlegt worden war – vermutlich würden Soldaten nun in hellen Scharen Gesuche für einen Kurzurlaub in Rom einreichen.
»Das glaub ich dir gern. Wie lange bist du denn schon hier?«
»Seit ein paar Wochen …« Im Klartext hieß das: seit Monaten.
»Freut mich, daß die Fünfzehnte Apollinaris so nett war, Junilla Tacitas Haushaltsgeld aufzustocken!« Ich starrte ihn an, bis er die Augen niederschlug. Wir wußten beide, daß er keinen müden Denar zum Haushalt meiner Mutter beigesteuert hatte. Was für eine Heimkehr! Erst meine demolierte Wohnung und jetzt das. Als wären während meiner Abwesenheit lauter gewissenlose Schurken auf der Suche nach Gratisbetten nach Rom gekommen.
Ich fragte mich, wo meine Mutter sich versteckt haben mochte, und empfand eine merkwürdige Sehnsucht nach den Nörgeleien, mit denen sie, als ich noch klein war, heiße Suppe in meine Lieblingsschüssel gelöffelt und mich aus meinen klitschnassen Kleidern geschält hatte. »Alles schön und gut, aber ich muß dich leider ausquartieren, Censorinus. Die Gästebetten braucht jetzt meine Familie.«
»Selbstverständlich. Ich verzieh mich, sobald ich was anderes gefunden hab …«
Ich hörte auf zu lächeln. Sogar meine Zähne waren müde. Ich zeigte auf die klägliche Truppe, die ich im Schlepptau hatte. Sie standen stumm da, zu erschöpft, um sich an der Unterhaltung zu beteiligen. »Ich wäre froh, wenn du dich ein bißchen sputen würdest.«
Sein Blick wanderte zu den Fensterläden. Von draußen hörte man den Regen unvermindert heftig trommeln. »Du wirst mich doch in einer solchen Nacht nicht auf die Straße jagen, Falco!« Er hatte recht, aber ich schuldete der Welt ein paar Schläge. Also grinste ich hämisch und sagte: »Du bist doch Soldat. Ein bißchen Regen wird dir nicht schaden …« Vielleicht hätte ich mich noch länger so amüsiert, aber just in dem Moment kam meine Mutter herein. Ihre schwarzen Knopfaugen erfaßten die Situation mit einem Blick.
»Ach, du bist wieder da«, sagte sie so gleichmütig, als hätte ich nur eben mal im Mohrrübenbeet Unkraut gejätet. Die kleine adrette, schier unermüdliche Frau trippelte an mir vorbei, küßte erst Helena und machte sich dann emsig daran, meine schläfrige Nichte aus ihrem nassen Mantel zu pellen.
»Schönes Gefühl, so sehnsüchtig erwartet zu werden«, murmelte ich.
Mama überhörte den pathetischen Unterton. »Wir hätten dich hier wahrhaftig gut gebrauchen können.«
Sie meinte nicht, um dem Hund die Zecken aus dem Fell zu holen. Ich sah, wie sie mit Helena einen Blick wechselte, eine deutliche Warnung, daß noch schlechtere Nachrichten warteten. Weil ich mich der geheimnisvollen Krise, die offenbar über den Didius-Clan hereingebrochen war, nicht gewachsen fühlte, wandte ich mich dem handfesten und nächstliegenden Problem zu. »Wir brauchen einen Unterschlupf: Das Bett vom großen Bruder ist schon belegt?«
»Ja. Ich dachte mir, daß du dazu ein Wörtchen zu sagen hast!« Ich sah, daß Censorinus anfing, nervös zu werden. Meine Mutter linste mich hoffnungsvoll an, während ich versuchte rauszukriegen, was von mir erwartet wurde. Aus irgendeinem Grund schien sie die hilflose alte Frau zu spielen, deren starker und mutiger Sohn endlich aus seinem Bau gekrochen war, um sie zu verteidigen. Das paßte überhaupt nicht zu ihr. Also war Vorsicht geboten. »Ich habe bloß eine Frage gestellt, Mama …«
»Oh, ich wußte, daß ihm das nicht passen würde!« erklärte Mama, ohne jemanden direkt anzusprechen.
Ich war zu müde, um zu widersprechen, und beschloß, dem Legionär die Stirn zu bieten. Er hielt sich wahrscheinlich für einen knallharten Burschen, aber es war leichter, mit ihm fertig zu werden, als mit einer verschlagenen Mutter mit undurchschaubaren Motiven.
Censorinus hatte kapiert, daß sein Spiel aus war. Mama machte klar, daß sie ihn nur so lange bei sich hatte wohnen lassen, wie sie darauf wartete, daß jemand kam und dagegen Einspruch erhob. Ich war wieder da: ihr Handlanger für die Drecksarbeit. Meiner Bestimmung konnte ich nicht entgehen.
»Hör mal, Freundchen, ich bin groggy und völlig durchgefroren, deswegen mache ich’s kurz: Ich bin zur schlimmsten Zeit des Jahres tausend Meilen weit gereist und hab meine Wohnung von Eindringlingen zertrümmert vorgefunden. Mein Bett steht praktisch unter Wasser wegen eines Lochs im Dach. In spätestens zehn Minuten will ich auf der Ausweichmatratze liegen, und daß du dich auf ihr breitgemacht hast – tja, Pech, nimm’s als Wink des Schicksals; die Götter sind nun mal wankelmütige Freunde …
»Soviel zur römischen Gastfreundschaft!« blaffte Censorinus mich an. »Und soviel zu Kameraden, die so tun, als wären sie echte Kumpel!«
Sein drohender Unterton beunruhigte mich, offenbar hatte er mit dem, was wir diskutierten, nichts zu tun. »Ich brauche das Gästezimmer für mich und meine Holde, aber deswegen jagen wir dich nicht in die Nacht hinaus. Oben gibt’s eine trockene Bodenkammer, die durchaus wohnlich ist …«
»Deine blöde Bodenkammer kannst du dir an den Hut stecken!« erwiderte der Legionär, und dann fügte er noch hinzu: »Festus kann mich mal – und du auch!«
»Nur zu, wenn dir dabei wohler wird«, sagte ich und ließ mir nichts anmerken. Für unsere Familie war das einzig Positive an Festus’ Tod, daß wir die schier endlose Prozession seiner schillernden Freunde nicht länger durchfüttern mußten.
Ich sah Mama dem Legionär auf die Schulter klopfen. Dann murmelte sie tröstend: »Tut mir leid, aber wenn du meinen Sohn so kränkst, kann ich dich nicht hierbehalten.«
»Beim Jupiter, Mama!« Sie war wirklich unmöglich.
Um die Dinge zu beschleunigen, half ich Censorinus beim Packen. Als er ging, warf er mir noch einen bösartigen Blick zu, aber ich war zu sehr mit den Freuden des Familienlebens beschäftigt, um mich darüber aufzuregen.
Kapitel 3
Helena und Mama machten sich mit vereinten Kräften daran, mich und meine Reisegruppe auf die vorhandenen Betten zu verteilen. Unsere Diener wurden in die Bodenkammer verfrachtet. Meine kleine Nichte Augustinilla durfte in Mutters Bett schlafen.
»Wie geht’s Victorina?« Ich mußte mich richtig zwingen, nach ihr zu fragen. Helena und ich hatten Augustinilla aufgenommen, weil ihre Mutter, meine Schwester, krank war.
»Victorina ist tot«, sagte Mutter ganz sachlich, aber ihre Stimme klang gepreßt. »Eigentlich wollte ich’s dir nicht gleich heute abend erzählen.«
»Victorina ist gestorben?« Ich konnte es kaum fassen. »Wann?«
»Im Dezember.«
»Du hättest mir schreiben können.«
»Und wozu wär das gut gewesen?«
Ich legte den Löffel auf den Tisch und nahm die Schüssel in beide Hände, ließ mich trösten von der Wärme des Geschirrs. »Das ist unglaublich …«
Falsch. Victorina hatte irgendwas Organisches gehabt, und so ein Quacksalber aus Alexandria, der darauf spezialisiert war, in der weiblichen Anatomie rumzustochern, redete ihr ein, die Sache wäre operierbar. Entweder war seine Diagnose falsch, oder er hat die Operation versaut – wahrscheinlich letzteres. So was passiert ja dauernd. Ich hatte also keinen Grund, mich über ihren Tod zu wundern.
Victorina war die Älteste von uns Kindern gewesen und hatte die übrigen sechs, die das Säuglingsalter irgendwie überstanden, furchtbar tyrannisiert. Ich war immer auf Abstand zu ihr geblieben, weil es mir zuwider war, dauernd geknufft und rumkommandiert zu werden. Sie war ungefähr dreizehn, als ich geboren wurde, und hatte schon damals einen schrecklichen Ruf: Machte immer den Jungs schöne Augen, wedelte mit einem kecken grünen Parasol und stopfte nie die aufgerissenen Seitennähte ihrer Tunika, sondern zeigte freizügig, was darunter war. Wenn sie in den Circus ging, waren die Männer, die ihren Sonnenschirm trugen, ausnahmslos widerliche Typen. Am Ende entschied sie sich für einen Stukkateur namens Mico und heiratete ihn. Von da an redete ich nicht mehr mit ihr.
Von ihren Kindern waren noch fünf am Leben. Der Jüngste war keine zwei Jahre alt. Aber bei den Überlebenschancen von Kindern war es gut möglich, daß er noch vor seinem dritten Geburtstag seiner Mutter Gesellschaft leisten würde.
Helena bekam dieses Gespräch zwischen mir und meiner Mutter nicht mit. Sie war an meiner Schulter eingeschlafen. Ich drehte mich zur Seite und schob sie behutsam in eine bequemere Lage; eine, in der ich ihr Gesicht sehen konnte. Ich brauchte diesen Anblick, um mich daran zu erinnern, daß die Parzen, wenn sie wollten, auch stabile, gute Fäden spinnen konnten. Helena war vollkommen entspannt. Niemand hat je so tief und fest geschlafen wie Helena in meinen Armen. Wenigstens einem Menschen war ich zu was nütze.
Mama deckte uns beide mit einer Decke zu. »Sie ist also immer noch bei dir?« Trotz ihrer Verachtung für meine früheren Freundinnen fand Mama, Helena Justina sei viel zu gut für mich. Die meisten Leute fanden das. Helenas Verwandte standen ganz vorn in der Schlange derer, die so dachten. Vielleicht hatten sie ja recht. Selbst in einer Stadt wie Rom mit ihrem Snobismus und ihren falschen Werten hätte Helena bestimmt was Besseres kriegen können.
»Sieht so aus.« Zärtlich fuhr ich mit dem Daumen über die zarte Mulde an Helenas rechter Schläfe. So gelöst, wie sie jetzt an mir lehnte, sah sie aus wie die Lieblichkeit und Sanftheit in Person. Ich war zwar nicht so töricht, das für ihre wahre Natur zu halten, aber es war doch ein Teil von ihr – auch wenn dieser Teil nur dann sichtbar wurde, wenn sie in meinen Armen schlief.
»Ich hab so was läuten hören, daß sie weggelaufen wär.«
»Sie ist da. Also hast du offenbar was Falsches läuten hören.«
Aber Mama war entschlossen, die ganze Geschichte zu erfahren. »Hat sie versucht, dir auszubüxen, oder hast du sie sitzenlassen, und sie mußte dir hinterherrennen?« Sie hatte einen guten Riecher dafür, wie unser Zusammenleben sich abspielte. Ich überhörte die Frage, deshalb schoß sie gleich die nächste ab: »Und? Wißt ihr inzwischen, wie’s weitergehen soll?«
Darauf wußten wir wohl beide keine Antwort. Unsere Liebe hatte ihre Höhen und Tiefen, und die Tatsache, daß Helena Justina die Tochter eines millionenschweren Senators war, ich dagegen nur ein armer Privatermittler, verbesserte unsere Chancen nicht gerade. Ich war mir nie sicher, ob wir mit jedem Tag, den ich sie halten konnte, der unausweichlichen Trennung einen Schritt näher kamen – oder ob die Zeit, die ich uns zusammenhalten konnte, irgendwann eine Trennung unmöglich machen würde.
»Ich hab gehört, Titus Caesar hätte ein Auge auf sie geworfen«, fuhr Mama erbarmungslos fort. Auch darauf antwortete ich lieber nicht. Titus könnte schon eine echte Herausforderung werden. Helena behauptete, sie hätte ihm einen Korb gegeben. Aber wie konnte ich dessen sicher sein? Womöglich freute sie sich insgeheim, daß wir wieder in Rom waren und sie den Sohn des Kaisers aufs neue becircen konnte. Sie wäre ja auch dumm, wenn sie’s nicht täte. Ich hätte mit ihr in der Provinz bleiben sollen, aber um mein Honorar für den Auftrag in Germanien zu bekommen, mußte ich nach Rom zurück und dem Kaiser Bericht erstatten. Helena war mitgekommen. Das Leben muß weitergehen, und Titus war ein Risiko, dem ich mich stellen mußte. Sollte er zum Problem werden, würde ich kämpfen. »Alle sagen, daß du sie irgendwann enttäuschen wirst«, versicherte meine Mutter vergnügt.
»Bislang hab ich’s verhindern können!«
»Deswegen brauchst du nicht gleich bissig zu werden«, kommentierte Mama.
Es war spät geworden. Mamas Wohnblock erlebte einen der seltenen Momente, in dem alle Bewohner plötzlich verstummen. In der Stille spielte sie am Docht der tönernen Öllampe herum und warf tadelnde Blicke auf die plumpe Bettszene, die auf der Keramik dargestellt war – die Lampe war einer der Scherzartikel, die mein Bruder zum Haushalt beigesteuert hatte. Als Geschenk von Festus konnte man sie natürlich jetzt nicht mehr wegwerfen. Außerdem spendete sie, trotz des Pornobildes, ein klares, helles Licht.
Der Tod einer meiner Schwestern, selbst derjenigen, die mir am wenigsten am Herzen lag, brachte die Erinnerung an meinen gefallenen Bruder zurück.
»Was wollte eigentlich dieser Legionär, Mama? Festus hatte ja einen Haufen Bekannte, aber kaum noch einer steht heutzutage plötzlich vor der Tür.«
»Ich kann den Freunden deines Bruders gegenüber nicht grob werden.« Brauchte sie ja auch nicht, solange ich das für sie erledigte. »Vielleicht hättest du ihn nicht so einfach rausschmeißen sollen, Marcus.«
Sie hatte ganz eindeutig von Anfang an gewollt, daß ich Censorinus vor die Tür setze; trotzdem wurde es mir im nachhinein angekreidet. Wenn man meine Mutter dreißig Jahre lang kannte, dann war ein solcher Widerspruch zu erwarten.
»Warum hast du ihm nicht selbst den Stuhl vor die Tür gesetzt?«
»Ich hab ja nur Angst, daß er böse auf dich ist«, murmelte Mama. »Damit komme ich schon zurecht.« Ihr Schweigen schien mir unheilschwanger. »Könnte er vielleicht einen besonderen Grund haben?« Meine Mutter blieb stumm. »Also ja!«
»Ach, es ist eigentlich nichts.« Mithin war es ernst.
»Du solltest mir lieber reinen Wein einschenken.«
»Ach … anscheinend gibt’s Ärger wegen irgendwas, was Festus getan haben soll.«
Mein Leben lang hatte ich ähnlich kryptische Worte gehört. »Jetzt geht das wieder los! Raus mit der Sprache, Mama. Ich kenne doch Festus! Und seine Katastrophen, die rieche ich quer übers Hippodrom weg.«
»Du bist müde, mein Sohn. Wir reden morgen darüber.«
Ich war so schachmatt, daß in meinem Kopf noch immer das Pferdegetrappel der Reise dröhnte, aber solange ein verhängnisverheißendes familiäres Geheimnis in der Luft hing, würde ich sowieso nicht schlafen können. Nein, erst mußte ich herausfinden, welches Problem mich zu Hause erwartete – und dann würde wahrscheinlich an Schlaf nicht mehr zu denken sein.
»Verflixt und zugenäht – natürlich bin ich müde! Und ich finde nichts so ermüdend wie Leute, die sich vor unbequemen Themen drücken. Mutter, was ist los?«
Kapitel 4
Festus lag seit drei Jahren im Grab. Die Tinte der meisten Dokumente war zwar inzwischen getrocknet, aber Schuldscheine und hoffnungsvolle Briefe von verlassenen Frauenzimmern trudelten immer noch von Zeit zu Zeit in Rom ein. Und jetzt meldete sich also das Militär; diese Truppe abzuschütteln dürfte nicht einfach werden.
»Ich glaube nicht, daß er was angestellt hat«, redete Mama sich gut zu.
»Und ob!« widersprach ich ihr. »Was immer da passiert ist, ich garantiere dir, daß unser Festus mittendrin war, kreuzfidel wie immer. Die Frage ist nur, was ich tun muß – oder wieviel ich bezahlen muß –, um uns aus dem rauszuhalten, was er diesmal angestellt hat.« Mama schaffte es, so zu schauen, als hätte ich ihren geliebten Sohn beleidigt. »Und jetzt sag mir die Wahrheit: Warum wolltest du, daß ich Censorinus rauswerfe?«
»Er fing an, lästige Fragen zu stellen.«
»Nämlich?«
»Er behauptet, daß ein paar Soldaten aus der Legion deines Bruders Geld in ein Geschäft gesteckt hätten, das Festus vorhatte. Censorinus ist nach Rom gekommen, um den Einsatz dieser Soldaten einzufordern.«
»Aber es ist kein Geld da.« Als Testamentsvollstrecker meines Bruders konnte ich das beschwören. Nach Festus’ Tod bekam ich vom Nachlaßverwalter seiner Legion einen Brief, der meine sämtlichen Vermutungen bestätigte: Nachdem seine Schulden vor Ort und das Begräbnis bezahlt waren, blieb nichts, was die Armee mir schicken konnte, außer der tröstlichen Gewißheit, daß ich ihn beerbt hätte, falls unser Held je imstande gewesen wäre, seine paar Kröten länger als zwei Tage in der Geldbörse zu behalten. Festus hatte seinen vierteljährlich ausbezahlten Sold immer schon im voraus verpulvert. In Judäa hatte er absolut nichts hinterlassen. Und auch in Rom konnte ich nichts finden, trotz der äußerst komplexen und verwickelten Geschäfte, die er hier laufen hatte. Festus’ Lebensstil basierte auf seinem wirklich fulminanten Talent zum Bluffen. Ich bildete mir ein, ihn so gut zu kennen wie kein anderer, aber selbst mich hatte er täuschen können, als er es darauf anlegte.
Ich seufzte. »Jetzt erzähl mir mal die ganze Geschichte. Was war das für ein Geschäft?«
»Irgendein komplizierter Plan, der viel, viel Geld einbringen sollte.« Das sah meinem Bruder ähnlich! Ständig glaubte er, irgendwo auf eine Goldader gestoßen zu sein. Und genauso ähnlich sah es ihm, jeden armen Teufel, der einmal sein Zelt geteilt hatte, in seine Glücksritterpläne mit einzubeziehen. Festus konnte selbst einem entschlossenen Geizhals, den er erst am Morgen kennengelernt hatte, bis zum Abend sein Geld abschwatzen. Seine vertrauensseligen Kameraden hatten gegen ihn keine Chance.
»Und was war das für ein Plan?«
»Weiß ich nicht genau.« Mama schaute verwirrt. Ich ging ihr nicht auf den Leim. Meine Mutter hatte Fakten stets so fest im Griff wie ein Oktopus seine künftige Mahlzeit. Sie wußte zweifellos ganz genau, was Festus vorgeworfen wurde; sie zog es nur vor, mich die Details selbst rausfinden zu lassen. Das bedeutete, die Geschichte würde mich wütend machen. Und Mama wollte nicht dabeisein, wenn ich explodierte.
Wir hatten sehr leise gesprochen, aber in meiner Erregung hatte ich mich wohl irgendwie verkrampft; jedenfalls bewegte sich Helena und fuhr aus dem Schlaf hoch. »Marcus, was ist passiert?« fragte sie, instinktiv in Alarmbereitschaft.
Verlegen suchte ich nach einer Ausrede. »Familienprobleme. Mach dir keine Sorgen; schlaf weiter.« Jetzt war sie hellwach.
»Geht’s um den Soldaten?« folgerte Helena messerscharf. »Ich hab mich schon gewundert, daß du ihn so einfach vor die Tür gesetzt hast. Ist er vielleicht ein Schwindler?«
Ich antwortete nicht. Die leichtsinnigen Abenteuer meines Bruders wollte ich lieber für mich behalten. Aber Mama, die sich eben noch so davor gedrückt hatte, mir die Geschichte zu erzählen, war sofort bereit, sie Helena anzuvertrauen. »Nein, nein, der Soldat ist schon echt. Aber wir haben ein bißchen Ärger mit der Armee. Ich hab ihn hier wohnen lassen, weil es zuerst so aussah, als wäre er einfach ein Freund meines ältesten Sohnes. Aber kaum, daß er die Stiefel unter meinen Tisch gestreckt hatte, fing er an, Ärger zu machen.«
»Weswegen, Junilla Tacita?« fragte Helena indigniert und saß vor Empörung kerzengerade. Sie redete meine Mutter oft so förmlich an. Seltsamerweise schuf diese strenge Etikette eine größere Vertrautheit zwischen ihnen, als Mama sie meinen früheren Freundinnen, die fast alle unbeleckt von gesitteter Rhetorik waren, je gestattet hätte.
»Angeblich gibt’s da Geldprobleme wegen irgendwas, worin der arme Festus verwickelt war«, erklärte meine Mutter Helena gerade. »Aber Marcus wird das schon für uns regeln.«
Mir blieb die Luft weg. »Ich kann mich nicht entsinnen, daß ich das gesagt hätte.«
»Nein. Du bist bestimmt sehr beschäftigt.« Geschickt änderte meine Mutter ihre Taktik. »Meinst du, daß viel Arbeit auf dich wartet?«
Ich rechnete nicht gerade mit einem Ansturm von Klienten. Nach sechsmonatiger Abwesenheit hatte ich sicher jeden Bonus verspielt. Die Leute haben’s immer so furchtbar eilig mit ihren dümmlichen Vorhaben, daß meine Konkurrenten mir in der Zwischenzeit gewiß alle lukrativen Aufträge weggeschnappt hatten – als da wären: Geschäftsüberwachung, das Beschaffen von Belastungsmaterial und triftigen Scheidungsgründen. Klienten sind ein heikles Völkchen, das es nicht fertigbringt, sich in Geduld zu üben, wenn der beste Detektiv von Rom zufällig gerade für unbestimmte Zeit in Germanien im Einsatz ist. Was konnte ich dafür, wenn der Kaiser oben auf dem Palatin erwartete, daß man seinen Angelegenheiten den Vorrang einräumte? »Ich glaube nicht, daß ich mich gleich überarbeiten werde«, räumte ich ein, weil meine Frauensleute mir sofort auf die Schliche kämen, wenn ich versuchen würde, sie zu beschummeln.
»Aber natürlich nicht!« rief Helena. Mir rutschte das Herz in die Hose. Helena hatte ja keine Ahnung, daß sie den Karren geradewegs in eine Sackgasse steuerte. Sie hatte Festus nicht gekannt; nicht einmal im Traum konnte sie sich vorstellen, wie seine Geschäfte meistens ausgegangen waren.
»Wer sonst könnte uns helfen?« fragte Mama eindringlich. »Ach, Marcus, ich hatte gehofft, daß du den Namen deines armen leiblichen Bruders reinwaschen willst …«
Wie ich es vorausgesehen hatte, verwandelte sich der Auftrag, den ich nicht hatte annehmen wollen, in einen, den ich nicht ablehnen konnte.
Ich muß wohl irgend etwas gebrummt haben, das wie Zustimmung klang, denn ehe ich’s mich versah, erklärte Mama, sie erwarte nicht, daß ich meine kostbare Zeit umsonst opfern würde. Gleichzeitig gab Helena mir mit Zeichen zu verstehen, ich könne meiner eigenen Mutter unter keinen Umständen eine Spesenrechnung schicken. Ich fühlte mich wie eine neue Stoffbahn, die eben zum Glätten durchgewalkt wird.
Meine Sorge war nicht das Honorar. Leider wußte ich schon im voraus, daß ich diesen Fall nicht gewinnen konnte.
»Also gut«, knurrte ich. »Wenn ihr mich fragt, dann hat der verschwundene Logiergast bloß mit einer flüchtigen Bekanntschaft angegeben, um an eine freie Unterkunft zu kommen. Und seine Anspielung auf irgendwelche krummen Geschäfte war bloß ein Druckmittel, Mama.« Meine Mutter war keine Frau, die sich unter Druck setzen ließ. Ich gähnte ostentativ. »Im übrigen werde ich mir kein Bein ausreißen wegen einer Sache, die schon so lange zurückliegt, aber wenn’s euch beide glücklich macht, dann rede ich morgen früh noch mal mit Censorinus.« Ich wußte, wo er zu finden war; ich hatte ihm gesagt, daß im Flora, der Caupona unseres Viertels, manchmal Zimmer vermietet wurden. Und in einer Nacht wie dieser war er bestimmt nicht weiter als bis dahin gewandert.
Meine Mutter strich mir übers Haar, und Helena lächelte. Keine ihrer schamlosen Schmeicheleien riß mich aus meiner pessimistischen Stimmung. Ich wußte, schon bevor ich auch nur angefangen hatte, daß Festus, der mir mein Leben lang Ärger eingebrockt hatte, jetzt noch aus dem Grab die allerschlimmsten Probleme machen würde.
»Mama, ich muß dich mal was fragen …« Ihre Miene blieb unverändert, obwohl sie bestimmt wußte, was kam. »Glaubst du, daß Festus getan hat, was seine Freunde ihm vorwerfen?«
»Wie kannst du es wagen, mir so eine Frage zu stellen?« rief sie beleidigt. Bei jeder anderen Zeugin in jeder anderen Vernehmung hätte dieser Ton mich davon überzeugt, daß hier eine Frau die Gekränkte spielte, weil sie ihren Sohn decken wollte.
»Dann ist’s ja gut«, nickte ich treu.
Kapitel 5
Mein Bruder Festus konnte jede x-beliebige Taverne in jeder Provinz des Reiches betreten, und sofort erhob sich irgendein Individuum mit dreckiger Tunika von einer Bank und begrüßte ihn mit offenen Armen als alten und geachteten Freund. Fragen Sie mich nicht, wie er das gemacht hat. Ich hätte den Trick selbst gut brauchen können, aber man muß das Talent haben, eine solche Herzlichkeit auszustrahlen. Der Umstand, daß Festus besagtem Individuum seit der letzten Begegnung noch einen Hunderter in der jeweiligen Landeswährung schuldig war, dämpfte die Wiedersehensfreude nicht im geringsten. Und wenn unser Glückspilz dann ins Hinterzimmer vordrang, wo die billigen Huren den Männern Gesellschaft leisteten, dann gab es auch dort Jubelgekreisch, und lauter Mädels, die eigentlich hätten klüger sein müssen, stürzten ihm hingerissen entgegen. Als ich das Flora betrat, wo ich seit fast zehn Jahren Stammgast war, nahm nicht einmal die Katze Notiz von mir.
Neben der Caupona Flora wirkte jede durchschnittliche Imbißstube wie ein schicker, hygienisch einwandfreier Laden. Die Kneipe lag an einer Ecke, wo eine schmuddelige Gasse, die vom Aventin herunterführte, auf einen Feldweg traf, der zu den Kais ging. Eingerichtet war das Lokal, wie üblich, mit zwei Theken im rechten Winkel zueinander, an die sich die Anwohner der beiden kümmerlichen Straßen beschaulich lehnen und darauf warten konnten, daß man sie vergiftete. Die Tresen waren aus weißem und grauem Stein, den man für Marmor halten mochte, wenn man gerade intensiv mit den nächsten Wahlen beschäftigt und obendrein fast blind war. Jede Theke hatte drei kreisrunde Löcher für die Kochkessel. Im Flora waren diese Löcher meist leer, vielleicht aus Rücksicht auf die Volksgesundheit. Was die vollen Kessel enthielten, war noch widerlicher als die übliche braune Pampe mit merkwürdigen Brocken darin, die den Passanten in irgendeinem vergammelten Stehimbiß vorgesetzt wird. Die kalten Speisen im Flora waren eklig lauwarm, die warmen Gerichte dagegen gefährlich kalt. Es ging das Gerücht, daß einmal ein Fischer noch an der Theke gestorben sei, nachdem er eine Portion Erbsenbrei gegessen hatte. Mein Bruder behauptete, um einen langen Prozeß mit dessen Erben zu vermeiden, hätte der Wirt den Mann flugs tranchiert und als würzige Heilbuttklößchen serviert. Festus hatte immer solche Geschichten auf Lager. Aber dem Zustand der Küche hinter der Caupona nach zu urteilen, könnte diese durchaus wahr sein.
Die beiden Tresen begrenzten einen engen Raum, in dem wirklich abgehärtete Stammgäste sich hinhocken und vom Kellner Nasenstüber einfangen konnten, während der ellbogenschwingend seiner Arbeit nachging. In dem Karree standen zwei uralte Tische; einer hatte Bänke ringsum, der andere einen Satz Klappstühle. Vor der Kneipe versperrte ein halbes Faß die Straße; auf ihm saß ständig ein schwachbrüstiger Bettler. Selbst heute war er da, obwohl die Nachhut des Gewittersturms noch immer für Schauer sorgte. Niemand gab ihm je Almosen, weil der Kellner ihm alles klaute.
Jeden Blickkontakt vermeidend, ging ich an dem Bettler vorbei. Irgendwas an ihm kam mir immer vage bekannt vor und deprimierte mich jedesmal. Vielleicht schwante mir ja, daß in meinem Beruf ein falscher Schritt genügte, und ich würde neben ihm auf seinem Faß enden.
Drinnen setzte ich mich auf einen Schemel und stützte mich, weil der so schrecklich wackelte, auf den Tisch. Die Bedienung würde auf sich warten lassen. Ich schüttelte mir den Regen von heute aus den Haaren und musterte die vertraute Szenerie: das Gestell mit den Amphoren, von Spinnweben verschleiert; das Regal mit den braunen Bechern und Krügen; ein überraschend hübsches, griechisch wirkendes Gefäß, das mit einem Oktopus verziert war, und die an die Wand gepinselte Weinliste – ein sinnloses Unterfangen, denn trotz der beeindruckenden Karte, die vorgab, sämtliche Lagen vom einfachen Hauswein bis hin zum Falerner anzubieten, gab es im Flora ständig nur ein und denselben zweifelhaften Jahrgang, und das, woraus der gekeltert wurde, war höchstens um zwei Ecken mit Trauben verwandt.
Kein Mensch wußte genau, ob es je eine Flora gegeben hatte. Vielleicht war sie vermißt oder tot, aber diesen Fall hätte ich nicht freiwillig übernommen. Gerüchten zufolge soll sie eine imposante Erscheinung gewesen sein. Meiner Meinung nach war sie entweder ein Mythos oder eine Maus. Jedenfalls hatte sie sich nie blicken lassen. Vielleicht wußte sie ja, was für Speisen in ihrer schlampigen Caupona serviert wurden. Oder wie viele Gäste sich gern wegen der überhöhten Rechnung beschwert hätten.
Der Kellner hieß Epimandos. Sollte er seine Chefin je persönlich kennengelernt haben, so behielt er das jedenfalls für sich.
Epimandos war vermutlich ein entlaufener Sklave. Wenn das stimmte, dann versteckte er sich hier seit Jahren mit Erfolg. Trotzdem sah er sich dauernd verstohlen um, wie einer auf der Flucht. Sein langgezogenes Gesicht saß auf den Schultern wie eine Maske. Er war stärker, als er aussah, weil er dauernd schwere Töpfe schleppen mußte. Seine Tunika war mit Spuren von Eintopf bekleckert, und unter seinen Fingernägeln lauerte eine untilgbare Knoblauchfahne.
Die Katze, die mich ignoriert hatte, war ein Kater und hieß Zwirn. Im Gegensatz zu dem Kellner war er eigentlich recht stämmig, hatte einen buschigen gestreiften Schwanz und einen heimtückischen Blick. Da er aussah wie ein Tier, das freundschaftliche Kontakte sucht, wollte ich ihm einen Fußtritt verpassen. Zwirn duckte sich verächtlich; mein Fuß traf Epimandos, der aber nicht dagegen protestierte, sondern bloß fragte: »Das Übliche?« Er sagte das so, als wäre ich erst seit letzten Mittwoch weggewesen und nicht so lange, daß ich selbst nicht mehr wußte, was »das Übliche« war.
Eine Schüssel mit merkwürdigem Eintopf und ein sehr kleiner Krug Wein offenbar. Kein Wunder, daß mein Hirn das verdrängt hatte.
»Schmeckt’s?« fragte Epimandos. Es hieß, er sei zu nichts zu gebrauchen, aber mir gegenüber war er stets sehr eifrig gewesen. Vielleicht hatte das was mit Festus zu tun. Der hatte nämlich ständig im Flora rumgehangen, und der Kellner erinnerte sich seiner immer noch mit sichtlicher Freude.
»Sieht aus wie immer!« Ich brach ein Stück Brot ab und tunkte es in die Schüssel. Eine Woge von Schaum schwappte mir entgegen. Die Fleischschicht darunter war viel zu hellrot; obenauf schwamm ein halber Zoll einer durchsichtigen Flüssigkeit, gekrönt von ein paar trägen Tropfen Öl, zwischen denen zwei Zwiebelringe und einige winzige dunkelgrüne Salatfetzen herumruderten wie Käfer in einer Wassertonne. Ich nahm einen Bissen und verklebte mir prompt den Gaumen mit Fett. Um den Schock zu überspielen, fragte ich: »Wohnt hier seit gestern ein militärischer Kläffer namens Censorinus?« Epimandos antwortete mir nur mit seinem gewohnt vagen Blick. »Sag ihm, ich würde gern mit ihm reden, ja?«
Epimandos wanderte zurück zu seinen Töpfen und fing an, mit einer verbogenen Schöpfkelle darin herumzurühren. Die trübe Suppe schwappte hoch wie ein Sumpf, der den Kellner kopfüber verschlucken wollte. Ein übermäßig strenger Geruch von Krabbenfleisch durchzog die Caupona. Epimandos machte keine Anstalten, meine Botschaft weiterzuleiten, aber ich unterdrückte den Wunsch, deswegen zu meckern. Das Flora war eine Kneipe, wo alles seine Zeit brauchte. Die Gäste hatten es nicht eilig; ein paar hätten zwar im Prinzip etwas zu tun gehabt, wußten sich aber zielstrebig zu drücken. Die meisten hatten kein Ziel und konnten sich kaum mehr erinnern, warum sie ausgerechnet diese Kneipe betreten hatten.
Um den Geschmack des Essens loszuwerden, nahm ich einen Schluck Wein. Wonach immer der schmeckte – Wein war es jedenfalls nicht. Aber immerhin brachte mich das Gesöff auf andere Gedanken.
Eine geschlagene halbe Stunde grübelte ich darüber nach, wie kurz das Leben und wie scheußlich der Wein war. Epimandos machte keinen einzigen erkennbaren Versuch, Censorinus zu benachrichtigen, und bald hatte er mit den Mittagsgästen genug zu tun, die von der Straße hereinspaziert kamen und sich an die Tresen lehnten. Als ich eben meinen zweiten Krug Wein riskierte, stand der Soldat plötzlich neben mir. Er mußte aus dem Hinterzimmer gekommen sein, wo hinter der Kochbank eine Stiege zu den winzigen Kammern hinaufführte, die das Flora gelegentlich an Leute vermietete, denen kein besserer Schlafplatz einfiel.
»Du willst also Ärger, wie?« feixte er hämisch.
»Eigentlich will ich mit dir reden«, antwortete ich, so gut es ging, mit vollem Mund. Der Leckerbissen, an dem ich gerade knabberte, war zu sehnig, als daß man ihn rasch hätte kauen können; ich hatte vielmehr den Eindruck, für den Rest meines Lebens an diesem Knorpel rumnagen zu müssen. Endlich hatte ich ihn aber doch in einen geschmacklosen Klumpen verwandelt, den ich mit mehr Erleichterung als Anstand aus dem Mund nahm und auf den Schüsselrand legte; natürlich fiel er prompt hinein.
»Setz dich, Censorinus. Du stehst mir im Licht.« Der Legionär war so gnädig, sich auf meine Tischkante zu pflanzen. Ich behielt meinen zivilisierten Ton bei. »Da geistern so häßliche Gerüchte herum, daß du schlecht über meinen berühmten Bruder redest. Willst du über dein Problem reden, oder soll ich dir gleich die Zähne einschlagen?«
»Ich hab kein Problem«, spottete er. »Ich bin hier, um Schulden einzutreiben. Und glaub mir, ich kriege mein Geld!«
»Das klingt ja wie eine Drohung.« Ich ließ den Eintopf stehen, hielt mich aber weiter an den Wein, ohne dem Legionär was davon anzubieten.
»Die Fünfzehnte hat’s nicht nötig zu drohen«, prahlte er.
»Nicht, wenn deine Forderungen legal sind«, stimmte ich zu, jetzt meinerseits in aggressiver Tonlage. »Wenn die Legion Ärger hat und wenn die Sache auch meinen Bruder betrifft, dann bin ich bereit, dir zuzuhören.«
»Zuhören allein reicht nicht!«
»Erst sagst du mir klipp und klar, was los ist – sonst können wir beide die Angelegenheit vergessen.«
Epimandos und Zwirn spitzten beide die Ohren. Der Kellner stand über seinen Töpfen und bohrte in der Nase, während er uns ganz unverhohlen anstarrte; der Kater dagegen hatte den Anstand, so zu tun, als lecke er an einem Brötchen, das unter den Tisch gefallen war. Das Flora war nicht der Ort, wo man seine Flucht mit einer reichen Erbin plante oder ein Fläschchen Gift kaufte, um damit seinen Geschäftspartner aus dem Weg zu räumen. Nein, diese Caupona hatte das neugierigste Personal von ganz Rom.
»Ein paar von uns, die Festus gut kannten«, erklärte Censorinus hochtrabend, »haben zusammengelegt und mit ihm ein gewisses Projekt finanziert.«
Es gelang mir, nicht seufzend die Augen zu schließen; das kam mir so entsetzlich bekannt vor. »Ach, ja?«
»Wenn ich’s dir doch sage! Wir wollen den Gewinn – oder unseren Einsatz zurück. Und zwar sofort!«
Ich ignorierte die Drohung. »Also bis jetzt bin ich weder interessiert noch beeindruckt. Erstens weiß jeder, der Festus kannte, daß er nicht unter jedem Bett, in dem er schlief, reich gefüllte Sparkrüge hat stehenlassen. Wenn ein Krug da war, dann hat er den als Nachttopf benutzt und damit basta! Ich war sein Testamentsvollstrecker – seine Hinterlassenschaft war gleich Null. Und zweitens, selbst wenn dieses famose Geschäft, von dem du redest, legal war, möchte ich doch erst mal einen Schuldschein sehen. Festus war in den meisten Dingen etwas wolkig, aber ich habe all seine Geschäftsunterlagen, und die sind tadellos in Ordnung.« Das galt zumindest für den Stapel vollgekritzelter beinerner Notizblocks, die ich bei meiner Mutter gefunden hatte. Aber ich war seit drei Jahren darauf gefaßt, in irgendeinem Versteck andere, fragwürdigere Bilanzen zu finden.
Censorinus maß mich mit kaltem Blick. Er wirkte sehr verkrampft. »Dein Ton gefällt mir nicht, Falco.«
»Und mir mißfällt dein Benehmen.«
»Stell dich lieber drauf ein, daß du zahlen mußt.«
»Dann komm lieber schleunigst mit ’n paar Erklärungen rüber.« Irgendwas stimmte nicht. Der Soldat schien merkwürdig abgeneigt, die Fakten auf den Tisch zu legen – obwohl das doch seine einzige Chance war, mir Bares abzuluchsen. Ich sah seine Blicke blitzschnell und aufgeregter als nötig hin und her huschen.
»Es ist mir ernst, Falco – wir erwarten, daß du für deinen Bruder blechst!«
»Olympus!« Meine Geduld war am Ende. »Du hast mir weder Zeit noch Ort genannt, weder das Projekt noch die Bedingungen oder das Resultat, geschweige denn den Betrag, um den es geht. Alles, was ich zu hören kriege, sind Lamento und Gezeter!«
Epimandos kam näher und tat so, als müsse er Tische abwischen und mit dem Zipfel eines verschimmelten Lumpens abgekaute Olivenkerne durch die Kneipe schnipsen.
»Verzieh dich, du Knoblauchzehe!« brüllte Censorinus ihn an. Er schien den Kellner jetzt zum ersten Mal zu bemerken. Epimandos bekam einen seiner nervösen Anfälle und machte hastig einen Satz zurück an den Tresen. Hinter ihm reckten die anderen Gäste die Hälse und spähten neugierig zu uns rüber.
Ohne Epimandos aus den Augen zu lassen, hockte Censorinus sich auf einen Schemel neben mir. Als er jetzt sprach, war seine Stimme nur noch ein gedämpftes, heiseres Krächzen. »Festus hatte ein Schiff gechartert.«
»Wo?« Ich versuchte, nicht erschrocken zu klingen. Das war eine neue Nummer im Katalog der Unternehmungen meines Bruders, und ich wollte alles darüber herausbekommen, ehe noch mehr Gläubiger auftauchten.
»Caesarea.«
»Und er hat ein paar von euch beteiligt?«
»Wir waren ein Syndikat.« Das große Wort beeindruckte ihn mehr als mich.
»Und was habt ihr transportiert?«
»Statuen.«
»Das paßt zu ihm!« Unsere Familie väterlicherseits war im Kunsthandel. »Kam die Ladung aus Judäa?«
»Nein, aus Griechenland.« Auch das paßte. Rom war ganz wild auf hellenische Plastiken.
»Und? Was ist passiert? Und warum kommst du erst drei Jahre nach seinem Tod, um dein Geld einzutreiben?«
»Im Osten war ein verdammter Krieg im Gange, Falco – hast du das etwa nicht gewußt?«
»Doch, doch«, erwiderte ich finster und dachte dabei an Festus. Censorinus riß sich zusammen. »Dein Bruder schien zu wissen, was er tat. Wir haben alle zusammengelegt, um die Ware einzukaufen, und er hat uns hohe Gewinne versprochen.«
»Dann ist das Schiff entweder gesunken – was mir für ihn und euch leid täte, aber woran ich auch nichts ändern könnte –, oder aber ihr hättet euer Geld längst kriegen müssen. Festus war ein Draufgänger, aber ich habe nie erlebt, daß er jemanden übers Ohr gehauen hätte.«
Der Soldat starrte auf den Tisch. »Festus hat gesagt, das Schiff wäre gesunken.«
»So ein Pech! Aber warum im Namen der Götter kommst du dann her und belästigst mich?«
Er glaubte nicht, daß das Schiff wirklich gesunken war, das war ganz offensichtlich. Aber seine Loyalität Festus gegenüber war immer noch so groß, daß er es nicht offen aussprach. »Festus sagte damals, wir sollten uns keine Sorgen machen. Er würde dafür sorgen, daß wir keinen Schaden davon hätten. Er wollte uns das Geld zurückgeben.«
»Aber das konnte er doch gar nicht. Wenn die Ladung verloren war …«
»Das hat er aber gesagt!«
»Ist ja gut! Wenn er’s gesagt hat, dann hat er’s auch so gemeint. Daß er euch Entschädigung angeboten hat, wundert mich nicht. Schließlich wart ihr seine Kameraden. Er hätte euch bestimmt nie im Stich gelassen.«
»Nein, das wär ihm auch schlecht bekommen!« Censorinus konnte einfach nicht den Mund halten, selbst dann nicht, wenn ich seiner Meinung war.
»Aber egal, mit welchem Plan er den Verlust wieder wettmachen wollte. Ich weiß nichts von neuen Geschäften und kann jetzt, drei Jahre nach seinem Tod, auch gar nichts mehr tun. Erstaunlich, daß du dir überhaupt Hoffnungen gemacht hast.«
»Er hatte einen Partner«, grollte Censorinus.





























