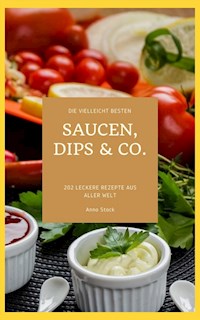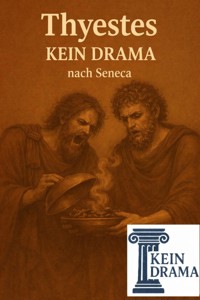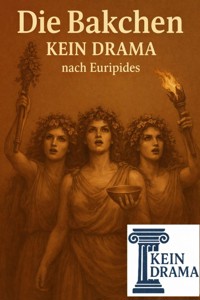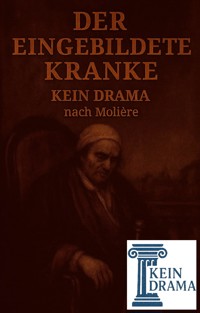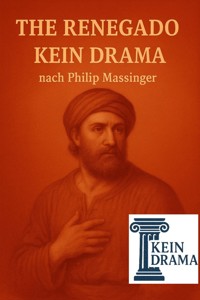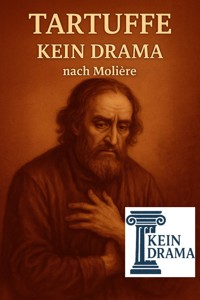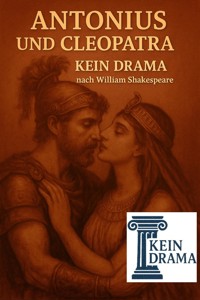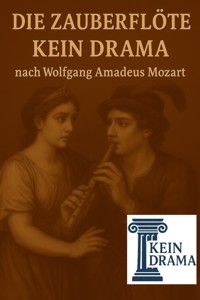6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kein Drama
- Sprache: Deutsch
Er war Roms größter Held. Bis die Stadt ihn zum Feind erklärte.Caius Marcius Coriolanus kehrt siegreich aus der Schlacht zurück, den Namen der eroberten Stadt als Ehrenzeichen tragend. Rom jubelt seinem Helden zu – doch hinter der Bewunderung lauert Misstrauen. Der stolze Kriegsheld verachtet das gemeine Volk, und das Volk fürchtet seine Verachtung.Als Coriolanus für das Konsulat kandidiert, prallen zwei unvereinbare Welten aufeinander: sein kompromissloser Stolz gegen die Forderungen der Volksvertreter. Getrieben von seiner dominanten Mutter Volumnia und unfähig zu politischen Zugeständnissen, steuert er auf eine Katastrophe zu. Die Tribunen hetzen das Volk auf, und bald steht nicht mehr das Konsulat auf dem Spiel, sondern Coriolanus' Leben selbst.Verbannt aus der Stadt, für die er geblutet hat, fasst der gefallene Held einen verzweifelten Entschluss: Er verbündet sich mit Roms Erzfeind, den Volskern, und führt eine Armee gegen seine Heimat. Doch als seine Mutter vor ihm kniet und um Gnade fleht, muss Coriolanus die unmöglichste aller Entscheidungen treffen.Eine zeitlose Geschichte über Stolz und Fall, über die Macht mütterlicher Liebe und die tragischen Folgen kompromissloser Prinzipien. Nach Shakespeares eindringlicher Tragödie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Anno Stock
Coriolanus - Kein Drama nach William Shakespeare
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Table of Contents
CORIOLANUS – Ein Roman nach William Shakespeare
Kapitel 1: Hunger in Rom
Kapitel 2: Die Mutter des Helden
Kapitel 3: Marsch nach Corioles
Kapitel 4: Sturm auf die Tore
Kapitel 5: Blut und Ehre
Kapitel 6: Wiedersehen mit Volumnia, Virgilia und seinem Sohn
Kapitel 7: Mütterlicher Stolz
Kapitel 8: Die Stimmen des Volkes
Kapitel 9: Umkehr
Kapitel 10: Entfesselte Wut
Kapitel 11: Abschied von Rom
Kapitel 12: Bündnis der Feinde
Kapitel 13: Planung des Feldzugs gegen Rom
Kapitel 14: Die Knie der Mutter
Kapitel 15: Rom in Angst
Kapitel 16: Rückkehr nach Antium
Kapitel 17: Nachricht nach Rom
Kapitel 18: Ehrenvolle Bestattung
Kapitel 19: Trauer bei Volumnia, Virgilia und dem Sohn
Kapitel 20: Das Erbe
Epilog
Nachwort
Impressum neobooks
Table of Contents
CORIOLANUS – Ein Roman nach William Shakespeare
Anno Stock
Kapitel 1: Hunger in Rom
Der Gestank des Hungers lag über Rom.
Es war kein sichtbarer Dunst, der durch die engen Gassen der Subura kroch, keine Wolke, die sich über die stolzen Hügel der Stadt legte. Und doch spürte jeder ihn – in den eingefallenen Wangen der Kinder, die nicht mehr spielten, in den hohlen Blicken der Frauen an den Brunnen, im gefährlichen Schweigen der Männer, die sich in den Schatten der Insulae zusammenrotteten.
Die Kornkammern waren fast leer. Die Ernte war erneut gescheitert, und was die Bauern des Umlands noch in die Stadt brachten, reichte kaum, um die Patrizier zu versorgen – jene reichen Adeligen, die in ihren luftigen Atriumhäusern auf dem Palatin residierten und deren Vorratskammern, so munkelte man, noch immer von Weizen, Gerste und Öl überquollen.
An diesem schwülen Junimorgen, als die Sonne gerade erst über den Esquilin kroch und die Travertin-Fassaden in goldenes Licht tauchte, braute sich zusammen, was schon lange gegärt hatte.
Auf dem Forum Romanum, jenem heiligen Herzen der Republik, wo sonst Senatoren in ihren gebleichten Togen würdevoll zur Kurie schritten und Händler ihre Waren feilboten, sammelte sich eine Menschenmenge. Nicht die übliche Schar von Müßiggängern und Klatschbasen, sondern Hunderte von Plebejern – einfache Bürger, Handwerker, Tagelöhner – die sich zu einem tosenden Strom vereinigten.
Sie trugen Knüppel, Äxte, Heugabeln. Ihre Rufe hallten von den Tempelsäulen wider.
„Brot! Wir wollen Brot!"
„Die Patrizier horten das Korn!"
„Lasst uns die Speicher öffnen!"
In der vordersten Reihe stand ein Mann namens Junius, ein Zimmermann mit breiten Schultern und einer Narbe, die sich über seine rechte Wange zog wie ein Blitz. Seine Stimme übertönte die anderen: „Wir verhungern, während sie sich mästen! Ist das die römische Gerechtigkeit? Sind das die Gesetze, für die unsere Väter gekämpft haben?"
Ein zustimmendes Brüllen erhob sich. Die Menge drängte vorwärts, ein lebendiger Organismus aus Wut und Verzweiflung.
„Zu den Kornhäusern!" rief eine Frau, deren mageres Kind sich an ihren zerlumpten Rock klammerte.
„Verbrennt die Häuser der Reichen!"
„Tod den Wucherern!"
Doch dann erhob sich eine andere Stimme, ruhiger, aber mit der Autorität des Alters. „Mitbürger! Römer! Hört mich an!"
Die Menge stockte. Durch die Reihen der Aufständischen bahnte sich ein älterer Mann seinen Weg. Er trug die Toga eines Senators, aber seine Haltung war nicht hochmütig, sondern beinahe väterlich. Sein Gesicht war von tiefen Falten durchzogen, die von einem langen Leben voller Sorgen und Weisheit zeugten. Sein Name war Menenius Agrippa, ein Patrizier, der beim Volk dennoch Gehör fand, weil er nie vergessen hatte, dass auch die Reichen einst einfache Bürger gewesen waren.
„Menenius!" rief jemand. „Was willst du uns erzählen? Mehr leere Versprechungen?"
Der alte Senator hob beschwichtigend die Hände. „Nein, meine Freunde. Ich komme nicht mit Versprechungen, sondern mit einer Geschichte. Ihr kennt mich – ich habe euch nie belogen. Hört mich an, nur einen Augenblick."
Die Menge murmelte, aber die Waffen senkten sich zumindest ein wenig. Menenius hatte diesen Moment oft genug erlebt – den Punkt, an dem ein Funke entweder ein loderndes Feuer entfachen oder verlöschen konnte. Er musste klug wählen.
„Es war einmal", begann er mit der Stimme eines Geschichtenerzählers, „da gab es einen großen Streit im menschlichen Körper. Die Hände, die Füße, die Zunge, die Augen – alle Glieder waren empört."
„Eine Fabel?" höhnte Junius. „Du willst uns mit Kindermärchen abspeisen?"
„Hört zu!" Menenius' Stimme wurde fester. „Die Glieder waren empört über den Magen. ‚Er sitzt nur da', sagten sie, ‚in der Mitte des Körpers, empfängt alle Nahrung, die wir ihm beschaffen, und tut selbst nichts! Wir arbeiten und schwitzen, wir greifen und gehen, wir sehen und sprechen – und er? Er verschlingt alles und gibt nichts zurück!'"
Einige in der Menge begannen zu lauschen, gefangen von der Kraft seiner Worte.
„Also beschlossen die Glieder zu rebellieren. ‚Wir werden ihm nichts mehr geben!' sagten sie. Die Hände weigerten sich, Speise zum Mund zu bringen. Die Zähne weigerten sich zu kauen. Die Füße wollten nicht mehr zum Markt gehen." Menenius machte eine Pause, ließ den Moment wirken. „Und was geschah?"
„Was geschah?" echote eine Stimme aus der Menge, fast gegen ihren Willen neugierig.
„Der ganze Körper begann zu schwächen", sagte Menenius leise. „Die Hände wurden kraftlos. Die Füße wankten. Die Augen trübten sich. Und die Glieder erkannten zu spät, dass der Magen, den sie für einen faulen Schmarotzer gehalten hatten, in Wahrheit die Nahrung verarbeitet und an alle Teile des Körpers verteilt hatte. Ohne ihn konnten auch sie nicht leben."
Schweigen legte sich über das Forum. Irgendwo krähte ein Hahn.
„Versteht ihr?" Menenius' Blick wanderte über die Gesichter. „Rom ist wie dieser Körper. Der Senat, die Patrizier – ja, wir empfangen vieles. Aber wir verteilen auch: Gesetze, Ordnung, Schutz vor Feinden. Und das Volk, ihr – ihr seid die starken Glieder, ohne die nichts geschieht. Wenn wir gegeneinander kämpfen, zerstören wir den ganzen Körper. Rom selbst."
„Schöne Worte!" Junius spuckte vor Menenius' Füße aus, wenn auch nicht mehr mit der gleichen Überzeugung wie zuvor. „Aber Worte füllen keine Mägen!"
„Das stimmt", räumte Menenius ein. „Aber Gewalt und Plünderung werden es auch nicht tun. Sie werden nur–"
Er wurde unterbrochen. Ein neuer Lärm erhob sich am Rande der Menge, das Klirren von Metall, der Rhythmus marschierender Füße. Die Plebejer drehten sich um, wichen auseinander. Durch die Reihen schritt eine Gruppe von Männern in militärischer Haltung, angeführt von einer Gestalt, die selbst in der einfachen Tunika eines Offiziers Autorität ausstrahlte.
Caius Marcius.
Er war ein Mann in den besten Jahren, Mitte dreißig, mit einem Körper, der von unzähligen Schlachten gehärtet worden war. Seine Statur war kräftig, aber nicht plump – jede Bewegung sprach von jahrelangem Waffengang. Das dunkle Haar war kurz geschoren, wie es sich für einen Soldaten gehörte, und sein Gesicht hätte als hübsch gelten können, wäre da nicht dieser Ausdruck gewesen – eine Mischung aus Verachtung und kaum verhülltem Zorn.
Die Narben waren das Erste, was man an ihm bemerkte. Eine verlief von seiner linken Schläfe bis zum Kiefer. Eine andere zog sich über seinen rechten Unterarm, sichtbar, wo die Tunika endete. Und es gab weitere, so hieß es, unter dem Stoff verborgen – Dutzende, Hunderte vielleicht. Jede einzelne ein Zeugnis seiner Tapferkeit.
Oder seines Wahnsinns. Die Meinungen darüber gingen auseinander.
„Welch ein Anblick", sagte Marcius, und seine Stimme triefte vor Sarkasmus. „Das edle Volk von Rom, versammelt in all seiner Würde. Mit Heugabeln und Mistgabeln bewaffnet, um... was genau? Die Republik zu retten? Oder euren eigenen Bauch zu füllen?"
Die Menge zischte. Einige machten einen Schritt auf ihn zu, aber die Soldaten hinter Marcius legten die Hände an ihre Gladii.
„Marcius", sagte Menenius warnend. „Dies ist nicht der Moment für–"
„Nicht der Moment wofür? Für die Wahrheit?" Marcius lachte, ein hartes, freudloses Geräusch. „Sieh sie dir an, Menenius. Sieh dir diese... diese Hasen an, die sich für Löwen halten. Gestern noch krochen sie vor uns auf dem Bauch, baten um Gnade für ihre Schulden, um Nachsicht für ihre Faulheit. Und heute? Heute spielen sie Revolution."
„Wir verhungern!" schrie die Frau mit dem Kind.
Marcius' Blick fixierte sie mit eisiger Präzision. „Ihr verhungert? Interessant. Du siehst dünn aus, das gebe ich zu. Aber du lebst noch. Du stehst hier, schreist, jammerst. Währenddessen – währenddessen verfault unsere Ernte auf den Feldern, weil ihr zu beschäftigt wart mit euren Versammlungen und Beschwerden, um sie einzubringen. Während unsere Feinde an den Grenzen unsere Schwäche wittern."
„Die Patrizier horten das Getreide!" warf Junius ein.
„Horten?" Marcius trat einen Schritt näher, und selbst der muskulöse Zimmermann wich unwillkürlich zurück. „Ihr wollt von Horten sprechen? Von Gier? Ihr, die ihr lieber Almosen empfangt als ehrliche Arbeit verrichtet? Die ihr den Tribunen nachläuft wie treue Hunde, weil sie euch die Ohren kraulen und euch sagen, dass all eure Probleme die Schuld der Reichen sind?"
„Marcius!" Menenius' Stimme wurde schärfer. „Genug! Du machst es nur schlimmer."
Aber Marcius war nicht zu bremsen. „Weißt du, was mich wirklich anwidert, Menenius? Nicht ihr Hunger. Hunger kann ich verstehen – ich habe selbst gehungert, in Kampagnen, wenn wir tagelang nichts hatten außer dem Regen, den wir vom Helm leckten. Nein, es ist ihre Anmaßung. Ihre Forderung, dass Rom ihnen etwas schulde. Als ob die Republik eine Amme wäre, die jedem ihr ewiges Kind die Brust reichen muss."
„Wir sind römische Bürger!" schrie jemand. „Wir haben Rechte!"
„Rechte?" Marcius lachte erneut. „Ihr habt Pflichten! Die Pflicht zu arbeiten, zu kämpfen, zu dienen! Stattdessen verschwendet ihr eure Zeit damit, euch zu beschweren, während Männer wie ich – während Soldaten wie wir –" er deutete auf die Krieger hinter sich, „– unser Blut vergießen, um diese Stadt zu schützen. Vor wenigen Wochen noch stand ich in Umbrien, Schild an Schild mit meinen Brüdern, während die Äquer auf uns einschlugen. Und wo wart ihr? Hier! Fordernd! Jammernd!"
Die Spannung war greifbar. Hände umklammerten Waffen fester. Menenius trat zwischen Marcius und die Menge.
„Caius Marcius, ich bitte dich bei unserer alten Freundschaft – schweig jetzt. Dies führt zu nichts Gutem."
Marcius' Kiefer mahlte, aber er schwieg – vorerst. Seine dunklen Augen musterten die Menge mit unverhüllter Verachtung, und die Menge gab den Blick zurück, voller Hass auf diesen Mann, der sie so offen verachtete.
In diesem Moment des brodelnden Schweigens erklang plötzlich ein neues Geräusch – das Klatschen von Sandalen auf Stein, schnell, gehetzt. Ein Bote, außer Atem, in den Farben des Senats, bahnte sich seinen Weg durch die Menge.
„Caius Marcius!" keuchte er. „Der Senat verlangt nach dir! Dringend!"
„Was ist geschehen?" Marcius' militärische Haltung war sofort zurück.
„Die Volsker", presste der Bote hervor. „Sie marschieren. Ein ganzes Heer unter Tullus Aufidius. Sie haben bereits die Grenze überschritten."
Ein Raunen ging durch die Menge. Die Volsker waren alte Feinde Roms, ein kriegerisches Volk aus dem Süden, das nie aufgehört hatte, die wachsende Macht der Republik herauszufordern. Und Tullus Aufidius war ihr gefährlichster Feldherr, ein Mann, dessen Name selbst in Rom mit Respekt – und Furcht – ausgesprochen wurde.
Marcius' Gesicht veränderte sich. Die Verachtung wich für einen Moment etwas anderem – nicht Freude, nicht genau, aber etwas, das dem nahekam. Vorfreude. Der Glanz in seinen Augen war der eines Raubtieres, das Beute gewittert hatte.
„Aufidius", murmelte er. „Endlich."
Er wandte sich an seine Soldaten. „Los. Zum Senat. Sofort." Dann, fast als Nachgedanke, warf er der Menge einen letzten Blick zu. „Ihr wolltet Brot? Kämpft dafür. Dient in der Legion. Verdient es, Römer genannt zu werden. Bis dahin –" er spuckte vor ihre Füße, eine kalkulierte Beleidigung, „– seid ihr nichts als Pöbel."
Mit diesen Worten drehte er sich um und marschierte davon, seine Männer folgten ihm. Die Menge explodierte in wütenden Rufen, aber niemand wagte es, ihm nachzusetzen. Nicht jetzt. Nicht mit Kriegsgefahr in der Luft.
Menenius seufzte tief. Er fühlte sich plötzlich sehr alt, sehr müde. „Geht nach Hause", sagte er leise zur Menge. „Bitte. Es wird eine Lösung geben. Der Senat wird beraten. Aber dies hier –" er deutete auf die Waffen, die Wut, „– dies ist nicht der Weg."
Langsam, widerwillig, begann sich die Menge zu zerstreuen. Aber die Blicke, die Menenius folgten, waren nicht dankbar. Sie waren von tiefem Misstrauen erfüllt.
Junius, der Zimmermann, spuckte erneut aus. „Eine Geschichte von einem Magen", murmelte er zu einem Gefährten. „Als ob wir Kinder wären. Und Marcius... eines Tages wird er zu weit gehen. Eines Tages."
In der Kurie, dem ehrwürdigen Sitzungssaal des Senats, herrschte kontrolliertes Chaos. Senatoren in ihren weißen Togen standen in Gruppen zusammen, ihre Stimmen ein aufgeregtes Summen. Auf den Stufen des erhöhten Podiums saßen die Konsuln, die beiden höchsten Beamten der Republik, und berieten sich mit finsteren Mienen.
Als Caius Marcius eintrat, verstummten die Gespräche für einen Moment. Alle Augen richteten sich auf ihn – einige bewundernd, andere misstrauisch, aber alle mit Respekt. Was immer man von Marcius' Art denken mochte, seine militärischen Fähigkeiten waren unbestritten.
„Caius Marcius." Einer der Konsuln, ein Mann namens Cominius, erhob sich. Er war selbst ein erfahrener Soldat, in seinen Fünfzigern, mit grauen Schläfen und dem gebräunten Gesicht eines Mannes, der viele Jahre unter südlicher Sonne gedient hatte. „Wir haben auf dich gewartet."
„Was wissen wir?" Marcius verschwendete keine Zeit mit Höflichkeiten.
„Die Volsker haben ein Heer von schätzungsweise fünftausend Mann versammelt", antwortete Cominius. „Sie marschieren auf Corioles zu."
Corioles. Eine volskische Stadt, strategisch wichtig, aber nominell mit Rom verbündet. Wenn sie fiel, würde das den Volskern einen perfekten Brückenkopf für weitere Vorstöße geben.
„Aufidius führt sie?" fragte Marcius.
„Persönlich."
Ein Lächeln spielte um Marcius' Lippen, dünn und humorlos. „Gut."
„Gut?" Ein anderer Senator, älter, korpulenter, mischte sich ein. „Wie kann das gut sein? Aufidius ist–"
„Ein würdiger Gegner", unterbrach Marcius. „Der Einzige unter den Volskern, der es wert ist, gegen ihn zu kämpfen. Wir haben uns schon fünfmal auf dem Schlachtfeld getroffen, und jedesmal entkam einer von uns mit seinem Leben, aber ohne Sieg. Das sechste Mal wird entscheidend sein."
Cominius nickte langsam. „Der Senat hat beschlossen, zwei Heere aufzustellen. Ich werde das eine führen, du das andere. Wir marschieren getrennt, vereinen uns bei Corioles."
„Wann?"
„Morgen bei Tagesanbruch."
Marcius' Augen blitzten. „Endlich etwas Sinnvolles. Besser als das Gekreische des Pöbels."
„Caius." Eine neue Stimme mischte sich ein. Menenius war eingetreten, noch immer vom Forum kommend. „Ein Wort unter vier Augen?"
Widerwillig folgte Marcius dem alten Senator in eine Ecke des Raums.
„Was du heute auf dem Forum gesagt hast –", begann Menenius.
„War die Wahrheit."
„War gefährlich." Menenius' Stimme war leise, aber eindringlich. „Caius, ich kenne dich, seit du ein Junge warst. Ich kannte deinen Vater, möge er in den Elysischen Feldern ruhen. Du bist der tapferste Mann, den Rom hat. Aber diese Verachtung für das Volk – sie wird dich eines Tages in Schwierigkeiten bringen."
„Soll ich lügen? Soll ich ihnen schmeicheln, wie diese Tribunen es tun?"
„Du sollst klug sein", sagte Menenius. „Die Zeiten ändern sich, Caius. Das Volk hat jetzt Tribunen, Vertreter, Macht. Sie werden nicht ewig still bleiben und nehmen, was man ihnen gibt."
„Dann sollen sie es sich verdienen", erwiderte Marcius kalt. „Wie ich es getan habe. Mit Blut und Schweiß."
Menenius seufzte. „Geh. Kämpfe deinen Krieg. Bedecke dich mit neuem Ruhm. Aber wenn du zurückkommst, Caius – dann denk an meine Worte. Rom ist nicht nur ein Schlachtfeld."
Marcius antwortete nicht. Er wandte sich ab und verließ die Kurie, seine Gedanken bereits bei Corioles, bei der kommenden Schlacht, bei Aufidius.
Hinter ihm murmelten die Senatoren weiter, planten, berieten. Und irgendwo in den Schatten der Kurie standen zwei Männer, die bisher geschwiegen hatten. Sicinius Velutus und Junius Brutus – die Tribunen des Volkes, die Vertreter der Plebejer.
„Er wird zu weit gehen", flüsterte Sicinius, ein schmaler Mann mit scharfen Zügen und noch schärferem Verstand.
„Ja", stimmte Brutus zu, sein Kollege, gedrungen und berechnend. „Und wenn er das tut, werden wir bereit sein."
Sie tauschten einen Blick aus, ein stilles Einverständnis. Dann verließen auch sie die Kurie, durch einen anderen Ausgang, zurück zum Volk, das sie vertraten.
Die Sonne stand jetzt hoch über Rom, brannte erbarmungslos auf die sieben Hügel herab. Der Gestank des Hungers war noch da, vermischt nun mit etwas anderem – der Vorahnung von Krieg, von Blut, von Schicksal.
Rom würde kämpfen. Wie immer.
Aber diesmal würde dieser Kampf Konsequenzen haben, die weit über das Schlachtfeld hinausreichten.
Kapitel 2: Die Mutter des Helden
Das Haus der Marcii stand auf dem Palatin, jenem vornehmsten der sieben Hügel Roms, wo die ältesten und reichsten Familien der Stadt ihre Residenzen hatten. Es war kein Palast im Sinne späterer Jahrhunderte, aber ein stattliches Atriumhaus mit hohen Säulen aus griechischem Marmor, das der Großvater einst aus Korinth hatte schaffen lassen. Die Wände des Atriums waren mit Fresken bemalt – Szenen aus der Geschichte Roms, natürlich: Romulus, der die Grenze der Stadt mit dem Pflug zog; Horatius Cocles, der allein die Brücke verteidigte; der Raub der Sabinerinnen.
Kriegerische Bilder. Ruhmreiche Taten. Blut und Ehre.
Als Caius Marcius durch das Vestibulum trat, den Eingangsbereich seines Hauses, blieb er einen Moment stehen und ließ die vertraute Kühle auf sich wirken. Draußen brannte die Mittagssonne gnadenlos, hier drinnen war es angenehm schattig. Der Geruch von Rosmarin und Lavendel wehte aus dem Peristyl, dem Innenhof, wo die Sklaven die Kräutergärten pflegten.
„Davus", rief er, und sofort erschien sein Haushofmeister, ein griechischer Sklave mittleren Alters mit klugen Augen. „Ist meine Mutter zu Hause?"
„Im Tablinum, Herr. Sie erwartet dich bereits."
Natürlich tat sie das. Volumnia wusste immer alles, noch bevor die offiziellen Boten kamen. Sie hatte ihre eigenen Quellen, ihre eigenen Ohren in der Stadt. Eine Frau ihres Standes und ihrer Intelligenz blieb nie uninformiert.
Marcius durchquerte das Atrium, wo das rechteckige Impluvium – das Wasserbecken – das Licht einfing und an die Decke reflektierte, und trat in das Tablinum, das Empfangszimmer. Dort saß sie, aufrecht auf einem gepolsterten Stuhl, eine Schriftrolle in den Händen. Volumnia.
Sie war eine Frau in den Fünfzigern, aber das Alter hatte ihr nichts von ihrer Präsenz genommen. Im Gegenteil – es hatte sie geschärft, wie eine Klinge, die man immer wieder am Schleifstein zieht. Ihr Gesicht war noch immer schön, wenn auch von Falten gezeichnet, und ihre Augen – dunkel, durchdringend, unnachgiebig – waren die Augen eines Feldherrn, nicht einer Matrone. Das graue Haar trug sie streng zurückgebunden, geschmückt nur mit einer einfachen Silberspange. Ihre Stola, das traditionelle Gewand der römischen Frau, war von tiefstem Purpur, ein Zeichen ihres Ranges.
„Mein Sohn", sagte sie, ohne von der Schriftrolle aufzublicken. Ihre Stimme war fest, moduliert, die Stimme einer Frau, die gewohnt war, dass man ihr zuhörte. „Ich höre, du hast heute Morgen wieder einmal das Volk entzückt."
Der Sarkasmus war unverkennbar.
„Sie verdienen keine Schmeicheleien, Mutter."
„Nein", stimmte sie zu und legte endlich die Schriftrolle beiseite. Ihre Augen fixierten ihn. „Aber sie verdienen vielleicht auch nicht deine offene Verachtung. Zumindest nicht auf dem Forum, wo jedes Wort zehn Ohren erreicht."
„Menenius hat mir dasselbe gesagt."
„Menenius ist ein weiser Mann." Sie erhob sich, glitt mit der Anmut einer jüngeren Frau zu ihm. „Aber du hörst nicht auf ihn. Du hörst nie auf jemanden, außer –" ein kleines Lächeln, „– manchmal auf mich."
„Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Lügen? Mich vor ihnen erniedrigen?"
„Du hättest schweigen können." Ihre Hand berührte seine Wange, eine überraschend zärtliche Geste. „Aber nein, das liegt nicht in deiner Natur. Du bist wie dein Vater – zu ehrlich für die Politik, zu stolz für Kompromisse." Ihre Finger glitten über die Narbe an seiner Schläfe. „Und zu tapfer für dein eigenes Wohl."
Er fing ihre Hand ein, hielt sie einen Moment fest. „Die Volsker marschieren. Aufidius führt sie."
Volumnias Augen leuchteten auf. „Wirklich? Aufidius?" Die Art, wie sie den Namen aussprach, war fast – bewundernd. „Dein würdigster Gegner. Wie oft habt ihr zwei euch nun gegenübergestanden?"
„Fünfmal. Das sechste wird das letzte sein."
„Für einen von euch", murmelte sie. Dann, lauter: „Wann marschierst du?"
„Morgen bei Tagesanbruch. Cominius führt die zweite Legion."
„Gut." Sie nickte zufrieden. „Du wirst dich auszeichnen. Wie immer." Es war keine Frage, keine Hoffnung – es war eine Feststellung, eine Gewissheit. „Du wirst zurückkehren, bedeckt mit neuem Ruhm, mit neuen Narben. Und Rom wird jubeln."
„Und wenn ich nicht zurückkehre?"
Die Frage war leise gestellt, fast nebenbei, aber Volumnia reagierte nicht mit Entsetzen oder mütterlicher Sorge. Stattdessen lächelte sie – ein schmales, stolzes Lächeln.
„Dann wirst du ehrenvoll gefallen sein. Als Held. Als Römer." Sie trat näher, ihre Stimme wurde intensiver. „Weißt du noch, was ich dir sagte, als du zum ersten Mal in den Krieg zogst? Du warst sechzehn. Ein Junge noch."
Marcius erinnerte sich. Wie könnte er je vergessen?
Zwanzig Jahre zuvor
Der Junge namens Caius stand im Atrium, nervös, aufgeregt, ängstlich. Er trug zum ersten Mal eine Rüstung, eine leichte, für sein Alter angemessene. Der Brustpanzer fühlte sich fremd an, zu schwer, zu eng. In seiner Hand hielt er einen Gladius, das römische Kurzschwert, und es zitterte leicht.
Volumnia trat zu ihm. Damals war ihr Haar noch dunkel gewesen, nur wenige silberne Strähnen durchzogen es. Sie war eine junge Witwe – der Vater war drei Jahre zuvor in Hispania gefallen, heroisch, wie man sagte, im Kampf gegen die Keltiberer.
„Mein Sohn", hatte sie gesagt, und ihre Hände hatten seine Schultern umfasst. „Sieh mich an."
Er hatte es getan, diese dunklen Augen getroffen, die ihn sein ganzes Leben lang geformt hatten.
„Du gehst jetzt in den Krieg. Viele Mütter würden weinen, würden dich anflehen zu bleiben, würden den Göttern opfern für deine sichere Rückkehr." Sie hatte eine Pause gemacht. „Ich bin nicht wie diese Mütter."
„Mutter, ich –"
„Hör mir zu." Ihre Stimme war sanft, aber unerbittlich gewesen. „Ich will nicht, dass du sicher zurückkehrst. Ich will, dass du ruhmreich zurückkehrst. Verstehst du den Unterschied?"
Er hatte genickt, obwohl er es nicht vollständig verstanden hatte. Nicht damals.
„Wenn du sterben musst", hatte Volumnia weitergesprochen, „dann stirb kämpfend. Mit dem Schwert in der Hand, dem Feind zugewandt, nicht weggelaufen. Lass sie deine Wunden auf der Brust finden, nicht auf dem Rücken. Das ist alles, was zählt."
„Und wenn ich feige bin?" hatte er geflüstert. „Wenn ich Angst habe?"
„Jeder hat Angst." Ihre Hände hatten sich fester um seine Schultern geschlossen. „Dein Vater hatte Angst. Ich weiß es – er hat es mir gestanden, in der Nacht vor seinem letzten Feldzug. Aber er ging trotzdem. Und er fiel wie ein Mann. Ich habe um ihn geweint, ja. Aber ich war stolz. So stolz." Ihre Augen waren feucht geworden, aber keine Träne war gefallen. „Wenn du zurückkommst, Caius, und ich sehe keine Narben auf dir – wenn ich sehe, dass du dich im Rücken gehalten hast, dich gedrückt hast, dich hinter anderen versteckt hast –" Sie hatte den Satz nicht beendet. Sie musste es nicht.
„Ich werde dich nicht enttäuschen, Mutter."
„Nein", hatte sie zugestimmt. „Das wirst du nicht. Du bist das Blut deines Vaters. Und meins. Du wirst kämpfen wie ein Löwe. Und wenn die Götter es wollen, wirst du zurückkehren, damit ich deine Wunden küssen kann."
Sie hatte ihn dann umarmt, fest, kurz. Und als er ging, hatte sie nicht geweint. Sie hatte gelächelt.
„Ich erinnere mich", sagte Marcius jetzt, im Hier und Jetzt. „Du hast mich geprägt, Mutter. Mehr als Vater es je hätte können."
„Dein Vater war ein guter Mann", sagte Volumnia. „Ein tapferer Mann. Aber ihm fehlte deine... Härte. Er war zu sanft, zu nachgiebig. Das habe ich in dir korrigiert."
„Korrigiert." Er lachte leise. „Wie man einen Fehler in Stein korrigiert."
„Genau so." Sie wandte sich ab, trat ans Fenster, das auf den Innenhof hinausging. „Rom braucht keine sanften Männer, Caius. Rom braucht Eroberer. Krieger. Männer, die Angst einflößen und Respekt erzwingen. Das bist du."
„Und wenn Rom mehr braucht als das? Wenn es auch Diplomatie braucht, Kompromisse, Politik?"
Volumnia schnaubte. „Politik ist für Feiglinge und Wortverdreher. Für Männer wie Sicinius und Brutus, diese Tribunen, die dem Pöbel nach dem Mund reden. Du bist über solche Dinge erhaben."
„Menenius meint, ich sollte lernen –"
„Menenius ist alt", unterbrach sie scharf. „Er gehört einer anderen Zeit an. Einer Zeit, als man noch mit dem Volk verhandeln musste, es beschwichtigen. Aber du, Caius – du musst nicht verhandeln. Du musst nur gewinnen. Auf dem Schlachtfeld. Das ist deine Arena. Dort sprichst du die einzige Sprache, die wirklich zählt."
Sie drehte sich wieder zu ihm um. „Morgen gehst du nach Corioles. Du wirst Aufidius gegenüberstehen. Und du wirst siegen. Und wenn du zurückkommst –" sie lächelte, ein Lächeln voller Erwartung, „– dann werden wir darüber reden, was als Nächstes kommt. Das Konsulat vielleicht. Es ist Zeit, dass du deinen rechtmäßigen Platz in Rom einnimmst. Nicht nur als Krieger, sondern als Anführer."
„Das Konsulat." Marcius verzog das Gesicht. „Das bedeutet, vor dem Volk zu stehen. Um ihre Stimmen zu betteln."
„Nicht betteln. Fordern. Du wirst ihnen zeigen, wer du bist. Was du für Rom getan hast. Und sie werden dir zustimmen müssen, weil sie keine andere Wahl haben."
Er wollte widersprechen, wollte sagen, dass es nicht so einfach war, aber in diesem Moment ertönte eine sanfte Stimme vom Eingang her.
„Caius? Bist du hier?"
Virgilia.
Seine Frau trat ins Tablinum, und die Atmosphäre veränderte sich augenblicklich. Wo Volumnia Härte und Intensität ausstrahlte, brachte Virgilia etwas völlig anderes mit – eine Sanftheit, eine Zartheit, die in diesem Haus fast deplatziert wirkte.
Sie war jünger als Marcius, Anfang zwanzig, mit einem Gesicht von klassischer römischer Schönheit: große, dunkle Augen, ein ebenmäßiger Teint, volle Lippen, die zum Lächeln gemacht schienen, aber es selten taten. Ihr kastanienbraunes Haar war kunstvoll hochgesteckt, geschmückt mit kleinen Perlen. Die Stola, die sie trug, war von blassem Blau, bescheiden, ohne den Prunk von Volumnias Purpur.
„Virgilia." Marcius' Stimme wurde weicher – nicht viel, aber merklich. „Ich wollte nicht –"
„Ich habe gehört", unterbrach sie leise. „Die Sklaven reden. Die Volsker. Und du... du wirst wieder gehen."
Es war keine Frage. Es war eine resignierte Feststellung.
Volumnia beobachtete die Szene mit kaum verhüllter Ungeduld. Das Verhältnis zwischen Schwiegermutter und Schwiegertochter war, gelinde gesagt, angespannt. Volumnia hatte nie verstanden, warum ihr Sohn diese sanfte, ängstliche Frau geheiratet hatte. Virgilia wiederum hatte nie verstanden, warum ihre Schwiegermutter den Krieg mehr zu lieben schien als den Frieden.
„Morgen bei Tagesanbruch", bestätigte Marcius.
Virgilias Augen füllten sich mit Tränen, aber sie ließ sie nicht fallen. „Wie lange?"
„Das weiß ich nicht. Wochen. Vielleicht Monate. Es hängt davon ab, wie schnell wir Corioles einnehmen können."
„Und wenn –" Ihre Stimme brach. „Wenn du nicht zurückkommst?"
„Er wird zurückkommen", sagte Volumnia scharf. „Hör auf mit diesem sentimentalen Gerede, Mädchen. Natürlich wird er zurückkommen. Siegreich. Wie immer."
„Aber was ist, wenn nicht?" Virgilia ignorierte ihre Schwiegermutter, ihre Augen fest auf ihren Ehemann gerichtet. „Was ist, wenn Aufidius –"
„Dann wird dein Sohn einen Helden zum Vater gehabt haben", unterbrach Volumnia kalt. „Und das ist mehr, als die meisten Jungen sagen können."
„Unser Sohn ist drei Jahre alt!" Virgilias Stimme wurde lauter, verzweifelter. „Er braucht einen Vater, keinen toten Helden!"
„Er braucht ein Vorbild", korrigierte Volumnia. „Ein Beispiel, dem er nacheifern kann. Glaubst du, ich hätte gewollt, dass Caius' Vater stirbt? Natürlich nicht. Aber er starb ehrenhaft, und das hat seinen Sohn geformt. Genauso wird Caius seinen Sohn formen – durch Taten, nicht durch weichliche Anwesenheit."
„Genug." Marcius' Stimme schnitt durch die wachsende Spannung. Er trat zu Virgilia, legte seine Hände auf ihre Schultern. „Virgilia. Sieh mich an."
Sie tat es, Tränen liefen jetzt über ihre Wangen.
„Ich werde zurückkommen", sagte er, und seine Stimme war überraschend sanft. „Ich verspreche es dir. Ich habe Aufidius schon fünfmal überlebt. Das sechste Mal wird keine Ausnahme sein."
„Du kannst so etwas nicht versprechen", flüsterte sie. „Im Krieg –"
„Im Krieg bin ich am lebendigsten." Er wischte eine Träne von ihrer Wange. „Ich weiß, du verstehst das nicht. Ich weiß, du hasst es, wenn ich gehe. Aber es ist, wer ich bin, Virgilia. Es ist, was ich bin. Ein Soldat. Das wusstest du, als du mich geheiratet hast."
„Ich wusste es", gab sie zu. „Aber ich dachte, vielleicht... mit der Zeit... würdest du weniger kämpfen wollen. Mehr zu Hause sein. Bei mir. Bei unserem Sohn."
Volumnia konnte sich ein Schnauben nicht verkneifen. „Männer kämpfen, Frauen warten. So ist die Ordnung der Welt. Du solltest dankbar sein, ein so tapferer Mann zur Seite zu haben, statt dich zu beklagen wie eine –"
„Mutter." Marcius' Ton war warnend. „Bitte."
Volumnia schwieg, aber ihr Blick sprach Bände.
„Wo ist der Junge?" fragte Marcius, das Thema wechselnd.
„Im Peristyl", antwortete Virgilia. „Mit seiner Amme. Er... er baut kleine Soldaten aus Lehm."
Ein Lächeln huschte über Volumnias Gesicht. „Natürlich tut er das. Es liegt ihm im Blut."
Marcius nickte. „Ich werde ihn sehen, bevor ich gehe."
Er verließ das Tablinum, Virgilia folgte ihm. Volumnia blieb zurück, zufrieden. Ihr Sohn würde kämpfen. Er würde siegen. Und er würde zurückkehren, noch berühmter als zuvor. Und dann – dann würde die Zeit kommen für größere Dinge. Das Konsulat. Vielleicht sogar mehr.
Rom brauchte starke Männer. Und sie hatte den stärksten von allen großgezogen.
Im Peristyl, dem von Säulen umgebenen Innenhof, saß ein kleiner Junge im Schatten eines Feigenbaums. Er hatte dunkles Haar wie sein Vater und die großen, ernsten Augen seiner Mutter. Vor ihm lagen kleine Figuren aus Lehm – grob geformt, aber erkennbar als Soldaten mit Helmen und Schilden.
Als Marcius sich näherte, blickte der Junge auf. „Vater!"
„Marcius." Er hatte den Jungen nach sich selbst benannt, wie es Tradition war. „Was spielst du da?"
„Krieg", antwortete der Junge ernst. „Diese Soldaten hier sind Römer. Und diese –" er deutete auf eine andere Gruppe, „– sind die Feinde. Die Römer gewinnen."
„Natürlich tun sie das." Marcius hockte sich neben seinen Sohn. „Und wer ist der Anführer?"
Der Junge hob eine Figur hoch, die geringfügig größer war als die anderen. „Das bist du, Vater."
Etwas in Marcius' Brust zog sich zusammen – ein ungewohntes Gefühl, fast schmerzhaft. Er war nicht gewohnt an Zärtlichkeit, an Gefühle, die nicht mit Kampf oder Ehre zu tun hatten. Aber dieser kleine Junge, der ihn mit solcher Bewunderung ansah...
„Ich muss morgen fortgehen", sagte er. „Für eine Weile."
Der Junge nickte, als hätte er es erwartet. „Zum Kämpfen."
„Ja."
„Wirst du viele Feinde töten?"