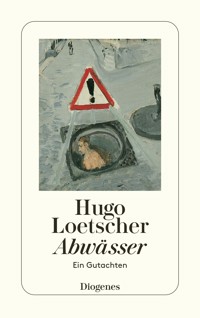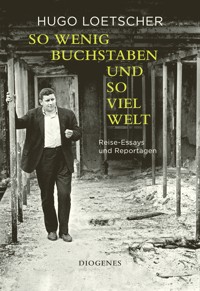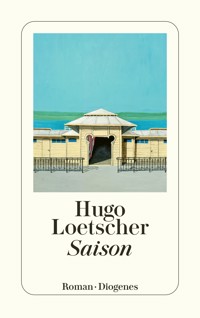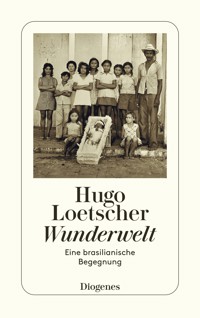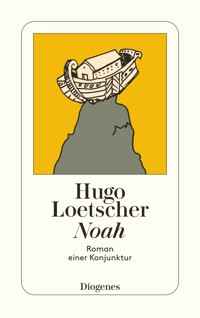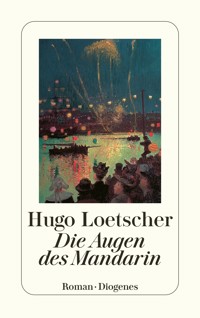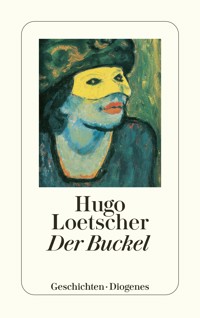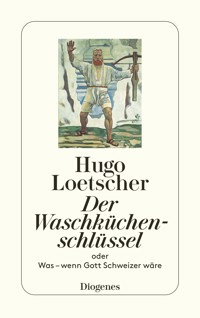20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hugo Loetschers schönste Reisereportagen über Brasilien zum ersten Mal in Buchform. Brasilien war eine Liebe, die den Schweizer Schriftsteller sein Leben lang nicht losließ. Immer wieder bereiste er sein Sehnsuchtsland und schrieb Reportagen darüber für diverse Zeitungen. Ein zeitlos aktuelles Porträt eines Landes, das, in Loetschers Worten, nach wie vor »zur Zukunft verdammt« ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Hugo Loetscher
Das Entdecken erfinden
Unterwegs in meinem Brasilien Reisereportagen
Herausgegeben und mit einem Nachwort von Jeroen Dewulf
{7}Unterwegs in meinem Brasilien
(1992)
Nein, zu erklären gibt es nicht viel. Wie soll man eine Liebe erklären? Aber auch was man nicht erklären kann (oder erklären mag), hat eine Geschichte. Selbst wenn sie nicht dort begann, wo es anfing.
Es fing in Portugal an. Nach der Veröffentlichung meines ersten Romans, Abwässer – Ein Gutachten, hatte ich einen Literaturpreis gewonnen, der mir erlaubte, in einem billigen (oder armen?) Land zu leben. Warum Portugal? Mag sein, dass es mit der Vorliebe für Übersehenes zusammenhängt. Ein Land im Rücken Spaniens, das seinerseits hinter den Pyrenäen lag. Der Zufallsentscheid wurde belohnt: Ich habe Lissabon als eine der schönen Städte Europas und die Portugiesen als liebenswertes Volk erlebt. Ein Portugal, das ein europäisches Winkeldasein führte, wo aber mit Selbstverständlichkeit von Luanda, Macau oder Goa gesprochen wurde. Provinzialität und Weltoffenheit, der Schweizer in mir fühlte sich angesprochen.
Über dieses Portugal herrschte Salazar, der mir die Liebe zu seinem Land verdarb. Ein Diktator, der bei uns kaum ernst genommen wurde. Dieses Portugal wählte ich als Filmthema. Das schweizerische Fernsehen war damit einverstanden.
Aber eine Stunde vor Ausstrahlung wurde der Film {8}abgesetzt. Ach Herr Salazar war eine »politische Elegie«. Am Schluss als Großaufnahme die Knochenwand im Gebeinhaus von Évora: »Hier herrscht die totale Demokratie. Aber man könnte mit ihr vorher beginnen.« Die Absetzung des Films weitete sich aus zu einem Skandal, von dem ein junger Autor nur träumen kann.
Der Text fand später Eingang ins Gratisbuch. Der Film selber ging verloren, als das Fernsehen nach Zürich-Oerlikon umzog. Er fand auch keine Aufnahme in die (gedruckte) Filmgeschichte. Es war, wie mich ein Herausgeber belehrte, ein 16-Millimeter-Film und nicht ein 36er. Ich habe mich in diesem Land immer wieder um Millimeter verrechnet.
An einen weiteren oder gar regelmäßigen Aufenthalt in Portugal war kaum mehr zu denken. Dies war umso ärgerlicher, als ich etwas Portugiesisch gelernt hatte. Aber anderseits: Gab es nicht eine lusitanische Welt? Und gehörte zu dieser lusitanischen Welt nicht Brasilien? Führte ein logischer Weg der Portugiesen nicht über den Südatlantik nach Südamerika? Meine Entdeckung Brasiliens verdanke ich einem Diktator und einem Fernsehredaktor, was nicht als Empfehlung gemeint ist.
Ohne es zu beabsichtigen, hatte ich mich literarisch auf Brasilien vorbereitet. Der erste Text, den ich auf Portugiesisch als Ganzes las, war die Predigt des heiligen Antonius an die Fische von António Vieira. In seiner Rollenpredigt übte dieser Jesuit aus dem 17. Jahrhundert schärfste Kritik an den portugiesischen Kolonialisten: »Dass ihr Fische einander fresst, ist ein Skandal. Der ist umso übler, als die großen die kleinen fressen. Umgekehrt wäre weniger schlimm. Da würde ein großer für sehr viele kleine genügen.«
{9}Die Predigt gab ich auf Deutsch heraus und schrieb dazu eine längere Einleitung. Dies schien mir schon deswegen aktuell, weil sich in den sechziger Jahren wieder einmal die biedere Auffassung breitmachte, edle Gefühle und anständige Gesinnung genügten für Literatur. Vieira bot ein Beispiel dafür, wie Moralität und stilistische Verantwortung eine gültige Verbindung eingehen. Das Vorwort erwies sich im Nachhinein als poetische Konfession.
Klar, dass ich beabsichtigte, die Orte aufzusuchen, an denen Vieira gewirkt hatte. Bahia, und hoch im Norden, in Maranhão, São Luís, wo er seine Predigt gehalten hatte.
Aber Brasilien begann in Rio. Und es begann atemberaubend, ohrenbetörend und augenbegeilend.
Der Abflug war kurzfristig entschieden worden, auch wenn es wie nach touristischer Planung aussah. Ich kam an einem Freitagmorgen an. Die erste Begrüßung mit einem cafézinho (Kaffeechen) und die Bekanntschaft mit Tropenfrüchten, deren Namen ich von nun an zu lernen hatte. Ein flüchtiges Flanieren durch die Renommierstraße Rio Branco. Ein koloniales Kloster als historische Reminiszenz und die Schattenschluchten zeitgenössischer Wolkenkratzer. Die erste cachaça (Zuckerrohrschnaps) an der Praça Mauá, damals noch mit Hafenkneipen und Matrosenbetrieb. Ein Tag des Jetlags, aufgekratzt und benommen unter einem feuchtheißen Himmel.
Und am andern Morgen Trommeln, die weckten. Samstag vor dem Karneval. Ich begab mich hinunter vors Hotel und folgte einer musizierenden Gruppe, ließ diese und zog einer anderen nach, hängte mich dort an und ließ mich hier treiben. Von Taumel zu Taumel und von einem Tag in den {10}andern hinein. Der schwarze Junge, der mit einer Hühnerfeder im Kraushaar sich in einen Indio verwandelte. Und die Luxusmasken auf dem Laufsteg, auf dem die Gäste defilierten, die am Opernball teilnahmen. Die kichernden Auftritte der Transvestiten und der Vorbeimarsch der Sambaschulen. In der tonisierten Luft vibrierten Stahl, Glas und Stein, und was eines Klangs fähig war, wurde als Schlagzeug benutzt. Die Anfälligkeit helvetischer Knochen für Rhythmus und Geist, der nicht mehr stark sein mochte, sondern willig wie das schwache Fleisch. Ein Karneval im Hochsommer. Die Körper entledigten sich der Kleider, und in allen Straßen und auf allen Plätzen tanzte die Schönheit der Mulattinnen und Mulatten. Die erste Umarmung. Und dann der Jetlag der Erotik. Und irgendwo und irgendwann der zweite Kuss.
Dann aber war die Stadt plötzlich dunkel und still. Selbst der Verkehrslärm nahm sich diskret aus, was etwas heißen will beim lateinischen Talent fürs Hupen. Man sagt dem Fleisch nur Lebewohl (carne vale), wenn es danach keins mehr gibt. Unsere protestantischen Fasnachten tun sich deswegen so schwer, weil ihnen kein Büßertag droht, der etwas anderes ist als ein Kater. Auch das Toben am Polterabend erhält nur Sinn, wenn anderntags die Asche der Ehe aufs Haupt gestreut wird.
Man hatte mich in Zürich vor dem Abflug gewarnt. Unmöglich, ein Hotelzimmer zu finden. Aber ich fand eins. Und zwar an dem, was man beste Lage nennt. Im Zentrum. In der Nähe des Platzes, wo die Oper, das Nationalmuseum und die Nationalbibliothek, das Justizministerium, das Parlamentsgebäude, der Senat ein Ensemble bilden, Bauten, {11}die daran erinnerten, dass Rio fünf Jahre zuvor noch Hauptstadt war.
Im Einzugsgebiet des Platzes eine Reihe von Theatern und Kleinbühnen. Wegen der vielen Kinos Cinelândia genannt. Ein Platz, der sich zu den Hauptstraßen von Downtown öffnet. Mühelos geht die Geschäftigkeit des Tages über in die Geschäftigkeit des abendlich-nächtlichen Nichtstuns. Gleich anfangs war der Entscheid gefallen, dass ich nie ein Copacabana-Bewohner werden würde. Ohne Zweifel imposant, der geschwungene Strand. Einzigartig die Skyline. Faszinierend, die Promenade abzufahren. Am Tag wie in der Nacht. Kein Rio-Aufenthalt ohne einen Abstecher nach Copacabana, Leme, Leblon, Ipanema oder wie immer die einzelnen Strände und ihre Viertel am Atlantik heißen. Ich blieb ein Bewohner jenes Rio, das an der Guanabara-Bucht liegt, an der es gegründet wurde.
Ich übernahm auch ein Ritual aus Lissabon: bald nach der Ankunft mit der Fähre ans andere Ufer zu fahren und mit einer der nächsten zurückzukehren, um stilgerecht vom Wasser her anzukommen. Hier bringt einen die Fähre nach Niterói, der Schwesterstadt. Und mit der Fähre zurück, sich der Wolkenkratzervielfalt von Rios Downtown nähernd. Auf die Stelle zusteuern, wo einst die Schiffe aus Europa anlegten, und einige repräsentative Bauten sehen, das Rio der Kaiserzeit, von der Fähre an Land gehen und sich als einer unter ihnen fühlen.
Auf diese Bucht ging der Blick vom Hotel Serrador. Er wäre klassischer nicht denkbar. Gegenüber der Zuckerhut und rechts oben die Christus-Statue auf dem Corcovado. Das Spiel des Lichts mit Wasser und Hügel. Eine {12}Landschaft, bei deren Kreation es sich der liebe Gott einfach machte, er wählte als Vorlage die schönste Postkarte.
Aber eines Jahres war das Hotel von der staatlichen Erdölgesellschaft, der Petrobras, gekauft worden. Mein Gepäck ließ alle Handgriffe hängen. Es begann ein nomadisches Hotelsuchen. Bis ich mich fürs Novo Mundo entschied. Und dies nicht zuletzt wegen des Viertels in seinem Rücken. Catete, nach dem früheren Regierungssitz benannt. Ansonsten ein recht gewöhnliches Wohnquartier, gerade dies war ausschlaggebend. Jene Banalität, deren Alltag alle Sightseeings überdauert. Nach wie vor der Blick vom Hotelzimmer auf die Bucht. Nicht mehr Breitleinwand, aber noch ein geschlossenes Bild. Als Hintergrund der Hügelzug am andern Ufer. Und in der Bucht stets Bewegung, ein Tanker, ein Segelschiff oder ein Kriegsschiff auf dem Wasser und in der Luft ein Flugzeug, das vom nationalen Flughafen aufsteigt, und die krabbelnden Kabinen der Schwebebahn vom Zuckerhut. Zu Füßen die Praia Flamengo. Ein Strand, an dem wegen der Verschmutzung das Baden verboten ist. Acht- oder zehnspurige Straßen. Aufgeschüttetes Terrain, von einem Landschaftskünstler gestaltet. Eine Anlage, in der es gefährlich wurde zu flanieren. Mit Fußballfeldern. Bis Mitternacht und darüber hinaus Jugendliche, die hier spielen. Straßenjungen, elternlos und ohne Heim, profitieren von der Leere, der Kühle und dem Flutlicht. Die meisten dunkelhäutig wie Pelé. Sie träumen mit den Füßen, mit denen sie gegen den Ball treten, und ihr aussichtsloses Leben gewinnt ein Ziel, ein Tor und eine Latte.
Rio blieb Anflughafen für Südamerika, auch wenn sich inzwischen einiges bei Ankunft und Einfahrt geändert hat.
{13}Als wir bei meinem ersten Flug nach Südamerika den Äquator überquerten, erhielt ich eine schriftliche Bestätigung, das Ereignis wurde mit Champagner begossen. Äquatortaufe in bester Seefahrermanier. Nur dass der Wassergott Neptun sich tüchtig recken musste, um mit seinem Dreizack hoch oben in der Luft zu grüßen.
Die Flugzeuge aus der Schweiz legten noch Zwischenstationen ein. In Lissabon und Dakar. Das empfand ich als themengerechte Einstimmung. Zwischenhalt bei den Portugiesen, die Brasilien entdeckten und aus ihm eine Kolonie machten. Und Dakar stellvertretend für Afrika, aus dem einst Schwarze als Sklaven nach Brasilien verschleppt wurden.
Was einst getauft wurde, was aus Afrika kam, wurde nun hygienisiert. Eine stickig-stinkende Taufe aus einer laizistischen Spraydose. Nach der Landung stiegen zwei Beamte an Bord und besprühten Passagiere und Gepäck. Rio war einst berüchtigt für Gelbfieber. Ein brasilianischer Wissenschaftler hat es ausgerottet. Das nach ihm benannte Institut ist ein Gebäude, das bei der Einfahrt als eines der ersten auffällt.
An dieser Einfahrt hat sich einiges geändert. Nicht nur weil inzwischen ein neuer Flughafen eingeweiht wurde. Die Slums wurden wegsaniert, die einem einst einen ersten Eindruck vermittelten. Pfahlbauten im Schwemmland der Bucht errichtet und über die Bucht selber eine Brücke nach Niterói gebaut. Nach wie vor führt die Avenida Brasil an den Docks vorbei, aber jetzt auf einer Hochstraße. Und die City drängte sich vor bis in den Hafen mit postmodernistischer Imponierarchitektur.
{14}Geändert aber hatte sich anderes. Mit jedem Mal wurde die Ankunft ein Stück mehr Heimat. Nicht nur, weil man in der Ferne die Steiltreppe zum Hügel der Felsenmadonna gleich erkennt oder ohne Mühe im Bergzug den Pico da Tijuca ausmacht. Nicht erst die Glória-Kirche im Zentrum grüßt einen als Bekannten. Schon eine Fußgängerüberführung oder eine Lagerhalle werden Vertraute in dem charakterlosen Industrieviertel, das man als Erstes durchquert. Je mehr Rückkehr, umso weniger Sensation. Es fuhr immer der Immune mit: »Am liebsten wäre er in alle Richtungen gegangen und aus allen Richtungen zurückgekehrt, bis jeder fremde Ort ein vertrauter wurde und jeder vertraute sich einem fremden anglich und es keine Unterschied mehr gab zwischen vertraut und fremd.«
Rio war nicht nur Anflughafen für Brasilien, für weitere Städte an der Küste und für das Hinterland der verschiedenen Hinterländer. Brasilien wurde Ausgangsland für das andere Südamerika, das spanische. Vom amazonischen Tiefland ging eines Tages die Reise in die kolumbianischen Anden. Oder der Weg führte vom südlichen Interior aus nach Bolivien, einmal mehr ins indianische Südamerika. Die Wasserfälle von Iguaçu wurden Station auf der Reise nach Paraguay, wo Mestizen über 90 Prozent der Bevölkerung ausmachten. Und von Rio oder São Paulo aus der Weiterflug über die Anden nach Santiago de Chile. Oder ins europäische Südamerika, nach Uruguay oder Argentinien.
Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass jemand dem Porteño (Bewohner von Buenos Aires) und dem Carioca (Bewohner von Rio) die gleiche Sympathie entgegenbringt. Wobei ich mich hüte, den Carioca mit dem Brasilianer {15}gleichzusetzen. Dem Klischee nach sind die aus dem Süden tüchtig und die aus dem Norden schwermütig, neben ihnen und andern ist der Carioca leichtlebig. Es heißt nicht umsonst, man gebe das Geld, das man in São Paulo verdient, in Rio aus. Und doch: Ein Vergleich des (portugiesischen) Carioca mit dem (spanischen) Porteño hat mir einiges klargemacht über die Lebenseinstellung des Brasilianers – oder müsste man nicht besser »Lebenskunst« sagen?
Brechen zwei Porteños von zwei entgegengesetzten Punkten auf, machen sie sich ellbogenbewehrt auf den Weg und gehen stracks geradeaus und behalten die Richtung bei, auch wenn sie den andern auf sich zukommen sehen; sollte der Zusammenprall tödlich sein, er war männlich und heroisch. Der Brasilianer weiß, dass es in diesem Leben nun einmal zu Konfrontationen mit dem andern kommt, also machen sich beide tanzend auf den Weg, wählen einen Schritt, bei dem der Ausfallschritt choreographisch eingeplant ist. So besteht die Chance, aneinander vorbeizukommen ohne Machobeulen, und beide haben doch ihr Gesicht gewahrt.
Ich habe immer bedauert, dass diese Gangart von den Militärs nicht verwendet wurde. Auch nicht von den brasilianischen. Eine Gangart, die einige damit erklären, dass sich der Brasilianer einen Alltag ohne Musik nicht vorstellen kann. Vielleicht ist es umgekehrt; denkbar, dass seine Art, durchs Leben zu gehen, nach Musik ruft.
Eine Gangart des Durch- und Davonkommens. Dies spielt nicht immer ohne den jeito, den Dreh. Und sicher nicht ohne Talent zur Improvisation. Mein Gesellenstück in dieser Lebenskunst legte ich nach meinen ersten drei {16}Monaten ab. Das Visum musste verlängert werden, was weiter kein Problem brachte. Außer dass man die Stempelmarken nicht auf dem Amt bekam, wo die Marken abgestempelt wurden. Dem Mann jedoch, der in einem anderen Büro die Marken verkaufte, waren die Siebziger, die ich benötigte, ausgegangen. Er bot mir an deren Stelle eine Achtziger an, die ich erwarb. Doch sein Beamtenkollege weigerte sich, eine Achtzigermarke anzunehmen, er wollte nur eine Siebziger. Meine Großzügigkeit beeindruckte nicht; ich konnte sie mir umso mehr leisten, als der Dollar damals mit 300 Cruzeiros umgerechnet wurde. Doch es war nichts auszurichten, so dass ich darum bat, beim Chef vorzusprechen. Dort legte ich eine größere Note auf den Tisch, bettelte um die Gunst, statt siebzig Cruzeiros achtzig bezahlen zu dürfen. Der Vorgesetzte zeigte Verständnis, steckte die Note ein und gewährte mir, der ich von so weit herkäme und Brasilien anscheinend möge, mehr zahlen zu dürfen, als vorgeschrieben ist.
In einem solchen Land mochte ich nicht nur zwei Monate länger bleiben. In ein solches Land wollte ich zurückkehren.
Es verhielt sich nicht so, dass ich in Zürich aus einem mehr oder weniger heiteren Föhnhimmel beschließen konnte: Ich fahre nach Brasilien. Damit hatte ich noch kein Ticket in der Tasche, und Kreditkarten beharren nun einmal auf der abrechnenden Stunde der Wahrheit.
Die Reisen wären ohne journalistische Arbeiten nicht möglich gewesen. Die Mitarbeit bei der Swissair Gazette bot die Chance eines Flugtickets. Solange ich Redaktor bei der Weltwoche war, stand der Publikationsmöglichkeit {17}nichts im Wege. Ich brauchte lediglich einige Kollegen zu überzeugen, dass in Brasilien nicht alles Samba war.
Man kann sich schwerlich vorstellen, dass Mitte der sechziger Jahre Südamerika in unseren Medien ein vernachlässigtes Thema darstellte. Die regelmäßige Berichterstattung setzte erst später ein. So hatten die ersten Reisen nach und durch Brasilien noch etwas vom Hauch und Schweiß der Avantgarde.
Welche Lücke sich auftat, merkte ich an mir selbst. Dieses Brasilien und sein Kontinent waren unbekanntes Terrain. Bevor ich andere informierte, hatte ich mich selber zu informieren. Das hieß nicht nur schauen und Gespräche führen, sondern auch lesen. Was habe ich Päckchen auf die Post geschleppt! Sollte meine Brasilienbibliothek zu einer Geschichte kommen, fände sich darin ein detailfreudiges Kapitel »Der Autor und die Paketpost«.
Journalistische Arbeit, die von dem ausging, was man vorfand, schien mir umso dringlicher, als recht bald die Ideologen sich Lateinamerikas annahmen. Und sie, die den Neokolonialismus von Wirtschaft und Politik kritisierten, betrieben eine sublime Form des intellektuellen Imperialismus, indem sie eine Terminologie mitbrachten, die aus anderen Gesellschaften stammte. Ich habe es stets vorgezogen, statt von Strukturen von der Suppe zu reden.
Ich war nie ein Newsman. Was nicht heißt, dass einen die Aktualität nichts angegangen wäre. Und an Aktualitäten sollte es auch nicht fehlen – die Zensur zum Beispiel war ein anhaltendes Thema von trauriger Ergiebigkeit.
In dem Brasilien, das ich kennenlernte, hatten ein Jahr zuvor die Militärs geputscht. Noch waren einige limitierte {18}Freiheiten möglich. Doch dann der »Putsch innerhalb des Putsches« 1968. Mit der institutionellen Akte 5 begann die harte Repression – Verhaftungen, Folter, Exil. Und danach, in den siebziger Jahren, das »Wirtschaftswunder«. Man brauchte kein Experte zu sein, um den Boom als Ausverkauf zu erkennen. Die Fachleute belächelten den weltfremden Intellektuellen. Am Ende erwies sich: kurz die Geschäfte und lang die Schulden. Danach die politische Hoffnung, die Öffnung, die Abertura, zögernd, aber immerhin. Die achtziger Jahre mit den ersten Wahlen und horrender Inflation, auch mit Korruption und wachsender Kriminalität. Ein verlorenes Jahrzehnt, wie man hinterher bilanzierte.
Journalistisch interessierte mich, was man Interdisziplinäres nennt: eine Komplexität, in der Geschichte und Aktualität gleicherweise spielen, Zusammenhänge und Ineinanderwirken von Politik und Kultur, von Alltag und Geisteshaltung, persönlicher Perspektive und Faktengerechtigkeit. Einem solchen Interesse wird nur die längere Berichterstattung gerecht. Dem Freischaffenden, der ich inzwischen geworden war, boten das Tages-Anzeiger Magazin und das »Wochenende« der NZZ ein gegebenes Forum. Und dementsprechend auch die Fotoreportagen, wie sie auf drei Reisen mit dem jungen Fotografen Willy Spiller entstanden. Die Themen konnten recht unterschiedlich ausfallen. Wenn Brasília, dann die Slums, welche die Hauptstadt der Hoffnung einkreisten. Urbanismus der Misere. Und wenn Militärs, dann der Besuch der »Sorbonne« in Rio, der intellektuellen Drillstätte für ideologische Legitimierung. Und wenn Gold, nicht nur die Fahrten durch die einstige Goldprovinz Minas Gerais mit ihren {19}Barockstädten, sondern auch der Abstieg in die größte Goldmine, deren Schächte bis unter das Meeresniveau reichen. Und beim Bau der Transamazônica dabei sein, der ersten Transversale durch Amazonien. Und dies als Gelegenheit nutzend, ein Porträt von Belém zu schreiben, der Stadt im Mündungsgebiet des Amazonas.
Nicht dass die Reisen sich auf journalistische Arbeiten beschränkt hätten. Sie boten eine Minimalgarantie und legten die Voraussetzungen für ein Unterwegs in eigener Regie und allein.
Ein Unterwegs, das nicht spektakulär sein muss. In São Paulo und Rio flanieren und benommen sein von der architektonischen Phantasie dieses Landes. Oder in einem Städtchen im Norden oder Nordosten unterwegs, zu jener Mittagsstunde, wenn nur verrückte Hunde und Engländer im Freien sind, verlassene Straßen und öde Plätze, die Leere genießend, auf dem Kopf eine Tropensonne, die alle Fragen wegbrennt.
Ein Unterwegs je nach Möglichkeit – ob hinten auf einem Lastwagen oder im Jet. In einer jener Propellermaschinen, die meinen, es sei lustig, von Wolke zu Wolke zu hüpfen. Bei einem Nachtflug der Blick auf die Feuer der Brandrodungen. Oder die Schleifen über dem Rio São Francisco im Helikopter, dem Urenkel des fliegenden Teppichs. Und obgleich die Schiene kaum von Bedeutung für Waren- und Passagiertransport ist, dennoch die Eisenbahn von Belo Horizonte nach Rio benutzen, und sei es nur, um zu sagen, man sei in diesem Land auch Zug gefahren. Und ansonsten immer wieder Busse. Der, der im Schlamm steckenbleibt, so dass man die Regennacht unter einer {20}Blache am Straßenrand verbringt. Oder jener Bus, der nicht den Berg hochkommt, so dass die Männer und die männliche Jugend aussteigen, hinterherstapfen und erst wieder zusteigen, wenn der Bus auf dem Grat erneut zu Schnauf kommt.
Ein Unterwegs mit einem anderen Raum- und Zeitgefühl. Fahr’ ich von Zürich nach Bern, werd’ ich ungeduldig; diese Fünfviertelstunden gehen nie zu Ende. Löse ich in Brasilien am Morgen früh ein Busbillett und komme ich am späten Nachmittag an, finde ich das angenehm, dann ist es noch hell und früh genug, um sich in Ruhe nach einem Hotel umzuschauen – vielleicht ein Hotelzimmer, das kein Bett hat, sondern nur Haken an der Wand für die Hängematte, die man als Bett mitbringt.
Amerikanisches Raumgefühl. Wir Europäer erfahren es auch in Nordamerika. In den USA. Bis zum horror vacui, ein Schreck vor der Leere, die zugleich die ungenutzte Möglichkeit ist. Solche Gefühle vermitteln einem auch andere lateinamerikanische Staaten – die endlosen Fahrten in den Anden oder das Durchqueren der argentinischen Pampa. Aber Brasilien bietet als Erlebnisbereich einen halben Kontinent. Und es ist nicht nur eine geographische Weite, sondern auch eine geschichtliche. Noch Indiostämme, die im Steinzeitalter leben, und zugleich die Metropolen der Hightechzivilisation.
Diese Welt findet sich wieder in der ethnischen Vielfalt der Gesichter. Raum genug für alle und jeden. Angesichts so vieler Möglichkeiten muss es auch Platz geben für jemanden wie mich. Mein Brasilien, in dem ich unterwegs bin, ist noch im Entstehen.
{21}Es gab aber auch ein Brasilien, das ich lange genug vernachlässigte. Der Süden, der südlich von São Paulo liegt. Ausgerechnet die Bundesstaaten, die für die Ökonomie des Landes ausschlaggebend sind. Ein Brasilien, das einen europäischen Charakter zeigt. Vielleicht war es gerade das, was nicht lockte. Blumenau mit seinen deutschen Chalets blieb eine Stippvisite – trotz Textilien, Blasmusik und Symphonieorchester. Das Desinteresse an einer Stadt wie Porto Alegre ließ sich im gegebenen Moment leicht beheben; aber auch hier zog es mich ins Hinterland des Staates Rio Grande do Sul, zu den »Sieben Missionen«, die einst zum Herrschaftsbereich der Jesuiten gehörten.
Die Routen gingen mit Vorliebe und Neugierde nordostwärts. Im Lauf der Zeit ein geradezu systematisches Abfahren der Küste. Von Stadt zu Stadt, und dies aus unterschiedlichsten Gründen. Ilhéus, die Kakaostadt, wegen Gabriela, der Mulattin, die der Schriftsteller Jorge Amado erfand. Olinda, die Barockstadt. João Pessoa, wo auf dem Flughafen zu lesen ist: »Sie kommen ins Land von Câmara Cascudo«, angespielt wird auf den bedeutendsten Ethnologen des Landes. Und eines Tages auch São Luís mit der Kathedrale, in der António Vieira seine Fischpredigt hielt.
Wenn eine Stadt meine Empfindsamkeit brasilianisch prägte, war es Salvador da Bahia. Die erste Hauptstadt des Landes, eine der barocken Kirchen und der afrobrasilianischen Riten, der katholischen wie der afrikanischen Religiosität. Meine ersten literarischen Texte zum Thema Brasilien verfasste ich über Bahia. Eine Sondernummer der Zeitschrift du, mit Fotografien von René Burri.
Meine ersten Texte waren schwärmerisch-poetisch {22}ausgefallen. Hier in Bahia hatte ich mich nahe am Geheimnis der brasilianischen Seele gefühlt. Bahia als Beispiel einer neuen Gesellschaft der Rassenmischung und Rassengleichheit. Nicht homogenen Gesellschaften gab ich (und gebe ich) Zukunft, sondern den vielrassigen und multikulturellen. Einer Gesellschaft, wie sie Brasilien in seiner ganzen Problemspannung ausprobiert.
Unvermeidlich die kritische Auseinandersetzung mit Gilberto Freyre, dem Soziologen, der die Portugiesen dafür pries, eine Tropenkultur der ethnischen Demokratie verwirklicht zu haben. Die Kenntnisnahme jener, welche ein weniger stilisiertes Bild entwarfen, das auch eher der Geschichte und der Gegenwart entsprach. Die Bekanntschaft mit Abdias do Nascimento, dem militanten Schwarzenführer, und seiner radikalen Behauptung einer brasilianischen Apartheid. Die Begegnung mit dem bahianischen Künstler Emanuel Araújo. Welcher Weg auch immer zurückgelegt wurde, die afrobrasilianische Kultur blieb für mich ein vorrangiges Element der brasilianischen Kreativität.
Und neben einem Staat wie Bahia die Region des Nordostens, so groß wie einige europäische Staaten zusammen. Und damit eine Stadt wie Recife, das Tor zu diesem Nordosten. Ein Gebiet der traditionellen Unterentwicklung. Eine Region der religiösen Fanatiker und liberalen Politiker, der Banditen und Bänkelsänger, lebendigster Volkskultur und einer hohen Literatur. Unter den vielen Gründen, den Nordosten aufzusuchen, auch die Seca, die zyklisch wiederkehrende Dürrekatastrophe. Eine Geographie des Hungers.
Die Einladung eines Gewerkschaftsführers zu einem {23}Essen. Er, der in den Slums von Recife wohnt, mag nichts anrühren, als die Platte aufgetragen wird. Mit erstickter Stimme gesteht er, dieses Stück Fleisch würde für seine ganze Familie ausreichen. Ihm gegenüber sitze ich, der über den Hunger schreibt und der sich täglich ernährt und der, selbst wenn er in einem bescheidenen Hotel wohnt, ein Dach überm Kopf hat. Einmal mehr das Dilemma derer, die auf der anderen Seite leben.
In diesem Nordosten im Staat Ceará der Wallfahrtsort Canindé. Vor der Kathedrale die Fotografen, die auf Kundschaft warten. Kinder, die einen Sarg tragen, und eine Familie, die sich für die Aufnahme bereitmacht. Wie ich in dem mit Krepppapier geschmückten Sargkistchen das tote Mädchen sehe, weiß ich, wie das Buch, das ich schon lange in mir trug, ausfallen wird. Da ein kleines Mädchen, das keine Chance hatte, seine eigene Welt kennenzulernen, und vor dem Sarg ich, der über alle Möglichkeiten verfügte, in seiner Welt zu reisen und sich umzusehen. Erzählend wollte ich dem Mädchen zurückgeben, was ihm schon immer gehörte. Eine brasilianische Begegnung in einer »Wunderwelt«, in der weder das Wirtschaftlich-Soziale noch das Christlich-Katholische wirkten.
Brasilien war auch ein Unterwegs im Bewusstsein. Das Abenteuer. Die Faszination durch das Exotische und Fremde. Die Lockung des Unbekannten. Die Befreiung von zivilisatorischem Kram. Und sei es nur eine Fahrt auf dem Amazonas nach Manaus. Und von dort den Madeira hinauf nach Porto Velho. Doch dann hinter aller Exotik und allem Tropikalen die Entdeckung der sozialen Wirklichkeit. Die Begegnung mit einer anderen Welt, die trotz {24}aller Ungewohntheit mehr mit der unseren zu tun hat, als wir gemeinhin anzunehmen bereit sind.
Am Ende einer, der nicht als der Gleiche zurückkehrt, als der er aufgebrochen ist. Der die eigene Realität mit anderen Augen sieht, die private wie die kulturelle und nationale seiner Herkunft. Und dem es manchmal schwerfällt, nachzuvollziehen, an was für Weh wir leiden.
Und mit jedem Abflug das unausgesprochene Versprechen, dorthin zurückzukehren, wovon ich Abschied nehme: »até logo«, »auf bald«, auch wenn das Bald länger dauern konnte als zwei Jahre. Eine Rückkehr, und sei es nur, um sich zu vergewissern, dass es die Schauplätze, an denen man leben durfte, noch gibt. Eine Bestätigung für die Vitalität, die sich nicht unterkriegen lässt und die sich mit zukunftsträchtiger Phantasie behauptet.
Aber auch der Umgang mit der Sehnsucht hat sich geändert. Nicht mehr die Sehnsucht in der deutsch-mütterlichen Art »stillen«. Sondern »matar saudades«, wie der Brasilianer sagt, die Sehnsucht »töten«.
{25}Bahia – Porträt einer Stadt
(1967)
Salvador da Bahia, kurz Salvador oder Bahia, eine Stadt, auf der Karte zu finden, doch hat sie einen Breitengrad mehr – Mutter der brasilianischen Städte, aber auch entthronte Hauptstadt Brasiliens, das Rom der Schwarzen.
Drei Kontinente brauchte die Stadt, bis es sie gab: das Europa der Portugiesen und das Afrika der Schwarzen, die Indianer überließen als Schauplatz Südamerika.
Portugal wollte sich noch einmal wiederholen. Es gibt Straßenzüge in Bahia, die könnten in Lissabon sein. Aber Bahia duldete keine Wiederholung, obwohl es sich mit den blauen Kacheln der Portugiesen schmückte.
Zwar lässt Bahia gelten, was es gibt. Es gewährt dem Barockportal Platz neben dem Quaderbau und dem Wolkenkratzer neben dem Fort. Das können andere brasilianische Städte wie Goiânia oder Ouro Preto nicht, die ertragen nichts, was über ihren Kolonialstil hinausgeht. Bahia ist unbekümmerter und mütterlich. Verzweifelt und lasziv erfand sich Bahia selber. Es mischte die drei Kontinente: im Bett, im Kochtopf und am Altar.
Da die Herren Portugiesen waren, spricht Bahia Portugiesisch. Aber wo sein Geheimnis beginnt, spricht die afrikanische Seele: beim Spiel, beim Tanz, beim Essen, bei den Festen. Und da die Indianer als Erste die Früchte, das {26}Gemüse und die Tiere dieser Region benannt hatten, benutzt Bahia deren Worte.
Bahia nahm von den Portugiesen die Herrschsucht und den Mut, die unübersetzbare Melancholie der saudade und den Barock. Von den Schwarzen nahm es den Rücken und das Lachen, den Gang und die Hautfarbe.
Wenn stimmt, dass Gott die Weißen, Schwarzen, Gelben und Roten erschuf, und wenn stimmt, dass die Portugiesen den Mischling schufen, wie sie sich rühmen und spotten, dann wurde in Bahia die Mulattin erfunden.
Ohne Frauen waren die Portugiesen in die Kolonien gegangen. Anders als jene, die die Vereinigten Staaten im Norden kolonisierten. Jene waren mit Frau und Kind aufgebrochen, sie wollten Europa zurücklassen und eine neue Welt verwirklichen.
Der Portugiese aber, der Lissabon verließ, vergaß Lissabon nicht. Er suchte das Abenteuer, und es galt irgendwelchem Paradies. Er war unterwegs – ein Volk von zwei Millionen, das seine Entdecker bis nach Indien, China und bis vor Australien schickte. Aber am Ende war die Rückkehr wichtig, und für die Rückkehr das beladene Schiff. Sie trieben eine Politik der Passanten, auch wenn die Gouverneure begannen, Paläste zu bauen, und die Beamten sich für längere Zeit einrichteten und viele blieben. Wenn der Brasilianer noch heute über den Portugiesen spottet wie nie ein Nordamerikaner über den Engländer, dann ist das nicht nur eine nachträgliche Befreiung von den einstigen Kolonialherren, sondern die Brasilianer spüren, dass der Portugiese Brasilien als Zwischenhalt nahm, auch wenn der Zwischenhalt schon Generationen dauert.
{27}Ohne Frauen waren diese Portugiesen losgezogen, und die ersten Frauen, die sie in Brasilien fanden, waren Indianerinnen. Die Nachfahren, die caboclos, stellen heute Landarbeiter und Kuhhirten, vaqueiros, die dumpfer und ernster sind als die gaúchos im Süden.
Aber der Indianer floh und zog sich zurück. Es gab mit ihm die Begegnung, den Handel, das Kind, die Taufe – aber nicht mit dem Indianer erfand Bahia sich eine Gesellschaft, sondern mit der schwarzen Frau.
Nun schliefen die Portugiesen auch in São Tomé mit schwarzen Frauen, auf den Kapverdischen Inseln, in Angola und Mosambik. Da die Frau von vornherein rechtlos war, erlaubte sich der Liebhaber von vornherein alle Phantasien der Tropensonne.
Aber in Bahia waren beide fremd – der Portugiese und die Schwarze, wenn auch aus verschiedenen Gründen. Der eine war aus freiem Willen über den Atlantik gekommen, und die andere war eingefangen und transportiert worden. Für beide aber lag die Herkunft jenseits dieses Meeres.
So steht am Anfang von Bahia eine Liebe, bei der beide ausgeliefert sind, der, der nimmt, und die, die nicht gefragt wird – mit aller Lust und Anhänglichkeit, aller Angst und aller Fruchtbarkeit. Die Schwarze gewährte dem Portugiesen den Schlaf, aber nahm ihm die Träume.
Nun wurde auch anderswo das Blut gemischt. Man kann auch auf den Antillen, in Venezuela oder Kolumbien die Mulattin antreffen – aber in Bahia wurde sie nicht geboren, sondern konzipiert. Sie kam nicht nur als Variante ins Straßenbild, wo ihr Gang unverkennbar ist; sie näht den Rock auf Kniehöhe enger.
{28}Bahia schuf für dieses gemischte Blut die entsprechende Umgebung. Nicht die Kulissen, die gekachelten Häuser, die barocken Tore und Säulen, das ist portugiesisch mit jener Abwandlung, die sich aus der Kolonie erklärt, die Straßenzüge, die Veranden um die Häuser verraten den Architekten aus Portugal. Aber das Leben, das sich in diesen Häusern und Straßen abspielt, das ist nur möglich, weil Bahia mehr als nur das Blut mischte.
Es mischte die Legenden und die Vorstellungen, die afrikanischen Gottheiten mit katholischen Heiligen. Die Bahianerin trägt nicht nur das Kreuz am Hals, sondern auch die figa, die schwarze Faust mit dem erigierten Daumen zwischen Zeige- und Mittelfinger. Bahia mischte die Traditionen; es bewahrte nicht nur eine Kampfmethode wie die capoeira, sondern machte daraus einen Duell-Tanz. Und Bahia mischte den portugiesischen Geschmack mit den Gewürzen Afrikas, den Stockfisch mit den Krabben. Der Karneval trägt einen christlichen Namen, aber der Samba ist ein Rhythmus aus Afrika.
Die einzelnen Kontinente sind noch zu erkennen, aber sie haben nur Wert als Anteil. Was Ursprung war, wurde Prozentsatz. Ein Drittel der Bevölkerung ist weiß, die andern zwei Drittel geben alle Stufen und Übergänge von Weiß bis Schwarz.
Bahia ist nicht nur deswegen Mutter der andern brasilianischen Städte, weil von hier aus die andern gegründet wurden und weil Bahia noch heute das einprägsamste Bild einer einstigen Kolonialstadt gibt, wo Mission, Handel und Verdienst gleiche Musen waren. Bahia ist die Mutter der brasilianischen Städte, weil es die Rassen demokratisierte, nicht {29}als Programm, nicht als ideologische Kupplerin, sondern der Tat und der Liebe nach.
In Bahia aber kam Brasilien zu seiner Idee. Hier wurden die Voraussetzungen geschaffen für den brüderlichen Nationalismus: »Somos todos brasileiros« – wir sind alle Brasilianer. Keine andere Nation hat sich eine ähnliche Devise gegeben. Alle anderen Devisen sind ausschließlich und betreffen die Abgrenzung. Hier nicht. Es gibt keinen, der nicht dazugehören könnte; hier stört niemand. Nicht einmal der liebe Gott. Denn auch von ihm heißt es, dass er Brasilianer ist.
1
Die Ersten, die in Bahia ankamen, landeten aus Zufall, der Wind hatte sie auf dem Weg nach Indien abgetrieben. »Sicherer Hafen« heißt der Strand, auch wenn von einem Hafen nichts zu sehen ist.
Drei Jahre dauerte die Kapitänie des Kapitäns Francisco Pereira Coutinho, aber nicht nur die Portugiesen waren seit 1501 da, sondern auch Franzosen, und die handelten mit dem Farbholz brasil, nach dem Brasilien heißt.
Und dann war Caramuru da, von dem kein Historiker weiß, zu wem er hielt und wen er verriet, aber wer in Bahia vornehm ist, rühmt sich dieser zwielichtigen Herkunft.
{30}1549 aber kamen sie, um eine Stadt zu gründen. Ihnen voran der Admiral Tomé de Sousa. Mit ihm 300 Soldaten, die suchten Gold, 6 Jesuiten, die suchten Seelen, 300 Beamte, die hatten schon ihre Stellen, und 600 Verbannte, zu kriminell für das Mutterland, aber für die Kolonien brauchbar genug, von Anfang an waren zwei Schwarze mit.
Da aber die Königin Catarina beliebte fromm zu sein, schickte sie zur Bevölkerung Bahias adlige Waisen. Es trafen Abenteurer aus Italien ein und auf einem andern Schiff Juden, die aus Europa flohen – die Gesellschaft konnte beginnen.
Das Gold, das sie fanden, lag nicht unter der Erde, sondern man musste es pflanzen, und es hieß Zuckerrohr. Die Seelen, die sie fanden, gehörten den Indianern, die hatten willige Seelen, aber ihre Hände waren nicht willig, und so führten die Herren von Bahia Schwarze aus Afrika ein.
An die zwei Millionen Schwarze kamen im Laufe der Zeit in Bahia an, bis die Sklaverei aufgehoben wurde; damit sind nur jene gezählt, welche den Transport überstanden, sie waren nicht nur für Bahia bestimmt, sondern für das Hinterland und den Rest von Brasilien, Bahia war der Hauptumschlagplatz schwarzer Ware.
Sie kamen aus dem Kongo und aus Dahomey, aus dem Sudan und aus Ghana, aus Mosambik und vor allem aus Angola. Je nach ihres Stammes Herkunft unterschieden sie sich: Man rühmte den Bantus nach, sie hätten sich am {31}leichtesten in die neue Situation gefügt, und von den Haussas heißt es, dass sie fast für sämtliche Rebellionen verantwortlich seien.
Da Bahia sehr rasch gedieh, kamen eines Tages die Niederländer, erbeuteten alles, aber wurden nach einem Jahr vertrieben. Die Portugiesen befestigten die Stadt nach der Wiedereinnahme, und Bahia konnte reich und reicher werden – dank des Zuckers und des »heiligen Krauts«, das bald Tabak hieß; für den stehen heute die Namen wie: Suerdieck, Dannemann, Pimentel, Leite & Alves.
Eines Tages aber wurde in Brasilien richtiges Gold gefunden, in den Gruben von Minas Gerais. Das Gold kam den Kirchendecken und Altären von Bahia zugute, aber nicht der Stadt. Die Hauptstadt wurde näher an die Minen verlegt, nach Rio de Janeiro. Seit 1763 kamen weniger Regierungsschiffe in den Hafen von Bahia.
Der Zucker ermöglichte zwar noch vielen ihre Palais, aber die Zuckerrübe hatte mit der Konkurrenz begonnen. Man sah sich in Bahia nach einem andern Gold um und fand den Kakao – die Dessert-Wirtschaft ging weiter.
Es kamen Schweizer, die richteten ihr Kontor ein und wurden Könige des Kakaos. Es kamen die Spanier, die eröffneten und behielten die Konditoreien, und aus dem Libanon kamen Einwanderer, welche mit allem handelten, vor allem mit bunten und billigen Stoffballen.
{32}Aber Kakao war nicht das Letzte, was Bahia bot. Eines Tages lag das Geld tatsächlich in der Erde; Bohrtürme holen es herauf, man kann in der Nacht am Rande der Bucht die Flämmchen des Erdölfeldes sehen. Es kamen amerikanische Ingenieure und Petrographen, und die staatliche Erdölgesellschaft Petrobras richtete sich in der Unterstadt ein.
Sonst wäre Bahia historisch geworden – auch ein Geschäft. Aus dem Palais Unhão wurde das Museum für Volkskunst, aus dem Seminar Tereza das Museum für sakrale Kunst, das Kloster Carmo, wo kaum noch Mönche leben, wird für Ausstellungen wie die Biennale benutzt, und im Fort São Marcelo, das vor dem Hafen liegt, wird ein typisches Restaurant eingerichtet und ein typischer Souvenir-Shop – zuletzt handelte Bahia mit sich selber, und es kamen Touristen, darunter einer wie ich.
2
Nimm eine schwarze Köchin. Nicht eine junge, die denkt an den Mann und nicht an den Koriander. Am besten eine, die keine Kinder mehr kriegt.
Aber nimm eine, die mit den Geistern gut steht. Denn die afrikanischen Götter mahlen die Gewürze mit. Ohne die candomblé hätte sich Bahias Küche nicht erhalten, und es heißt, eine Freimaurerei von schwarzen Köchinnen habe das Geheimnis der Rezepte gehütet.
{33}Schon an der nächsten Straßenecke wirst du die schwarze Köchin finden. Sie kauert hinter einem Tablett, das Tisch und Auslage ist, und neben ihr, auf dem Holzkohlenfeuer, siedet das Palmöl. Geh nicht zu spät, denn am Abend trägt sie die Garküche auf dem Kopf nach Hause.
Als Vorbild für die schwarze Köchin aber diene Dona Maria de São Pedro; als sie starb, trauerten die Dichter, und Bahias Magen weinte. Sie kochte im ersten Stock des Mercado für alle, die im Hafen, an den Quais und auf dem Markt arbeiteten; zu ihr kam die Intelligenz und zwielichtiges Volk, und um Fremde hat sie sich nie besonders gekümmert.
Wenn du heute eine Dona Maria sehen willst, so geh zu Trivial da Dona Maria, an der Ladeira de São Francisco, 33. Frag, wenn du die Nummer nicht findest; erschrick nicht ob dem dunklen Gang und dem ärmlichen Raum, den Plastikblumen und den Wachstuchtischen; ihre Küche öffnet sich auf einen Hinterhof, wo vor der Brandmauer über Brettern ein Huhn spaziert.
Stört dich das Huhn, verzehre es als xinxim, dann wird es in wenig Wasser aufgesetzt, oder noch besser em molho pardo, an schwarzer Sauce, dann wird es im eignen Blut gekocht, dem man Essig beimischt.
Nachdem du die schwarze Köchin hast, schenk ihr einen Turban – weiß, gelb oder hellblau. Die Köchin trägt die Tracht. Das Rezept muss genau sein. Leg ihr um die {34}Schulter ein grelles Tuch und gib ihr weite, gesteifte Röcke, Schale um Schale wie der Zwiebel, und um den Hals häng ihr Ketten und um die Arme schwere Spangen und überlass ihr eine Berlocke und frage nicht, ob als Amulett oder zur Zierde.
Wenn du die schwarze Köchin angezogen hast, gib ihr zum Palmöl die Kokosnuss. Sie braucht Milch zum Sud für den Barsch, der eine moqueca werden will: In Kokosmilch gesotten und in Palmöl gebraten, kommt der Fisch mit einer Zwiebelschwitze auf den Tisch.
Für jede Mahlzeit braucht die schwarze Köchin eine Kokosnuss, und sei es nur zum süßen Abschluss als cocada – weiß, geraffelt, wie ausgeschält, oder braun, wenn mit gebranntem Zucker gemischt, und wenn ein Ei hineingeschlagen wird, dann eben gelb.
Da die schwarze Köchin nun Palmöl hat und Kokosnüsse, geh an den Strand und sammle Krabben. Die liegen hier billig herum. Denn teuer kann die Küche dieser einstigen Sklaven nicht sein. Irgendwo gab es immer die Innereien eines Schweins, Kutteln, die man klein zerhackte, und das Blut vom Schwein, Lorbeer, Knoblauch und Nelken beigegeben – und die sarapatel kann verspeist werden, sie hat am Abend am meisten Aroma.
Wenn du inzwischen die Krabben aufgelesen hast, bring die eine Hälfte frisch nach Hause. Die schwarze Köchin wird sie in die Pfanne tun und Eier darüber schlagen und dir das Ganze als figueira vorsetzen.
{35}Die andere Hälfte der Krabben aber trockne. Erst die getrockneten Krabben geben dem Quiabo-Gemüse und den kuhzungenlangen Blättern des Efó den bahianischen Geschmack. Die getrockneten Krabben wird die schwarze Köchin durch den Wolf drehen, zusammen mit gerösteten Mandeln und Caju-Nüssen, mit aufgeweichtem Brot und Reismehl, mit Zwiebeln und mit Knoblauchzehen, den Fischkopf nicht vergessen, am liebsten zwei, und 50 Gramm Ingwer, nicht mehr. Inzwischen sieden der Barsch und die frischen Krabben, und wenn am Ende alles gemischt ist, kannst du der schwarzen Köchin sagen, wie du die vatapá wünschest, ob hell oder dunkel gebräunt aus der Sonne des Dendê-Palmöls.
Doch iss die vatapá nicht allein, verlange dazu ein acarajé oder ein abará – Pasteten aus Bohnenmehl, du wirst sie aus einem Bananenblatt wickeln, und wenn darin eine acacá liegt, dann muss sie das Gelb des Maises verloren haben und durchsichtig sein.
Nimm eine schwarze Köchin, bist du in Bahia, und gib den Straßen den Geruch des süßen Palmöls.
3
In Bahia beginnt das Gedicht auf der Straße. Nicht in der Rua Chile, wo die teuren Geschäfte stehen und das düsterste Erstklasshotel, und wo feierabends um fünf die tätige Bourgeoisie ihren eleganten Corso spielt.
{36}Nicht auf einem Platz, der nach einem General oder Senator heißt und sonst nach wem oder nach einem Datum. Was soll ein Name wie Marcílio Dias? Das ist Bildung, Geschichte und Schule.
Was aber ein »Leidensweg« ist, das versteht auch das Volk, und über den Leidensweg hüpft, Stufe um Stufe, der Fußball.
Das Gedicht beginnt in den Straßen, nicht weil an den Hauswänden der Verputz blättert und jedes Jahr mit seinem eigenen Farbanstrich durchkommt, nicht weil die Masten fast aus dem Mörtel fallen und die elektrischen Leitungen mit Bäuchen über den Straßen hängen, nicht wegen der Vögel, die in ihren Käfigen singen, und nicht wegen des trottenden Esels und eines Mulatten, der auf einer Bank im Schatten schläft – das ist die Lyrik des Farbfilms.
Das Gedicht beginnt in den Straßen Bahias mit den Straßenschildern, auch wenn sie kaum zu lesen sind, auch wenn die Straßen umgetauft wurden. Und dies Gedicht ist härter, abstrakter, reimlos und da.
Das Gedicht beginnt in einem Viertel wie dem der »Freiheit«, wo jene wohnen, die frei sind von allem, dessen der Mensch bedarf, die auch in »Schanghai« oder in der »Mandschurei« hausen, so ferne Namen erfindet Bahia für die, die nicht im Tennis-Club verkehren und nicht im Club der Portugiesen.
{37}Das Gedicht beginnt, wo eine Anschrift »Paradiesfreude« heißt oder »Strohhalm«. Warum soll einer nicht in der Gasse des »Kleinen Teufels« wohnen, wenn die Nummer nur stimmt; es gibt andere genug mit der Anschrift der »Legalität«, und auch eine »Straße der Abwässer« ist zu finden und ein »Gässchen der Ruhe«.
Für jeden eine Straße und für alles einen Platz.
Wer auf dem »Aussichtspunkt des Jammers« steht, blickt über die Bucht bis zum »Guten Ende«, wo im »Saal der Wunder« die Knochen aus Wachs sind.
Welche Adressen, der Postbote ist unterwegs, auch wenn er sich Zeit nimmt.
Schreib mir einmal an die »Galgenstraße«, und komm einmal, nachmittags um halb vier, rüber an die »Straße der Agonie«.
Die Namen verraten und verheimlichen. Umsonst wird einer bei der »Festung der Kleinen Eidechse« nach diesem Tierchen suchen; das Fort heißt nach einem Typus von Kanone, den die Soldaten so tauften. Und am »Platz der Frömmigkeit«, da verkauften die Kapuziner kostbaren Schmuck, um zu Geld zu kommen.
Aber die Straßen dichten über die Quartiere hinweg ihre Balladen, wie die von jenem, der am »Guten Geschmack des Zimmers« aufwuchs, nun lebt er in der »Straße der {38}sieben Messerstiche« und lässt sich kaum mehr in den »Fünfzehn Mysterien« blicken.
Und die Straßen dichten die Erinnerung für Bahia. Auf dem »Pulverplatz« stand eine Pulverfabrik. Da wurden die Helden des Pernambuco-Aufstands erschossen, jetzt erhebt sich dort der Justizpalast.
Und auf der »Steilstraße der Folter« wird nicht mehr gefoltert. Ursprünglich wurden die Schwarzen auf dem Rathausplatz gezüchtigt, aber dann beschwerten sich die Jesuiten, sie würden beim Lesen durch die Schreie gestört. An der Steilstraße der Folter stehen die Patrizierhäuser von einst, riesige Gebäude, in denen heute zimmerweise Familien wohnen.
Und wo die Sklaven ausgerufen wurden, lernen Schüler zeichnen und nehmen mit dem Stift das Maß der polychromen Säulen, aus dem »Haus des Mitleids« wurde die »Akademie für Kunst«.
Wo aber die Straßen schon mit dem Gedicht beginnen, da hat die Sprache der Straße ihre Poesie.
»Ausgehen« heißt im Dialekt der Bahianer »mit dem Liebhaber fliehen«, und »eine Frau, die gut ist« nennt man »Brötchen«.
{39}4
Die Voraussetzung war gut. Bahia war verwöhnt, ehe es da war. Von einem grünen Meer. Und wer das Grün nicht mag, kann zur Lagune Abaeté gehen; dort ist das Wasser tiefschwarz, dort knien tagsüber die Wäscherinnen und legen die farbigen Tücher in den weißen Sand.
Verwöhnt von einer Bucht, die immer noch vom Fort Santo Antônio beschützt wird und deren Einfahrt der Leuchtturm von Barra angibt. Eine Bucht, die kleineren Buchten ihr Versteckspiel erlaubt und Inseln trägt wie die von Itapariga, ein Ausflug im Sommer und eine kühlere Residenz.
Ein Naturhafen ist die Bucht, offen für alle Schiffe, für die der Entdecker und der Korsaren, der Sklavenhändler und anderer Transporter, auch für amerikanische Schiffe, die in Base Baker ihre Marinebasis haben.
Und verwöhnt von einem Strand, der sich in Strände aufteilt. Der von Itapuã blufft, er sei der schönste; er kommt am meisten im Schlager vor, und man weiß heute nicht, ob er schöner ist oder das Lied, das Dorival Caymmi über ihn sang.
Aber die andern Strände kümmert das nicht – nicht den von Pituba und nicht den von Amaralina; dorthin kommt man schon mit dem Omnibus und braucht keinen eignen Wagen. Den »Garten Allahs« mögen jene vor allem, die die Liebe im Sand gernhaben.
{40}An diesen Stränden stehen nicht nur die Cabannen der Fischer, nicht nur die Rundhütten, mit Palmblättern bedeckt, nicht nur die Sommerhäuser aus Holz – da stehen die Großanlagen der Clubs und ein Hochhaus, das dem Yachtclub gehört; hier wird angesichts des Atlantiks im süßen Wasser des Swimmingpools gebadet, membership, membership.
Die Voraussetzungen waren gut, und Bahia wurde an seiner Küste mit Forts verwöhnt – Schachteln aus Stein, mit Erkertürmen bewehrt, oder unregelmäßige Sterne. Wer studieren will, wie die Militärarchitekten zur Kolonialzeit bauten, geht zum Fort Monte Serate und merkt sich besonders die Zugbrücke.
Und verwöhnt von Kokospalmen, die nicht nur zum Strand gehören, sondern auch zur Silhouette der Stadt; überall stehen die Gruppen, auf den ganzen Plan verteilt, gewöhnlich in Reih und Glied, Soldaten, die den Helm in den Nacken geschoben haben.
Aber nicht nur von Natur aus wurde Bahia verwöhnt, von den Mangobäumen und Zitrusfrüchten, der Baumwolle und dem Kakao, dem Maniok und dem Rizinus – nicht nur von Glimmer und Magnesium, von Asbest und schwarzen Diamanten. Bahia wurde auch vom Menschen verwöhnt.
Es wurde ihm aus Lissabon und Genua Marmor gebracht, und aus Brasilien selbst das Jacarandá-Holz verwendet, das brasilianische Rosenholz. Und Bahia ließ sich von einem {41}Manuel Ignácio da Costa Altäre schnitzen; es ließ sich Azulejos für das Oratorium des Osterkreuzes und für die Kirche »Von unserer Frau der guten Reise« schenken. Es ließ sich die Kathedrale von João Correira vergolden. Und einem Presciliano Silva erlaubte Bahia das Deckengemälde im einstigen Palast der Familie Calmon, und von Teófilo de Jesus nahm die Stadt auch Bilder an.
Die Voraussetzungen waren gut. Bahia wurde die wichtigste Fremdenverkehrsstadt Brasiliens, sie umfasst am fünftmeisten Menschen, hat den drittwichtigsten Hafen, verfügt über eines der ausgedehntesten Hinterländer.
Immer nahe dem Superlativ – im Analphabetismus führend und auch in der Kindersterblichkeit, das Einkommen pro Kopf ist eines der geringsten.
5
Da sich Bahia gefiel, errichtete es sich auf einem Felsen, von dem es auf die Bucht und den Atlantik schaut. Es erbaute sich Terrassen und Türme, um von überall auf das Meer zu blicken, wo Iemanjá, die große Mutter des Wassers, wohnt, der Bahia an den Festen Blumen in die Wellen streut.
Auf dem Felsen baute es sich die Kathedrale und andere Kirchen, die Klöster und die Schulen, den Sitz für den Gouverneur und den Sitz für den Bischof, das Rathaus und die Gerichte. Hier öffnete sich Bahia für Plätze wie den {42}Terreiro do Jesus, der bis heute sein Kolonialgesicht bewahrt hat, und für einen wie Campo Grande, wo das beste Hotel und das Theater stehen, hinter denen die Villenviertel beginnen.
Doch Bahia begnügte sich nicht mit einer Stadt. Es wünschte auch eine Unterstadt und baute sie um den Hafen. Baute die Quais und den Mercado, die Bürotürme und das Kakao-Institut; hier liegen die Konsulate und Banken, die Versicherungen und Handelsgesellschaften.
Beide Städte liebt Bahia, gewohnt, die Liebe zu teilen; aber nur am Tag liebt es sie beide gleich. Am Abend ist die Unterstadt tot. Da warten noch einige auf der Praça Visconde de Cairu auf die Omnibusse, welche in die Vororte fahren. Die Fotografen haben ihre Apparate eingepackt und die Prospekte für den Hintergrund der Porträtaufnahmen zusammengerollt; kein Schuhputzer jagt einem andern die Kunden ab. Hunde und Katzen machen sich an die Abfälle, und ein Marinezögling huscht noch zur rechten Zeit in die Kaserne.
Die Unterstadt ist für den Morgen geschaffen, wenn die Schiffe ankommen und die Tropenfrüchte verladen werden, die ein Fremder nicht nach dem Namen, sondern mit dem Fingerzeig kauft. Dann wird aus den Schiffsbäuchen das Farofa-Mehl geschöpft. Schiff an Schiff drängt sich, so dass man zu Fuß über das Becken könnte. Jungen tauchen nach Früchten, die beim Verladen zwischen die Schiffe ins Wasser fallen. An den Quais ertönt die Litanei der Ausrufer und {43}Red und Gegenrede jener, die markten. Und wenn die Wärme kommt, dann mischt sich in den Markthallen der Geruch des gesalzenen Fleisches mit dem von Häuten, von Fett und Fisch, von Schweiß und Zuckerrohrschnaps. Einer bietet Salben an und einer Schildpatt, Hängematten und ein Krokodil aus dem Amazonas, und ein blinder Bettler klappert in einem Nickelteller mit Münzen, die keinen Wert mehr haben bei der Inflation des Papiergeldes.
Am Abend aber liebt Bahia nicht nur die Oberstadt: Dort spielen die Kinos, die Billardsäle sind überfüllt, das Eis wird in Ruhe geschleckt, in den buates, den Nightclubs, drehen sich die Platten. Am Abend liebt Bahia nicht nur die Vororte und die Haine, wo der Gong zur candomblé ruft und die Kalebassen in ihrer Monotonie die Ekstase vorbereiten. Zu der Stunde liebt Bahia nicht nur die Parks und die Forts, deren Befestigungswerke als Grünanlagen dienen und wo auf einer Bank zwei Liebespaare sitzen, und Bahia liebt nicht nur die Küstenstraßen, auf denen der Abend verbummelt wird.
Zu der Stunde liebt Bahia besonders das Zwischenland, zwischen der Stadt oben und unten, wo Kakteen wuchern und aus den unbefestigten Burgen der Bordelle Musik und Streit ertönen.
Zwischen diese Oberstadt und Unterstadt aber hat Bahia den Lift Lacerda gestellt. Als zum ersten Mal ein mechanisches Transportmittel die Höhen überwand, da protestierten die freigelassenen Sklaven und pochten auf ihr Vorrecht, {44}in Sänften die Leute von der einen Stadt in die andere tragen zu dürfen, aber sie verloren gegen den Lift. Er ist der Eiffelturm Bahias.
Aber beide Städte wachsen, auch die Unterstadt kam zu ihrer Kirche und die Oberstadt zu ihren Banken. Die Wolkenkratzer wachsen Bahia über seinen Kopf der braunen Ziegel und Türme. Und Bahia wächst, nicht zuletzt weil aus dem Hinterland der Landprolet kommt, er tauscht seine Not mit einer andern Not. Aber in der Stadt hat er vor Augen, wovon er träumt.
6
Der Portugiese rühmt sich, unblutig zu sein. In seinem Stierkampf wird der Stier nicht getötet. Brasilien löste sich ohne Krieg vom Mutterland, es war nicht Angola und nicht Mosambik. Ohne Blutvergießen, heißt es, wurde Brasilien unabhängig. In Bahia aber fielen Schüsse.
Für ganz Brasilien begann die Unabhängigkeit mit dem Jahre 1822. In Bahia aber ein Jahr später. Der 7. Januar ist das Datum: Da wurde die Flotte der Portugiesen geschlagen, und Madeira de Melo zog mit seinen Truppen ab.
Portugal hatte sich in Bahia so lange gewehrt, weil es ahnte, dass es nicht nur eine Kolonie verlor, sondern eine Konzeption.
{45}Damals wurde Joana Angélica de Jesus ermordet. Sie war als Mädchen ins Kloster da Lapa eingetreten und war bis zur Äbtissin emporgestiegen. Als die Portugiesen Eintritt ins Kloster verlangten, verwehrte dies die Frau, und sie starb an den Bajonettstichen am Eingang. Sie verteidigte ihren Bereich der Religion und wurde eine Heldin der Unabhängigkeit.
Denn Bahia hat nicht nur seine Götter und Heiligen, sondern auch seine Helden, wenn auch die nicht immer Namen haben, sondern bloß Schneider heißen, weil sie am Aufstand der Schneider teilgenommen hatten. Sie verlangten schon 1789 die Unabhängigkeit, das war dreißig Jahre zu früh, und was die Republik betrifft, irrten sie sich nochmals um sechzig Jahre. Für diesen Irrtum wurden sie gefoltert und getötet.
Aber der Aufstand von 1789 hat den von 1837 nicht verhindert. Es waren Mulatten, die für ihr Recht kämpften und nach dem Abzug der Portugiesen ihren Anspruch meldeten. Aber auch die Schwarzen selber bereiteten ihre Befreiung vor; die Aufständischen wurden zwar 1835 niedergeschlagen, aber da hatte schon ihr Dichter zu schreiben begonnen.