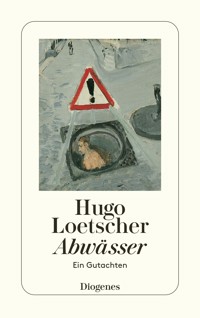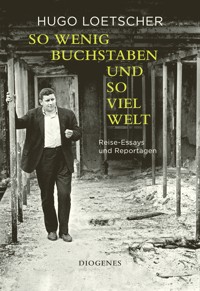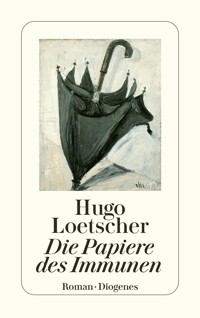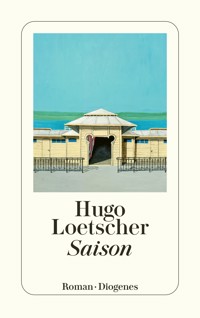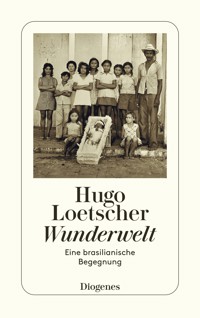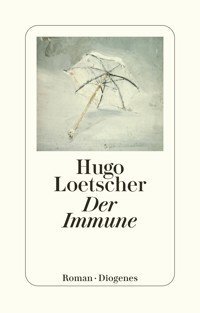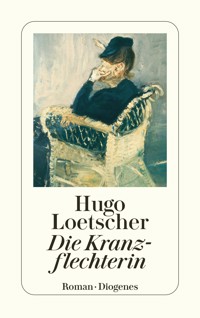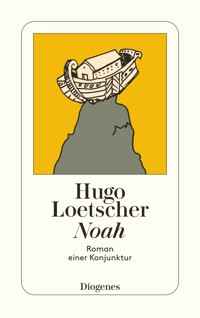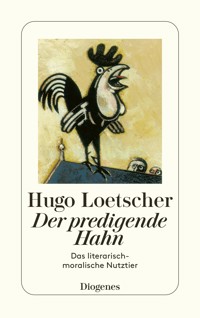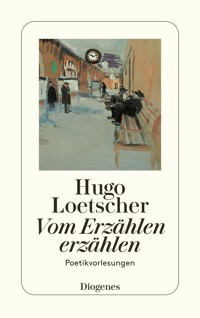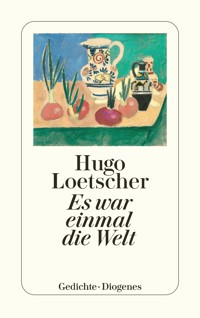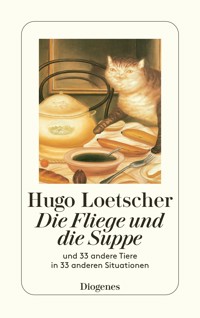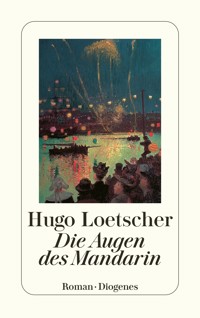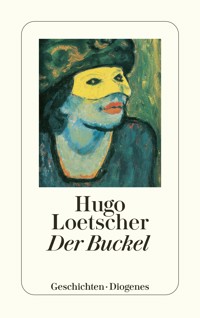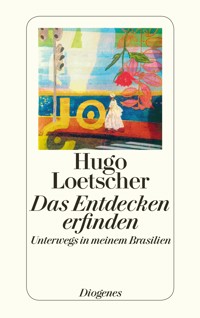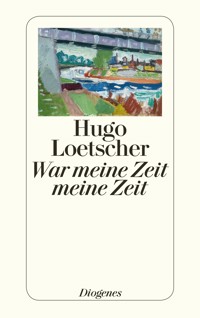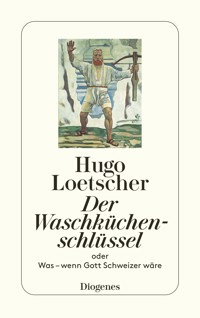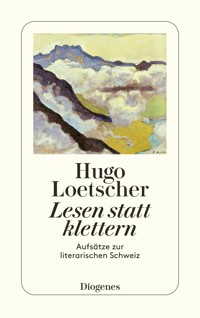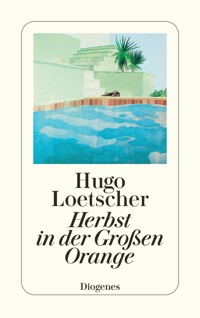
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Los Angeles, die Große Orange, lauter Schnitze um ein Nichts. In solchen Schnitzen hatte er seinen Herbst verbracht. Wie grün war dieser Herbst.« Loetschers melancholische Satire umkreist das Thema ›Herbst‹ vielfach: die Jahreszeit in einer Landschaft zwischen Wüste und Ozean, in der es eigentlich keinen Herbst gibt; den Lebensherbst der Hauptfigur; den Herbst schließlich einer Zivilisation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hugo Loetscher
Herbst in der Großen Orange
Diogenes
Das Grün der Zugereisten
Los Angeles, die »Große Orange« – lauter Schnitze um ein Nichts. In solchen Schnitzen hatte er seinen Herbst verbracht. Wie grün war dieser Herbst.
Zwei Grün hatte er. Eines, das man aussäte, und eines, das man per Meter von der Rolle kaufte. Einen Rasen, der von selber wuchs, mit so viel Chlorophyll, als sei er im Labor erzeugt worden. Und einen zweiten Rasen, den man aufklebte, von solch unregelmäßiger Struktur, als habe nicht eine Maschine, sondern der Zufall der Natur mitgewirkt. Lagen die beiden im Freien nebeneinander, war nicht auszumachen, für welchen er den Mäher brauchte und für welchen das Fleckenwasser.
Als Kontrastprogramm zeichneten sich am Horizont kahl und nackt die Hügel ab; sie stiegen gleich hinter der Küste hoch, und ihre Ketten verliefen sich in alle Richtungen.
Als H. herüberflog und sie sich der Großen Orange näherten, hing unter dem Flugzeug eine schäbige Decke aus Rauch und Wolken, zerwühlt wie nach einem schlechten Schlaf. Zwischen den Rissen sah er vereinzelte Buschfeuer, riesige Motten, die sich durch die Hügel fraßen, Löcher hinterlassend, die nicht mehr kunstzustopfen waren.
Später lernte er auf seinen wahllosen Fahrten unzählige dieser Hügel kennen. Gleich hinter den Gärten und Rasen wurde der Boden gelb und struppig. Nur noch Schotterstraßen führten hinauf zu den knapp bewachsenen Kuppen. Dort, neben bloßem Fels und inmitten von Geröll, machte der Chaparall mit seinem Gestrüpp auf Immergrün, als ob dieses nicht leichter Zunder wäre.
Nein, es war keine Zeit, um mit Streichhölzern zu spielen. Das hatte er auch nicht im Sinn.
An Gelegenheit, sich an die Sirenen zu gewöhnen, fehlte es jedenfalls nicht. Einmal schwoll das Heulen an, daß die Fensterscheiben zitterten; verstört sah er durch die Lamellen der Storen. Das Warnlicht blinkte direkt vor dem Haus, aber es gehörte nicht einer Ambulanz.
Wegen seiner Rasen brauchte H. kein Schaumlöschgerät bereitzustellen. Für den einen kam genügend Wasser aus dem Schlauch; für den andern stand ein Staubsauger zur Verfügung. Beide blieben fußsohlenfreundlich wie am ersten Tag des Einzugs.
Der Hausmeister, der ihm die Schlüssel überreichte, erinnerte sich an die Dürre vor ein paar Jahren, an regenlose Monate und Wochen der Entbehrung: zweimal auf die Toilette gehen und einmal spülen.
Mehrmals hatte der Hausmeister dazu angesetzt, den Namen des neuen Mieters auszusprechen, bis er ihn amerikanisierte. H. nickte, er schrieb auf den Karton ein Initial. Er unterließ es, das Namensschild an der Tür seines Appartements anzubringen. Das Lämpchen neben der Klingel beleuchtete einen weißen Flecken.
Anfänglich, als H. noch über keinen Wagen verfügt hatte, war er oft in der Nachbarschaft flaniert. An zaunlosen Vorgärten vorbei war er Eigenheim um Eigenheim abspaziert und Straße für Straße. In den Gärten und auf den Zufahrtswegen war an diesen Frühnachmittagen kein Mensch zu sehen, so daß er sich wunderte, weshalb die Häuser Eingänge hatten. Weder ein Transistor noch das Schlagen einer Wagentür waren zu hören, einzig das schleifende Zirp-Zirp der mechanischen Grillen, die den Rasen sprengten. Also mußte es Menschen geben, mindestens die, welche die Sprinkler angestellt hatten, aber vielleicht war das die letzte Handlung gewesen, bevor sie weggezogen waren.
Auch der Friedhof, den er aufsuchte, war grün. Er war seinetwegen mehrmals mit dem Bus umgestiegen. Gleich hinter dem Portal und den Mauern hatte eine einzige Rasenfläche begonnen, entlang den Abdankungshallen und Parkplätzen. Als Trauermobiliar zuweilen eine Nische, Bänke und eine Pietà. Bunt hoben sich die Frischgräber mit ihren Sträußen, Bouquets und Kränzen ab. Ansonsten ein durchgehendes Grün, im Schatten alter Baumbestände, sanft und wellig und ohne sichtbares Ende. In den verschwiegenen Grund waren Bronzeplatten eingelegt. Als H. Namen, Daten und Sprüche las, entdeckte er eine Platte, die nur mit einer Nummer versehen war. Lautlos bewegte er sich auf dem dichten Gras. Als er vom Rasen auf die Straße zurückkehrte, kamen seine Schritte wieder zu einem Echo.
So grün sein Herbst war, die vorhandenen Flüsse hätten nie ausgereicht, ihn so grün zu machen. Auch der nicht, der nach der Großen Orange hieß. Oft schon hatte H. sich vorgenommen, anzuhalten, wenn er in seine Nähe kam. Bis er es endlich tat. H. zog sich an der Brüstung hoch und beugte sich über das Geländer, vom Fluß her stieg ihm eine Staubwolke entgegen.
Zwar stieß H. auf seinen Fahrten am Straßenrand immer wieder auf Schilder, die ein Wasser anzeigten. Aber die Flüsse wurden nicht angeschrieben, damit man wußte, wie sie hießen, sondern damit man zur Kenntnis nahm, daß es welche gab.
Bei einer Party hatte jemand erzählt, daß weit weg in den Bergen oben Seen zu finden seien, deren Wasser nicht aufbereitet sei, mit Fischen drin, die nicht ausgesetzt wurden, eine Freizeit-Natur als Tip fürs verlängerte Wochenende.
Aber einer seiner ersten Flirts hatte einem kleinen Stausee gegolten. Dieser lag versteckt am Rand des Hügels, wo turmhohe Stahlgerüste die einzelnen Lettern stützten, welche »Hollywood« ankündigten. Nur weil H. eine Abzweigung verpaßt hatte, war er an diesen Ort gelangt. Er war überzeugt, das Reservoir entdeckt zu haben, von wo einst all das Wasser für die Schlachten mit den Gartenschläuchen in den Stummfilmen hergekommen war. Es lockte ihn, über den Maschendrahtzaun zu klettern; ihm war ein Gebäude aufgefallen, das mußte die Garderobe sein, wo sich die Goldfische umzogen.
Grün war dieser Herbst nicht wegen der Flüsse, die ihren Lauf nahmen, sondern dank der Kanäle.
Stundenlang fuhr H. an den Ufern solcher Wasserwege entlang. Auf der einen Seite den linearen Lebenslauf von Kanälen, die als Ereignis nur den Wechsel des Wasserspiegels kannten. Auf der andern Seite Felder, zuweilen von einem hellen Grün, wenn die Saat jung war, und dann wiederum in fleckigem Grün, das mit dem Alter eingedunkelt war.
H. hatte die Absicht gehabt, eigens eine Fahrt zu dem Fluß zu machen, den man gezwungen hatte, sich an einer andern Stelle ins Meer zu ergießen, als er es sich selber vorgenommen hatte.
Aber H. hatte es bleiben lassen. Nun war es in diesem Herbst auch zu ganz anderem nicht gekommen.
Verschiedentlich schon hatte er sich vorgenommen, den Aquädukt aufzusuchen, nur schon, weil das Wort einen südlichen Klang hatte. Zudem hatte ihn, der Gutachter von Beruf war, eine Historie gelockt, wie man mit Schaufeln, Revolvern und Paragraphen einander das Wasser abgräbt.
Aus purem Zufall war er auf den Aquädukt gestoßen; er bestand nicht aus Bogenbrücken, die sich über die Landschaft spannten, es war ein Kanal, aber einer, der mitten durch die Wüste floß.
Als Kontrast zu seinem Grün boten sich H. nicht nur knapp bewachsene Hügel, sondern auch Wüsten.
Man mußte nun einmal das Wasser für die Große Orange dorther holen, wo es mit Wahrscheinlichkeit regnete oder schneite. Hunderte von Meilen aus dem Norden und indem man einen All-American-Canal baute. Nachts spät wollte einer mit H. wetten, daß man vom Mond aus nur zwei von Menschenhand geschaffene Dinge sehe. H. war weder auf die Chinesische Mauer noch auf besagten Kanal gekommen, doch versprach er, der Sache bei Gelegenheit nachzugehen.
Es war ein Herbst der Schleusen, Dämme und Pumpwerke. Zwar wurde gerade geprüft und nachgezählt, wieviele Staumauern nicht sicher oder gar undicht waren. Einer der Seen, an denen sich H. in diesem Herbst aufgehalten hatte, war entstanden, weil einst Dämme eingestürzt waren.
Aber auch wenn alle Pumpwerke ausgesetzt hätten und alle Wasseruhren stillgestanden wären, hätte H. nach wie vor ein Stück Grün besessen, jenes, das sich so zuschneiden ließ, daß man es den geschwungenen Rabatten anpassen und mit ihm Stufen auskleiden konnte, und das man regelmäßig desinfizierte.
Auf diesem Rasen gediehen die Pflanzen in Töpfen. In einem eine Agave. Bis zum Balkon erigierte ihr Stengel, schief und dürr, und die Dolden vertrocknet. H. ging selten daran vorbei, ohne einen Blick auf die Pflanze zu werfen, die sich Jahre darauf vorbereitet, um für ein einziges Mal in die Blüte zu schießen. Die unteren Blätter waren geknickt; aus einigen war das Fleisch weggestorben, die schieren Fasern bildeten ein Gewebe, als habe man aus dem Sisal bereits ein Stück Teppichvorleger verfertigt.
Am Rande des andern Rasens aber wuchs direkt aus dem Boden ein Efeu, er kletterte mit kleinen Beamtengriffen am Ziermäuerchen hoch. Neben ihm eine Tanne, die sich nach weißen Weihnachten sehnte. Jenseits der japanischen Gartenplatten ein Kastanienbaum; er warf Schatten aus einer Zeit, als es noch keine Sonnenschirme gab.
Dieser andere Rasen setzte sich fort in den nachbarlichen Hintergärten und Innenhöfen und auf dem Vorplatz des Apartmenthauses in anderen Vorplätzen. Er fand sich wieder als Streifen zwischen Trottoir und Randstein, er wies auf ein Pendant hin auf der Gegenseite. Die grünen Bordüren zogen sich beidseitig den Straßen entlang, nur durch Fahrbahnen unterbrochen, und sie gingen hinter den Stopplichtern weiter, Kreuzung um Kreuzung, in Richtung Ozean und in Richtung Wüste.
Allerdings: Das eine Grün war an einzelnen Stufen durchgescheuert und stand an einer Ecke ab, weil der Belag nicht mehr hielt. Aber auch das andere Grün war gefährdet.
Eines Nachmittags fuhr ein Lieferwagen vor. Auf der Karosserie war die Empfehlung der Rasenfarm zu lesen, die sich auf Sportplätze und ähnliche Anlagen spezialisiert hatte. Es wurden Rasenziegel ausgeladen und gegen die dürren ausgetauscht, welche die beiden Mexikaner ausstachen; sie polsterten den Erdboden neu. Als H. hinterher darüberging, federte es leicht.
Vernachlässigte man den Rasen, wurde er strohig und bekam Grasausfall. Dann wurde er dem ariden Boden ähnlich, den er zudecken sollte; solch gelblichen Flecken war H. überall mitten im Grün der Großen Orange begegnet. Hätte man diesen Boden sich selber überlassen, H. hätte in diesem Herbst vorgefunden, was von Anfang an zur Verfügung stand: ein besseres Ödland.
Am Fuß eines Hügels war ein Stück Land so hergerichtet worden, wie es ausgesehen hatte, bevor Kolonisatoren, Soldaten und Viehzüchter gekommen waren. Hier hatte H. zum ersten Mal die Wildeiche gesehen. Diese Einheimische hatte es sonstwo in der Großen Orange immer schwerer mit dem bewässerten Terrain, da sie sich auf den ursprünglichen trockenen Boden eingestellt hatte.
Aber es war nun einmal nicht bei den Wildeichen geblieben, deren Früchte einst die Indianer sammelten, um aus ihnen einen Brei zu machen. Man hatte es auch nicht bei den Olivenbäumen bewenden lassen, welche spanische Missionare zogen, und nicht bei den wenigen Reben, aus deren Trauben die Franziskaner ihren Meßwein preßten.
Schließlich verdankte die Große Orange ihren Namen einer Frucht, die nicht von Anfang an in diesem Ödland gewachsen war.
Die Orange gehörte zum täglichen Morgengruß. Sie lag als dünne Scheibe neben Bratkartoffeln. Oder die Scheibe war dicker und an einer Stelle eingeschnitten, so daß man sie aufstellen konnte und sie neben den Eiern einen Spagat machte. Oder die halbe Orange war so ausgezackt, daß sie als Krone auf den Farmers Würstchen und dem gebratenen Corned Beef thronte.
Als H. durchs Zitrusgebiet fuhr, ließ er sich von der Verbotstafel nicht abhalten. Zwischen Reihenbäumen standen Öfen und Windmaschinen, um die erwärmte Luft gegen die Äste zu treiben. Im dunklen Laub reifte hinter makellosen Schalen ein Konzentrat heran, das man mit Vitaminen anreicherte.
Und in Riverside hatte er eigens die Gedenkstätte für die Nabel-Orange aufgesucht. Er war beinahe geniert, weil er mit leeren Händen gekommen war. Er hätte am Denkmal der Unbekannten Orange einen Kranz niederlegen mögen, als Hommage von einem, der aus der Schweiz zugereist war, an eine, die aus Brasilien stammte.
Die Nabel-Orange, die im Winter trug, und die aus Valencia, die es im Sommer tat, sie waren beide nicht von hier, so wenig wie H. oder die Zitrone aus Sizilien.
Es war ein Herbst unter Zugereisten.
Nicht daß die Rose die Ananas gesucht hätte oder der Pfefferbaum die Haselnuß; aber es war Platz genug da, daß sie nebeneinander wachsen konnten. Genau wie die Bougainvillea neben allem gedieh, und nicht nur neben der Kiefer. Ein Nachbar hatte im Schatten von Bananenstauden ein Büschel Edelweiß gepflanzt; er war bei einem Möbel-Quiz mit seinen Schätzungen am nächsten an die Verkaufspreise herangekommen und er hatte eine Reise nach Österreich, alles-inbegriffen, gewonnen.
So war das Grün in diesem Herbst auch voll Erinnerung. Selbst wenn der Nußbaum neben dem Supermarkt nichts zu berichten hatte und die Linde nicht an einem Brunnen vor dem Tor wuchs, sondern neben einer Autowaschanlage, und die Akazien an den Borden der Schnellstraße gar nicht zu Worte kamen.
Die Erinnerung war auch mit dem Farn da. Seine Blätter hingen tief hinunter bis zu den Tasten des Getränkeautomaten, und er verdankte die Feinheit seiner Blätter einer Stanzmaschine.
Das Grün des Farns war so gleichmäßig dunkel wie das der Palmen in der Bar des benachbarten Hotels, nur daß von diesen regelmäßig Staub gewischt wurde. Ihre Kübel standen auf Säulen, und die Kunststoff-Fächer zitterten leicht im Luftzug der Klimaanlage.
Von allen Palmen waren nur jene von Anfang an dagewesen, die mit dünnen Stämmen in den Himmel ragten. Noch wenn es windstill war, erriet man, woher für gewöhnlich der Wind wehte; die Bäume krümmten sich oben in die Richtung, in die er sie gezwungen hatte. Waren sie in Reihen gepflanzt, beugten sie sich als Schicksalsgenossen alle gleich, und doch leistete jede auf eigene Weise Widerstand.
Palmenreich war der Herbst dank Palmen, die in Java oder am Mittelmeer, in Afrika oder auf den Kanarischen Inseln beheimatet waren.
Ihre Stämme waren behaart oder kahl oder gedrungendick. Den einen lappten unter dem Kranz der frischen Blätter die alten dürr und kraftlos wie ein Rundherum-Bart herab, klotzig verholzten bei andern die Narbspuren der abgeschlagenen und abgefallenen Blätter. Manche Palmen fächelten sich weit oben Luft zu, und andere stießen ihre Stilettblätter in die Luft, als könne man diese ritzen.
Zwischen den Betonwänden einer Versicherung und einer Erdölgesellschaft stand eine Palme für sich allein; zu welcher Tageszeit H. auch vorbeikam, ließ sie ihren geknickten Schatten auf den Mauern wandern. Am Weg zum Drugstore schossen Ensembles von zwei, drei Exemplaren aus dem Boden. Kaum eine Straße in der Nachbarschaft, die nicht von Palmen gesäumt gewesen wäre. Als H. begonnen hatte, die Straßen der Großen Orange zu bereisen, fuhr er in allen Orangenschnitzen durch Palmenalleen, die sich in der Ferne verjüngten. Immer wieder schlossen Palmen den Horizont ab, und nicht nur am Ozean.
Plötzlich aber führte der Wind der Nase einen Schwall von Eukalyptus zu, überraschend, aber nie so scharf wie der Kaligeruch von den frisch gedüngten Feldern. Dieser Eukalyptus weckte in H. die Erinnerung an ein Bubenbett, in dem eine Erkältung kuriert werden mußte. Über dem Kopf eine Decke, im Dampfkessel kochte das Wasser und die Watte im Inhalator war mit dem ätherischen Öl des Eukalyptus getränkt.
Hier aber war nicht nur die Luft schwer von Eukalyptus, sein Geruch stieg auch vom Boden auf. Manchmal zertrat H. die grauen Kapseln absichtlich, oder er riß ein Blatt ab und zerrieb es zwischen den Fingern. Tief atmete er den Geruch ein.
Unter solchen Bäumen schüttelte ihn einer seiner ersten Anfälle, so daß er sich an einem Parkingmeter festhielt. Ein Passant, einen Hund an der Leine, blieb stehen und empfahl ihm Holundersirup.
So selbstverständlich der Eukalyptusgeruch zu seinem Herbst gehörte, die Bäume stammten aus Australien wie die Zeder aus dem Libanon oder die Pappel aus der Lombardei oder der Ginkgo aus China – ein Fossil von einem Baum, der im Reich der Mitte alle Dynastien überdauert hatte, weil er in Klöstern gehalten wurde, und der nun in der Großen Orange wuchs, resistent gegen Insekten und immun gegen Abgase.
All diese Wurzelträger genierten sich nicht, weil sie Kontinente und Länder hinter sich gelassen hatten. Sie machten nicht auf ewige Natur, als hätten sie hier schon immer ihre Wurzeln gehabt.
Manche der Bäume waren stolz, Baumschulen durchlaufen zu haben und nicht analphabetischer Wildwuchs zu sein, auch wenn sich die Zwergzypressen pudelhaft benahmen, getrimmt, als hätte der Gärtner die Brennschere benutzt.
In der Großen Orange hatte nicht nur der Wind die Samen verteilt, sondern auch die Post. Die Bäume, Büsche und Blumen hatten sich nicht wegen einer zufälligen Biene oder wegen irgendeines Zwischenträgers vermehrt. Samen waren einst in Planwagen angekommen und andere später im Flugzeug. Die meisten waren durch ein Einwanderungsbüro geschleust worden, auch wenn unzählige illegale Setzlinge wucherten. So hatten die Pflanzen für gewöhnlich nicht nur einen lateinischen Namen, sondern auch eine amerikanische Niederlassungs- und Arbeitsbewilligung. Nicht einmal das Unkraut stammte von hier.
Auch in diesem grünen Herbst gab es Bäume, die ihre Blätter verloren. Die Amber war eigens gepflanzt worden, um während einigen Wochen das Schauspiel von Herbstfarben zu bieten. So vergaß auch H. nicht, daß der Herbst anderswo anders war, zum Beispiel dort, wo er seine feste Adresse hatte.
Daneben aber blühten in diesem Herbst Bäume, solche, die von der südlichen Halbkugel stammten. Auch wenn diese in der Großen Orange gediehen, sie hielten sich nach wie vor an den Wechsel der Jahreszeiten, wie er sich in ihren Herkunftsländern vollzog. So trugen sie Blüten, wenn zuhause Frühling und in der Großen Orange Herbst war, und sie hatten ihren Herbst, wenn die Große Orange Frühling feierte.
Bäume, die man importiert hatte, und Büsche, die umgesiedelt worden waren, Verpflanzte, Emigranten und Eingewanderte; sie machten es möglich, daß dieser Herbst grün war, wie bisher keiner. Aber dieser grüne Herbst war nicht nur der Jahreszeit nach ein Herbst.
Die mobilen Himmel
In diesem Herbst hatte H. auch mehr als einen Himmel. Zunächst einmal den von Südkalifornien und den von Paramount.
Der eine hing über der Großen Orange und ihren Schnitzen, er breitete sich über den Wüsten und dem Ozean aus. Er fand sich mit Vorliebe wieder in den blau gestrichenen Swimmingpools, blitzte im Chrom der Autos und spiegelte sich in den Glaswänden der Wolkenkratzer.
Der andere lehnte an eine Fassade, dahinter in ganzer Länge ein Streifen des Aufnahmestudios, zurückversetzt ein Hügelzug und darüber der erste Himmel.
Dieser obere Himmel konnte sich verdüstern und verhangen sein. Auf der Riesenleinwand hingegen blieben die Wolken anhaltend weiß und hatten keinen Mundgeruch. War der Stoff lottrig, wurde er nachgespannt.
Zweierlei Blau hatte H., eines, das sich veränderte, und eines, das reparierbar war.
Nun erwartete man von dem oberen Himmel nichts anderes als Bläue, auf jeden Fall rechnete niemand mit Regen.
Obwohl – einmal tröpfelte es. Gar in den Feierabend hinein. Selbst die Verkehrsampeln wurden nervös, und keine Schnellstraße war mehr schnell genug. Jeder steuerte seinen Wagen so rasch als möglich zum heimatlichen Parkplatz, und jeder wollte vor der Sintflut noch einmal die lieben Seinen umarmen und in den Versicherungspolicen das Kleingedruckte nachlesen. Aber als sie nach dem letzten Gang zum Eisschrank vereint vor dem Fernsehapparat saßen, erblickten sie auf dem Bildschirm den Regenbogen in allen Farben des Farbfernsehens.
Wenn doch einmal Wolken bis in die Hügel hineinreichten und alles grau verhangen war, und wenn es einmal nicht nur nieselte, sondern der Wind den Regen ins Gesicht peitschte, die Straßen glitschig waren und der Pullover vor Nässe schwer, dann nur in den drei Tagen, als H. aus der Großen Orange auf und davon gefahren war.
Es könne auch hier tüchtig schütten, monierte der Hausmeister. Dann würden die Häuser in den Canyons, die auf Pfähle gebaut sind, einknicken und absacken und alles, was weiter unten stehe, erdrücken. Ströme von Schlamm und Dreck kämen herunter, die nähmen auch Autos mit, es gebe immer Vermißte. Tagelang seien Straßen gesperrt. Es würden Sandsäcke verteilt, um die Böschungen zu polstern und sie am Rutschen zu hindern.
Der Hausmeister malte diese Möglichkeit aus, um von einem Tropenregen reden zu können, den er wie sonst nur wenige kenne. Er erwähnte ungern den Krieg, der ihn zum Veteranen gemacht hatte, aber er wies bei Gelegenheit darauf hin, daß er ein Ex war. Beim Sortieren der Post strich er plötzlich über die Prothese unter seiner Hose:
»Die erste Rate.«
Was immer der Hausmeister zu bedenken gab, es hatte keine Gültigkeit für den Herbst, den H. in der Großen Orange verbrachte.
Selbst der Salat, den H. antraf, kümmerte sich nicht um das, was über ihm geschah. Quadratmeilen um Quadratmeilen gedieh er auf den Feldern. Mochte die Sonne ihren täglichen Aufgang ein paar Minuten verschieben, die Schleusen öffneten sich jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit und ließen soviel Wasser durch, wie für das Gedeihen notwendig war. Der Salat hatte sich darauf eingestellt, in einem gleichmäßigen Milieu aufzuwachsen, behütet vor Blattbefall und ohne Schnecken-Trauma. Jeder Regen von oben hätte seinen Haushalt durcheinandergebracht, und er wäre im zusätzlichen Wasser ersoffen und verfault. Von dem Schock hätte sich kein Salatherz erholt, und keines seiner Blätter hätte seinen knackigen Charakter behalten.
Wenn sich der Salat schon nicht über diesen Himmel Sorgen machte, wie hätte H. es tun sollen, der den Hahnen selber auf- und zudrehte.
Unbelehrbar blau konnte der Himmel sein, und er schwindelte mit Wolken, die nicht einmal ein Versprechen brachen, so wenig hatten sie in Aussicht gestellt.
H. bemerkte den jungen Mann erst, als dieser aufsprang und beinahe das Tischchen umwarf. Die Hecke des Straßencafés nahm sich wie ein Rednerpult aus. Aber der Twen suchte kein Publikum, als er mit seinen Fäusten gegen den blauen Himmel anging. Jetzt hätten in Minnesota die Herbststürme eingesetzt. Jetzt sei es dort naß und kalt und man müsse zusammenrücken, um nicht zu frieren. Er komme von dort, er sei dort Lastwagen gefahren, die würden im Dreck steckenbleiben so tief bis zur Führerkabine, dann brauche man Bretter und Kies, und man müsse schaufeln auf Teufel komm raus, das sei ein Klima, das einem wenigstens erlaube zu fluchen.