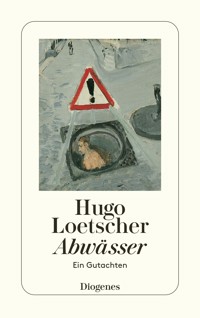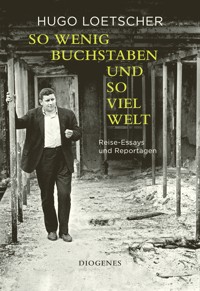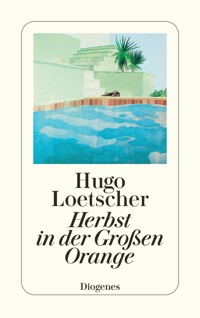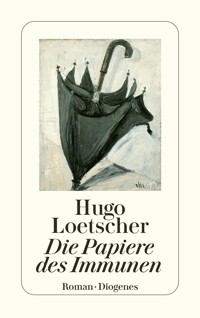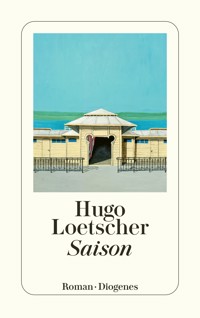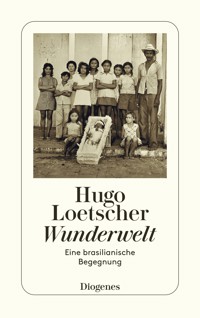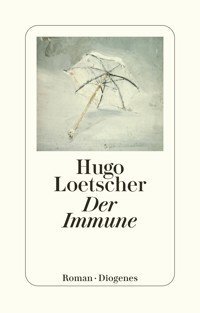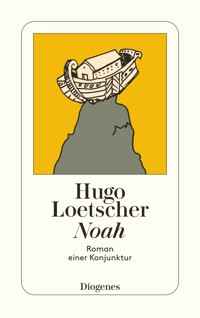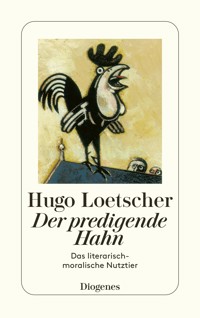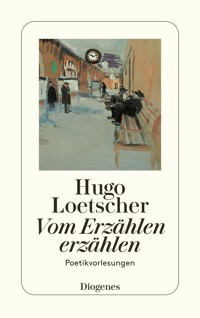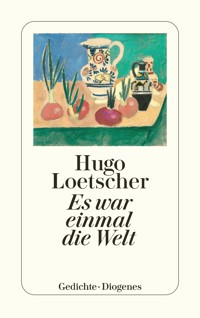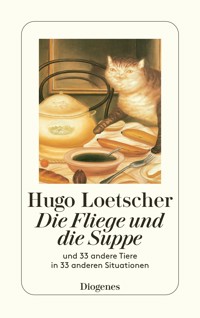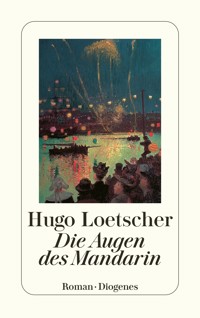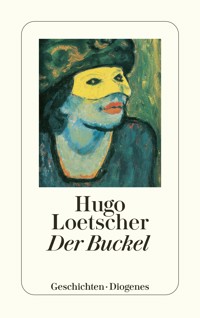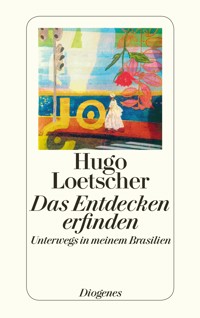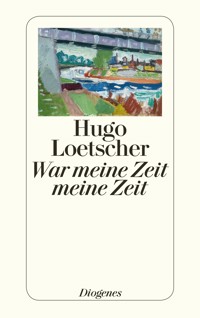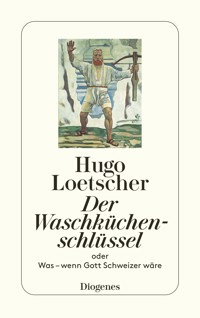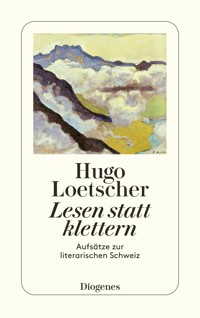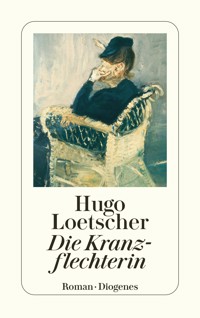
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»›Jeder soll zu seinem Kranze kommen‹, pflegte Anna zu sagen; sie flocht Totenkränze.« So beginnt dieser Roman, in dem nicht nur Einzelschicksale, sondern eine Stadt, eine ganze Epoche im Symbol der Kränze Gestalt gewinnen. Um Annas karges Leben gruppieren sich die Lebensläufe der Menschen ihrer nahen Umgebung und all jener, denen sie mit Tannenreis, Lorbeer, Nelken und Rosen den letzten Dienst erweist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hugo Loetscher
Die Kranzflechterin
Roman
Diogenes
Jeder soll zu seinem Kranze kommen«, pflegte Anna zu sagen; sie flocht Totenkränze. Für sich hatte sie ein einziges Mal einen Kranz geflochten, aber dieser Kranz hätte einer Kranzflechterin nicht zu Ehren und nicht zu Einkommen verholfen. Damals waren ihre Hände eher rascher als geschickt, jedoch jung. Nun war ihr erster Kranz auch nicht für ein Grab.
Als sie den Myrtenkranz in den Händen hielt, als könnte er auseinanderfallen, schien er ihr zu dünn für den morgigen Tag. Also ging sie in den Garten. Aber am Draht schnitten sich die Narzissen den Kopf vom Stengel. Da riß Anna Wurzelstöcke aus, wickelte von der Bohnenstange Bast und band damit die jugendzarten Runzelblätter der Primel auf den Myrtenkranz, Sie bückte sich zum Birnbaum und brach Knospen, die an ihren Fingern klebten, und lachte die Vögel aus, die vor ihr auf den Apfelbaum flüchteten. Da ihr Spinat gefiel, nahm sie vom Stielgemüse zur Garnitur und flocht vom Schlehdorn dazu. Nachdem sie Setzlinge vom Wirsingbeet gepflückt hatte, kletterte sie über den Zaun; das Gelb des Löwenzahns schien ihr passend, und damit das Gelb nicht allein sei, pflückte sie Maiglöckchen und ließ die wächsernen Tüten bimmeln. Von den Schlüsselblumen wollte sie haben; rot brannte der Feuerbusch. Sie polsterte mit Immergrün. Locker saßen die Trauben am Stengel und braunrot samtig, Dolden drängten sich über die Myrten und Blütenkörbe, Verholztes stand aufrecht, und anderes gab Milch – ihr Kranz wuchs um ein Loch zu einem runden Strauß von ungewachsenem Gemüse und blühendem Obst, von Blumen und von Unkraut. Als Anna sich den Kranz aufsetzte, suchten Bienen über ihr Nektar. Mitten auf der Wiese stand sie; weil kein Spiegel da war, sah sie sich im Himmel an.
Als die beiden Hände nach ihrem Kranze griffen, neigte sie den wehrlosen Kopf. Sie hatte den Kranz mit Spangen im Haar und zusammen mit dem Schleier befestigt; sie hatte das Holz des Birnenzweiges gespürt und war aufrecht gegangen, damit der Schlehdorn nicht den Halt verliere. Wo die Spangen widerstanden, riß der Tüll zu zarten Faserlöchern. Die Primeln matschten unter den fremden Händen, und die Wurzeln verloren den Bast. Die Nägel rupften dem Löwenzahn das Körbchen leer und zerpflückten die Rosetten; die Blüte der Birne zerfiel in Kelch und Krone; der Spinat wurde mit dem Immergrün zu einem Quetschgemüse, und die Setzlinge wurden ein zweites Mal ausgerissen. Anna griff nach ihrer Brust, doch war die Brosche nicht aufgegangen; rot lappte der Feuerbusch vor ihren Augen, und alle gelben Schlüssel gingen verloren. Der Kranz hatte gehalten, er saß schief auf dem Kopf; aus dem Kranze fielen Glocke, Stempel und Gefäß.
Als der Bruder des Bräutigams allein den Weg heraufgekommen war, hörte Anna nicht hin, ob der Steinacherfranz nach Amerika geflohen sei oder sich in einer Scheune verstecke; sie hörte nicht, wie ihr Vater, die Luft schlagend, dem nicht erschienenen Bräutigam den Prügeltod versprach; sie gab keine Antwort, als der Sigrist fragte, ob die Meßbuben aufhören sollten, die Glocken zu läuten. Anna sah nach ihren drei Gespielinnen. Die erste hatte ihr das Kleid zugeschnitten und den Schleier und alle Säume genäht; nun stand sie am Eingang zum Kirchhof und sah weg. Die zweite hatte ihr geholfen, sich einzukleiden, hatte ihr die Falten gelegt und die Lenden geschnürt, beide hatten sie über den Brautkranz gelacht. Eben hatte die zweite hinter ihr gestanden und war nun ebenfalls beim Kirchhof. Als die beiden das Türchen zum Kirchhof öffneten, fiel die Schaufel des Totengräbers auf den Kies. Die dritte Gespielin aber, die einzige, die nicht sonntäglich gekleidet war, riß an Annas Hochzeitskranz; sie langte nach einer Schere unter ihrer Schürze und schnitt Annas Brautschleier auf Halshöhe ab. Die Scherenspitzen klemmten das Stück Tüll, es flatterte im Wind, Flecken waren auf der Fahne – und diese dritte, die lachte.
Was von diesem ersten Kranze blieb, ging in eine Hand. Anna hatte sich in den Stall geschlichen und hatte dem Vieh mitgeteilt, daß aus ihrer Hochzeit nichts wird; sie hatte die Bäume im Garten aufgesucht und ihnen bekannt, wie es um sie steht; sie hatte die Bienen aufgefordert: »Immen, summt es hinaus!« Dann stand sie, noch im Hochzeitskleide, in der elterlichen Küche, hatte den Kranz vom Kopf gelöst und gerissen, als er nicht nachgab, Haare und Fäden vom Schleier hatten sich darin verfangen; sie reinigte den Kranz von allen Zutaten. So hätte sie Gänse und Hühner gerupft, Feder um Feder, wie nun Primel um Maiglöckchen, alles für den Steinacherfranz, der vom Geflügel das Schwarze liebte. Keinen Faden hätte sie an den Bohnen gelassen und dafür gesorgt, daß immer Speck mitgekocht worden wäre. Erbsen hätte sie ausgehülst, wie sie nun den Schlehdorn von den Myrten löste, und die Schoten den Schweinen und Kaninchen verfüttert. Äpfel hätte sie in den Strudel getan und Birnen gedörrt, süß wie jene, die der Steinacherfranz ihr aus dem Mund genommen und selber gegessen und mit deren Stiel er ihre Nase gekitzelt hatte. Blumen hätte sie aufgestellt, denn er hatte eine zwischen den Zähnen gehalten, als sie in den Wald gegangen waren; sie wäre in den Wald gegangen, hätte Eicheln gesucht und gemahlen, obwohl sie den Kaffee aus Afrika liebte. Das Linnen auf den Betten hätte sie glattgestrichen am Morgen, wie sie nun mit ihren Fingern den Kranz abfuhr. Als sie den Kranz von Blüten und Blättern, von Stengeln und Zweigen gesäubert hatte, erwürgte ihn Anna in ihrer Hand zu einem Knäuel von Draht und Myrten.
Diese Kranzleiche rollte, schabte und überschlug sich, wenn Anna die oberste Schublade ihrer Kommode aufzog. Jeden Samstag verteilte sie die Markscheine auf drei gelbe Briefumschläge. Ohne Erklärung hatte man sie in den Mauser-Gewehr-Fabriken angestellt zum Aussortieren. Sie hatte versprochen, zu Hause Hand anzulegen, in der Frühe und nach der Arbeit, in der Küche und im Stall – nur das Vieh mochte sie nicht tränken am Dorfbrunnen. Jeden Morgen fuhr sie mit dem Hofnersepp nach Oberndorf. Der hatte immer allein gelebt, sprach mit sich oder zu seiner Kuh; die hatte die Maul- und Klauenseuche überstanden, taugte zum Ziehen und brachte die Milch der andern Kühe zur Bahn. Nur eines Tages, als der Hofnersepp mit der Handbremse nicht nachkam, die Räder über Steine hüpften und der Wagen sich beinahe überschlug unter dem Tusch der Kannen, da wandte sich der Alte an Anna: »Mädchen, ich würde ein Kissen mitnehmen ab heute.« Anna nickte: »Ich bin im fünften.« Der Hofnersepp sah in die Wolken; Anna nahm einen Sack und stülpte ihn als Pelerine über sich; graues Mehl und feiner Staub fielen auf ihr Haar.
Die Hebamme hatte Kerzen angezündet und eine Hühnerfeder abgebrannt. Dann ließ sie die Tasche aufschnappen und wühlte in dem abgeschabten Lederbauch. Sie zog eine abwaschbare Ärmelschürze hervor, kichernd schüttelte sie in der Flasche den Weingeist und das Lysolgift, Anna zuzwinkernd. Neben den Schleimsauger stellte sie einen Eiterbecher. Während sie Gaze um einen Holzspachtel wickelte, sagte sie Anna voraus: »Das steck’ ich dir in den Mund, damit du dir nicht die Zunge zerbeißest.« Mit dem Abhörrohr suchte sie im Umkreis von Annas Nabel nach dem Herzschlag des Kindes und grinste: »Da.« Dann starrte die Hebamme von neuem in ihre Ledertasche und flüsterte. Als sie die Schere in die Höhe hielt, schnitzelte sie die Luft, das Metall beschwörend: »Schnapp!« Darauf stülpte sie einen runzeligen Fingerling über eine hochgestreckte Fingerbeere, so daß ein launiger Gummikasperle Anna zunickte. »Wir werden abklemmen!« verkündete die Hebamme und zerlegte die Kornzange in ihre Teile, stocherte mit dem Katheter im Spülkännchen und packte eine Nickelkassette aus und sprach von Pülverchen und von Tablettchen. Sie schob den Leinensack mit den ofenwarmen Kirschensteinen tiefer in die Kissen: »Vorgewärmt wäre.«
Da wies Anna auf einen gelben Briefumschlag: »Für die Geburt! Reicht es nicht, überlassen Sie mich für den Rest mir selber.« Zum zweiten gelben Briefumschlag meinte sie: »Für den Fall, daß es schiefgeht.« Die Hebamme schüttete heißes Wasser in ein Becken, der Dampf schlug den Spiegel blind. Da gab der Hund im Hof an. Die weise Frau lehnte sich durchs Fenster. »Sei still. Es ist kein Dieb unterwegs. Ein neuer kommt.«
»Der Vorhang geht hoch!« schrie die Hebamme und schob Anna das Hemd bis zur Brust. »Tut dein Kind weh, presse, bis du es ausgetrieben hast!« Die Eröffnungswehen nahmen zu. Annas Bauch hüpfte und verzog sich zu grinsenden Falten. Blutiger Schleim ging ab; es zeichnete. Mit jedem Tritt der Mutter drehte sich das Kind in einem langsamen Tanz der Öffnung zu, den Rücken zum Ausgang schiebend, ein ruckender Pantomime. Annas Kopf hing über den untergeschobenen Matratzenkeil; sie stöhnte im Selbstgespräch. Ihre Finger suchten nach Griffen und Riemen und fanden die eignen Kniekehlen, spitz wurden ihre Knie, und ihre Beine traten an Ort, und die Hände der Hebamme gaben dem Bauch das Stichwort. Auf dem Damm, wo der Steinacherfranz gespielt hatte, lag keimfreie Watte. Ihr war, als stiege das Wasser bis zum Mund, doch im Mund saß ein gaze-umwickelter Knebel. Schlag auf Schlag fiel auf das Kind, und im Rhythmus der Schläge wurde dessen Herzton leiser und nahm vor jeder Wehe wieder zu. Der Muttermund verstrich. Anna hörte Glocken fallen, ihr Kreuz brannte, als läge sie im Feuerbusch. Die Muskeln rissen ein, der Weichteil war verwundet. Das Kind reckte den Kopf und kam ins Rampenlicht, und durch den knöchernen Kanal schoben sich Schultern nach. Der Abgang war total. Das Kind war aufgetreten: es hing mit den Füßen in der Linken der Hebamme. Die weise Frau schlug das Kind; ihre Klatscher waren der Voraus-Applaus zum Geschrei. Annas Schoß war ein offenes rotes Tor: es hätte ein Prinz mit seinem Festgefolge durchziehen können.
Der Nabel war dem Mädchen noch nicht abgedorrt, da packte Anna das Kind ein. Sie puderte ihm das Gesäß und die Innenschenkel mit dem feinsten Weißmehl, das vom Dreikönigskuchen-Backen übriggeblieben war. Dreifach schlug sie Windeln um das Kind. Sie zog über das erste Leibchen aus Linnen ein zweites leinenes und wieder eines aus Barchent und darüber ein viertes, gestricktes. Dem Kinde wurden die Arme steif, sie standen steckengleich in die Luft, die Achseln waren Höcker. Dann packte sie das Kind in blaue Höschen, ein rotes darüber, ein ausgewaschenes gelbes und ein helles gelbes und zuletzt ein weißes. Schicht um Schicht wuchs der Säugling zu einem Monstrum. Um den Schädel, der noch nicht vernahtet war, band sie ein Häubchen. Eine Mißgeburt aus Wolle und Leinen wimmerte vor ihr, mit Kugelarmen und Stumpfbeinen, halslos und gnomengleich, ein Hutzelweibchen. »Jetzt hast du alles an, was dir gehört.« Dann griff Anna zum Koffer. Den hatte ihr die dritte Gespielin ans Kindbett als Geschenk gebracht. Früher als der Hofnersepp brach sie auf, da sie zu Fuß nach Oberndorf ging, in der linken Hand den Koffer und unterm rechten Arm das Kind. Im Januar war der Weg gefroren, und sie wählte nicht die Abkürzung, den Steig. Bevor sie aufbrach, öffnete sie die oberste Schublade ihrer Kommode, stopfte den Kranzknäuel ins Gepäck und nahm den dritten gelben Briefumschlag, auf den sie »fort« geschrieben hatte.
In der Feuerkiste glühten die Kohlen, und die Siederohre schwitzten an diesem vernebelten Wintermorgen. Anna klemmte im Winkel des Abteils mit dem Rücken den Koffer gegen das Fenster und umklammerte das Kind auf ihrem Schoß. Der Dampfkessel kochte. Die Treibräder griffen in die Kuppelräder, die Laufräder rollten auf den Schienen. Wo eine Unebenheit war, nickte und wankte die Dampflokomotive. Das Kind nahm das Rütteln als Wiege; beim ersten Zwischenhalt weinte es, da gab ihm Anna die Brust, und während sich das Kind vollsog, dachte Anna an den Steinacherfranz, der hatte Zähne gehabt. Sie überließ sich dem Schlingern; das Räderwerk tat für sie Arbeit und zog sie fort: eine Rauchkammer half ihr, und in den Aschenkasten fielen die Rückstände der Kohlen, die für sie verbrannt wurden, so daß am Funkenfänger glühende Teilchen stoben; der Dampfkessel war schwarz vom Steinkohlenteer, die Puffer sahen stumpf den Hindernissen entgegen, die Kolbenstangen stampften, und aus der Feuertür fuchtelten Flammen. Anna summte das Lied: »Mues i denn, mues i denn zum Städtele hinaus.« Sie sah vor dem Fenster den schwarzen Rauch, als hätte der Himmel Morgentrauer. Sie wurde keuchend und ratternd in die große Welt hinaus gestampft. Durch eine ringförmige Spalte drang Dampf in eine Glocke mit einem scharfen Rand, die Luft wurde in Schwingung versetzt – es pfiff, vor jeder Kreuzung warnend.
Ja – einmal hatte Anna für sich einen Kranz geflochten, einen unregelmäßigen, mit Blumen, die nicht zueinander gehörten, das Holz vom Birnbaum neben Margeriten, einen wuchernden Strauß. Die Narzissen hatten gelahmt, ehe sie den Kranz aufsetzte. Sie wußte nicht, daß man Schnittblumen in feuchtes Moos wickelt, damit sie länger halten. Sie hatte nicht gelernt, alle Blumen in gleicher Richtung anzulegen. Der Kranz, den sie für sich geflochten hatte, war nicht für ein Grab gedacht. Doch für die Kränze, die sie den andern band, sollte sie gelobt werden, aber sie begann nicht sogleich damit, Kränze zu winden.
»Zürich, das gibt es«, meinte Anna, als ihr Schwager fragte, weswegen sie in diese Stadt gekommen sei. Ihre ältere Schwester sagte ihr, man habe alles aus Beffendorf geschrieben. »Gottlob nicht auf einer offenen Karte«, tröstete sich ihr Schwager. »Natürlich habe ich Gepäck«, verteidigte sich Anna; sie habe den Koffer unten im Hausgang gelassen; sie wolle nicht bleiben. Doch da bot ihr die ältere Schwester ein Türkenbett an – »vorläufig einmal«. Anna zog aus ihrer Handtasche den gelben Briefumschlag: mit Gemüse wolle sie handeln, davon verstehe sie etwas; sie wisse, wann ein Rettich holzig ist und wie eine Kohlrabe ausschaut; sie wisse, daß man den Spinat am Morgen noch wäscht, bevor man ihn auf den Markt bringt, damit das aufgesogene Wasser das Gewicht vermehrt; und Beeren habe sie schon früher gesammelt, Wälder werde es wohl geben. Aber gerade hier im Quartier, warnte der Schwager, gebe es unzählige Gemüseläden. Doch Anna wehrte ab, sie brauche nicht viel für das Kind und sich. Sie müsse etwas Sicheres haben – diesmal. Aber ihr schwäbischer Dialekt hindere den Verkauf, versuchte der Schwager noch einmal abzuraten. Anna sagte: »Sodele? Sodele?« Während sie das Kind trockenlegte und ihrer älteren Schwester das Gewicht des Neugeborenen angab, bereitete sie sich vor und erklärte: »Der Mensch will essen. Und Gemüse ist zum Essen da.« Anna stellte sich ihre Zukunft in Gemüse vor; sie, die sich später auf die Toten verließ, verließ sich zunächst auf die Lebenden, die Hunger hatten.
Nicht in der Langstraße, aber in einer Querstraße mietete sie ein Lokal. Da sie eine alleinstehende Frau war, gar mit einem Unehelichen, hatte sie die Miete für ein halbes Jahr sicherzustellen. Hinter dem Laden waren eine Küche und ein Zimmer und ein größerer Abstellraum. Sie hatte sich vorerst geweigert, den Schuppen im Hinterhof mitzumieten, doch willigte sie dann ein, weil sie sonst die Toilette mit dem Schuppenmieter hätte teilen müssen. Sie kriegte einen Ladenkorpus gegen Anzahlung und noch die Böcke und Bretter dazu, um draußen vor dem Laden einen Stand aufzubocken. Einen Leiterwagen hatte sie gekauft. Es hatte noch für die Waage und die Gewichtssteine gereicht, einen Posten Schiefertafeln hatte sie erstanden und ein Paket Kreide dazu, um darauf die Preise zu schreiben und »Heute frisch«. Alles hatte Anna für den Gemüsehandel bereit, wie sie dereinst alles für die Kranzbinderei haben sollte. Noch vor der Eröffnung saß sie im Laden hinter dem Verkaufstisch, nickte übungsweise zur Tür und blickte durch das verdunkelte Schaufenster. Da nahm sie die Waage, legte auf die eine Schale Gewichtssteine und auf die andere Schale ihre eine Hand und sah, daß eine Hand so viel wiegt, mit welcher Kraft man auf die Schale drückt.
Jeden Morgen zog Anna mit dem Leiterwagen aus – zum Großmarkt für das Gemüse und direkt zu den Bauern, durch ein fremdes Quartier einer fremden Stadt und in die fremde Landschaft eines fremden Stadtrandes. Zeitig mußte sie auf dem Großmarkt sein, um den Einkäufern der Hotels und Restaurants zuvorzukommen. Endivie und Chicorée ließ sie ihnen leichten Herzens, das hätte sie im Industriequartier nicht verkaufen können. Sie wußte zu streiten, wenn die Randen tropften; sie handelte den Preis der Bohnen herunter und versprach, das nächste Mal zehn Pfund mehr zu nehmen; sie schaute bei den Tomaten in der Kiste auch die untere Schicht an; nie hätte sie Äpfel eingekauft, ohne in einen gebissen zu haben. Sie zog den Wagen die Langstraße hinauf, wartete bei der Bahnsperre und bog in die Militärstraße ein. Postangestellte und Bahnarbeiter waren bereits auf, die Milchhändler waren an der Arbeit; sie hatte auf die Fuhrwerke der Bierbrauer achtzugeben. Diese Frühaufsteher grüßten sich wie auf dem Dorf. Kam sie vom Großmarkt zurück, fuhr sie über die Sihlbrücke, von den Militärstallungen an der Kaserne vorbei zu den Zeughäusern, da waren die Verkäufer auf und alle, die ins Büro gingen, aber sie grüßten sich nicht.
Wenn Anna zu den Großgärtnern ging, hatte sie noch früher aufzubrechen; die halbe Stunde machte ihre Erbsen und Bohnen billiger; deswegen zog sie den Wagen nach Albisrieden und über die Limmat bis nach Höngg. Immer war ihr Kind dabei. Zwischen dem Gemüse wuchs es auf. Es lernte sich an Körben aufrichten und holte sich den ersten Splitter an einer Kiste. Als es greifen lernte, griff es nach Bohnen und streute sie auf die Straße. Streckte das Kind die Arme zwischen dem Suppengrün aus, dann waren es zwei lebendige Lauchstengel, die in die Luft ragten; und schlief es zwischen den Blumenkohlköpfen, war das Kindergesicht so rund wie ein Blumenkohl; und wie der Blumenkohl ein Häubchen trug, trug auch Annas Kind ein Häubchen, nur daß der Blumenkohl, der Anna gehörte, manchmal weinte.
Schön sollte es das Gemüse haben bei ihr, wie es später die Kranzblumen schön haben sollten. An keinem Kopfsalat ließ sie ein angeschwärztes Blatt; in keinem Wirsing gab es eine Schnecke. So nahm sie später auch nie eine Schlampe von Dahlie oder den Hängekopf einer Aster mit. Sie legte das Herz der Gemüse bloß, auch wenn sie für den Verkauf an Gewicht verlor. Sie band die Petersilie, den Schnittlauch und den Lauchstengel zu einem Strauß und nahm sich Zeit zu einer Schleife aus Bast. Die Zwiebeln warf sie nicht in den Korb, sondern zöpfelte sie, und lieber verzichtete sie auf das Geschäft, als daß sie einen Zopf aufgelöst hätte. Auch als Anna den Gemüseladen führte, flocht sie bereits Kränze. Allerdings Kränze aus Knoblauch. Nie hätte Anna für sich Knoblauch verwendet. Aber im Industriequartier wohnten viele Italiener, die kauften zwar bei andern Italienern ein, aber manchmal war Annas Laden näher. Diese Italiener hängten ihren Kindern eine Knoblauchzehe um den Hals gegen Anstekkung; die stachen sich am Samstagabend mit den Messern; die sprachen einen ebenso merkwürdigen Dialekt wie Anna; die taten in jede Sauce Knoblauch und hatten keine Würmer. Diese Knoblauchkränze flocht Anna; sie wand einen Stengel um einen andern ohne Bast und Schnur, wenn nach dem Mittagessen keine Kunden kamen. Sie hängte die Knoblauchkränze zur Garnitur über Körbe und Kisten. So waren von Beginn an in Annas Laden Kränze; auch die, die sie später für die Toten band, dufteten manchmal.
Aber einmal blieben ihr Kartoffeln liegen. Meiser hatte im Herbst zehn Säcke bestellt, und Anna hatte achtgegeben, daß es gleich große Knollen waren. Da kam dessen Frau, und die kam in Schwarz, schnupfte und sagte, sie brauche keinen Vorrat mehr für den Winter, die Wohnung gebe sie sowieso auf. Nicht Erdäpfel brauchte sie, sondern einen Kranz. Anna sah sich um; aber Knoblauchkränze ließen sich selbst Italiener nicht aufs Grab legen, und ein Zwiebelzopf war auch nicht das richtige.
Frau Meiser klagte, was ein Toter koste, selbst wenn man Tannenholz für den Sarg wähle, natürlich habe sie eine Wochenillustrierte mit Versicherung abonniert; er brauche einen Kranz, und sie weinte lauter, es wäre unrecht, wenn er nicht zu seinem Kranze käme, dabei habe er sie geschlagen, und jetzt werde sie nie mehr geschlagen, als der Karger gestorben sei, habe der auch einen Kranz gehabt, und der habe seine Frau betrogen, es müsse ein Kranz sein, der nach etwas aussehe, mit einer großen Schleife. Anna versprach, die Kartoffeln kiloweise zu verkaufen – »Der Mensch will essen, aber am Ende will er einen Kranz« –, und Anna wiederholte, was sie soeben gehört hatte: »Jeder hat ein Recht auf einen Kranz, selbst wenn er im Leben geschlagen hat.«
Anna saß auf den Kartoffelsäcken und dachte nach. Als sie nachgedacht hatte, streichelte sie den Rotkohl und legte die Köpfe in eine Gerade, dann rückte sie den Blumenkohl zurecht und fuhr über die Herzen des Kopfsalates, sie schüttete den Spinat auf und ordnete die Radieschen. Sie sah zur Decke und grüßte die Zwiebelzöpfe und die Knoblauchkränze; die hingen als Gemüse-Engel über dem irdischen Sellerie. Anna nahm Abschied vom Gemüse: Schnittlauch, leb wohl und bleib der Petersilie treu! Sie lachte die Karotten aus: Für das letzte Mal hättet ihr euch den Wurzelbart schaben können. Sie hob einen Kürbis hoch und wog ihn noch einmal. Sie wandte sich den Bohnen zu, denen, die als Busch wachsen, und denen, die sich an eine Stange klammern; sie nickte zu den Erbsen. Sie dankte dem vereinigten Gemüse, das stückweis und gebündelt in Körben und Kisten lag, ausgegraben und gepflückt, im Schatten gediehen und in der Sonne aufgewachsen. Sie gedachte des Rosenkohls als des zartesten Wintergemüses – aber es werden Rosen sein, die sie in Zukunft einkaufen wird. Und nicht nur einige Fliederbüsche werden in einer Blechbüchse in ihrem Laden stehen; unter lauter Blumen wird sie arbeiten. Sie zog den Schnittlauch an seinem Schopf aus dem irdenen Topf: »Platz gemacht.« Dann bat Anna die Blätter und Wurzeln, die Stengel und die Knollen, die Herzen und Köpfe um Verständnis. Sie zog die Schublade des Verkaufstisches auf, um den Ladenschlüssel herauszunehmen. Da sah sie den Lorbeer, eines der wenigen Gewürze, die sie verkaufte. Sie nahm einige Blätter in die Hand und zerrieb sie zu Splittern, die sie auf den Boden fallen ließ: »Getrockneter Lorbeer, das mag für die Lebenden richtig sein, die Toten brauchen frischen.«
Die erste Sendung Rohkränze war eingetroffen. Anna schichtete sie im Schuppen und beglückwünschte sich, den Schuppen mitgemietet zu haben, und hängte den Draht an einen Nagel. Sie hielt auf dem Schoß einen Strohkranz und überlegte, wie er wohl aussehen wird, wenn sie ihn mit Blumen bekleidet haben wird. Da trat der Steinacherfranz durch die Tür. Er nahm den Hut in die Hand und machte einen zarten Vorwurf: Sie sollte einen Zettel an die Wohnungstür heften, sonst fände man sie nicht. Von seinem geraden Scheitel hing eine Locke ins Gesicht, und unter seinem Schnurrbart wuchs eine rote Lippe aus Fleisch. Anna sprang auf, der Kranz fiel von ihrem Schoß und rollte mit schwankender Langsamkeit auf den Steinacherfranz zu, der fing ihn auf, eh er austorkelte, und lachte. Er stülpte sich den Kranz über den Kopf, so daß der Reifen auf seine Schultern fiel. Mit eingezogenen Schultern und angepreßten Armen drehte er seinen Oberkörper bei festem Fuß; seine Brust stand vor und sank ein; er beschleunigte den Kreiseltanz des Kranzes, der, wenn er zu fallen drohte, stets aufgefangen wurde, bis der Mann plötzlich kerzengerade und schlank und jung dastand. Da torkelte der Kranz an seinem Leib und schlug auf den Boden. Staub wirbelte auf; der Kranzesmitte entstieg der Steinacherfranz.
Er hatte ihr die Haare gelöst und dann die Haare auf dem Rücken geteilt, hielt die Haarschwänze in der Hand, zog sie über ihre Schultern, ließ sie auf ihre Brüste fallen und fuhr den Haarspitzen entlang. Anna dachte an ihr Kind; aber es weinte nicht, und hätte es geweint, sie hätte es hier in dem Separatzimmer auf dem gemieteten Bett gehört. Sie flocht ihre Finger in seine Haare, aber diese Haare hielten nicht wie Knoblauch und Zwiebel, das waren Stengel ohne Blumenköpfe. Sie bohrte ihre Nägel in seine Schultern, als wollte sie Draht hineinstechen und ihn mit Lorbeer bestecken. Sie flocht sich in seine Schenkel ein und schloß die Hände auf seinem Rücken. Ihr Kopf lag auf seiner Brust als Tuff zur Garnierung. Anna, die dem Gemüse adieu gesagt und als Kranzflechterin beginnen wollte, hing am geliebten Körper des Mannes als eine Girlande zuckender Glieder, die verstummten.
Die Matratze war gegen die Wand gestülpt, die Leintücher schleiften vom Bett aus – er hatte das Versteck gefunden. Lächerlich, Geld zwischen Matratze und Schoner zu verbergen. Aber es war die Miete, und Anna war in die Stadt gegangen, um sich einen neuen Hut zu kaufen, mit Kunstkirschen, die wippten. Noch im Mantel und mit dem Hut verließ sie die Wohnung und drückte auf die Klinke der Tür zum Separatzimmer; sie war nicht abgeschlossen. Das Bett war unbenutzt, im Zugwind schlug die Schranktür und zeigte leere Tablare, nur ein schmutziges Hemd lag noch zerknüllt auf dem Boden des Kastens. Bierflaschen standen als säuberlicher Trupp in einem Winkel. Gottlob war der Steinacherfranz eitel gewesen und hatte sich geschämt, beim Einkauf von Bier leere Flaschen mitzubringen. Als Anna ins Treppenhaus zurückging, sah sie ihre ältere Schwester und die Frau vom zweiten Stockwerk und eine dritte, die kicherte. Da griff Anna nach ihrer Brust. Sie vernahm, daß er schon am Morgen weggegangen sei – »der Zimmerherr« – und daß er jeder von den dreien einen Strauß Blumen gebracht habe – »zum Abschied«. Da rannte Anna die Treppe hinunter, durch die Hintertür auf den Hof zum Schuppen. Sie stieß die Türe zum Schuppen auf, zählte und lehnte den Kopf an die Wand – er hatte die Miete genommen und die Blumen verschenkt; aber Anna stellte fest: Dir sind die Kränze geblieben, noch nie hat ein Dieb Kränze gestohlen.
»Du mußt mir helfen«, flüsterte Anna, »ach, entschuldige, ich bin gerannt, verzeih, die Langstraße hinauf und durch die Badenerstraße zu dir, gegrüßet seist du, Maria. In den ersten Tagen wird es mit dem Flaschenpfand gehen, ave, der Herr sei mit dir; sag ihm doch, daß er auch ein wenig mit mir ist, ich bin die Kranzflechterin von der Luisenstraße, ich gab das Gemüse auf, ich wohne gleich links im Erdgeschoß. Dich hat er heimgesucht, Maria, meine Frucht ist nicht gebenedeit in meinem Leib, der Steinacherfranz war drin. Ich habe schon ein Kind, ich zeige dir die Kleine einmal, sie spricht schon, und ich bringe ihr bei: »gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade« – aber was soll unsereiner machen. Du solltest ihn einmal sehen, den Steinacherfranz, du bist gebenedeit unter den Weibern, aber wer weiß, was jetzt in mir geschieht. Laß mich bluten an meinen Tagen, du jungfräulichste aller Jungfrauen. Du hättest ihm auch geglaubt, wäre er zu dir gekommen, Meerstern, den ich grüße. Du hattest immerhin Joseph. Verzeih, Maria, nimm es mir nicht übel, wenn ich auch noch den heiligen Antonius bitte; der versteht uns kleine Leute. Ich will ja kein Wunder, ich möchte nur, daß man mir die Miete stundet, die drei Monate, weißt du, wegen des Vertrags, ich kann zu Rubinfelds in die Textilienhalle putzen gehen. Aber du hast recht, wo das Geld so wichtig ist wie bei uns, wär’s ein Wunder, würden sie stunden. Du, Jungfrau, stelle dir vor, mich mit einem Vermieter, eine alleinstehende Frau. Mach, daß ich bleiben kann; ich müßte mit dem Kind auf die Straße, denn der Schuppen gehört zur Wohnung, und es wäre sicherlich schwierig, mit meinem ausländischen Dialekt herumzuwandern. Du hast einen Kranz von Sternen um dich. Ich verspreche dir, ich werde auf jedem Kranze die Blumen ganz dicht stecken; jeder soll zu seinem Kranz kommen, auch du, im nächsten Frühjahr, lauter Lilien, dann, wenn sie noch teuer sind. Laß mich bluten an meinen Tagen.«
Es war immer noch Frühling, als der Steinacherfranz gegangen war. Im Keller wurden die Kartoffeln schwarz, und Keimlinge schlugen aus. Die Vorfenster wurden ausgehängt und die Matratzen in die Höfe getragen zum Reinemachen. Der erste Spinat kam auf den Markt, und die Kohlenrechnung blieb unbezahlt. Wenn es wieder soweit sein sollte, dann mußte die Kohle im Hause sein. Die Vorfenster werden wieder eingehängt werden, aber dann wird sich Anna nicht bücken dürfen. Noch waren nicht alle Flaschen zurückgetragen, es blieb immer noch etwas Pfand. Das Separatzimmer hatte sie weitervermietet und das Mietgeld weitergegeben. Wenn es wieder soweit sein wird – und Anna nahm den Kalender. Den hatte sie von einem Einbeinigen gekauft. Sie blätterte den Widder um