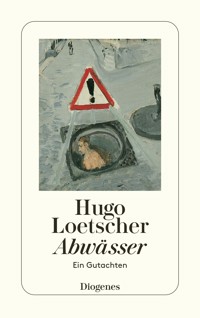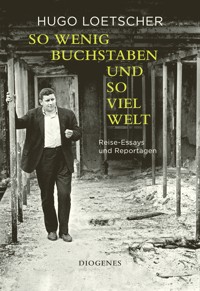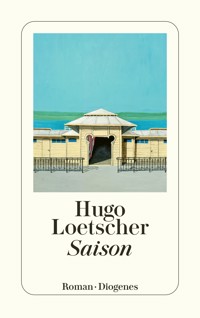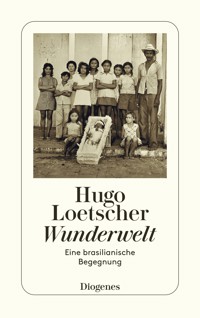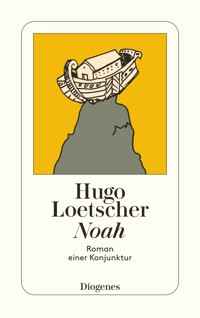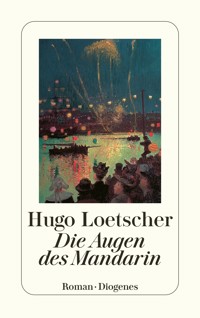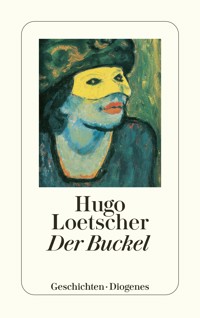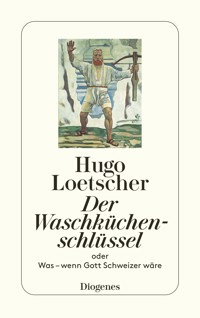9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unter den ›Papieren des Immunen‹ findet sich die Geschichte von einem, der zum eigenen Leichenmahl lädt, neben der Geschichte von einem, der ein Attentat auf ein Wachsfigurenkabinett plant; Puppenmörder und Sünden-Priester; ein Kinderlied wird zum Politikum, es erklingt die Registerarie der Städte. Diese und andere ›Papiere‹ sind Spiegel und Gegenbilder des Immunen, seiner Interpretationen und Sehnsüchte…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 793
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hugo Loetscher
Die Papiere des Immunen
roman
Diogenes
ZUGEGEBEN, DIE ROTBRAUNEN FLECKEN auf dem Wecker sind nicht Rost, wie ich behauptete. Im Augenblick, als ich dies sagte, war mir klar, wie leicht es sein wird, mich der Lüge zu überführen – als ob nicht auch die Wahrheit etwas wäre, das wir erfinden.
Aber die beiden Detektive, die meine Wohnung durchsuchten, waren schon von Berufs wegen überzeugt, sie hätten es bei mir mit einem Schwindler zu tun. Insofern kam ich ihnen entgegen, indem ich sie anlog; sie wurden auch gleich umgänglich, als sie merkten, daß ich mich an ihre Spielregeln hielt.
Selbst wenn sie den Nachweis erbringen, daß es Blut ist, was auf dem Uhrengehäuse eingetrocknet ist, sie werden sich wundern, wie wenig ihnen Erkenntnis weiterhilft.
Und daß sie wiederkommen, daran zweifle ich nicht.
Ich kann mir schwer vorstellen, daß sie, die jede Schublade öffneten und soviel an Unterlagen wegtrugen, ausgerechnet diese Papiere übersehen haben sollten. Nachdem die beiden gegangen waren, zog ich mit einem Griff ein erstes Bündel unter dem Stoß Schreibmaschinenblätter hervor. Und ich brauchte auch nicht lange im Papierkorb zu wühlen, bis ich ein weiteres fand. Es scheint, daß das ganze Geheimnis unter unbeschriebenen Seiten und im Papierkorb liegt. Wie dem auch sei, diese Papiere führen eher zum Immunen als die Sicherung von Kratzspuren oder das Abklopfen von Wänden oder das Überprüfen von Alibis.
Ich finde es dennoch merkwürdig, daß sich die beiden trotz ihrer Akribie nicht einmal im Badezimmer umsahen. Jedenfalls fragten sie nicht, warum der Spiegel zerbrochen sei. Es braucht kein Kriminalistenauge, um die Sprünge zu entdecken, die von dem Punkt aus verlaufen, wo der Schlag hintraf. Sie hätten mich zum Beispiel nur auffordern müssen, den rechten Hemdsärmel hochzukrempeln, und sie hätten eine Verletzung entdeckt, über die Auskunft zu geben mich in Verlegenheit gebracht hätte.
Mit unbekümmerter Sicherheit traten die beiden auf; sie können von der Annahme ausgehen, daß es für jeden von uns, der sich in dieser Gesellschaft einzurichten verstanden hat, einen Paragraphen gibt, auf Grund dessen man ihn belangen kann, sobald sich Polizei und Gericht mit ihm ausführlich befassen. Mit Neid habe ich ihnen bei der Arbeit zugeschaut; ich möchte auch einmal so fraglos unterscheiden können zwischen dem, was war, und dem, was möglich ist.
So überraschend der Auftritt der beiden war – unerwartet kamen sie nicht. Ihre Erklärung, aus der Nachbarschaft seien Klagen eingegangen, schien mir dürftig, obwohl – mir fiel gleich die dickliche Blondine ein, die seit Jahren von ihrem Fenster über die Gasse auf unsere Terrasse starrt, mit einem Lächeln, das sie bleicht wie ihr Haar, und deren Lächeln und Haar mit jeder Bleichung dünner werden.
Sicherlich wurde in jener Nacht geschrien. Aber nicht so laut, daß man es draußen hörte. Auch der Wecker, der in meiner Hand losging, läutete zu kurz, als daß man sein Rasseln in einem Nachbarhaus hätte wahrnehmen können. Zudem drehte ich gleich das Radio an, und wenn der Schrei mir bis ins Mark ging, dann nicht, weil er laut oder lang gewesen wäre.
Ich komme nicht vom Gedanken los, daß es Hinweise anderer Art gibt. Ich hege sogar die Vermutung, der Immune selber stecke dahinter.
Der oberste Zettel seiner Papiere ist eine handgeschriebene Notiz: »Suchanzeige. Ich vermisse mich. Für die Auffindung meiner Person wird eine hohe Belohnung in Aussicht gestellt.« Der Zusatz »Um schonendes Anhalten wird gebeten« ist durchgestrichen, ein zweites Mal, flüchtiger, hingeschrieben und wieder durchgestrichen. Dann folgt die übliche Formel: »Zweckdienliche Mitteilungen sind erbeten an den nächsten Polizeiposten oder an« – und die Telefonnummer, die dasteht, ist meine.
Sollte das Ganze eine Inszenierung des Immunen sein? Macht er sich lustig über die, denen es tatsächlich gelingt zu verschwinden? Aber es wäre ein Hohn, von dem ich weiß, daß er nicht frei von Bewunderung ist. Oder will der Immune demonstrieren, daß er endlich einer Kurzschlußhandlung fähig war? Daß er zu jener Verzweiflung gefunden hat, um die er mich beneidete, und damit zu einer eigenen Desperatheit gelangte, von der er hofft, daß sie für ihn tödlich verläuft?
Und dies in einem Moment, da sich Leute für ihn interessieren, denen er bisher gleichgültig war. Und nicht nur gleichgültig. Wir waren es gewohnt, daß Leute, kaum hörten sie das Wort ›immun‹, die Achseln zuckten und mit gefühlvollem Blick nachsichtig lächelten.
Jetzt aber, jetzt erkundigt sich die Zeitungsverkäuferin vom Kiosk nach ihm und auch der Besitzer des Tabakladens. Der Briefträger will wissen, wie es ihm geht, ebenso der Kellner an der Eckbar, und dies, obwohl sie gewohnt sind, daß der Immune monatelang nicht auftaucht. Sogar die Italienerin, welche das Treppenhaus reinigt, hat seinetwegen ein Gespräch angefangen; eine Telefonistin fragte nach ihm, als ob sie ihn näher kennt; selbst ein Fremder sprach mich auf der Straße an, er habe von einem Immunen gehört.
Jedermann scheint sich plötzlich für einen zu interessieren, dem man nachsagt, er komme immer davon, als möchten alle wissen, wie das einer fertigbringt, als gebe es für alle nur noch ein Problem.
Selbst die beiden, die von Amtes wegen vorsprachen, legten ein doppeldeutiges Verhalten an den Tag. So sehr sie mich als Verdächtigen behandelten, sie sahen in mir gleichzeitig einen Verbündeten, der ihnen die Verbindung zum Immunen vermitteln könnte, von dem sie behaupteten, sie führten ihn im Spitznamenverzeichnis. Ich spürte, sie hätten gerne einen solchen Mann kennengelernt, als könne er ihnen ein Geheimnis preisgeben. Aber gleichzeitig muß einer, dem niemand und nichts etwas anhaben kann, für die beiden ein Ärgernis darstellen. Denn Sinn und Trachten ihrer Arbeit zielt doch dahin, daß ihnen keiner entgeht und niemand entwischt; sie hielten nicht mit dem Verdacht zurück, daß der Vermißte tot sei, vielleicht ermordet; aus ihrer Vermutung sprach unüberhörbar die Hoffnung, daß dies zutreffe.
Der Immune als Toter – eine Vorstellung, über die ich vor einer Woche gelacht hätte. Aber die beiden Beamten scheinen aus purem Mißverständnis näher an die Sache heranzukommen – wie tauglich zuweilen eine mangelhafte Vorstellungsgabe sein kann.
Es entspricht durchaus ihrer Logik: Wenn schon, bin ich es, der die Leiche des Immunen identifizieren könnte. Ich wäre selber neugierig, was für ein Gesicht der Immune aufsetzt, wenn er stirbt, oder, wie er noch früher gesagt hätte, wenn er das Sterben durchspielt – er, der so viele Erfahrungen in Simulatoren machte.
Ich vermute, er würde gesichtslos sterben, so daß auch die Identitätskarte, die er bei sich trägt, nicht weiterhülfe, sofern er überhaupt eine bei sich hat, wobei es immer noch darauf ankommt, auf welchen Namen der Ausweis gerade lautet. Jedenfalls müßte der Name, unter dem man ihn findet, nicht unbedingt der sein, der auf dem Totenschein eingetragen wird, und dieser noch lange nicht derjenige, der auf dem Grabstein stünde, selbst wenn dieser der meine wäre.
Es hätte mich längst stutzig machen müssen, daß der Immune in letzter Zeit ein geradezu praktisches Interesse dafür bekundete, wie man das mache: sterben. Er wollte sogar wissen, ob es Do-it-yourself-Kurse dafür gibt. Wie sehr dies nicht eine zufällige Neugierde war, wird mir jetzt beim Durchblättern dieser Papiere klar. Da steht auf einer der ersten Seiten schon die Frage, ob es unvermeidlich ist, daß einem Toten das Kinn herunterfällt.
Sie suchen den Immunen. Ich frage mich, wie sie einen finden wollen, der von sich sagte, er könne am schrecklichsten Ort der Welt untertauchen, nämlich im Kopf eines Menschen.
Sie erwarten von mir Auskunft. Aber wenn jemand auf Informationen angewiesen ist, bin ich es selber. Wie soll ich weiterhelfen, der ich nicht einmal weiß, ob es weitergeht?
Was blieb, sind Papiere. Für den Moment halte ich mich daran. Ich werde sie durchgehen, so rasch als möglich. Die Zeit auch nutzen, um sie gegebenenfalls verschwinden lassen zu können.
Und doch, diese Papiere kommen mir wie ein Lebenszeichen des Immunen vor, wobei ich gleich auflache, wenn ich im Zusammenhang mit ihm noch von Zeichen rede, die fürs Leben stehen. Oder soll ich sie als Abschiedspapiere nehmen, auch wenn ich nicht wüßte, wer von wem Abschied nimmt und wovon.
Und dies nach über fünfzig Jahren, die wir zusammen verbrachten, eine Zeit, die in so vielen Fällen für ein Leben ausreichen muß.
Natürlich hatte ich mich bei Gelegenheit zur Bemerkung hinreißen lassen, der Immune möge verschwinden. Er hatte darauf jeweils lächelnd reagiert: Ich erwecke den Eindruck, als könnte ich den Leuten mit einem Federstrich den Kopf abschlagen. Träumerisch fügte er hinzu: Vielleicht bringen wir es einmal soweit, daß sich der eine vom andern befreit, indem er die Korrekturtaste drückt.
Aber der Immune wußte, daß meine Verwünschung ebenso ernst zu nehmen war, wie wenn ich jeweils vorschlug, mein biographisches Experiment vorzeitig und freiwillig abzubrechen und es bei den bisherigen Erfahrungen bewenden zu lassen. Nach jedem solchen Ausbruch hat es mich hinterher immer noch gegeben, wie es mich auch jetzt noch gibt, vorläufig mindestens.
Vor mir aber liegen nicht nur die Papiere des Immunen, sondern ein paar Zeichnungen, die ein Kind verfertigt hat: Es hat einen Büffel gezeichnet und ein Haus auf Pfählen, wie man eben in seinem Dorf baut, und mit einigen Vierecken hat es Reisfelder abgesteckt und ein paar Worte hingekritzelt, in einer Schrift, die ich nicht lesen kann.
Wegen dieses Kindes sind wir aneinander geraten. Aber ich weiß heute, es hätte auch etwas anderes Anlaß sein können; der Immune schien nur auf einen solchen zu warten. Zum ersten Mal war ihm meine Hilflosigkeit willkommen.
Es war Verrat im Spiel. Er machte mir einen ungeheuerlichen Vorschlag. In jener Nacht ging etwas zu Ende; im Vergleich dazu ist der Tod, selbst der gewaltsame, eine Gutenachtgeschichte.
Wer würde mir schon glauben, daß in jenem Moment nicht ich es war, der verzweifelte und flehte, sondern daß der Immune bettelte, daß er es war, der Hilfe suchte, und dies ausgerechnet bei mir, als ob nicht ganz anderes abgemacht worden wäre.
Als ich mich wehrte, er möge die Welt nicht auf den Kopf stellen, meinte er nur: Sie sei rund und stehe immer auf dem Kopf; darauf ließen ihn die Worte im Stich; er wischte sich die Augen, ich lachte noch auf, er sei ja gar nicht fähig zu weinen; aber dann tat er, was ich ihm nie zugetraut hätte: er schrie.
Damals wurde mir klar, daß im Immunen Sehnsüchte lebten, von denen ich nichts ahnte. Ich weiß nicht, ob er die schon immer besaß oder ob er sie sich im Umgang mit der Welt erwarb.
Es hat den Anschein, daß ich seinen Sehnsüchten in diesen Papieren wieder begegne. Es überrascht mich jedenfalls nicht, unter ihnen ein Typoskript zu finden, das ›Der Puppenmörder‹ überschrieben ist. So lange ist es nicht her, daß er mich in einem Gespräch an diese Episode aus meiner Kinderzeit erinnerte. Aber nach dem, was nun vorgefallen ist, lese ich das wohl anders. Mir fällt nachträglich auf, daß seine Stimme schon damals etwas Heischendes hatte, als sei seine Geschichte ein Appell, als wolle er mich beschwören: Wenn einer als Knabe fähig sei, eine Puppe zu töten, müsse er als Mann auch imstande sein, einen andern zu erschlagen.
Der Puppenmörder
»Was machen wir jetzt?«
»Oh diese Yolanda, die fragt immer das gleiche.« Peter tippte mit dem Finger an die Stirn.
»Ich wollte nur wissen, was wir nachher spielen.«
Yolanda schloß am Kleid ihrer Puppe einen Druckknopf, riß ihn auf, drückte ihn gleich wieder zu und sah zum Teppichklopfständer, unter dem Heidi aus einer Schuhschachtel zwei leere Yoghurtbecher hervorholte.
Heidi war unmutig: »Wir haben doch erst angefangen.« Sie schichtete aus Streichhölzern zwei Häufchen, vergewisserte sich, daß in der Cola-Flasche noch Wasser war, wickelte eine Schnur zu einem Knäuel und legte diesen zwischen den Becher und eine Zeitung. Dann wandte sie sich Yolanda zu und zeigte auf eine Konservendose: »Wollen Sie den Wurm oder nicht?«
»Ich nehme die Hälfte.« Yolanda hatte ihre Puppe unter den Arm geklemmt.
Peter zog aus der Hosentasche ein Messer: »Aus einem Wurm kann man zwei machen.«
»Auch aus einem Menschen«, antwortete ihm Yolanda.
»Nie!« Heidi schaute entsetzt auf die Blechdose.
»Doch.« Yolanda beharrte darauf: »Man kann eine Frau in zwei Teile sägen. Man muß sie nachher nur wieder zusammensetzen.«
»Ich nehme den Wurm. Den ganzen.« Peter hatte das Messer aufgeklappt, er strich mit der Klinge über den Pulloverärmel, als wolle er sie wetzen.
»Du bist nicht an der Reihe.« Heidi fuhr sich durchs Haar, machte einen Knicks und fragte Yolanda: »Oder möchten Sie ein Sandwich?« Sie zeigte auf zwei Styroporstücke, zwischen denen Gras herausschaute.
»Haben Sie Bouillonwürfel?«
»Die will immer, was ich nicht habe.« Heidi verzog den Mund.
»Das nächste Mal gehe ich in einen anderen Laden. Milch haben Sie auch keine?«
»Doch.« Heidi riß ein Stück Zeitungspapier ab; sie formte eine Tüte und schüttete weißes Pulver hinein.
»Alles daneben.«
»Vorher hat sie das Waschpulver als Mehl verkauft.«
Peter steckte einen Finger ins Pulver und tat, als lecke er daran.
»Und?« Heidi reichte Yolanda die Tüte. »Wenn man zum Waschpulver ›Mehl‹ sagt, ist es Mehl, und wenn man zu ihm ›Milch‹ sagt, ist es Milch. Macht einen Franken.«
»Davon kriegt mein Kind Bauchweh.« Yolanda legte die Tüte auf die Bank zurück.
»Wenn das Kind krank ist, muß man operieren.« Peter kniff die Augen zusammen: »Die Puppe ist ganz bleich.«
Yolanda stieß Peter zur Seite: »Meine Mutter will nicht, daß ich Doktor spiele.«
»Paß auf«, warnte Heidi, »der macht alle Puppen kaputt.«
»Jetzt kommt die wieder mit ihrer alten Geschichte.« Peter kickte einen Stein und zielte auf den Fensterladen neben dem Kellereingang.
»Nicht getroffen.« Heidi klatschte in die Hände.
Yolanda wiegte ihr Kind im Arm und hielt plötzlich inne: »Fein – spielen wir Apotheke.«
»Wieso Apotheke?« wollte Heidi wissen.
»Weil mein Kind krank ist.«
»Apotheke ist wie Verkaufsladen. Von mir aus.« Peter klaubte aus seiner Tasche ein entwertetes Trambillett: »Jetzt bin ich an der Reihe. Hier mein Rezept.«
»Du mußt etwas draufkritzeln. Wo bist du überhaupt krank?«
»Ich habe einen Knoten im Bauch. Wie mein Vater.«
»Dann mußt du ins Spital«, sagte Yolanda.
»Ihr kommt mich doch nicht besuchen. Rasch. Wenn du mir nichts gibst, falle ich in Ohnmacht.« Mit hochgezogenen Schultern begann Peter zu zittern.
»Was ist das?« Yolanda zeigte auf die Streichhölzer.
»Ich weiß es noch nicht«, antwortete Heidi.
»Und das?« Yolanda zeigte auf die Erdnüsse.
»Spielen wir jetzt Verkaufsladen oder Apotheke? Wenn wir Apotheke spielen, sind es Pillen. Man muß dreimal davon nehmen, immer vor dem Essen.«
»Wenn du deiner Puppe eine Pille gibst, kriegt sie keine kleinen Puppen.«
»Peter ist ein Sauhund«, rief Yolanda.
»Klar«, fuhr Peter fort, »die Großen nehmen eine Pille, und dann sind die Kinder weg. Dich gibt’s nur, weil deine Mutter vergessen hat, die Pille zu nehmen.«
»Tu nicht so.« Heidi schäufelte mit der hohlen Hand das verschüttete Pulver zusammen. »Das ist bei dir genau gleich.«
»Nein.« Yolanda küßte ihre Puppe auf die Nase. »Dich hat das Christkind gebracht.«
Heidi brach von einigen Streichhölzern die Köpfe ab und tat sie in einen Becher: »Es gibt auch Pillen mit Schokolade drumherum. Mein Vater kennt einen Brunnen, da steht ein Mann drauf und der frißt Kinder. Sogar die großen, die schon in die Schule gehen.«
»Wieviel Kieselsteine hast du?« wollte Peter wissen.
Heidi zog ihr T-Shirt über die Kartonschachtel: »Das geht dich nichts an.«
»Bevor ich weiterspiele, will ich wissen, wieviele Kieselsteine in der Kasse sind.«
»Da.« Yolanda bückte sich, hob einen Kiesel auf und reichte ihn Peter.
»Ich will kein Geld von dir. Ich möchte einbrechen.«
»Hast du einen Revolver?« fragte Yolanda.
»Klar.« Peter machte eine Faust, streckte den Zeigefinger als Lauf ab und richtete ihn auf Yolanda: »Päng, päng.« Dann nahm er den Yoghurtbecher: »Den brauche ich als Taschenlampe. Ich komme in der Nacht. Ihr dürft auch nicht blinzeln.«
»Wir haben einen Hund.« Yolanda machte mit ihrer Puppe Schnappbewegungen gegen Peter: »Wau, wau.«
»Hier.« Peter hielt der Puppe die Blechdose mit dem Wurm hin: »Friß die Wurst und hör auf zu bellen.«
»Was willst du stehlen?« fragte Yolanda.
»Gift.«
»Er will uns vergiften!«
»Wir vergiften Frau Huber.« Alle blickten zu einem Balkon hinauf. Es war niemand zu sehen. Aber Peters Stimme wurde leiser: »Dann kann sie uns nie mehr den Ball verstecken. Wir tun ihr jeden Morgen Gift in den Kaffee und sagen, ihr Mann sei es gewesen.«
»Toll«, Yolanda schöpfte kurz Atem, »dann spielen wir Gefängnis.«
»Aber diesmal sperren wir Peter ein.« Heidi jubelte.
»Ihr bringt mich nie in den Keller.«
»Oh, er hat Schiß. Siehst du, Yolanda, er hat Schiß.«
»Die Buben haben immer Schiß. Drum geben sie doch immer so an.«
»Zuerst müßt ihr mich erwischen.« Peter setzte zum Wegrennen an.
»Wir stellen ihm ein Bein.«
»Das würde ich euch nicht raten!«
Aber Heidi eiferte drauflos: »Als Polizei dürfen wir das. Und wir stechen dich mit der Brosche. Das habt ihr bei mir auch getan.«
»Weil du nicht gestanden hast.«
»Ich bin’s gar nicht gewesen.«
Peter höhnte: »Warum hast du denn zugegeben, daß du vom Herausgeld einen Franken behalten hast?«
»Damit ihr im Keller das Licht wieder andreht.«
»Sie wollte nur wichtig tun«, sagte Yolanda.
»Fangt mich, wenn ihr könnt.« Peter tat, als kicke er ein Motorrad an, brauste los und gab mit den Händen Gas. Vor dem Rasen schnitt er, eine Kurve und drehte sich brüsk um »Brrr«, beugte sich vor und stützte sich auf die Oberschenkel.
Yolanda sang »Alle meine Entlein«; sie hielt die Puppe kopfüber in die Höhe und lief mit ihr im Kreis herum.
Heidi holte aus der Schuhschachtel einen Kerzenstummel und versuchte den Docht aus dem Wachs zu lösen.
»He.« Peter kam zurückgeschlendert. »Ihr könnt mich verhaften.« Er streckte beide Arme hin: »Habt ihr Handschellen?«
»Du mußt alles abgeben.«
»Da.« Peter warf das Messer zu Boden, so daß es stecken blieb und der Griff zitterte.
»Deinen Ausweis.«
»Ich habe keinen.«
»Da.« Heidi zeigte ihm das Trambillett: »Das Datum ist dein Geburtstag.«
»Er muß auch alles Geld abgeben«, sagte Yolanda.
»Zwei Franken dreißig. Die brauche ich wieder. Ich muß noch eine Illustrierte kaufen. Sonst geht der Krach heute abend wieder los.« Peter langte nach der aufgewickelten Schnur und versteckte sie hinterm Rücken.
»Was willst du mit den Spaghetti?« fragte Heidi.
»Das ist ein Strick. Vielleicht werde ich mich erhängen.«
Peter streckte die Zunge heraus.
»Das darf man nicht machen.« Yolanda hielt ihrer Puppe die Augen zu.
»Erhängte dürfen die Zunge herausstrecken.«
»Geh endlich in die Zelle.« Heidi schubste Peter, der unter den Teppichklopfständer kroch.
»Du mußt die Beine anziehen.« Sie half ihm nach. Dann faltete sie eine Zeitung auseinander, beschwerte die Seiten auf dem Ständer mit ein paar Steinen und ließ sie herunterhängen.
»Davon wird man ganz steif.« Peter rutschte hin und her. »Was habe ich überhaupt verbrochen?«
»Das sagen wir dir später.«
Und Yolanda: »Er hat meinem Kind ein Bonbon gegeben und ist mit ihm in den Wald gegangen. Schau, den bösen Onkel.«
»Die spinnt, die spinnt wirklich. Sicher nicht mit der blöden Puppe.«
Yolanda zog das Messer aus dem Boden und machte einen Schlitz in das Zeitungspapier. Heidi puffte Yolanda. »Machst wieder alles kaputt.« Aber Yolanda verteidigte sich: »Durch dieses Loch beobachten wir ihn.«
»Nein«, sagte Peter, »durch dieses Loch müßt ihr mir zu essen geben.«
»Gut.« Heidi holte die Cola-Flasche, schüttelte sie, daß das Wasser darin schäumte, und stellte sie neben das Loch. Yolanda legte das Sandwich dazu. Aber Heidi zog das Gras zwischen den Styropor-Stücken heraus: »Er kriegt nur Brot und kein Fleisch.«
Peter machte das Loch größer und langte durch die zerrissenen Zeitungen nach der Cola-Flasche, hob sie zum Mund und pfiff darauf.
»Ei! schau«, Yolanda drehte der Puppe den Kopf in seine Richtung: »Peter sieht aus wie ein Inserat. Spielen wir Inserat.«
»Wenn schon, dann Fernsehreklame«, sagte Peter.
»Oh ja, spielen wir Fernsehen«, sagte Yolanda.
Peter sah sich suchend um: »Ich brauche ein Mikrophon.«
Yolanda reichte ihm den Yoghurtbecher. Peter hielt ihn vor den Mund. »Wollt ihr den berühmten Sänger …«
»Nein«, schrie Heidi.
Verdutzt hielt Peter inne. »Warum nicht? Also gut.« Er nahm ein Stück Holz vom Boden, schlug auf die Blechbüchse und schüttelte sich im Rhythmus dazu.
»Gib auf den Wurm acht«, mahnte Heidi.
»Schön, schön.« Peter holte den Wurm aus der Blechdose, der sich in seinen Fingern wand. Er hielt ihn den beiden entgegen: »Ich bin ein Schlangenbeschwörer. Wie heißt das Land schon wieder, wo die Schlangen tanzen?«
»Schlangen können gar nicht tanzen.« Heidi zuckte die Achseln: »Elefanten können tanzen.«
»Prima.« Yolanda klatschte in die Hände. »Spielen wir Quiz.«
»Ja«, sagte Peter. »Der erste Preis ist ein Auto«, er hielt das Styropor in die Luft.
»Nein«, rief Yolanda, »der erste Preis ist – was ist der Wurm?«
»Wenn ihr wollt, daß ich mitspiele, müßt ihr warten.«
Heidi nahm zwei Erdnüsse.
»Was willst du mit den Pillen?« fragte Yolanda.
»Das sind doch Nüsse, oder?« Heidi hockte sich neben Yolanda, die ihre Puppe auf den Knien hüpfen ließ, und hielt ihr eine Nuß hin: »Jetzt haben wir etwas zum Knabbern. Peter kann anfangen.«
»Spielen wir Kinderstunde. Dann kann meine Puppe nachher ins Bett.«
Heidi reagierte sauer: »Das habe ich zuhause die ganze Zeit.«
»Achtung«, meldete sich Peter zu Wort. Er legte seine flache Hand über die Augen und sah in die Ferne. »Dort muß es sein. Dort.«
Er umklammerte seine Knie, ließ den Oberkörper kreisen und seine Stimme an- und abschwellen.
»Hast du Bauchweh?« fragte Yolanda.
»Frag nicht so blöd. Das ist ein Sturm.« Peter zwängte sich unter dem Teppichklopfständer hervor. »Das Schiff geht unter.« Er kletterte auf den Ständer. »Die Insel.«
Er blieb einen Moment in der Hocke.
»Alle ertrunken.« Dann griff er nach dem Messer, streckte sich und hieb um sich in die Luft. »Die Indianer wären erledigt.« Darauf wandte er sich zu den Mädchen: »Wißt ihr überhaupt, was ich spiele?«
»Schon lange.«
»Also was? Sagt es.«
Die beiden Mädchen blieben stumm.
Peter ließ die Arme sinken: »Ich spiele Schatzsucher.«
»Es gibt gar keine Schätze«, sagte Heidi.
»Im Kino schon«, meinte Yolanda.
»Nein. Es gibt keine versteckten Schätze mehr. Dafür gibt es Lotto.«
»Man muß das Zauberwort wissen.«
»Nein, man muß einen Sechser haben.«
»Ha. Das ist die Höhle.« Peter beugte sich vor und hob die Schuhschachtel auf. Lange schaute er hinein, dann zog er die Schnur heraus, hielt sie in die Höhe und ließ sie baumeln: »Eine Perlenkette.« Er sah zu den Mädchen.
Yolanda führte Heidi vor, wie man der Puppe den Rock enger knöpfte.
»Warum schaut ihr nicht zu?«
Yolanda sah kurz zu Peter hinüber: »Wir haben schon längst abgeschaltet.«
»Immer diese Puppe.« Peter blieb einen Moment ruhig, dann nahm er ein Streichholz; er suchte nach der Schachtel, riß das Streichholz an und steckte die Zeitungsseiten in Brand. Eine Flamme schlug hoch. Peter blies hinein, und Asche wirbelte.
»Der spinnt. Der zündet alles an!« Yolanda preßte ihre Puppe an sich.
»Ich spiele Tagesschau!« rief Peter. »Es brennt, es brennt, es brennt überall!«
Heidi lief zur Bank, griff nach der Cola-Flasche und spritzte ins Feuer.
»Du machst mich ganz naß!« Peter wischte sich übers Gesicht. »Wenn’s im Fernsehen brennt, braucht man nicht zu löschen.« Peter sprang vom Teppichklopfständer, ging in die Knie, rollte über den Boden und blieb liegen.
Heidi rief Yolanda zu, sie solle ihr besser beim Löschen helfen, als herumsitzen.
»Toll.« Yolanda hielt ihre Puppe wie eine Kühlfigur vor sich: »Wir spielen Feuerwehr. Tütätütä!« Sie lief einen großen Bogen und machte vor Peter halt: »Dein Gesicht ist ganz schwarz. Was machst du?«
»Ich bin eine Leiche.«
Yolanda beugte sich über ihn und kitzelte ihn. Peter trat mit dem Fuß nach ihr.
»Die richtigen Toten lachen nicht.«
»Klar bin ich tot. Die Schuhschachtel ist explodiert.«
»Peter möchte gerne Krieg spielen.« Heidi wickelte die Schnur um einen Finger.
»Aber nicht mit euch Mädchen.« Peter stützte sich auf.
»Jetzt dürfen auch Mädchen Krieg machen«, sagte Yolanda.
»Für einen Krieg sind drei zu wenig«, erklärte Peter. »Es war eine Bombe. Siehst du dort oben?«
Yolanda sah nach oben und gleich wieder auf Peter: »Oh, du willst mir nur unter den Rock schauen.« Yolanda kauerte sich hin, legte die Puppe neben sich und zeichnete mit den Fingern auf dem Boden ein paar Linien.
»Es hat dich auch getroffen. Du mußt dich hinlegen.« Peter versetzte Yolanda einen Stoß.
»Ich mag aber nicht.« Yolanda packte die Puppe und lief mit ihr ein Stück weit weg. Dann blieb sie stehen und winkte: »Wir haben uns gerettet – Ätsch.«
»Die Puppe kriegen wir schon noch.« Peter rappelte sich hoch und klopfte sich den Staub von den Hosen.
»Peter hat nasse Hosen. Er hat in die Hosen gemacht.« Yolanda lachte, und Heidi lachte mit.
Peter stellte sich vor Yolanda, machte eine Faust: »Hör auf zu lachen.«
»Ich habe gar nicht gelacht.«
»Wer denn?«
»Die Puppe.«
»Was für eine Bescherung.« Heidi hatte die Arme in die Hüften gestemmt. »Die Schachtel ist ganz schwarz. Alles kaputt. Auch die Schnur – angesengt.« Sie besah sich das Styropor; es war zu einem schmutzigen Klumpen zusammengeschmolzen. »Die Yoghurtbecher haben einen Sprung. Wir können nie mehr Vater und Mutter spielen.«
»Das will ich auch gar nicht.«
»Gestern hast du noch geschimpft, weil das Essen nicht fertig war.«
»Das war früher.«
»Wenn du Vater spielst, mach ich dir einen Pudding.« Heidi rührte im Yoghurtbecher Waschpulver an.
»Meinst du, ich laufe wieder jeden Morgen zum Baum, schabe den ganzen Tag am Stamm und bringe am Abend etwas Rinde nach Hause?«
»Wir hätten ja auch kein Kind mehr«, sagte Heidi und sah zu Yolanda. »Ich darf meine Puppe nicht mehr mit herausnehmen.«
»Du warst einverstanden.«
»Du hast ihr ein Loch in den Bauch gemacht.«
»Deine Puppe hatte Blinddarmentzündung.«
»Jetzt kann sie nicht mehr ›Mama‹ sagen, weil Luft hereinkommt.«
»Du hättest das Pflaster drauflassen sollen.«
»Es hat nicht gehalten.«
»Die Puppen sagen ›Mama‹, weil sie innen ein Apparätchen haben. Eines mit Luftklappen.«
»Ich habe alles meinem großen Bruder erzählt.«
»Dein blödsinniger Laden.« Peter warf einen Yoghurtbecher in die Luft. Als er die Schachtel packen wollte, riß sie ihm Heidi weg; da stieß er sie mit dem Ellenbogen in die Seite. Und Heidi schrie: »Au!«
»Das hat er mit Absicht gemacht«, rief Yolanda, »ich hab’s gesehen.«
»Die Schachtel gehört mir.«
»Nein, Peter, das ist nicht wahr. Die hast du mir zur Hochzeit geschenkt.«
»Ich will sie wieder haben.«
»Fein«, rief Yolanda, »spielen wir Streit.«
»Immer diese Yolanda.«
»Spielen wir Scheidung. Das haben wir noch nie gespielt.« Da Heidi und Peter sie anstarrten, senkte sie den Blick. »Nur einmal.«
Heidi wandte sich an Peter: »Wenn du schon nicht heiraten willst, könntest du dich wenigstens scheiden lassen.«
»Wir könnten auch eine Kerze anzünden.« Bevor Yolanda nach dem Kerzenstummel greifen konnte, hatte ihn Heidi an sich genommen und versteckte ihn hinter dem Rücken.
»Was soll das jetzt wieder mit der Kerze?« fragte Peter.
»Wir können Geburtstag spielen. Meine Puppe darf die Kerze ausblasen.« Doch die beiden andern reagierten nicht. »Gut, spielen wir halt Scheidung.«
»Aber ich lasse mich nicht von dir scheiden, sondern von Heidi.«
»Spiel ich halt nicht mehr mit.« Yolanda wandte sich ab und ging hinter den Teppichklopfständer. Sie stellte die Puppe auf den Boden und faßte sie an beiden Händen. Dann ging sie mit ihr im Kreis herum und sang »Maria saß auf einem Stein …«
»Wenn die nur aufhören würde zu singen.« Peter begann eine andere Melodie zu pfeifen.
»Komm doch wieder«, bat Heidi.
»Ich mache nicht mehr mit.«
»Wir spielen Scheidung, wenn du willst. Nicht wahr, Peter? Sie darf sich von dir scheiden lassen?«
»Das will ich gar nicht mehr.« Yolanda sang weiter.
»Wenn du wieder mitmachst, sag ich dir, wo Peter den Wurm her hat.«
»Ich wüßte schon, was sie spielen könnte«, sagte Peter.
»So.« Yolanda hielt die Puppe wieder im Arm. »Was denn?«
Peter nahm die Schnur. Er reichte Heidi das eine Ende und das andere Yolanda. »Telefoniert. Aber wenn ich das Kabel aus der Wand reiße, müßt ihr aufhören zu quatschen. Jetzt, Heidi, kannst du alles deiner Mutter erzählen.«
Heidi hielt das Schnurende ans Ohr: »Hallo.«
»Hallo.«
»Es ist furchtbar mit ihm.« Heidi stöhnte.
»Ich habe es dir schon immer gesagt. Was macht er jetzt?«
»Moment.« Heidi sah zu Peter und fragte ihn, was er mache.
Peter hatte die Cola-Flasche am Mund: »Ich kriege einen Rausch.« Er torkelte.
»Recht geschieht ihm«, sagte Yolanda. »Hallo – bist du noch dran?«
»Wenn die das nächste Mal zu Besuch kommt, werfe ich sie die Treppe hinunter.«
Yolanda ließ das Schnurende sinken: »Ich möchte sowieso etwas anderes spielen.«
»Ich weiß schon.« Heidi kicherte: »Sie möchte deine Freundin sein.«
»Ach woher!« rief Yolanda.
»Klar. Die aus dem Büro.«
»Nein. Ich möchte unter euch wohnen und mit dem Besen an die Decke klopfen, wenn ihr streitet. Weil mein Kind nicht schlafen kann.« Sie zog Heidi die Schnur aus der Hand und band sie der Puppe mehrmals um den Hals.
»Jetzt sieht deine Puppe wie ein Hund aus.« Peter wischte sich mit dem Handrücken den Mund und spuckte.
»An die Schnur kommt der Schlüssel. Damit das Kind in die Wohnung kann, wenn es von der Schule heimkommt.«
»Die verliert sicher ihren Schlüssel. Dann geht sie selber auch verloren«, sagte Peter.
»Nein«, Yolanda streichelte ihre Puppe, »das machst du nicht. Wenn du verloren gehst, suchen wir dich. Wenn du verloren gehst, kommst du im Fernsehen.«
»Nicht alle Kinder, die verloren gehen, kommen im Fernsehen«, sagte Peter.
»Aber die, die verhungern«, behauptete Yolanda.
»Auch nicht alle.«
Und Heidi: »Wer ins Fernsehen kommen will, wird vorher getestet.«
»Was machen wir jetzt?« fragte Yolanda.
»Oh, dieser Plaggeist.«
»Spielen wir Guck-in-die-Luft«, schlug Yolanda vor.
»Damit sie wieder behaupten kann, sie sehe viereckige Sterne.« Heidi hob ihr Gesicht und schloß die Augen: »Ich sehe nichts.«
»Man muß nur lange genug die Augen reiben.« Yolanda stellte ihre Puppe auf den Boden und hielt sie an den Händen: »Mach schön einen Schritt. Ganz langsam. Schaut, meine Puppe lernt gehen.«
»Guck-in-die-Luft haben wir schon einmal gespielt.« Heidi riß von der Zeitung ein paar Fetzen ab und blies sie in die Luft.
Yolanda glättete den Rock der Puppe: »Auch Lehrer und Schüler.«
»Räuber und Polizei auch«, fügte Peter bei.
»Sollen wir Verstecken spielen?«
»Nicht schon wieder.«
»Man kann sich hier nirgends richtig verstecken.«
»Früher hat es hier viel mehr Kinder gehabt.«
»Ich weiß schon, warum Yolanda das sagt.« Heidi flüsterte Peter ins Ohr: »Weil Erich weggezogen ist. Er war ihr Schatz.«
»Blödsinn.« Yolanda wurde zornig: »Es war kein richtiger Schatz.«
»Hat jemand Kaugummi?« fragte Peter. Die beiden Mädchen schüttelten den Kopf.
»Schade, dann hätten wir kauen können.«
»Du hast ja Geld. Kauf doch uns und meiner Puppe etwas.«
»Verdammt.« Peter wühlte in der Schachtel, holte die Münzen heraus, zählte nach und steckte sie in die Tasche.
»Himmel und Hölle haben wir auch schon gespielt.«
»Das ist sowieso etwas für Mädchen.«
»Zeig Peter, wie man auf einem Bein hüpft.« Yolanda hatte das eine Bein der Puppe nach hinten gedreht und ließ sie auf dem Boden hüpfen.
Peter sah gar nicht hin. Er kratzte an einem Schorf auf seinem Handrücken.
»Was würden wir spielen, wenn wir einen Spielplatz hätten?« fragte Heidi in die Luft hinaus.
»Willst du immer durchs gleiche Rohr kriechen?« Peter schüttelte den Kopf.
»Wir haben schon alles gespielt.«
Heidi sah in die Schuhschachtel. Sie zog einen Becher hervor, warf ihn zurück.
»Was spielt man, wenn man schon alles gespielt hat?«
Peter nickte: »Dann ist man groß und erwachsen.«
»Mein Vater sagt, es sei jeden Tag das Gleiche«, bemerkte Heidi.
»Wir sollten wegfahren.« Peter stellte sich breitbeinig vor den Teppichklopfständer.
»Fein.« Yolanda schaute der Puppe in die Augen. »Hast du gehört, wir fahren in die Ferien.«
»Nein«, sagte Peter, »nicht in die Ferien. Aus den Ferien kommt man immer wieder zurück.«
»Wollen wir auf den Mond?« fragte Yolanda.
»Nein, dort sind schon andere.« Peter zeigte in die Höhe.
»Aufs Dach?« Yolanda legte den Kopf tief in den Nacken.
»Viel weiter. Dahin kannst du die Puppe nicht mitnehmen.«
»Warum nicht?« Yolanda faßte die beiden Hände der Puppe und schlug sie gegeneinander. »Mach schön bitte bitte.«
»Aber ihr müßt hinten sitzen.«
Heidi hatte den Ständer leergeräumt. »Den Wurm nehmen wir auch mit. Vielleicht gibt es dort, wo wir hinkommen, keine Tiere.«
»Also los.« Peter setzte sich vorn auf den Teppichklopfständer. Er nahm die Schuhschachtel auf das Knie, bohrte mit der Ahle ein Loch hinein und zog eine Schnur hindurch. »Das Kabel. Und jetzt noch den Kopfhörer. Gib einen Yoghurtbecher.«
Heidi setzte sich hinter ihn, die Blechdose mit dem Wurm unter dem einen Arm, mit dem anderen klammerte sie sich an Peter. Rittlings hinter ihr saß Yolanda, zwischen sich und Heidi die Puppe geklemmt.
»Du mußt beim Starten umgekehrt zählen.« Heidi guckte Peter über die Schulter.
»Das weiß ich selber. Achtung: drei, zwei, eins und null.«
Peter bog den Oberkörper scharf zur Seite. Die Mädchen machten die Bewegung mit. Dann lehnte er sich zurück. »Jetzt fahren wir am Kamin vorbei. Wir sind schon höher als die Baukranen.«
»Mir wird schwindlig.« Heidi drückte ihr Gesicht an Peters Rücken.
Yolanda winkte mit dem Puppenarm: »Dort unten haben wir gespielt.«
»Achtung.« Peter sprach den Befehl in den Yoghurtbecher: »Ein Wolkentunnel. Kopf einziehen.«
Alle drei duckten sich.
»Wo ist die Erde?« fragte Yolanda.
Peter warf einen flüchtigen Blick zur Seite und zeigte auf einen zusammengeschmolzenen Klumpen Styropor, an dem ein paar angesengte Gräser klebten.
»Der Zeiger, verdammt, der Zeiger«, stellte Peter fest.
Yolanda wunderte sich: »Du hast doch gar keinen Zeiger.«
»Was weißt denn du. Wir müssen abspringen.«
»Wohin?« fragte Heidi.
»In die Luft.« Mit einem Ruck stand Peter auf, er riß die Schnur aus der Schachtel: »Kein Kontakt mehr. Bevor wir springen, auf drei zählen und am Gurt ziehen.«
»Ich habe keinen Gurt.« Yolanda stand neben Heidi auf dem Teppichklopfständer; diese sprang Peter nach.
Peter redete auf Yolanda ein: »Spring, bevor es zu spät ist.«
Yolanda breitete die Arme aus; als sie sprang, fiel die Puppe zu Boden. Sobald Yolanda gelandet war, bückte sie sich. Sie feuchtete einen Finger an und rieb über die Puppenstirn.
Heidi sah in der Blechdose nach: »Der Wurm ist noch ganz.«
Yolanda hob die Puppe ans Ohr: »Sie atmet.«
»Schade«, sagte Peter, »sonst hätten wir Beerdigung spielen können.«
»Oh ja!« rief Heidi, »das haben wir noch nie gespielt.«
»Aber nicht mit meiner Puppe.«
»Warum nicht? Es ist sowieso eine alte Puppe.«
»Das ist nicht wahr.«
Heidi deutete auf den Puppenkopf: »Sie hat nicht einmal echtes Haar. Und der Mund hat auch kein Loch. Du kannst ihr nicht einmal die Flasche geben.«
Und Peter doppelte nach: »Die modernen Puppen machen Pipi wie Kinder.«
Yolanda hielt den beiden ihre Puppe vors Gesicht. »Da. Sie kann die Augen auf- und zumachen. Sie ist auch modern.«
»Als du Scheidung spielen wolltest, haben wir auch mitgemacht«, sagte Heidi.
»Yolanda ist eine Spielverderberin.«
»Sie weiß eben nicht, wie das geht, ein Begräbnis.«
»Als Tante Berta starb, war ich noch zu klein«, sagte Yolanda. »Aber wenn Großmutter stirbt, darf ich an die Beerdigung. Wir müssen sie aber vorher noch einmal im Heim besuchen.«
»Sie fragt immer nur, was machen wir nachher. Aber mitmachen tut sie nicht.«
»Es geht sowieso nicht.« Peter winkte ab: »Mit dieser Puppe kann man nicht Beerdigung spielen.«
»Wieso nicht?« Yolanda sah fragend auf ihre Puppe.
»Man darf niemanden lebendig begraben«, sagte Peter, »aber Yolanda, die würde das machen.«
»Sicher nicht«, antwortete Yolanda, »das weiß ich auch, obwohl ich kleiner bin, daß das verboten ist.«
»Also muß die Puppe sterben, bevor wir sie begraben können.«
Yolanda wiegte die Puppe im Arm: »Du mußt jetzt deine Augen zumachen.«
»Sie muß richtig tot sein. Und nicht nachher die Augen aufmachen. Willst du, daß deine Puppe im Sarg plötzlich wieder erwacht?«
Als Peter nach dem Messer griff, schrie Yolanda auf: »Nein. Weißt du, wie das wehtut?«
»Wir geben ihr vorher ein Schlafmittel.« Heidi schüttete vom Waschpulver in den Yoghurtbecher und gab etwas Wasser dazu, dann goß sie die Flüssigkeit der Puppe über den Mund, es lief auf beiden Seiten herunter.
»Langsamer, sonst verschluckt sie sich.« Peter hielt der Puppe den Kopf.
»Siehst du, Yolanda, wie sie immer noch die Augen aufmacht?« Er streckte den Mittel- und Zeigefinger seiner Rechten aus und legte sie auf die Augen. »Achtung.« Er drückte. »Die ist stark.« Alle drei waren einen Moment lang still. Peter stieß erneut zu. Ein Knacken. Yolanda seufzte. Etwas brach ab und schlug dumpf auf. »Der Kopf ist nicht leer.« Peter schüttelte die Puppe, und in ihrem Kopf kollerte es. »Das tönt nach Metall. Was da wohl drin ist?« Peter versuchte einen Finger durch eine Augenhöhle zu stecken. »Au.« Er zog den Finger zurück. »Diese blöde Puppe. Ich habe mich geschnitten.«
»Da.« Heidi zeigte auf die Wange der Puppe. »Es hat richtiges Blut drauf.«
Peter leckte den Finger: »Jetzt können wir sie beerdigen.«
Yolanda ging zum Teppichklopfständer, setzte sich drauf, mit den gestreckten Armen stützte sie sich auf den Rand, ließ die Beine baumeln und sah zu Boden.
Heidi holte die Schuhschachtel.
»Siehst du, wie das jetzt paßt, daß die Schachtel schwarz ist?« Peter legte die Puppe hinein und fragte Yolanda: »Willst du sie noch einmal sehen?«
Yolanda schüttelte den Kopf, ohne den Blick zu heben.
»Bring den Wurm«, sagte Peter, und als ihn Heidi fragend ansah:
»Den tun wir hinein. Damit die Puppe nicht so allein ist.«
Da trommelte Yolanda auf die Eisenstange und stieß mit den Füßen gegen den Boden. »Das tut man nicht. Das weiß ich, daß man das nicht tut. Du machst es sowieso nicht richtig.«
»Wieso?« fragte Peter zurück.
»Bei Tante Berta haben sie gebetet.«
»Gut.« Peter faltete die Hände über der Schuhschachtel. »Aber nicht laut.«
Heidi reichte ihm den Deckel, und der schloß die Schuhschachtel.
»Und einen Kranz hat sie auch nicht.« Yolanda sprach in den Himmel hinauf.
»Du könntest einen aus Zeitungsfetzen machen«, schlug Heidi vor.
»Weißt du, eine Schnur durchziehen. Ich zeig’s dir.«
»Nicht die ganze Schnur«, rief Peter. »Wir müssen die Schachtel zubinden.«
»Möchtest du die Kerze anzünden?« Heidi wollte Yolanda den Stummel geben.
»Jetzt will ich auch nicht mehr. Ich wollte vorher.«
»Schau.« Heidi nahm ein Grasbüschel und schob es unter die Schnur der Schuhschachtel. »Wie schön das aussieht.«
»Gib mir das Trambillett«, sagte Peter, und nachdem Heidi es ihm gereicht hatte, schob er es ebenfalls unter die Schnur. »Damit man weiß, wer drin liegt.«
Er wandte sich an Yolanda. »Kommst du mit auf den Friedhof?«
»Wo ist denn der Friedhof?«
»Ja«, Peter sah sich ebenfalls um, »wo ist der Friedhof.«
»Da.« Heidi zeigte auf die Abfallsäcke, die sich an der Hauswand stapelten.
»Yolanda, kommst du jetzt mit oder nicht?«
Yolanda erhob sich und ließ den Kopf hängen.
Peter nahm die Schachtel in beide Hände und trug sie vor sich her. »Ich gehe voraus. Heidi, du mußt schluchzen. Nicht wie Yolanda. Bei der hört man nichts.«
»Ich weine doch richtig.« Yolanda wischte sich mit dem Handrücken unter der Nase. »Und was machen wir, nachdem wir geweint haben?«
MIT EINER SOLCHEN GESCHICHTE MOCHTE DER IMMUNE Erfolg haben in jenem Puppenmilieu, in dem er in letzter Zeit nicht ungern verkehrte. Damit spiele ich nicht nur auf das Mannequin an, mit dem er eine Liaison unterhielt. Sie arbeitete in einem der teuersten Geschäfte an der Bahnhofstraße und blickte aus ihrem Schaufenster auf zwei Portale von Schweizer Großbanken.
Ohne Zweifel war sie chic. Sie trug das Neueste, jedoch stets zur Unzeit. Während draußen vor dem Schaufenster Kundinnen sich in luftigen Sommerkleidern drängten, zeigte sie bereits Übergangsmäntel und Stiefel mit Pelzfutter, und wenn sich die Neugierigen vor der Scheibe in Mäntel und Schals einmummelten, führte sie Strandanzüge und Badetaschen vor. Sie war gewohnt, daß Photographen vor ihr in die Knie gingen; sie hatte sich auch einmal mit einem eingelassen. Der hatte sie soweit gebracht, daß sie sich nackt photographieren ließ mit ihrem kahlen Schädel, er hatte ihr für die Aufnahme einen Arm abgeschraubt; mit einer Kette behängt und auf einen Schirm gestützt stand sie da, so hatte der Photograph sie auch stehen lassen.
Sie mochte Cocktail-Parties, schon deswegen, weil sie bei solchen Anlässen Gewagtes tragen konnte, was sonst kaum möglich war. Sie schwärmte für die ›haute culture‹. Vor allem für die Oper, für die man sich umzog, insbesondere für Richard Wagner, weil es bei seinen Bühnenweihfestspielen mehr als eine Pause gab. Sie suchte Atelierfeste auf, mit Vorliebe, wenn sich Avantgardisten trafen, die propagierten, es komme nicht darauf an, was man male, man müsse nur eine Saison voraus sein; auf diesen Parties machte sie die Bekanntschaft von Bildhauern, die für die Konfektion der öffentlichen Bauten arbeiteten, und flirtete sie mit manchem Prêt-à-porter-Maler.
Bei einer solchen Gelegenheit lernte sie den Immunen kennen. Der Zufall wollte, daß wir in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnten. Wenn nach elf Uhr abends in ihrem Schaufenster die Spot-Lichter ausgingen, brauchte sie nur durch eine Gasse zu huschen, und schon war sie bei uns. Bei ihrem ersten Besuch war sie entzückt, wie gut die bunten Buchrücken zum gerippten Grau unserer Fauteuils paßten.
Sie war allerdings geniert, als sie feststellte, daß man das Badezimmer nicht abschließen konnte. Ich mußte ihr versprechen, nicht hereinzuplatzen; ich wußte auch so, daß sie statt eines Nabels eine andere Produktionsnarbe hatte. Und doch überraschte ich sie, als ich eines Morgens das Zimmer des Immunen betrat; ich hatte gehört, daß er bereits die Wohnung verlassen hatte, sie aber lag noch im Bett. Zwischen den Kissen entdeckte ich ihr Gesicht, changeant, wie sie selber gesagt hätte, »ein glänzender Ölfleck in einer Wasserpfütze«. Sie besaß ein kostbares Stück Gesicht, aus Niobium oder Titanium verfertigt, einem Metall, das mit der Temperatur die Farbe wechselt. Ich begriff, daß sie nicht in einem lichtlosen und kalten Schaufenster die Nacht verbringen mochte und daß sie Wärme brauchte, die ihrem Gesicht Farbe verlieh; ich wunderte mich nur, daß sie diese Wärme beim Immunen suchte. Ich hatte später von ihm vernommen, die Müllabfuhr habe sie geholt. Sie führte nicht nur Modelle vor, sondern war selber eines; das ihre war nicht mehr en vogue: sie hatte ihren Arbeitsplatz an jemanden aus Plexiglas abtreten müssen. Bei der Gelegenheit erfuhr ich, daß ihr Vater bei der Polizei gearbeitet hatte; an ihm hatten Generationen von deutschen Schäferhunden geübt, wie man einen Menschen anfällt.
Merkwürdig, wie genau ich mich an diese Frauenfigur erinnere, und es scheint nicht die einzige Figur zu sein, die jetzt zum Leben erweckt wird. Ich spüre, wie vieles in mir aufbricht, obwohl ich doch so unbegabt bin für die Erinnerung. Jetzt, da ich nicht weiß, wie es weitergeht, ist mir alles recht, was aus dem Gedächtnis abgerufen werden kann.
Wegen eines solchen Mannequins wären der Immune und ich nie aneinander geraten wie wegen so vieler anderen Gestalteten, denen er in unserem Kopf Unterschlupf gewährte und sich dort für immer einrichten ließ.
Nun war sein Interesse für solche Puppen verhältnismäßig neu. Er hatte sich früher mehr mit Mechanik beschäftigt, wenn ich nur daran denke, daß er einmal aufziehbare Menschen exportieren wollte und wenn ich mich an unsere Gespräche über Roboter und deren Hände erinnere.
Allerdings gab es unter dem Wenigen, das er sammelte, nicht nur einen Heiligen mit einem hohlen Bauch oder ein Wurzelweibchen oder die Inkunabel von einem Aufnahmegerät. Ich hatte mich über die Unförmigkeit des Paketes gewundert, das er eines Tages auspackte – wenn es gelte davonzukommen, sagte er, dürfe man keine lebensrettende Maßnahme außer acht lassen.
Auf einem Brett war ein Kopf aus Kunststoff befestigt, der sich dank einer Feder schräg hochstellen ließ; unten am Kinn war der Kehlkopf angebracht, und als Luftröhre führte ein Plastikschlauch zu zwei Gummisäcken, den Lungenflügeln. Er legte das Brett auf den Boden und kniete daneben; nachdem er seinen Mund auf den des Phantoms gelegt hatte, deutete er auf die Lungenflügel, die sich langsam blähten, hoben und zusammenfielen. Dann lud er mich ein, es auch mit der Mund-zu-Mund-Beatmung zu versuchen. Er hängte das Phantom, das dank uns geatmet hatte, als dreidimensionales Bild an die Wand und nannte es »Adam«. Auch Adam habe trotz seines biblischen Alters nur ein paar Minuten geatmet.
Nur einmal noch habe ich den Immunen in einem Zustand solch erschöpfter Zufriedenheit gesehen, da hatten wir eben eine Samenbank als Donatoren verlassen.
Erschrocken aber war ich doch, als ich vor ein paar Tagen die Wohnungstür aufschloß und jemanden im Flur liegen sah. Der Immune hatte für das Rückgrat einen Besenstiel benutzt und für die Haare Holzwolle; er hatte der Puppe eine Jacke und eine Hose von mir übergezogen, so daß ich meinte, ich selber liege da, das Gesicht auf dem Teppich. Der Immune hielt ein Messer in der Hand und stach in den mit Schmutzwäsche angefüllten Unterleib: Mit solchen Puppen könne man Kriminalfälle rekonstruieren, er orientierte sich an einer Skizze in einem Boulevardblatt. Er schleppte die Puppe hinter einen Fauteuil und versteckte sie so im Gebüsch.
Damals stieg in mir der flüchtige Verdacht hoch, daß sich der Immune von mir befreien wolle. Allerdings überraschte mich die Szene, weil ich in der Hand des Immunen ein Messer sah. Er rühmte sich doch, als einzig zulässige Waffe das Wort zu benutzen – und wie er damit zuschlagen konnte, das habe ich in jener Nacht zu spüren bekommen, es war so, daß ich das Messer vorgezogen hätte.
Aber vielleicht gab es für das, was in jener Nacht geschah, viel mehr Anzeichen, als ich annahm oder wahrhaben wollte. Hätte ich es bereits als Warnung verstehen sollen, als er mir eines Morgens eine Zeitung auf den Frühstückstisch warf? Freunde aus Amerika hätten ihm geschrieben, aber da sie seine Adresse nicht gehabt hätten, hätten sie die Grüße in die Zeitung gesetzt. Auf der Frontseite waren die Ansichtskarten aus Kalifornien abgebildet: auf der ersten Männer, Frauen und Kinder in einem Flugzeugrumpf an ihre Sitze geschnallt. Eine Treibstoffmischung wurde getestet, die weniger leicht brennbar war. Die zweite Postkarte zeigte das ausgebrannte Wrack, keine der Puppen war lebend davongekommen.
Der Immune redete von ihnen, als seien sie Schicksalsgenossen, obwohl sein Schicksal, wenn das Wort überhaupt gebraucht werden darf, gerade darin bestand, den Unfall zu überleben. Er hatte ja seine Bekanntschaft mit einem Ausbildungschef für Piloten benutzt, um in einem Simulator Absturz zu üben.
Er war sich selber bewußt, wie unpassend sein Vergleich war, wenn er mit Experimentier-Puppen auf unsere Situation anspielte. Wenn schon, war ich es, der das Material sammelte, und er war es, der an die Auswertung ging, nur zu oft habe ich ihn beobachtet, wenn er unschlüssig war, ob das von mir eingebrachte Lebensmaterial verwertbar sei.
Das schloß nicht aus, daß er sich in frivolen Momenten auf meine Knie setzte: wir würden zusammen eine Variété-Nummer abgeben. Ohne Zweifel hätten wir ein attraktives Duo geboten, weil in unserem Falle die Puppe gesprochen hätte und der Bauchredner die Lippen so bewegt, als kämen zwischen ihnen irgendwelche Laute hervor. Oft genug hatte der Immune seine Hand an meinem Nacken, drehte meinen Kopf in alle Richtungen und ließ ihn nicken, so daß ich den Eindruck erweckte, ich sei ein lebendiges Wesen. Davon galt es weit weniger ein Publikum zu überzeugen als mich selber.
An seiner Puppengeschichte irritierte mich nicht der angebliche Mord, sondern daß der Immune sich auf eine Begebenheit bezog, an die ich mich nicht erinnern kann. Aber solche Erfahrungen werde ich wohl in diesen Papieren noch öfters machen, wie nur schon das erste Durchblättern zeigt.
Ich war es gewohnt, daß der Immune mir Ereignisse erzählte, die aus meinem Leben stammen sollten. Meist merkte ich es erst hinterher, daß er mich meinte, denn er gab seinen Protagonisten irgendwelche Namen. Und wenn ich verwundert fragte, was dieser Robert oder Georg oder Lukas solle, meinte er, die Zufälligkeit der Namen entspreche der Zufälligkeit der Ereignisse, man könne auch mit einem Namen anonym bleiben, zudem höre man sich selber aufmerksamer zu, wenn man glaube, man erfahre über eine Drittperson etwas Neues.
Aus heiterem Himmel konnte er sein »Weißt du noch« vorbringen und damit auf recht Unterschiedliches anspielen. Wir konnten am Tisch beim Abendessen sitzen, und er meinte mit seinem »Weißt du noch« einen Abend, da wir auf einem Felsen zugeschaut hätten, wie Kinder, Litaneien singend, geradeaus ins Meer liefen, weil sie glaubten, daß die, welche das Heilige Land von den Ungläubigen befreien, auf dem Wasser gehen können. Und im Handumdrehen meinte er mit dem »Weißt du noch« nicht die Zeit der Kinderkreuzzüge, sondern die Jahre, in denen die Kugelschreiber aufkamen, und die Frauen anfingen, Strumpfhosen zu tragen.
Aber wenn ich dem Immunen zuhörte, staunte ich oft nicht schlecht darüber, was ich erlebt und getan haben sollte. Doch er wischte all meine Skepsis und Bedenken weg: Man lebe umso reicher, je mehr einem zugemutet werde; sein eigenes Leben bestehe aus dem, was man ihm andichte; deswegen müsse er stets darauf bedacht sein, daß den andern zu ihm etwas einfalle. Und diese Ansicht konnte ich insofern teilen, als ich oft neidvoll zur Kenntnis nahm, auf Umwegen oder in Andeutungen, was ich alles getan haben sollte – Dinge, die ich getan hätte, wenn ich von selber draufgekommen wäre. Aber vielleicht ist das, was uns direkt zustößt, nur der geringste Teil von dem, was wir leben.
Denn ich erfuhr ja nicht nur vom Immunen, was ich gelebt haben soll, sondern auch von Dritt- und Viertpersonen. Und das konnte sogar zu peinlichen Momenten führen, selbst wenn es dabei um völlig Belangloses ging.
Da empfahl mir jemand ein Kriegerdenkmal: auf dem Sockel ein nackter Soldat, nur mit einem Helm bewehrt und einer Fahne in der Hand, und die flattert so, daß sie sein Geschlecht verdeckt. Ich staunte, denn ich hatte meinem Gegenüber vor einiger Zeit genau dieses Denkmal empfohlen, ich fand die Züchtigkeit der Darstellung so ehrlich und sinnvoll, weil die Fahne, in deren Namen der Soldat starb, genau die Stelle bedeckt, mit der er hätte Leben weitergeben können.
Im gleichen Gespräch aber berichtete ich davon, wie ein Bekannter mich an seinen Arbeitsplatz eingeladen habe, ein Pathologe in einem Bezirksspital, er habe mich in die Kellerräume mitgenommen, wo die Anatomie untergebracht war, ich hätte zuschauen dürfen, wie er einer Leiche Organe entnahm und wie er von einem Herz ein Stück abschnitt und es auf eine Waage legte, und diese Waage, eine alte Metzgerwaage, habe nicht nur das Gewicht angegeben, sondern auch gleichzeitig den Preis. Da starrte mich mein Gegenüber an: die Sache komme ihm bekannt vor, sie sei nämlich ihm passiert, und er habe sie mir vor einigen Wochen erzählt.
Wir bewegen uns nun einmal in einer Gesellschaft, in der es ein Copyright auf Erlebtes gibt. Als ob es nicht viel mehr darauf ankäme, daß überhaupt etwas erlebt wird. Sollten wir nicht froh sein, daß wenigstens ein anderer erlebt, was uns nicht vergönnt ist, und gar, wenn der andere es viel besser erlebt, als wir dazu je in der Lage gewesen wären.
Aber würde es sich mit dem Tod nicht gleich verhalten? Vielleicht stirbt ein anderer den Tod, der zu uns passen würde. Das gäbe uns wenigstens die Gewißheit, daß es für uns einen passenden Tod gegeben hätte. Warum sollte nicht der eigene, der für uns selber so nutzlose Tod, von jemand anderem gebraucht werden können?
Im Falle des Immunen mochte ich mich schon gar nicht wehren, wenn er mir Erlebnisse zuschrieb; das konnte mir nur willkommen sein, weil er mir damit zu verstehen gab, daß ich lebte.
Ja, selbst die ärgste Verdächtigung hat noch immer etwas von einer Mund-zu-Mund-Beatmung.
Wenn die beiden Detektive, die meine Wohnung durchsuchten, wüßten, was sie mir alles anhängen könnten. Aber ich befürchte, sie werden es bei einem simplen Delikt bewenden lassen; es ist nun einmal so, daß selbst ein Massenmörder weit unter dem Niveau seiner Ungeheuerlichkeit zur Rechenschaft gezogen wird.
Wenn der Immune zu einem seiner »Weißt du noch« ausholte, tat er dies, indem er unzählige Details vorbrachte. Das hing mit seiner Methode zusammen, schwierige Situationen durchzustehen, indem man sich an Einzelheiten hält. Das hatten wir bei unserem Vater gelernt, wenn er uns aus dem Bett holte und in seinem Rausch in der Küche alles zusammenschlug – was haben wir uns da nicht alles an Details gemerkt.
Aber anscheinend war auch für den Immunen der Moment gekommen, da ihm nicht mehr genügend Einzelheiten zur Verfügung standen, an die er sich hätte klammern können. Genug Einzelheiten hatte es indessen noch gegeben, als ich, oder soll ich sagen, als wir oder als ein Mr. Robert in Malakka eine Nachricht erhielt.
Die Nachricht
Lächelnd nahm der Chinese aus dem Brieffach die ›Message‹ und überreichte sie Mr. Robert. Sein Name auf dem Umschlag war dick durchgestrichen, darüber in Druckbuchstaben ein zweites Mal weniger falsch geschrieben, daneben seine Zimmernummer. Der Mann vom Empfang nickte; während er mit der Linken in einem Fahrplan weiterblätterte, preßte er dem Gast den Zimmerschlüssel so fest in die Hand, daß dieser in den Handballen schnitt.
Im Lift riß Robert den Umschlag auf: die Telefonnummer, die er in Singapore anrufen sollte, konnte nur die der Firma sein, die als Kontaktadresse diente. Sonst wußte niemand, daß er nach Malaysia geflogen war; er hatte auch ihr lediglich für die Tage in Malakka angeben können, wo und ab wann er erreichbar war.
Als der Lift anhielt, vergewisserte sich Robert, ob es das richtige Stockwerk war. Da ging die Tür bereits wieder zu. Der Lift setzte sich nach oben in Bewegung. Als er stoppte und die Tür sich auseinander schob, wartete niemand davor. Robert drückte den Knopf seiner Etage; die Lämpchen auf der Bedienungstafel leuchteten abwärts auf. Der Lift fuhr an seinem Stockwerk vorbei. Als er anhielt, öffnete sich die Tür zur Hotelhalle. Der Chinese und der Hotelpage tuschelten und sahen erschrocken auf.
Im Zimmer ging Robert gleich zum Telefon. Aber er nahm den Hörer nicht ab. Stattdessen holte er aus der Minibar ein Portionsfläschchen Whisky, stellte es aber auf den Nachttisch. Er drückte die Plastikhülle über dem Trinkglas ein und ließ Eiswürfel hineinfallen, er behielt zwei zurück, zerrieb sie in der Hand und legte die Reste in den Aschenbecher. Er fuhr mit den Fingern durchs Haar. Darauf nahm er den Hörer und verlangte die Nummer in Singapore, Zahl für Zahl wiederholend. Die Telefonistin fragte, ob der Adressat eine Firma sei, weil es schon gegen Büroschluß gehe. Robert wiederholte, was er in der Nachricht gelesen hatte: Dringend, sehr dringend.
Er setzte sich für einen Moment aufs Bett, dann streckte er sich aus, verschränkte die Arme unter dem Kopf und sah zur Decke. Die Klimaanlage summte; von Zeit zu Zeit rumpelte der Motor. Dann stützte sich Robert auf, drehte am Radio, stellte es gleich wieder ab. Er ließ sein Feuerzeug aufschnappen. Da hörte er einen Schrei, er mußte vom Gang herkommen oder aus dem Nebenzimmer. Darauf wurde es still. Bis Robert ein verzweifeltes Gackern vernahm, das mit einem Schlag aufhörte.
Er ging zum Fenster, öffnete es, sah zum Nebenfenster hinüber und blickte in den Hof hinunter. Dort warf ein alter Mann in Turnhosen und mit zerschlissenem Unterhemd ein Huhn in den Korb zu anderen Hühnerleibern. Er hielt noch den Hals mit dem Kopf in der Hand, hackte mit einem Metzgerbeil den Kamm ab und legte ihn in eine Aluminiumschüssel. Neben ihm kauerte am Boden ein Kind, es rupfte ein Huhn, unvermittelt sah der Junge hoch, sein Gesicht war von Schweiß und Tierblut verschmiert, und an seinem Kinn klebten Federn.
Da schrillte das Telefon. Kaum hatte Robert die Hand ausgestreckt, hörte das Läuten auf. Die Hand blieb in der Luft. Dann setzte das Klingeln von neuem ein. Die Telefonistin fragte, ob er eine Verbindung mit Singapore wünsche, und wiederholte die Nummer, die er verlangt hatte. Ein Knacken, und dann ein Summen, er wußte nicht, ob es von der Klimaanlage herkam oder aus dem Hörer; aus dem Hintergrund der Leitung irgendwelche Stimmen, die kicherten, und auf dem Gang vor der Tür laute Schritte. Er glitt mit zwei Fingern die Telefonschnur entlang; wo sie in den Apparat führte, war sie ausgefranst. Er rief »Hallo, hallo« und hörte Totenstille.
Endlich meldete sich die Firma. Eine Frauenstimme erkundigte sich, was er wünsche. Er habe ein Telegramm erhalten. Um welche Abteilung es sich handle. Er möchte gerne Herrn Breitinger persönlich sprechen. Ein Knacken und eine andere Frauenstimme, Herr Breitinger sei nicht im Haus, er solle morgen wieder anrufen, aber nicht vor zehn. Da schrie er, er habe eine Nachricht erhalten. Die Frau erkundigte sich, ob er der Schweizer sei, für den sie die Post zurückbehielten. Nach einem Geflüster meldete sich eine Männerstimme: Mr. Robert möge entschuldigen, das Telegramm aus Zürich sei liegengeblieben, Herr Breitinger sei auf Reisen gewesen, ob er einen Mister, und dann entzifferte er zögernd einen Namen, kenne. Das sei kein Mister, sondern seine Schwester. Da las der andere: »Mutter friedlich verstorben. Stop. Beerdigung Samstag. Stop. Brief folgt.« Robert ließ den Hörer sinken; als er ihn auf die Gabel legte, gab der Apparat ein Nachklingelzeichen von sich. Er nahm den Hörer gleich wieder hoch und sagte in die tote Muschel hinein »Danke«.
Er ordnete ein paar Zeitungen und steckte sie in den Papierkorb. Er holte vom Schrank den Koffer herunter und legte ihn aufs zweite Bett. Er nahm aus der Reisetasche das Plastiketui einer Fluggesellschaft, in das er alte Hotelrechnungen und sonstige Spesenbelege steckte; er sah auf dem Ticket nach, für wann er den Flug nach Singapore gebucht hatte. Er zündete sich eine Zigarette an. Die Eiswürfel im Aschenbecher waren geschmolzen; auf der Platte des Frisiertisches war ein schmutziges Rinnsal eingetrocknet.
Da läutete das Telefon von neuem. Er zögerte. Als er an den Apparat ging, nannte ihm die Telefonistin die Kosten für die internationale Verbindung. Er sah auf die Uhr, steckte den Flugschein ein. Als er die Zimmertür hinter sich zuzog, fiel sie hart ins Schloß. Aus dem Nebenzimmer kam das Etagenmädchen; sie hielt ein Tuch in der Hand, das tropfte und das sie zu verbergen versuchte.
Vor dem Hotel zögerte Robert einen Moment. Er ging nicht Richtung Stadt, sondern nach links. Vor einer Garage spritzte ein Arbeiter einen Motorenteil ab, den er eingeschäumt hatte. Robert folgte neben einem offenen Abzugsgraben einer gelben Linie, die einen schmalen Trottoir-Streifen markierte. Er machte halt beim chinesischen Tempel. Bis hierhin war er schon am Vortag spaziert. Dann ging er die Straße hinauf, die in leichtem Bogen anstieg. Schon nach ein paar Schritten wählte er einen Fußweg, er sprang über einen Graben, in dem Abfall verbrannt worden war. Der Haufen schwelte noch. Von der Straße aus hatte er die Hufeisenformen gesehen, die in den Hügel eingelassen waren. Vor dem geschwungenen Hintergrund, mit Platten ausgelegt, eine Art Kanzel mit Seitenmäuerchen und nach vorne offen. Er fragte sich, welche Zeichen auf dem Stein für den Namen und welche für die Jahreszahl standen. Als er sich umdrehte, übertrat er den Fuß, er fing sich auf und stützte sich auf einen verwitterten Zwerglöwen, der ein Grab bewachte.
Der Bukit war nicht bloß ein Hügel, wie er von seinem Hotelfenster aus hatte annehmen können. Hinter ihm tat sich eine ganze Friedhofslandschaft auf. Zum Bukit selber führte ein zementierter Stufenweg mit Geländern auf beiden Seiten. An den Hängen war stellenweise das Gras abgebrannt worden, von den Stoppeln und dem dunklen Boden hoben sich die Gräber ab, viele eingesunken und von manchen nur noch ein Stein übrig, und dann wieder eine ausgebaute Grabstätte mit einer Photographie. Da es gegen Abend ging, warfen die Gräber längere Schatten. Beim Gehen scharrte Robert Heu auf, zwischen dem geschnittenen Gras sprossen Halme, und um die Gräber zitterten helle Rispen im Wind.
Bevor er hinunterstieg, bemerkte er, wie ein junger Mann in Sporthose und Turnschuhen sich neben einem Grab aufstellte. Er sprang in die Grätsche, streckte die Arme nach oben und ließ den Oberkörper kreisen. Dann hüpfte er ein paarmal auf der Stelle, klatschte mit den Händen an die Seiten der Oberschenkel. Er ließ sich auf den Boden fallen und machte Liegestütze. Wenn er den Kopf nah am Boden hatte, tauchte hinter ihm die Inschrift auf einem Grabstein auf.
Über einen Seitenweg gelangte Robert zur Hauptstraße. Er blieb vor einem Langbau stehen, der aussah, als gehöre er zu einem Stadion. Aber es waren zwei Kinos. Vor dem einen hingen Jugendliche am Scherengitter. Das andere schien nicht mehr in Betrieb. Die Plakate waren vom Wetter aufgeweicht und blätterten schichtweise ab. Ein Inder in einem weiten weißen Rock befestigte ein Tuch an der Mauer. Darauf übergroß skizziert die Innenflächen zweier Hände mit den Handlinien und numerierten Feldern. Er legte ein dickes Buch auf den Boden und schloß den Lautsprecher an die Batterie an, er selber hockte auf einem Schemel daneben, und aus dem Lautsprecher kam seine Stimme vom Band.
Im Reisebüro machte sich die Angestellte am Computer zu schaffen; für morgen sei alles ausgebucht, auch für übermorgen, im Flugzeug seien nur sechzehn Plätze. Ob er schon das Stadthuys gesehen habe, den ältesten Bau, den Europäer hier errichtet hätten. Sie schob ihm einen Prospekt zu und empfahl die Countryside-tour: Besuch einer Gummiplantage und einer Fabrik, die Kokosnüsse verarbeitet. Robert fragte nach dem Busbahnhof.